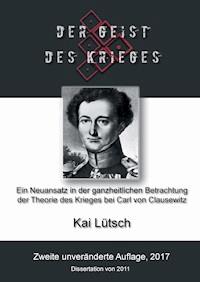
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Werk wurde 2011 als Dissertation am Institut für Politische Theorie an der Universität der Bundeswehr in München eingereicht. Mit Hilfe des Klassikers "Vom Kriege" des preußischen Generals Carl von Clausewitz erarbeitet der Autor eine umfassende und ganzheitliche Theorie des Krieges. Die Zielsetzung dabei ist: Erstens, den Krieg zu beschreiben, d.h. einzugrenzen, zu definieren, in seinen einzelnen Elementen darzustellen und diese zu systematisieren; Zweitens, den Krieg zu erklären, d.h. zwischen den einzelnen Elementen des Krieges Verbindungen herzustellen sowie den Krieg als Ganzes mit äußeren Bedingungen in Zusammenhang zu bringen und somit Wirkungsketten zu erschließen; Drittens, sofern möglich, auf ein im Sinne der Theorie richtiges Handeln zu schlussfolgern, d.h. generische oder an spezifische Bedingungen geknüpfte Überlegungen aufzustellen, die im Speziellen oder im Allgemeinen helfen, zwischen vernünftigem und unvernünftigem Handeln im Krieg zu unterscheiden. Die Gesamtheit dieser Arbeit wirft eine vollkommen neue, bisher nicht dargestellte Perspektive auf die Zusammenhänge zwischen Krieg, Politik und Strategie. Siehe auch: www.der-geist-des-krieges.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1347
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort des Präsidenten der Clausewitz-Gesellschaft e.V.
Generalleutnant a.D. Kurt Herrmann
zur zweiten Auflage (2017)
Wachtberg-Adendorf, der 14. August 2017
Was ist nicht schon alles über den preußischen General und Strategieexperten Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz geschrieben worden. Passagen seines berühmten Werkes „Vom Kriege“ wurden und werden häufig zitiert, vielfach missverstanden, wiederholt instrumentalisiert, und sie sind auch nach fast zweihundert Jahren weiterhin aktuell und regen zu lebhaften Diskussionen an. In unserer gelegentlich als post-heroisch bezeichneten Gesellschaft werden heute Begriffe wie Krieg und Ausübung von militärischer Gewalt von vielen nahezu reflexartig zurückgewiesen, ideologisch als das „Böse schlechthin“ diskreditiert oder weitgehend tabuisiert bzw. möglichst ausgeblendet. Dabei hat sich bereits früh in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts gezeigt, dass mit der Beendigung des Kalten Krieges und der Jahrzehnte langen Phase der Ost-West-Konfrontation keineswegs das „Ende der Geschichte“ erreicht war, sondern die von vielen erhoffte paradiesische Friedensphase eine Illusion bleiben würde. Dennoch verweigern sich breite Kreise unserer Gesellschaft weiterhin einer objektiv sachlichen Auseinandersetzung mit den Ursachen, Motiven, Zielen, Zwecken, Ausprägungsformen, Strukturen, psychologischen Faktoren und Wirkungen gewaltsamer Auseinandersetzungen und vor allem mit ihrer extremsten Form, dem Krieg.
Vor diesem Hintergrund verlangt es schon eine gehörige Portion Mut, sich dem Thema „Der Geist des Krieges“ intensiv und öffentlichkeitswirksam zu widmen. Der Verfasser des vorliegenden Buches hat zudem mit dem Zusatz „Ein Neuansatz in der ganzheitlichen Betrachtung der Theorie des Krieges bei Carl von Clausewitz“ die Messlatte selbst sehr hoch gelegt. Beim Lesen seines mit höchster Akribie und bewundernswerter Kompetenz verfassten Werkes wird man vermutlich feststellen, dass diese Ausarbeitung in ihrer Grundanlage und differenzierten Gestaltung eigentlich überfällig war. Das Buch kann nicht nur einen außerordentlich wertvollen Beitrag zum zeitgemäßen Verständnis der Methoden und Erkenntnisse des militärtheoretischen Analysten und auch in der Praxis erfahrenen Generals Carl von Clausewitz leisten. Die vom Verfasser entwickelten beispielhaften Fälle und Szenarien, seine gut nachvollziehbaren Schlussfolgerungen und insbesondere auch seine klare, in wesentlichen Passagen ebenfalls konstruktiv kritische Auseinandersetzung mit der umfangreichen Sekundärliteratur zu Clausewitz‘ Hauptwerk machen deutlich, welche fortbestehende Aktualität und grundlegende Gültigkeit die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts von Clausewitz erforschten Faktoren und Zusammenhänge zu den heute oft als unbequem, lästig oder gar unmöglich empfundenen Tatbeständen in Verbindung mit Krieg und gewaltsam ausgetragenen Konflikten besitzen.
Aufgrund seines frühen Todes war es dem General Carl von Clausewitz nicht mehr vergönnt, seine über viele Jahre hinweg erstellten Aufzeichnungen zu seinen Studien, analysierenden Untersuchungen und weiterführenden Gedanken ganzheitlich oder hinreichend geschlossen zu überarbeiten. Seiner intelligenten Frau und dann Witwe ist es zu verdanken, dass die umfangreichen Überlegungen posthum in dem berühmten Sammelband „Vom Kriege“ veröffentlicht wurden. In Kenntnis und feinfühliger Berücksichtigung dieser Umstände setzt sich der Verfasser des vorliegenden Buches in erstaunlicher Breite und beeindruckender Tiefe mit den im genannten Referenzwerk enthaltenen Erkenntnissen der Clausewitz‘schen „Theorie vom Kriege“ auseinander. Dabei stellt er die für Krieg und gewaltsam ausgetragene Konflikte relevanten komplexen politisch-militärischen Zusammenhänge in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen.
Sehr eindringlich und überzeugend gelingt es dem Verfasser aufzuzeigen, wie wichtig im Grunde ein hinreichendes gegenseitiges Verständnis zwischen Politik und Militär ist. Er unterstreicht dabei wiederholt und nachdrücklich, dass einerseits das militärische Führungspersonal Kenntnisse über die Grundlagen und Prozesse der Politik besitzen sollte und andererseits auch verantwortliche Politiker militärische Strategie und Taktik als „Instrumente der Politik“ verstehen sowie insbesondere die grundlegenden militärischen Fähigkeiten und wesentlichen Wirkungsmöglichkeiten kennen sollten.
Dankenswerter weise wird vom Verfasser bei seinen Interpretationen der „Clausewitz’schen Theorie vom Kriege“ hinsichtlich der potentiellen Akteure kriegerischer Auseinandersetzungen auch die notwendige Transferleistung von Clausewitz‘ eher traditionellem „Staatsbegriff zu dem universelleren Begriff „politisches Gemeinwesen“ vorgenommen. Außerdem werden der Krieg oder ein gewaltsam, militärisch ausgetragener Konflikt nicht im eher herkömmlichen Sinn als Zustand, sondern als Prozess betrachtet, als „Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“. In seiner erweiterten Definition des Krieges bezeichnet der Verfasser den Krieg in treffender Weise als „eine wechselseitige politische Handlung, mit welcher ein politisches Gemeinwesen physische Gewalt anwendet oder androht, um hierdurch den Willen eines wehrhaften gegnerischen politischen Gemeinwesens zu überwinden und so den eigenen Willen zu verwirklichen.“
Die heute bei heraufziehenden oder eingetretenen Krisen und Konflikten häufig nahezu reflexhaft vernommene Äußerung, die Situation könne nicht militärisch gelöst werden, mutet - gerade auch im Licht der o.a. Anmerkungen - letztlich an wie eine vorschnelle Preisgabe eines wesentlichen Teils des politischen Instrumentariums. Deshalb ist es dem Verfasser des vorliegenden Buches als besonders verdienstvoll anzurechnen, dass er hinreichend überzeugend das Clausewitz‘sche Verständnis von Krieg oder militärischem Gewaltpotential und Diplomatie als sich wechselseitig komplementär ergänzende „politische Instrumente“ und politische Handlungsoptionen herausstellt. In seiner akribisch aufgearbeiteten, erfreulich differenzierten Analyse der politischen und militärischen Faktoren und Parameter, die u.a. Einfluss auf den Ausbruch, Verlauf, Dimension und damit letztlich auf die Strategien eines Krieges haben und in enger, dynamischer Wechselwirkung zueinander stehen, erläutert er eingängig nachvollziehbar die von Clausewitz unter dem Begriff „Wunderliche Dreifaltigkeit“ analysierten Zusammenhänge. Die dabei relevanten, vielfältigen „Begriffstriaden“, die im Grunde sehr weitreichend den Geist des Krieges beschreiben, stehen bei den detaillierten Ausführungen zu Recht im Mittelpunkt.
Der Verfasser des Buches verschweigt keineswegs, dass der Zusammenhang zwischen Krieg und Politik in der wissenschaftlichen Literatur zu erheblichen Auseinandersetzungen und verschiedensten Interpretationen geführt hat. Außerdem zeigt er klar auf, dass das konkrete und richtige Verständnis des Gefechts von zentraler Bedeutung für die Clausewitz’sche „Kriegstheorie“ ist. Dabei unterstreicht er ebenfalls zutreffend, dass die Politik den Krieg und die Grundlagen von gewaltsamen Auseinandersetzungen verstehen muss, wenn die Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt als Instrument der Politik in Erwägung gezogen werden kann oder soll, wie es bereits oben erwähnt wurde.
Mit begrüßenswerter Klarheit ist vom Verfasser insgesamt die Clausewitz’sche Erkenntnis herausgearbeitet worden, dass es keine grundsätzliche „Idealstrategie“ geben kann, sondern jede spezifische Strategie - die Clausewitz selbst als Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges definiert und die im Wesentlichen die Vorgabe von Raum, Umfang der Kräfte und zeitlichen Abläufen an die Taktik beinhaltet - vielmehr für den jeweiligen konkreten Fall einzeln zu prüfen, zu analysieren und abzuschätzen ist. Dabei kommt letztlich - stets und jeweils - auch einer klaren Definition des politischen Zwecks und des zu erreichenden Ziels eine besondere Bedeutung zu. Zugleich vermittelt der Verfasser einen detaillierten Einblick in die engen Zusammenhänge zwischen Strategie und Taktik, die von Clausewitz, wegen des (direkten) Aufeinandertreffens von gegnerischen Streitkräften, als die „Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht“ bezeichnet wird.
Im vorliegenden Buch wird dankenswerter Weise deutlich herausgestellt, dass die von Clausewitz und natürlich auch vom Verfasser vorgenommene Befassung mit Krieg und gewaltsamen Auseinandersetzungen nicht als Befürwortung von Militarisierung oder gar Verherrlichung des Krieges verstanden werden darf. Zur Untermauerung dieses Verständnisses wird u.a. erwähnt, dass Clausewitz auch die Schrecken und die Brutalität des Krieges deutlich hervorgehoben hat. Nach Auffassung des Verfassers will Clausewitz mit seiner „Theorie des Krieges“ „keineswegs die Gestalt des Krieges in ihrer chamäleonhaften Vielfältigkeit darstellen oder abbilden“. Vielmehr ist es Clausewitz‘ Absicht und sein zentrales Anliegen, „die Grundidee und die innere Logik, d.h. den Geist des Krieges zu durchdringen, zu systematisieren und offenzulegen, um so in einem späteren Schritt verschiedene externe Faktoren in ihrer Wirkung auf den Geist des Krieges zu verstehen und erklären zu können, um Ergebnisse besser prognostizierbar zu machen und dem Menschen ein besseres Verständnis für ein Mittel an die Hand zu geben, welches er schon seit Jahrtausenden mal mehr mal weniger bewusst anwendet.“ Dieser einleuchtenden Interpretation folgend unterstreicht der Verfasser ebenfalls, dass sich die Clausewitz’sche Betrachtungsweise von anderen Kriegstheoretikern in fundamentaler Weise abhebt. Clausewitz betrachte den Krieg letztlich als eine aus rationalen Elementen bestehende Handlung(sfolge) und verleihe ihm damit eine deutlichere Gestalt. In der Clausewitz’schen Kriegstheorie sei die Zweckmäßigkeit der einzelnen Handlungen in Bezug auf den durch den Krieg zu verwirklichenden politischen Zweck der „normative Orientierungspunkt“. An die Stelle von gut und böse oder recht und unrecht trete bei Clausewitz das Attribut zweckmäßig oder unzweckmäßig.
Der Verfasser bietet begrüßenswerter Weise am Ende des Buches auch einige Ausblicke auf die weiterhin notwendige Übertragung der Methoden und Erkenntnisse von Clausewitz in die Neuzeit an, u.a. unter Berücksichtigung heutiger politischer, sozio-kultureller und technologischer Entwicklungen. Besonders deutlich wird das - neben der erwähnten Bedeutung moderner demographischer und politischer Faktoren zur Bevölkerungsentwicklung sowie zur Entwicklung von Rüstungs-/ Waffentechnologie - vor allem beim Thema der strategischen Beeinflussung von Bevölkerung mittels gesteuerter oder manipulierter Informationsversorgung, wie wir dies heute mit dynamisch rasant wachsender Zunahme im Cyber- und Informationsraum erleben. Aber auch potentielle Bedrohungen durch internationale organisierte Kriminalität, global agierenden Terrorismus und Proliferation von Massenvernichtungswaffen sowie zu deren Verbringung erforderlichen Trägermitteln verlangen weitergehende Analysen und entsprechende Transferleistungen zur sinnvollen und zweckorientierten Übertragung von Clausewitz‘schen Erkenntnissen in die heutige Zeit.
Wie bedeutsam und wichtig es ist, die Bestimmungsgrößen und Prozesse gewaltsamer, kriegerischer Auseinandersetzungen verschiedener „politischer Gemeinwesen“ als dynamische Prozesse zu betrachten und für die heutige und künftige Sicherheitsvorsorge und Verteidigungsfähigkeit ein ausreichendes Maß an Anpassungsfähigkeit und strategischoperationeller Flexibilität im politisch-diplomatischen sowie militärischen Raum zu erlangen oder zu bewahren, das haben nicht zuletzt die tiefgehenden und sicher noch lange nachwirkenden Entwicklungen der letzten drei bis fünf Jahre im Bereich der regionalen und globalen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gezeigt. Auch für die Bewertung dieser Lage und der absehbaren oder notwendigen Entwicklungen bieten die Clausewitz’sche „Theorie des Krieges“ und insbesondere das darin enthaltene Gedankenmodell der „Wunderlichen Dreifaltigkeit“ weiterhin eine vortreffliche Grundlage für die systematische Erfassung, Analyse und Bewertung komplexer, dynamischer Vorgänge und Zusammenhänge. Deshalb ist es umso mehr zu begrüßen, dass die Begriffswelt, die Grundzüge der Theorie und auch die Methodik des Generals Carl von Clausewitz in dem vorliegenden Buch in ausgewogen differenzierter, heute verständlicher Sprache und eingängig nachvollziehbarer Weise behandelt werden. Das Buch vermag damit hoffentlich einen weiteren wichtigen Beitrag zur notwendigen Versachlichung und dringend erwünschten Vertiefung eines möglichst intensiven Diskurses zur Sicherheitspolitik und Strategie mit breiten Kreisen der Gesellschaft zu leisten.
DISSERTATION
ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES
(DR. RER. POL.)
AN DER
STAATS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT
(INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT)
DER
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR IN MÜNCHEN
Der Geist des Krieges
Ein Neuansatz in der ganzheitlichen Betrachtung der Theorie des Krieges bei Carl von Clausewitz
- Nicht lektorierte Originalfassung -
Kai Christoph Lütsch
Februar 2011
Erstgutachter:Prof. Dr. Ulrich Weiß
Zweitgutachter:Prof. Dr. Michael Wolffsohn
Kontakt: [email protected]
US-Präsident Barack Obama bei der Verleihung seines Friedensnobelpreises in Oslo, 2009:
„I do not bring with me today a definitive solution to the problems of war. What I do know is that meeting these challenges will require the same vision, hard work, and persistence of those men and women who acted so boldly decades ago. And it will require us to think in new ways about the notions of just war and the imperatives of a just peace.
We must begin by acknowledging the hard truth: We will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations -- acting individually or in concert -- will find the use of force not only necessary but morally justified.
I make this statement mindful of what Martin Luther King Jr. said in this same ceremony years ago: "Violence never brings permanent peace. It solves no social problem: it merely creates new and more complicated ones." As someone who stands here as a direct consequence of Dr. King's life work, I am living testimony to the moral force of non-violence. I know there's nothing weak -- nothing passive -- nothing naïve -- in the creed and lives of Gandhi and King.
But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism -- it is a recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason.“1
1Obama, Remarks.
VORWORT
Am Anfang dieser Arbeit stand eine Frage. Ich hatte gerade einen Vortrag über meine Diplomarbeit „Jeder Krieg ist anders. Jeder Krieg ist gleich – Eine Analyse des Kriegsbegriffes bei Carl von Clausewitz“2 gehalten, da fragte mich ein Zuhörer, inwiefern sich der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr unter den Clausewitz’schen Kriegsbegriff subsumieren ließe. Zu dieser Zeit war der Begriff Krieg in diesem Zusammenhang noch viel weniger gebräuchlich und man sprach einhellig von einer Friedens- bzw. Stabilisierungsmission. Nur diejenigen, die aus pazifistischen Gründen gegen das militärische Engagement am Hindukusch eingestellt waren, nutzten das Wort Krieg zu dessen Diffamierung. Nach kurzer Überlegung antwortete ich entschieden, dass der Einsatz in Afghanistan für die Clausewitz’sche Theorie überhaupt kein Krieg sein könne. Wem sollte dort ein Wille aufgezwungen werden? Und überhaupt: Im Krieg sei die Gewalt das Mittel der Wahl, in Afghanistan hingegen sei die Anwendung der Gewalt für die Bundeswehr nur ein letztes Hilfsmittel, um sich selbst oder Dritte vor illegalen An- und Übergriffen zu verteidigen. Es gäbe also höchstens einige kriegerische Elemente innerhalb des Gesamtkomplexes.
Der Fragesteller nickte zustimmend und schien durch meine Antwort hinreichend befriedigt zu sein. Ich war es jedoch nicht und ein Korn des Zweifels war gesät. Die schlichte Negation eines Zusammenhangs schien mir zu einfach zu sein. „Wo aber Streitkräfte, das ist bewaffnete Menschen angewendet werden, da muß notwendig die Vorstellung des Kampfes zum Grunde liegen“3, hatte Clausewitz in seinem Hauptwerk „Vom Kriege“4 geschrieben. Je länger ich über diesen Satz nachdachte, desto schlüssiger und allgemeingültiger schien er zu werden. In Afghanistan wurden und werden Streitkräfte eingesetzt. Muss dann nicht auch die Vorstellung des Kampfes diesem Einsatz mehr oder weniger zu Grunde liegen? War es vielleicht so, dass die Clausewitz’schen Grundgedanken in Afghanistan mehr zum Tragen kamen, als man es sich diesseits eingestehen wollte, weil man doch friedliche Absichten hatte und keineswegs Krieg führen wollte?
Die Idee war geboren, eine wissenschaftliche Arbeit über den Zusammenhang zwischen der Clausewitz’schen Theorie und dem empirischen Fall des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr zu verfassen. Es begann eine Phase, in der ich mich intensiv mit der Geschichte und den politischen Zusammenhängen in Afghanistan auseinandersetzte. Im Ergebnis standen mehr Fragen als Antworten, da die Lage in Afghanistan derart komplex und vielschichtig ist, gleichsam aber die Informationen darüber undurchsichtig und zum Teil widersprüchlich erscheinen. Eine empirische Arbeit, die den Gesamtkomplex notwendigerweise auf überschaubare Wirkungspunkte zurückführen muss, war folglich in weitere Ferne gerückt. Zudem stellte sich mir der gegenwärtige Forschungsstand zur Clausewitz’schen Theorie als nicht hinreichend dar, um mit ihm eine allein empirische Arbeit zu verfassen. Es wurde immer deutlicher, dass noch viele theoretisch abstrakte Zusammenhänge in diesem Gebiet erschlossen werden mussten, bevor dies als eine tatsächlich empirisch belastbare Theorie erscheinen konnte.
Schließlich unterbrach ein Auslandseinsatz im Kosovo, die Versetzung ins Heeresamt und ein damit einhergehender Umzug zwangsweise meine wissenschaftliche Arbeit, so dass ich mich nach einer insgesamt zehnmonatigen Pause für die weitere Richtung entscheiden musste. Eine Aufgabe des Projekts lag nahe – vielleicht sollte ich doch lieber ein Zweitstudium anstreben?
Nach reiflicher Überlegung entschied ich mich im August 2009 eine in der Hauptsache theoretische Arbeit zu verfassen und ein oder zwei empirische Fälle anzuhängen, um dem abstrakten Gedanken ein reales Bild gegenüberzustellen. Indem ich aber immer tiefer in die theoretische Materie eindrang und sich mir stetig mehr und neue Zusammenhänge in der Theorie erschlossen, die Arbeit folglich immer umfangreicher wurde, entfernte ich schließlich den an sich sachfremd gewordenen empirischen Teil vollständig aus meiner Arbeitsliste. Es schien mir viel interessanter und gewinnbringender, die Theorie selbst tiefgreifend zu erfassen, ganzheitlich zu betrachten, in ein System einzuordnen und bisher unbekannte Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Empirie ist dadurch freilich nicht von der Arbeit ausgeschlossen, sondern die allgemein abstrakte theoretische Betrachtung wird regelmäßig auf den konkreten Fall zurückgeführt, so dass die Erscheinungen des wirklichen Krieges dargestellt, erklärt und verstanden werden können. Dazu zwingt allein die Clausewitz’sche Theorie, die zu einer permanenten kritischen Überprüfung der Theorie an der Praxis anrät und solche Theorien, die mit der Wirklichkeit in Widerspruch geraten, als vernichtet betrachtet.5 Von dem ursprünglich geplanten empirischen Teil ist schließlich nur ein überschaubares Kapitel ganz am Ende dieser Arbeit übriggeblieben, welches Schlaglichter der Clausewitz’schen Theorie auf abstrakt gehaltene, moderne Konflikte werfen und somit einen Richtungsweiser für möglicherweise folgende empirische Arbeiten bieten soll.
Wer sich intensiv mit Clausewitz befasst, ist von seiner Sprache und der Prägnanz seiner Sätze fasziniert. Hat man sich an den seiner Zeit gemäßen Satzbau gewöhnt, so kann man vorzüglich beliebige Seiten seines Werkes aufschlagen und sich an seinem Wortwitz und Scharfsinn erfreuen. Nachdem ich im Zuge dieser Arbeit Hegel gelesen habe, erscheint mir der Clausewitz’sche Sprachstil sogar von einer erfrischenden Einfachheit und Klarheit gekennzeichnet. Dabei ist und bleibt das Thema jedoch düster.
Krieg ist ein anstößiges Thema und nicht selten habe ich mir beim Schreiben die Frage gestellt, ob es überhaupt die Anstrengung wert ist, dieses Wissenschaftsgebiet intellektuell weiter zu erschließen. Weiß doch in unserer Gesellschaft jeder, dass Gewalt keine Lösung ist und die Tendenz naheliegt, dass jede Anwendung derselben nur eine Verschärfung der Konflikte mit sich bringt. Der Soziologe Gerhard Vowinckel brachte diese sehr deutsche Sichtweise prägnant, mit leicht ironischem Unterton zu Papier:
„In der idealen Welt haben Gewalt und Krieg selbstverständlich keinen Platz. Sie verkörpern das böse, das teuflische Prinzip. Ihre bloße Erwähnung zwingt den Gesinnungsmoralisten, seine untadelige Friedfertigkeit zum Ausdruck zu bringen – durch Bekundungen des Abscheus oder womöglich eine Anwandlung von Übelsein. Dasselbe erwartet er von allen anständigen Menschen. Wer Krieg und Gewalt sachlichwissenschaftlich, unter einstweiligem Verzicht auf moralische Stellungnahme, erörtert, ist in seinen Augen ein unverantwortlicher Zyniker, moralisch unzuverlässig oder einfach böse.“6
In der Tat hat mich das Verfassen dieser Arbeit eher zum Pazifisten werden lassen, als dass es mich der Idee und Billigung des Krieges näher gebracht hätte. Es hat mich mehr von der Unlogik und Ungangbarkeit des Krieges überzeugt, denn von seiner Logik oder seiner Sinnhaftigkeit. Pazifisten mögen dies bereits für einen Erfolg halten, doch dies war weder die ursprüngliche Absicht, noch ist es eine Aussage der vorgelegten Arbeit. Tatsächlich ist es auch kein Erfolg für den Pazifismus, denn dieses Werturteil über den Krieg wird offensichtlich nicht von jedem Menschen geteilt und aus diesem Grund gibt es weiterhin eine einfache Wahrheit in Bezug auf den Krieg: Er existiert – sei es klein oder groß, heiß oder kalt, symmetrisch oder asymmetrisch. Kriege existieren und selbst wenn sie zeitweilig nicht unmittelbar wirklich existieren, so besteht die Möglichkeit ihrer Existenz und ihrer Anwendung und sie existieren also in der Vorstellung fort. Und gegen den Krieg kann man sich mit nichts anderem wehren als mit dem Krieg, denn kein Glaube, keine Vernunft, keine Rechtsauslegung und im Übrigen auch kein Wohlstand ist stark genug, um eine Gesellschaft vor dem Krieg und der kollektiven Gewalt zu schützen. Im Zweifel, wenn in einem Streit keine höhere moralische Instanz gehört wird, entscheidet das Recht des Stärkeren, sowohl im Kleinen wie auch im Großen.
Im Kleinen, d.h. innerhalb der Gesellschaft, gibt es die mit dem Recht auf Gewaltanwendung ausgestattete Polizei, welche den Einzelnen vor demjenigen schützt, der glaubt stärker zu sein als andere und darum willkürlich in die Rechte der anderen zu seinem Vorteil eingreift. Die Polizei gebraucht dazu im Zweifel physische Gewalt als letztes Mittel und nutzt in diesem Sinne selbst nichts anderes als das Recht des Stärkeren. Im Großen aber, d.h. zwischen den Gesellschaften, gibt es dieses Gewaltmonopol nicht, es gibt keine Weltpolizei und jeder souveräne Gesellschaftsverband muss seine Rechte im Zweifel selbst behaupten. Freilich gibt es Meinungen, die von der Geltung und Anwendung universaler Menschen- und Völkerrechte überzeugt sind. Aber ist dies im Angesicht der Empirie realistisch? Die Geltung von Recht scheint auf zwei Füßen zu stehen. Zum einen bedarf es einer Mehrheit, die dieses Recht als legitim erachtet und freiwillig annimmt. Zum zweiten bedarf es einer Gewalt, die dieses Recht gegen eine uneinsichtige Minderheit im Zweifel gewaltsam behauptet.
Die Welt wäre schöner ohne Gewalt, Hass und Krieg. Diese gehören aber ebenso zum Menschsein wie Friede, Freude und Liebe und manche behaupten, dass diese Phänomene sich gegenseitig bedingen und es die einen ohne die anderen nicht geben könnte. Die Fähigkeit zum Kriegführen ist für eine souveräne Gesellschaft offenkundig unabdingbar und dies muss mit dem Anspruch verknüpft sein, den Krieg auch erfolgreich, d.h. siegreich zu führen. Und auch wenn der Krieg selbst nicht logisch ist, so gibt es doch eine Logik in ihm. Diese zu ergründen, verständlicher zu machen und offenzulegen und damit auch die Fähigkeit zu stärken, den Krieg erfolgreich führen zu können, soll der Zweck dieser Arbeit sein. Denn nur die Starken können den Frieden bewahren. Dabei darf die Theorie des Krieges jedoch niemals als Handlungsmaxime verstanden werden, denn jedes Handeln bedarf einer ethischen Überprüfung und dies kann die Theorie des Krieges, so wie sie in dieser Arbeit dargelegt und verstanden werden wird, nicht bieten.
Ich danke Herrn Professor Weiß für sein Vertrauen in mich, welches er durch die vielen Freiheiten, die er mir beim Verfassen dieser Arbeit ließ, zum Ausdruck brachte. Außerdem danke ich Herrn Professor Wolffsohn, der bereitwillig als Zweitgutachter zur Verfügung stand.
Vor allem aber danke ich meiner geliebten Ehefrau. Für alles.
2Lütsch, Krieg.
3Clausewitz, Kriege, S. 222.
4Clausewitz, Kriege.
5Vgl. Clausewitz, Kriege, S. 213.
6Vowinckel, Einleitung, S. 7 f.
Übersicht
Vorwort
Einführung
Gesellschaftstheoretischer Rahmen
Grundlagen der Theorie des Krieges
Politische Dimension: Umfang der Kräfte
Strategische Dimension: Effizienz der Kräfte
Taktische Dimension: Intensität der Gewalt
Ganzheitliche Theorie des Krieges
Literatur- und Quellenverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einführung
Zielsetzung der Arbeit
Vorgehen und Aufbau der Arbeit
Leben und Wirken Carl von Clausewitz‘
Schwierigkeiten des Hauptwerkes Vom Kriege
Gesellschaftstheoretischer Rahmen
Einleitung
Exkurs: Gesellschaftstheoretischer Hintergrund
2.1. Platon
2.2. Machiavelli
2.3. Hobbes
2.4. Hegel
Politisches Gemeinwesen: Einführung
Politisches Gemeinwesen II: Innere Einheit und Gewalt
4.1. Das Gemeinwesen als subjektiver Organismus
4.2. Ausschweif zum physischen und moralischen Gewaltbegriff
4.3. Bestimmendes Merkmal: Höchste moralische Gewalt
4.4. Spekulative Überlegungen zu Verbrechen und Rebellion
Politisches Gemeinwesen III: Politik und äußeres Verhalten
5.1. Der Begriff des Politischen und die Intelligenz des Gemeinwesens
5.2. Das Verhältnis von Krieg und Politik
5.3. Funktionale Dreifaltigkeit des politischen Gemeinwesens
Internationales System und Überlegenheit der negativen Absicht
Zusammenfassung
Grundlagen der Theorie des Krieges
Der Begriff Krieg
1.1. Orientierungslosigkeit im modernen Sprachgebrauch
1.2. Clausewitz‘ Definition des Krieges
1.3. Der absurde, ideale Krieg
Erkenntnisinteresse und Perspektive der Theorie
Verschiedenartigkeit der Kriege als wesentliche Schwierigkeit
Analytische Einteilung der Kriegstheorie
4.1. Zweck, Ziel und Mittel als Analyseinstrument
4.2. Krieg, Feldzug und Gefecht – Politik, Strategie und Taktik
4.3. Schlüssel zur Clausewitz’schen Theorie des Krieges
Grundlagen des Angriffs-Verteidigungs-Komplexes
5.1. Erste Überlegungen
5.2. Definitionsmerkmale und Totalbegriff nach Raum-Zeit-Kriterium
5.3. Kritik an Totalbegriff nach Raum-Zeit-Kriterium
5.4. Positiver und negativer Zweck als bestimmendes Merkmal
Politische Dimension: Umfang der Kräfte
Einleitung
Eigentümliche Natur des Mittels „Krieg“
2.1. „Erste Eigentümlichkeit: geistige Kräfte und Wirkungen“
2.2. „Zweite Eigentümlichkeit: lebendige Reaktion“
2.3. „Dritte Eigentümlichkeit: Ungewißheit aller Datis“
2.4. Zusammenfassung: Das spekulative Element des Kriegs
Erste Orientierung: politischer Zweck, Interesse, Willenskraft
Der Wille zum Krieg: Wunderliche Dreifaltigkeit
4.1. Motiv 1: Die Natur eines politisches Werkzeugs
4.2. Motiv 2: Der Hass und die Feindschaft
4.3. Motiv 3: Das Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls
4.4. Wille zum Krieg: Zusammenfassung und Folgerung
Überwindung des gegnerischen Willens als Ziel der Kriegführung
Unterschiede zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg
6.1. Positive und negative Zwecke, Zweckasymmetrie
6.2. Wendepunkt zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg
6.3. Verteidigung oder Angriff als der Ausgangspunkt des Krieges?
6.4. Stärken und Schwächen der beiden Kriegsformen
6.5. Die Bedeutung von Leidenschaft und freier Seelentätigkeit
Zusammenfassung
Strategische Dimension: Effizienz der Kräfte
Einleitung
Das Gefecht als einzig wirksames Mittel der Strategie
2.1. Begriff des Gefechts und dessen Entscheidung
2.2. Unmittelbare Wirksamkeit des Gefechts für die Strategie
2.3. „Mögliche Gefechte sind [...] als wirkliche zu betrachten“
2.4. Das Benutzen des Sieges am Beispiel der Verfolgung
2.5. Zusammenfassung
Unmittelbare strategische Bestimmung von Gefechten
3.1. Kräfte
3.2. Raum
3.3. Zeit
3.4. Zusammenfassung
Der Handlungsrahmen der Strategie; Angriff und Verteidigung
Suche nach der besten Strategie und Bedeutung des Feldherrn
5.1. Allgemeines Strategieproblem und unvollkommene Lösung
5.2. Begriff und Rolle des Feldherrn im Krieg
5.3. Das Wesen des kriegerischen Genius
5.4. Rückschluss auf die Suche nach der besten Strategie
Zusammenfassung: Strategie und Effizienz der Kräfte
6.1. Handlungsrahmen der Strategie
6.2. Stoß gegen den Schwerpunkt vs. dezentraler Ansatz der Kräfte
Taktische Dimension: Intensität der Gewalt
Einleitung
Das Mittel der Taktik: Streitkräfte
2.1. Begriff der physischen und moralischen Streitkräfte
2.2. Moralische Größen und moralische Kräfte
2.3. Moralische Hauptpotenzen und Dreifaltigkeit des Krieges
2.4. Gesamtbetrachtung: Kämpfer, Krieger und Söldner
Ziel und Zweck in der Taktik
Grundprinzipe des Gefechts; Angriff und Verteidigung
Taktik und Rücksichtslosigkeit der Gewaltanwendung
Ganzheitliche Theorie des Krieges
Der Geist des Krieges
Streiflichter der Theorie auf moderne Konflikte
2.1. Das Fehlen eines dynamischen Gesellschaftsbildes bei Clausewitz
2.2. Die Bedeutung der Bevölkerung
2.3. Die Folgen ungleicher Verhältnisse
2.4. Bilanz: Streitkräfte als Mittel der Stabilisierung
VIII. Literatur- und Quellenverzeichnis
I. EINFÜHRUNG
1. ZIELSETZUNGDER ARBEIT
Das Thema Krieg gewinnt in Anbetracht moderner bewaffneter Konflikte und dem zunehmend offensichtlichen Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan auch im deutschen Sprachraum an Aktualität und Brisanz. Dabei gibt es kaum eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema, die ohne einen Verweis auf oder ein Zitat aus dem Clausewitz’schen Hauptwerk Vom Kriege auskommt. Clausewitz geht es dabei wie den meisten Autoren klassischer Standardwerke, über die man gern sagt, sie seien oft zitiert, wenig gelesen und kaum verstanden worden.7 Dies mag insbesondere für das Clausewitz’sche Werk zu gravierenden Missverständnissen geführt haben, da schon kurz nach dessen Erscheinen eine zeitgenössische Militärzeitschrift kommentierte:
„Die Sprache des Verfassers ist überaus gediegen, aber nicht immer so populär, um von dem großen Haufen verstanden zu werden. Diese Schrift will daher nicht bloß gelesen, sie will studiert sein.“8
Stößt also ein komplexes, schwer verständliches und zudem unvollendetes Dokument auf eine vor allem an markigen Zitaten interessierte Leserschaft, so sind im Ergebnis Missverständnisse vorprogrammiert. Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahezu jede Partei in militär- und sicherheitspolitischen Diskussionen glaubte, sich auf Clausewitz berufen zu können.9 An prominentester Stelle für die jeweiligen Patenschaften steht der Strategiestreit im späten 19. Jahrhundert, in welchem Delbrück10 unter Berufung auf Clausewitz vehement die Ermattungsstrategie postulierte, wohingegen seine Gegner, die Verfechter der Vernichtungsstrategie, selbst Anhänger von Clausewitz waren.11 Auch die Debatte um das Verhältnis zwischen ziviler Staatsführung und militärischem Oberkommando wurde beidseitig mit Hilfe von Clausewitz ausgetragen. Moltke der Ältere12, als ausgewiesener Clausewitz- Bewunderer, forderte im Kriegsfall die Übernahme der Staatsgewalt durch das Militär. Zwar führte sein erbitterter Gegner Bismarck13, der die zivilpolitische Führung beanspruchte, Clausewitz – wahrscheinlich aus Unkenntnis14 – nicht ins Feld, doch unterstellen die Interpreten des 20. Jahrhunderts, dass seine Ansichten voll und ganz im Geiste Clausewitz‘ lagen.15 Die Berufung auf Clausewitz reicht bis in die Gegenwart, wenn Studien aus dem angloamerikanischen Sprachraum die neusten Trends der amerikanischen Streitkräfte in Bezug auf Aufstandsbekämpfung analysieren und dabei Clausewitz zur Bewertung dessen hinzuziehen.16 Daraus folgt von selbst, dass die Anzahl derjenigen, die Clausewitz zu widerlegen oder zu überwinden beabsichtigen, nicht minder klein ist, doch dass sie tatsächlich nur spezifische Interpretationen, nicht aber den eigentlichen Clausewitz anfechten.
Die Interpretations- und Rezeptionsgeschichte von Vom Kriege ist also vielfach widersprüchlich und wenig homogen. Die schiere Anzahl der Arbeiten über Clausewitz hat jedoch einige Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass größere Funde in Bezug auf das Clausewitz‘sche Werk nicht mehr zu erwarten seien und dass nur noch im Rahmen von Detailstudien Neues herausgearbeitet werden könnte.17 In Anbetracht der hohen Widersprüchlichkeit und der bis heute anhaltenden Rätselhaftigkeit18 vieler Passagen, kann jedoch von einem Abschluss des Forschungsgegenstandes Clausewitz in keiner Weise gesprochen werden. Im Gegenteil liegt vielmehr die Annahme nahe, dass es bisher an einer ganzheitlichen Betrachtung und einem widerspruchsfreien Verständnis der Clausewitz’schen Theorie ermangelt.
So lassen sich die bisherigen Interpreten von Clausewitz grob in zwei Lager teilen. Zum einen die militärisch fokussierte Fraktion, beginnend bei Moltke dem Älteren, über Schlieffen19 und Liddell Hart20 bis hin zu den heutigen angloamerikanischen Studien um Christopher Bassford21. Sie befassen sich vor allem mit der Frage, wie Krieg geführt werden müsse und sind hauptsächlich an der Thematik Strategie interessiert. Dieses Lager hat eine gewisse Tendenz dazu, die Clausewitz’sche Theorie auf einzelne Sätze zu verkürzen, diese teils in anderen Zusammenhang zu setzen und militärische oder strategische Grundsätze daraus abzuleiten. Die Arbeiten weisen dabei durchweg einen hohen zeitgenössischen Bezug auf und es fehlt ihnen an Abstraktion und Allgemeingültigkeit. Die zweite Fraktion könnte hingegen als ziviler Gegenpol verstanden werden, deren Begründer wohl Delbrück war, obwohl er selbst inhaltlich zur militärisch fokussierten Kategorie zu zählen ist. Rothfels22, Hahlweg23, Aron24, begrenzt Kondylis25 sowie Münkler und Herberg-Rothe26 bilden die wesentlichen Meilensteine dieser Fraktion, welche sich vorrangig mit dem Zusammenhang zwischen Krieg und Politik bzw. Gesellschaft oder mit wissenschaftlich methodischen Aspekten des Clausewitz’schen Hauptwerkes befasst. Dieses Lager hat jedoch an der Idee des Kriegführens im engeren Sinne kein tiefgreifendes Erkenntnisinteresse und hinterfragt aus diesem Grunde weder das Wesen des Krieges noch die daraus resultierenden Implikationen für die Kriegsführung.
Keinem der durch die verschiedenen Lager vertretenen Forschungsinteressen fehlt es an Berechtigung, es fehlt aber bisher eine Betrachtung, die sich mit dem eigentlichen Kern des Werkes, nämlich einer Theorie des Krieges an und für sich, vollumfänglich befasst. Clausewitz hatte nämlich den bisher einzigartigen Versuch unternommen, den Krieg als wissenschaftlichen Gegenstand zu untersuchen und damit seine innere Logik allgemeingültig und abstrakt nachzuvollziehen.27 Sämtliche, bis in die Gegenwart geführten Diskussionen über Clausewitz sind jedoch vor allem deshalb von bemerkenswerten Missverständnissen geprägt, weil ein umfassendes Verständnis in Bezug auf die von ihm verwandte Gesamtsystematik, die einzelne Begriffe, deren Einordnung und den innere Zusammenhang des Krieges fehlt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird folgendes von einer abstrakten und allgemeingültigen Theorie des Krieges erwartet:
Sie soll zunächst den Untersuchungsgegenstand Krieg
beschreiben
, d.h. eingrenzen, definieren, in seinen Elementen darstellen und diese systematisieren.
Sie soll den Krieg
erklären
, d.h. zwischen den einzelnen Elementen des Krieges Verbindungen herstellen sowie den Krieg als Ganzes mit äußeren Bedingungen in Zusammenhang bringen und somit innere Wirkzusammenhänge erschließen.
Sie soll – sofern dies möglich ist – auf ein im Sinne der Theorie richtiges Handeln
schlussfolgern
, d.h. generische oder an spezifische Bedingungen geknüpfte Überlegungen aufstellen, die im Speziellen oder im Allgemeinen helfen, zwischen vernünftigem und unvernünftigem Handeln im Krieg zu unterscheiden.
Clausewitz in diesem Zusammenhang zu analysieren ist eine komplexe und vielschichtige Aufgabe. Es wird dabei gerade darauf ankommen, sich nicht auf ein einzelnes Element oder wenige Details zu fokussieren und andere Aspekte auszublenden, sondern es soll eine Gesamtansicht geschaffen werden, vor deren Hintergrund die vielen von den Interpreten oftmals missverständlich empfundenen Gegenstände leicht nachvollzogen werden können. Insbesondere die Tatsache, dass Clausewitz sein Werk nicht vollenden konnte bzw. den Großteil desselben unter anderen theoretischen Prämissen verfasst hatte, macht diesen Ansatz freilich angreifbar, da dies eine teils spekulative Interpretationsweise notwendig werden lässt. Anders als z.B. bei Aron, dem ein sehr kluges und das bisher umfassendste Werk zu Clausewitz zu verdanken ist, geht es im Rahmen dieser Arbeit also nicht um eine Interpretation des Clausewitz’schen Werkes bzw. dessen Wirkungsgeschichte,28 sondern es geht vielmehr darum, einzelne Gedanken von Clausewitz aufzugreifen, weiterzuentwickeln, zu einem Ganzen zu verbinden und auf diesem Wege das Clausewitz’sche Werk als den ersten „Lichtstrahl [zu nutzen], der für uns in den Fundamentalbau der Theorie fällt.“29
Ziel dieser Arbeit soll es also sein, eine umfassende und ganzheitliche Theorie des Krieges herauszuarbeiten, die sich in ihrem Kern auf die im Clausewitz’sche Werk manifestierten Überlegungen und Gedanken stützt. Der Anspruch, dass das daraus resultierende Endergebnis genau dies ist, was Clausewitz der Nachwelt vermitteln wollte, ist hierdurch nicht begründet. Das Ziel kann vielmehr nur dann erreicht werden, wenn an einigen Stellen über die Clausewitz’schen Gedanken hinaus gegangen wird, sie entweder abstrahiert, gelegentlich auch fortgesetzt, in jedem Falle aber miteinander verbunden werden. Das Ergebnis soll eine Theorie des Krieges sein, die den Geist des Krieges erschließt.
2. VORGEHEN UND AUFBAU DER ARBEIT
Im Rahmen des Versuchs, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht allzu viel von dem zu wiederholen, was schon vielfach geschrieben wurde, wird auf eine ausführliche Darstellung der Rezeptionsgeschichte und des Forschungsstandes zu Clausewitz30 sowie auf die Darstellung der offensichtlichen Relevanz des Themas verzichtet.
Inhaltlich stützt sich diese Arbeit in der Hauptsache auf die von Hahlweg herausgegebene, 19. Auflage des Clausewitz’schen Werkes ‚Vom Kriege‘. Sekundärliteratur stelle ich überall dort inhaltlich dar, wo es sinnvoll erscheint, z.B. um die Komplexität eines Sachverhaltes zu erschließen oder meine Position zu schärfen bzw. zu verteidigen. Eine ausführliche Liste der in dieser Arbeit verwendeten Literatur findet sich im letzten Teil dieser Arbeit. Die bei der Erstellung dieser Arbeit relevantesten Standardwerke sollen zur Orientierung eine kurze Erwähnung finden. Sie decken die Erkenntnisse des nicht militärisch fokussierten Teils der Interpretationslandschaft annähernd vollständig ab.
Mit der Formel „den Krieg denken“
31
hat Aron im Jahr 1976
32
die bisher umfangreichste Studie über die Clausewitz’sche Theorie vorgelegt. Sein Fokus liegt dabei auf der dialektischen Vorgehensweise des Kriegsphilosophen. Zudem ist Aron durch sein Bemühen gekennzeichnet, Clausewitz für ein friedensorientiertes, ziviles Publikum salonfähig zu machen. So ist eine seiner zentralen Aussagen, dass Clausewitz die strikte Oberhoheit des Zivilen über das Militär gefordert habe.
Paret hat ebenfalls im Jahr 1976
33
die bisher umfangreichste Studie zu Clausewitz‘ Persönlichkeit und seinem Verhältnis zum Staat vorgelegt, ohne dabei jedoch detailliert auf die Theorie des Krieges einzugehen. Ihm sind wesentliche Erkenntnisse zum geistigen Hintergrund, zur politischen Einstellung sowie zur Charakterentwicklung des Protagonisten zu verdanken.
34
Kondylis befasste sich 1984 mit der Clausewitz’schen Theorie und stellte sie in einen Zusammenhang mit den Theorien von Marx, Engels und Lenin. Sein Werk ist vor allem deshalb bedeutend, weil es Clausewitz aus einer neuartigen, sehr abstrakten kulturphilosophischen Seite aus betrachtet. Kondylis wendet sich dabei explizit gegen eine liberale Clausewitz-Interpretation, wie sie von Aron vertreten wird.
35
2001 legte Herberg-Rothe eine Studie der Clausewitz’schen Kriegstheorie vor. Er greift grundsätzlich die Richtung von Aron auf, interpretiert den Clausewitz’schen Text jedoch vorrangig vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse des frühen 19. Jahrhunderts, um die Ergebnisse anschließend selbst in das 21. Jahrhundert zu übertragen. Vor allem ist er der bisher einzige Autor, der die drei Wechselwirkungen zum Äußersten als ein zentrales Element der Theorie näher analysierte.
36
Eine hilfreiche und übersichtliche Zusammenfassung bisheriger Erkenntnisse zum Thema Clausewitz, insbesondere auch der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte, hat Heuser
37
im Jahr 2002
38
unter dem Imperativ „Clausewitz lesen“
39
publiziert.
Ein Vergleich der unterschiedlichen Kriegsbegriffe von Platon, Hobbes und Clausewitz wurde 2002 von Kleemeier veröffentlicht. Von besonderer Bedeutung für die Clausewitz’sche Theorie ist hierbei die fundierte Darstellung der moralischen Größen, die für Kleemeier zu Recht eine zentrale Stellung in der Clausewitz’schen Theorie einnehmen.
40
Schösslers 2009 veröffentlichter „Grundriss einer Ideengeschichte militärischen Denkens“
41
ist insbesondere in Bezug auf den Strategiebegriff, das dialektische Verhältnis von Angriff und Verteidigung sowie die Relation von Zweck, Ziel und Mittel von Bedeutung.
Im Rahmen meiner Arbeit soll der Forschungsgegenstand Krieg in mehreren Schritten erschlossen werden. Noch im einführenden ersten Teil wird kurz auf das Leben und Wirken von Carl von Clausewitz eingegangen sowie die Genese und wesentlichen Problemstellungen seines Hauptwerkes dargestellt. Davon sind keine neuen Forschungsergebnisse zu erwarten, der Anteil ist aber zum Gesamtverständnis für diejenigen Leser notwendig, die mit Clausewitz bisher nur geringe Berührungspunkten verbanden.
Nach dieser Einführung wird im zweiten Teil der Arbeit ein gesellschaftstheoretischer Rahmen um die Kriegstheorie gesteckt. Es soll darin aufgezeigt werden, dass der Staatsbegriff, welchen Clausewitz verwendet, durchaus sinnvoll und ohne Bedeutungsverlust abstrahiert werden kann, so dass die Theorie auch außerhalb der konventionellen Staatenwelt sowie in Bürgerkriegen anwendbar ist. Zu diesem Zweck wird der Begriff politisches Gemeinwesen als abstraktes Grundelement in die Theorie des Krieges eingeführt und anhand einiger Clausewitz'scher Gedanke präzisiert. In diesem Zusammenhang muss auch der Begriff Gewalt für das Grundverständnis der Kriegstheorie entschlüsselt werden. Insbesondere ist im Sinne einer Prämisse herauszuarbeiten, dass moralische Gewalt nur innerhalb von politischen Gemeinwesen Anwendung finden kann und dass sich aus diesem Grunde die verschiedenen politischen Gemeinwesen untereinander in einer Art Naturzustand im Hobbesschen Sinne befinden. Es gibt in diesem Denkmodell also keine höhere moralische Instanz, die in dem Falle eines Konflikts Lösungen erzwingen oder wenigstens Regeln für die Konfliktaustragung vorgeben könnte. Zur Lösung von Konflikten bleibt also nur ein konsensorientierter Handel im Sinne eines Interessenausgleichs (Diplomatie) oder die Austragung durch prinzipiell nicht regulierte, physische Gewalt (Krieg).
Im dritten Teil der Arbeit soll die Theorie des Krieges in den engeren Fokus gerückt und deren Grundlagen dargestellt werden. Dazu ist zunächst der von Clausewitz gebrauchte, handlungsorientierte Kriegsbegriff zu analysieren und zu definieren. Insbesondere muss hierbei der in der Sekundärliteratur vielfach umstrittene Begriff des absoluten Krieges aufgegriffen werden. Mit Hilfe von Textanalyse soll dargelegt werden, dass der absolute Krieg im Endstadium der Clausewitz’schen Theorie nur noch ein Absurdum und gewissermaßen den Endpunkt eines rein theoretischen, mit der wirklichen Welt nicht mehr in Zusammenhang stehenden, logischen Gedankenfadens vor dem Hintergrund eines Sieges um jeden Preis darstellte. Dies bildet gleichsam den Übergang zu der hauptsächlichen Schwierigkeit der Kriegstheorie, welche Clausewitz in den letzten Jahren seines Lebens maßgeblich umtrieb. Diese Hauptschwierigkeit bestand in der Erfassung der Verschiedenartigkeit der Kriege. Diese Verschiedenartigkeit bezog sich dabei nicht – wie in der Sekundärliteratur vielfach angenommen – auf ein sich mit der Zeit wandelndes Kriegsbild im Allgemeinen, sondern konkret auf die Verschiedenartigkeit in der Intensität der Kriegsführung. Diese Intensität lässt sich auf die Faktoren 1) Anstrengung der Kräfte als Ganzes, 2) Effizienz, mit welcher diese Kräfte die Vernichtung der gegnerischen Kräfte anstreben und 3) Rücksichtslosigkeit, mit welcher die Streitkräfte die Gewalt anwenden, zurückführen.
Dabei wäre die Verschiedenartigkeit nicht weiter wundersam, wenn das Äußere der Intensität ein Ideal darstellen würde und jedes Abweichen davon auf eine konkrete Schwäche oder einen Mangel an Energie zurückgeführt werden könnte, wenn es sich also regelmäßig um einen Fehler handeln würde. Das starke Erkenntnisinteresse Clausewitz‘ ist jedoch dadurch begründet, dass die Verschiedenartigkeit in jedem einzelnen Fall begründet zu sein scheint und also im normativen Sinne der Theorie zweckmäßig und somit richtig ist. In der Hauptsache problematisiert Clausewitz also nicht die konkrete Gestalt der Gewaltanwendung bzw. des Krieges, sondern das abstrakte Ideal der Kriegsführung im Sinne einer normativen Bewertung von richtigem und falschem Handeln im Krieg, welches von Fall zu Fall verschieden zu sein scheint. Es wandelt sich also nicht nur die Erscheinung des Krieges, sondern auch das eigentliche Wesen desselben.
Nach dieser engeren Umgrenzung der eigentlichen Problemstellung der Theorie des Krieges im Clausewitz’schen Sinne folgt eine analytische Einteilung der Kriegstheorie, die im weiteren Verlauf auch die Struktur der Arbeit bestimmen wird. Demnach lassen sich drei Dimensionen des Krieges in der Theorie trennscharf differenzieren:
In der politischen Dimension ist der Krieg bzw. der Feldzug ein Mittel, um den jeweiligen politischen Zweck zu verwirklichen. Gleichsam ist hier die Bestimmung der Anstrengung der Kräfte zu verorten, die das politische Gemeinwesen für den Krieg aufbringt.
Auf strategischer Ebene wird der Krieg bzw. der Feldzug, der in der politischen Dimension als Ganzes betrachtet wurde, in einzelne Gefechte zergliedert. Die Gefechte sind nunmehr ein Mittel, welches – allgemein gesagt – zu dem Zweck der Politik eingesetzt wird. Hier wird unter anderem der Grad der Effizienz bestimmt, mit welchem die eigenen Streitkräfte auf das Ziel ausgerichtet werden, die gegnerischen Streitkräfte zu vernichten.
Schließlich bleibt die taktische Dimension, in welcher das Gefecht in die Einzelhandlungen der Streitkräfte zergliedert wird. Hier sind also die Streitkräfte das Mittel, welches zum Zweck der Strategie eingesetzt wird. Entsprechend ist hier auch die Bestimmung zu verorten, mit welchem Grad der Rücksichtslosigkeit die Gewalt angewendet wird.
Der vierte Teil der Arbeit befasst sich mit der politischen Dimension des Krieges. Zunächst ist dazu die eigentümliche Natur des Mittels Krieg herauszuarbeiten. Demnach verfügt jeder Krieg aufgrund der darin wirksamen lebendigen Kräfte, der lebendigen Reaktion des Gegners sowie der Unbekanntheit aller Daten über ein hohes Maß an Eigendynamik, die sich im Vorfeld eines Krieges kaum durch die Politik kalkulieren lässt. Hiernach wird festgestellt, dass jeder Krieg auf einem politischen Zweck beruht, d.h. dass jedem Krieg eine politische Absicht zugrunde liegt, welche mit Hilfe des Krieges verwirklicht werden soll. Diesem politischen Motiv steht jedoch ein anderer politischer Wille entgegen, so dass der Zweck nicht unmittelbar realisiert, sondern zunächst der politische Wille des Gegners überwunden werden muss (Ziel des Krieges). Die endliche Realisierung des politischen Motivs ist also unter Umständen eine dem Krieg selbst nicht angehörige Folgehandlung. Dabei ist es ein normativer Anspruch der vernunftorientierten Theorie des Krieges, dass dieser politische Zweck als ursprüngliche Absicht auch das Handeln im Krieg bestimmen soll. Dies ist deshalb keine Selbstverständlichkeit, weil sich im Krieg auch andere Motive neben den politischen Zweck als das ursprüngliche Motiv stellen. Diese Motive sind im Rahmen dieses Teils der Arbeit zu analysieren. Es stellt sich ferner die Frage, in welchem Zusammenhang die Motive zum Krieg mit der Intensität der Kriegsführung auf politischer Ebene, d.h. mit dem Umfang der Anstrengungen zum Krieg, zusammenhängen. Da auch der Gegner von Motiven zum Krieg angetrieben wird, muss der Krieg seiner Zielsetzung nach genau gegen diese Motive wirken, um den Gegner zum erwünschten Frieden zu zwingen. In der Folge kommt der Analyse der gegnerischen Motive zum Krieg eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Ziele des Krieges zu.
Im fünften Teil der Arbeit wird die strategische Dimension des Krieges betrachtet. Die Strategie verfolgt – wenn sie im Sinne der Theorie treffend gewählt wurde – den Zweck der Überwindung des gegnerischen Willens (auch Ziel des Krieges auf politischer Ebene). Das einzig wirksame Mittel dazu ist das Gefecht oder die Bedrohung des Gegners mit demselben. Dazu bestimmt die Strategie Kräfte, Raum, Zeit und Ziel der einzelnen Gefechte. Es muss hier also zunächst das einzelne Gefecht, sowie die Implikationen der einzelnen Bestimmungen desselben näher untersucht werden. Insbesondere ist zu hinterfragen, welche Ziele die Strategie dem einzelnen Gefecht vorgeben kann und welche Ziele die Strategie folgerichtig sich selbst setzen kann, um den Zweck, die Überwindung des gegnerischen Willens zum Krieg, zu erfüllen. Es wird dabei darauf ankommen, einen Zusammenhang zwischen strategischer Zielsetzung und Effizienz der Kräfte herzustellen. Werden die Kräfte zusammengefasst in einer Hauptschlacht verwendet oder wird eher eine Art Klein- oder Partisanenkrieg geführt oder gar das Gefecht überhaupt gemieden? Aus dieser Frage ergibt sich eine Diskussion um die Möglichkeiten generischer Grundsätze, mit denen eine möglichst treffende Strategie entwickelt werden könnte. Eine allgemeingültige Lösung kann die Theorie in diesem Zusammenhang nicht bieten, da die strategische Gleichung im konkreten Einzelfall von zu vielen unüberschaubaren Variablen abhängt – sie muss es aber auch nicht, da die im Einzelfall gewählte Strategie niemals idealtypisch sein kann, sondern in der wirklichen Welt maßgeblich durch die Fähigkeiten, die Talente und die Machtvollkommenheit des Feldherrn bestimmt wird. Entsprechend wird ein besonderes Augenmerk auf die von Clausewitz im Rahmen des kriegerischen Genius vermittelte idealtypische Persönlichkeitsstruktur des Feldherrn gelegt, um daraus im Anschluss Rückschlüsse auf eine sich dem Ideal annähernden Strategie zu ziehen.
Der sechste Teil der Arbeit befasst sich mit der taktischen Dimension des Krieges, d.h. mit der Führung des Gefechts bzw. dem unmittelbaren Einsatzes von Gewalt. Das Mittel der Taktik sind die Streitkräfte, die zum Zweck des strategischen Ziels benutzt werden. Zunächst wird also eine Analyse und eine Systematik in Bezug auf Streitkräfte entwickelt. Insbesondere werden die moralischen Kräfte auf einer abstrakten Ebene strukturiert und analysiert. Es wird festzustellen sein, dass die Streitkräfte im Gefecht notwendigerweise mit dem Ziel eingesetzt werden müssen, andere Streitkräfte zu vernichten. Damit stellt sich also die Frage, wie auf dieser Ebene des Krieges überhaupt zwischen verschiedenen Intensitäten der Gewalt differenziert werden kann. Dazu sind elementare und allgemeingültige Grundprinzipe des Gefechts sowie Möglichkeiten der Rücksichtnahmen und Gewaltbegrenzungen zu untersuchen. Das Ziel des Gefechts bzw. die Art und Zusammensetzung der Streitkräfte wird dabei wesentlich darüber entscheiden, mit welcher Rücksichtslosigkeit die Vernichtung feindlicher Streitkräfte verfolgt wird. In der konkreten Situation wird die Art und Zusammensetzung der Streitkräfte, die im jeweiligen Einzelfall ein Gegebenes ist, also erhebliche Rückwirkungen auf die Möglichkeiten des Feldherrn in Bezug auf seine strategischen Zielsetzungen haben.
Zum Abschluss der Arbeit folgt im siebten Teil eine ganzheitliche Betrachtung, in welcher die einzelnen Dimensionen zu einem Ganzen zusammengebracht werden, so wie sie auch in der wirklichen Welt keine getrennten Aspekte, sondern immer nur ein Teil des Ganzen sind. Es wird hier also versucht, den Geist des Krieges endlich in seiner Gesamtheit zu erfassen und darzustellen. Danach folgt ein Ausblick auf zukünftige, auf dieser Arbeit möglicherweise aufbauende Forschungsvorhaben. Insbesondere soll eine Richtung dafür angegeben werden, wie moderne Konflikte, vor allem sogenannte Stabilisierungsoperationen, in der in dieser Arbeit aufgestellten Systematik eingeordnet und erklärt werden können.
3. LEBEN UND WIRKEN CARL VON CLAUSEWITZ‘
Das Leben von Clausewitz ist in der bestehenden Literatur ausführlich und weitestgehend unstrittig nachgezeichnet.42 Im Folgenden soll das Leben des Generals mit den wichtigsten Eckpfeilern dargestellt werden, damit das Hauptwerk ‚Vom Kriege‘ auch aus der Zeit und den Lebensumständen seines Verfassers heraus verstanden werden kann.
Erste Erfahrungen und Schriften bis 1806
Über Clausewitz‘ Kindheit ist nicht viel bekannt.43 Er wurde im Juli 1780 in Burg bei Magdeburg geboren, sein Vater war ein königlicher Steuereintreiber,44 der zuvor als Offizier im Siebenjährigen Krieg gedient hatte und dort schwer verwundet worden war. In seinem Elternhaus erlebte Clausewitz ein Übermaß an Patriotismus und militärischem Geist. Drei der vier Clausewitz-Kinder traten in die preußische Armee ein und starben im Generalsrang.45 Eine gewisse Fragwürdigkeit der adligen Abstammung der Familie Clausewitz46 könnte eine erste Zäsur in Clausewitz‘ Leben darstellen; so musste sich der Offizier zeit seines Lebens dem Eindruck erwehren, er sei ein Usurpator des Adelstitels und des Offiziersstatus unwürdig.47 Obwohl seine adelige Abstammung erst im Jahr 1827 eindeutig und offiziell durch König Friedrich Wilhelm III bestätigt wurde,48 konnte Clausewitz im Alter von 12 Jahren als Offizieranwärter in das Infanterieregiment ‚Prinz Ferdinand‘ (Nr. 34) eintreten, welches ausschließlich adlige Offiziere annahm.49 Bereits 1793 nahm Clausewitz mit seinem Regiment an einem Feldzug gegen französische Revolutionstruppen teil und konnte bei der Belagerung und späteren Besatzung der Stadt Mainz erstmals die enthusiastische Kraft von revolutionärem Gedankengut beobachten.50
1801 wurde Clausewitz an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin zugelassen, in welcher der spätere Heeresreformer Scharnhorst51 auf den 25 Jahre jüngeren, intellektuellen und nach Bildung strebenden Clausewitz aufmerksam wurde. Scharnhorst lernte den jungen Clausewitz sehr schnell zu schätzen und es entwickelte sich auch privat eine enge Bindung zwischen beiden.52 Durch Scharnhorst wurde Clausewitz in die Reihen der Heeresreformer eingeführt, die sich intensiv mit der napoleonischen Kriegsführung auseinandersetzten und früh erkannten, dass die preußische Armee, die noch immer das Erbe Friedrichs des Großen in sich trug, dringend reformiert werden musste, wenn sie im Kampf gegen Frankreich bestehen wollte. Dieser kritische Zeitgeist stieß allerdings auf beachtliche Widerstände der traditionellen preußischen Elite.53 Derweil wurde Clausewitz von Scharnhorst nicht nur geistig geprägt, sondern durchaus auch dienstlich gefördert. Nachdem Clausewitz die Kriegsschule als Jahrgangsbester absolviert hatte, verschuf ihm im Sommer 1804 vor allem die Fürsprache von Scharnhorst den attraktiven und prestigeträchtigen Posten54 des Adjutanten bei dem Prinzen August55. Damit hatte Clausewitz Zugang zum königlichen Hof und den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Preußens, bis er 1806 in seiner Funktion als Adjutant in die Schlacht um Jena und Auerstedt zog.
In der Berliner Zeit von 1801 bis 1806 entstand eine Reihe von überlieferten Niederschriften und Aufzeichnungen des jungen Offiziers.56 Dabei stechen vor allem drei Titel heraus: Eine umfangreiche Studie über die Feldzüge Gustav Adolfs57 in den Jahren 1630 bis 1632, einige Notizen zum Stichwort ‚Strategie‘58 und ein in der ‚Neuen Bellona‘59 anonym erschienener Artikel, in dem Clausewitz die Ansichten des damals hoch angesehenen Bülow60 scharf angriff.61
Die Abhandlungen über die Feldzüge des schwedischen Königs während des Dreißigjährigen Krieges wurden zwar erst posthum veröffentlicht,62 sind aber wahrscheinlich in ihrer ursprünglichen Fassung verblieben. Das Werk ist ausgesprochen umfangreich, glänzt vor allem durch eine präzise und eindrucksvolle Sprache und ist in sich schlüssig. Der frühe Clausewitz analysiert dezidiert die schwedischen Feldzüge im Dreißigjährigen Krieg und schafft es, sich auf diese zu konzentrieren ohne von den eigentlichen Hauptschlachten des großen Krieges abgelenkt zu werden. Das Hervorstechende dabei ist, dass Clausewitz entgegen den Strömungen seiner Zeit nicht mathematische, rein rationale Überlegungen in den Mittelpunkt stellt, sondern bereits die moralischen Größen63 und das Genie des Feldherrn64 konzentriert untersucht und hierin die wesentlichen Merkmale des Feldzuges identifiziert. Auf diesem Wege spannt er auch den Bogen zu seiner Zeit und kritisiert die Haltung seiner Generation sowohl im militärtheoretischen, als auch im politischen Bereich.65 Insgesamt ist dieses Werk des Mitte-Zwanzigjährigen verblüffend seiner Zeit voraus und weist einen hohen Abstraktionsgrad auf.66
Beim zweiten hervorstechende Titel, „Strategie von 1804“67, handelt es sich um eine Notiz, die wohl kaum zur Veröffentlichung gedacht war und entsprechend ebenfalls erst nach Clausewitz‘ Tode publiziert wurde. Dieser Aufsatz ist eine Abhandlung, die eine umfassende Anzahl von Themen einschließt, die jeweils nur kurz, fast stichpunktartig angeschnitten werden. Hervorstechend ist dabei durchweg, dass die Bedeutung des Gefechts und des energischen Handels in den Vordergrund gestellt werden.68 Clausewitz spricht sich in diesem Zusammenhang implizit gegen die Manövertaktik der auslaufenden Militärepoche aus, mit der im Schwerpunkt versucht wird, durch Truppenbewegungen den Gegner in eine nachteilige Position zu bringen, insgesamt das Gefecht aber aus Kostengründen zu meiden. Auffallend ist, dass Clausewitz bereits in diesen frühen Schriften einige Formulierungen findet, die charakteristisch und endgültig sind und unverändert in sein großes Werk ‚Vom Kriege‘ übernommen werden.69 So zum Beispiel die Definition der Begriffe Strategie und Taktik70, deren Formulierung er in ‚Vom Kriege‘ wortgleich übernimmt.71 Andere Aspekte reifen zwar schon in seinem Verständnis, doch die endgültige Form fehlt dem jungen Clausewitz noch. So formuliert er zwar in ‚Strategie‘, dass die Franzosen aufgrund der Ausdehnung ihres Angriffs in Polen leichter zu schlagen seien als in Italien und dass ihnen daher spätestens in Russland der Untergang gewiss sei,72 findet aber erst in ‚Vom Kriege‘ die allgemeingültig abgeleitete Formel des Kulminationspunktes im Angriff,73 mit welcher er feststellt, dass die Truppen im Angriff mehr abgenutzt werden als in der Verteidigung und damit verbunden ein Punkt existieren muss, an dem der Verteidiger das Übergewicht erhält. Gegensätzlich zu seinen späteren Auffassungen sieht Clausewitz in der ‚Strategie‘ den Zufall allerdings noch als Störgröße im Krieg, die es so weit wie möglich auszuschalten gelte. Er hat sich also zu diesem Zeitpunkt noch nicht gänzlich von der rationalistischen Militärdoktrin frei gemacht.74 Jedoch sind die vielleicht interessantesten Überlegungen seines Hauptwerkes ‚Vom Kriege‘ zum Zusammenhang zwischen Krieg und Politik in dieser frühen Schaffensphase noch nicht vorhanden. Im Gegenteil schreibt er, dass der politische Zweck auf das militärische Ziel eines Krieges kaum Einfluss habe.75
In der dritten hervorstechenden Schrift, der Bülow-Rezension76, greift Clausewitz die militärtheoretischen Ansichten von Bülow massiv an. Bülow hatte kurz zuvor in den Versuch unternommen, „Ordnung in die Ansichten über den modernen Krieg zu bringen, indem er allgemeingültige Lehrsätze in die Militärtheorie einführen und eine allgemein anerkannte Terminologie entwickeln wollte“77. Seine Hauptthese war dabei, „daß der Erfolg einer militärischen Operation weitgehend abhängig sei von dem Winkel zweier Linien, die von den äußersten Punkten der Operationsbasis zum Angriffsziel führen. Wenn die Operationsbasis günstig gelegen und so weit ausgedehnt sei, daß die Linien in einem Winkel von 90 Grad oder mehr zum Ziel zusammenlaufen, dann sei der Sieg nach menschlichem Ermessen sicher.“78 Natürlich war es genau jene Rationalisierung, jene Mathematisierung des Krieges, die Clausewitz massiv ablehnte. Entsprechend polemisch und harsch war auch seine in der Neuen Bellona anonym79 veröffentlichte Gegenschrift.80 Allerdings war es in der damaligen Zeit für einen Offizier in Clausewitz‘ Rang durchaus nicht ungewöhnlich, in derartiger Form am öffentlichen Diskurs teilzunehmen.81
Insgesamt hebt sich Clausewitz bereits mit seinen frühen Schriften deutlich von vergleichbaren Werken ab. Seine Schriften hatten bereits jetzt das Niveau der besten Militärliteratur der damaligen Zeit, auch wenn es dem jungen Clausewitz noch an der Differenzierung fehlte. Im Alter von 25 Jahren hatte er zwar schon eine gewisse Reife erlangt, strebte aber fortwährend weiter danach, seine Bildung zu vertiefen und seine theoretischen Ansichten zu verfeinern.82 Doch zunächst wurden die literarischen Arbeiten Clausewitz‘ durch den Krieg zwischen Preußen und Frankreich unterbrochen.83 Bei der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 standen sich nicht nur zwei feindliche Armeen gegenüber, sondern auch zwei unterschiedliche Militärdoktrinen.
Hintergründe der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806
Auf der einen Seite kämpfte die Militärmaschinerie Preußens in der Tradition des Königs Friedrich II. Dieser hatte Preußen während seiner langen Regierungszeit mit Hilfe einer Reihe von Kriegen in den Kreis der europäischen Großmächte geführt,84 doch nach seinem Tod eine enorme Lücke hinterlassen. Der omnipräsente, autoritäre Herrscher konnte durch seine Nachfolger kaum ersetzt werden.85 So verharrte auch die preußische Armee in der Kriegführung des 18. Jahrhunderts, die den einfachen Soldaten ausschließlich als unmündigen Erfüllungsgehilfen ansah. Hintergrund war ein Staatsverständnis, nachdem der gemeine Bürger ausschließlich Untertan, ohne jegliche Mitsprache oder Teilhabe am Staatswesen war. Unter diesen Voraussetzungen erwarteten die Fürsten kaum, dass sich der Untertan persönlich für die Sache des Staates einsetzte. Da alle europäischen Staaten nach ähnlichen Grundsätzen regiert wurden, konnte dem Untertan letztlich egal sein, welchem Herrn er zu gehorchen hatte.86 Entsprechend war das erste Problem des Feldherrn des 18. Jahrhunderts zumeist nicht der Kampf mit dem Feind, sondern der Zusammenhalt der eigenen Armee. So hatte Friedrich der Große in einer Vorschrift für Truppenführer auch gleich das erste Kapitel der Verhinderung von Fahnenflucht gewidmet.87 Die Motivation des einzelnen Soldaten zum Kampf konnte somit nicht aus einem Enthusiasmus für die Sache hervorgehen, sondern musste durch blinden Gehorsam ersetzt werden. Dieser wurde in erster Linie durch Furcht vor drakonischen Strafen erzeugt.88
Aus diesem Bild des absolut unmündigen, blind gehorchenden, meist zwangsrekrutierten Soldaten heraus entwickelte sich die Lineartaktik, mit welcher die Infanterie in engen Formationen zu drei Gliedern auftrat, wobei die erste Linie abhockend, die zweite stehend und die dritte auf Lücke feuern konnte. Die Flanken wurden jeweils von der Kavallerie gedeckt. Diese Taktik, die jegliche Eigeninitiative oder das Mitdenken des einfachen Soldaten ausschloss, wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts optimiert. Es kam darauf an, die Abläufe innerhalb der Formationen, das Laden, das Vorrücken und die Veränderung der Stellung zu perfektionieren und zu höchster Geschwindigkeit zu führen. Auf diesem Wege wurde die Armee zu einer Art Uhrwerk, einem mechanischen Instrument, welches nach mathematischen und geometrischen Grundsätzen zu berechnen war, wenn der Waffendrill nur hinreichend gut eingeübt war.89 Dies erklärt auch den Glauben an „vollkommene Plan- und Berechenbarkeit militärischer Operationen“90.
Nach Friedrichs Tod hatten die nachfolgenden Monarchen kein vergleichbares Durchsetzungsvermögen und es mangelte ihnen an Erfahrung. Daher waren sie auf den Rat der Generalität angewiesen.91 Diese wussten ihre neue Stellung durchaus gut auszunutzen, traten gegenüber der Krone ausgesprochen selbstbewusst auf und wehrten jegliche Neuerungen aus Traditionsbewusstsein ab.92 Die preußische Armee zog daher nicht die nötigen Lehren aus der Französischen Revolution und beharrte auf ihrem alten Menschenbild, da den Generalen die Lineartaktik als das Maß aller Dinge erschien. Die kleine Gruppe der Reformer um Scharnhorst, zu der sich auch Clausewitz zählen durfte, die immer wieder auf die Bedeutung der moralischen Größen im Gefecht, den Enthusiasmus und den notwendigen Mut der Soldaten hinwiesen,93 wurden kritisch beäugt und man sah in ihnen sogar eine Gefahr für die Monarchie und das alte, konservative Weltbild. Eine Volksbewaffnung, oder ein Soldat, der freiwillig sein Vaterland verteidigt, schien den Generalen absurd, ja sogar gefährlich. Patriotische Empfindungen, die in Deutschland durchaus vorhanden waren, wurden daher in keiner Weise militärisch genutzt. Der Drill wurde perfektioniert, sodass am 14. Oktober 1806 das „Paradebeispiel einer exzellent funktionierenden Kriegsmaschine“94 auf den Schlachtfeldern bei Jena und Auerstedt stand.95
Auf der französischen Seite stand im Gegensatz zur preußisch gedrillten Berufsarmee eine freiwillige Volksarmee. Die Soldaten waren hier also keine ausgebildeten Untertanen, sondern motivierte Bürger, die kaum über eine militärische Grundausbildung verfügten und nach herkömmlichen Maßstäben eher wenig diszipliniert waren.96 Dieser Kämpfertypus trat erstmals in den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen auf und stellte die militärischen Führer zunächst vor einige Herausforderungen. Der enthusiastische, motivierte Kämpfer eignet sich nur bedingt für die damals übliche Kampfweise der Lineartaktik und dies wurde von den eigenen militärischen Führern zunächst als Nachteil empfunden. Erst nach den ersten erfolgreichen Schlachten wurden die Vorteile dieses Kämpfertypus deutlicher, denn endlich konnten einige schon im Absolutismus diskutierte Taktiken und Formationen erprobt und angewendet werden, für die der unmündige, gepresste Kämpfer ungeeignet war.
Bei der Tirailleurtaktik traten die Schützen in losen Verbänden auf, konnten also das Gelände ausnutzen, in Deckung gehen und sich weitestgehend frei bewegen. Die mangelhafte Waffentechnik verhinderte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch einen wirkungsvollen Einsatz der Tirailleure, so dass diese Formation nur dazu geeignet war, Lücken zu decken oder den Formationswechsel der Hauptkräfte abzusichern.97 Den Tirailleuren fehlte es an Stoß- und Feuerkraft.98 Ebenfalls neu, aber äußerst wirkungsvoll war die Kolonnentaktik, bei der sich die Schützenverbände nicht wie bei der Lineartaktik breit und flach, sondern schmal und tief gliederten und mit aufgesetztem Bajonett die feindlichen Linien stürmten und im Nahkampf niederrangen.99 Ganz offensichtlich liegt diese Kampfweise dem leidenschaftlichen Kämpfer deutlich näher als dem gedrillten, emotionslosen Befehlsempfänger.
Der entscheidende Vorteil der französischen Armee war nun weniger die Überlegenheit einer neu entwickelten Taktik über eine ältere, als vielmehr die Möglichkeit, seine Taktiken zu kombinieren und zu wechseln, um somit weniger vorhersehbar zu handeln, die Situation besser auszunutzen und in verschiedenen Lagen flexibler reagieren zu können.100
Der preußischen, exzellent gedrillten und disziplinierten Kriegsmaschine stand also die französische, nur rudimentär gedrillte, aber äußerst flexibel einsetzbare Volksarmee gegenüber. Dieses Bild spiegelte sich auch in der Armeeführung wieder: Die Franzosen wurden von ihrem 37-jährigen Napoleon Bonaparte persönlich angeführt. Seine Herrschaft war unangefochten, seine Mannschaften verehrten ihn und folgten ihm aus Überzeugung. Die Befehlshaber seiner Armeekorpse waren bis auf Augereau101 zwischen 36 und 39 Jahre alt, Führungs- und Machtverhältnisse waren zwischen ihnen klar geregelt und unstrittig. Der jüngste französische General war 29 Jahre. Insgesamt war das französische Offizierkorps jung, dynamisch, flexibel, belastbar und kampferprobt. Leistung, Befähigung und Bewährung im Felde gab idealtypischerweise den Ausschlag für Beförderungen.102
Ganz anders waren dagegen die Verhältnisse auf preußischer Seite. Der König Friedrich Wilhelm III war zwar anwesend, führt aber nicht aktiv. Als Befehlshaber vor Ort wurde der 71-jährige Herzog zu Braunschweig-Lüneburg103 eingesetzt, dessen – nach Clausewitz‘ Urteil – „Wesen und Betragen eines verbindlichen Hofmanns [ihn] verhinderte[…], über Menschen und Umstände herrisch zu gebieten“104. Der greise Feldmarschall erwies sich als unfähig, den Überblick zu bewahren und die nötige Entschlusskraft aufzubringen, um aktiv und wendig zu führen. Hinzu kam, dass das Verhältnis zu den drei anderen preußischen Befehlshabern unklar und durch persönliche Differenzen gestört war.105 Insgesamt zeigte sich das Offizierkorps überaltert. Bei der Infanterie waren 56 Prozent der Offiziere über 50 Jahre, bei der Kavallerie gar knapp 70 Prozent.106 Zum Vergleich: Bei den Franzosen war der Marschall Augereau mit 49 Jahren der älteste General. Bei Beförderungen preußischer Offiziere bestimmten Herkunft und Abstammung die maßgebliche Reihenfolge, Leistung und Befähigung traten in den Hintergrund.107 Scharnhorst bewertete das Offizierkorps wie folgt: „Unsere höheren Offiziere wissen nicht zu kommandieren; nur wenige sind in ihrer Stelle brauchbar.“108 So ergab sich ein äußerst schlechtes Bild für die preußische Führung. „Der Großteil der Offiziere konnte nur lehrbuchmäßig agieren und wusste nicht, flexibel auf die neu angewandte Taktik der Franzosen zu reagieren.“109
So ereignete sich am 14. Oktober 1806 die unausweichliche Katastrophe für Preußen. Der stolze Militärstaat wurde durch die verheerende Niederlage bei Jena und Auerstedt in seinen Grundfesten erschüttert. Zwar hatte der kleine Zirkel von Reformgeistern um Scharnhorst schon zuvor das alternde Militärwesen Preußens kritisiert,110 doch waren diese wissenschaftlichen Diskurse doch eher theoretischer Natur und deren praktischer Nutzen in weiter Ferne gewähnt.111 Der Niederlage in Jena und Auerstedt folgte der völlige Zusammenbruch Preußens. „Noch wenige Tage zuvor schien das Alte gut und bewährt. Nun wird unversehens jene vormals unbesiegbare Großmacht im Herzen Europas in Frage gestellt.“112





























