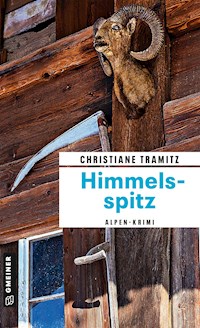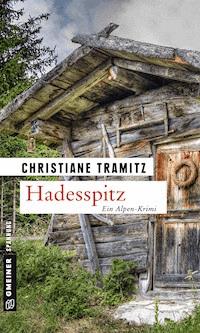9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als ihr Ehemann Anderl, der schwer unter Kriegsfolgen leidet, 1953 zum Totengräber von Waging berufen wird, übernimmt die 25-jährige Rosa diese Aufgabe für ihn. Ein Handkarren und später ein schwarzer VW-Käfer mit Anhänger dienen als Leichenwagen. Mit der Zeit übernimmt Rosa die Bestattungsaufgaben sämtlicher umliegender Gemeinden und sorgt als Hauptverdienerin für das Überleben der Familie. Fast 70 Jahre lang ist sie im bayerischen Rupertiwinkel die Erste, die gerufen wird, wenn jemand gestorben ist. In ihrer Heimat gilt sie als Legende. Die Bestsellerautorin Christiane Tramitz, deren Bruder von Rosa Wegscheider bestattet wurde, erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte dieser starken und eigenwilligen Frau. Sie entführt uns in die einfache, aber glückliche Welt einer dörflichen Gemeinschaft – zwischen Liebe und Tod, Tradition und Emanzipation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ZUMBUCH
Als ihr Ehemann Anderl, der schwer unter Kriegsfolgen leidet, 1953 zum Totengräber von Waging berufen wird, übernimmt die 25-jährige Rosa diese Aufgabe für ihn. Ein Handkarren und später ein schwarzer VW-Käfer mit Anhänger dienen als Leichenwagen. Mit der Zeit übernimmt Rosa die Bestattungsaufgaben sämtlicher umliegender Gemeinden und sorgt als Hauptverdienerin für das Überleben der Familie. Fast 70 Jahre lang ist sie im bayerischen Rupertiwinkel die Erste, die gerufen wird, wenn jemand gestorben ist. In ihrer Heimat gilt sie als Legende. Die Bestsellerautorin Christiane Tramitz, deren Bruder von Rosa Wegscheider bestattet wurde, erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte dieser starken und eigenwilligen Frau. Sie entführt uns in die einfache, aber glückliche Welt einer dörflichen Gemeinschaft – zwischen Liebe und Tod, Tradition und Emanzipation.
ZURAUTORIN
Christiane Tramitz wuchs in Oberbayern in einem kleinen Dorf auf, zeitweise auch in den rauen Ötztaler Alpen. Zudem sammelte sie während ihrer Berliner Zeit ausreichend Großstadterfahrung. Ihre Leidenschaft gilt dem Reisen, den Menschen und, seit über 30 Jahren, dem Schreiben. Nachdem die promovierte Verhaltensforscherin zahlreiche Sachbücher über menschliches Verhalten verfasst hatte, wandte sie sich vermehrt dem Genre True Crime bzw. Tatsachenroman zu. Neben den Erfolgstiteln Irren ist männlich, Unter Glatzen und Das Dorf und der Tod verfasste sie auch den Spiegel-Bestseller Harte Tage, gute Jahre. Für ihre Veröffentlichung über Straßenkinder erhielt sie den Karl-Buchrucker-Förderpreis. Die Autorin hat zwei Kinder und lebt in Oberbayern.
CHRISTIANE TRAMITZ
Der
Geruch
von Erde
Das einfache reiche Leben
der Totengräberin von Waging
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 09/2022
Copyright © 2022 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Heike Fischer
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch,
unter Verwendung von Shutterstock.com/canadastock und © Privatarchiv
Fotos im Innenteil: © Privatarchiv und © Christiane Tramitz
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28823-5V001
www.Ludwig-Verlag.de
Wer bist du?«, fragte das Mädchen.
»Kennst mich nicht?«, antwortete der schwarze Mann mit der Kapuze und dem Umhang.
»Was machst du mit der Sense?«
»Ach, die, die brauche ich für meine Arbeit.«
Das Mädchen blinzelte, die Augen halb geschlossen. »Was arbeitest du denn?«
»Ich hole Menschen wie dich.«
»Wohin bringst du mich?«
»Das wirst du schon sehen.« Der Mann hob den Kopf, er hatte kein Gesicht, schwarze Höhlen statt Augen, Zähne in den blank liegenden Kieferknochen.
»Du gefällst mir nicht«, sagte das Mädchen, »und deswegen gehe ich auch nicht mit.«
»Du hast keine Wahl, Kind, du bist krank, du hast Fieber, und du bist allein.« Er drehte sich um und deutete mit der Sense auf das Feld, das hinter ihm lag. »Schau, da ist deine Familie beim Ernten. Deine Mutter, dein Vater, Geschwister, Onkel und Tanten sind weit weg. Und dich haben sie einfach hier auf die Erde gelegt und allein gelassen.«
»Sie kommen wieder«, antwortete das Kind.
»Hast nicht gehört, was deine Mutter gesagt hat?«
Das Mädchen schwieg.
»Wenn wir mit dem Mähen fertig sind, ist die eh tot. Genau das hat deine werte Frau Mama gesagt. Und deswegen bin ich hier, meine Kleine. Man braucht dich auf Erden nicht mehr. Man will, dass ich dich mitnehme.«
»Aber wer bist du?«, wiederholte das Mädchen seine Frage.
Der Mann lachte. »Der Tod bin ich, ganz einfach.«
»Der Tod?«
Der Mann stellte die Sense vor sich auf den Boden und stützte sich darauf. »Was ist jetzt? Mach die Augen zu und hör auf zu atmen, ich hab nicht ewig Zeit, du bist schließlich nicht die Einzige, die sterben muss.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Will nicht. Bin doch erst fünf Jahre alt. Da stirbt man nicht. Außerdem lass ich mir von einem fremden Mann, der so hässlich ist wie du, nichts sagen.«
Dann fielen dem Kind die Augen zu, der Atem ging flach, und durch die Nase strömte der Geruch von Erde.
* * *
Es ist das Jahr 2020.
Die Totengräberin zittert, es ist kühl und windig an diesem verhängnisvollen Nachmittag, an dem die Tragödie beginnt und alles bergab geht. Nebel liegt auf dem See, verdeckt die dunkle Farbe, die das Wasser im späten Herbst annimmt. Die Trauernden blicken bang in den grauen Himmel. Noch halten die tief hängenden Wolken den Regen zurück, es scheint trocken zu bleiben an diesem ansonsten unwirtlichen Tag.
Als der Sarg zum Grab getragen wird, raunt Wastl der Totengräberin zu: »Tante, ich hab’s doch immer gesagt, das ist ein Zweimeter.«
»Ah geh, Schmarrn«, zischt diese zurück, »ich werd doch wohl besser wissen, wie groß der Wimmer Hans war! Unter eins achtzig! Das passt schon.« Wastl schweigt, Widerworte sind sinnlos, Rosa Wegscheider hat stets recht. Die alte Frau steht stramm und beobachtet die Trauernden zufrieden, grüßt nickend nach links, nach rechts, sie kennt nahezu alle, die gekommen sind, einige von ihnen seit ihrer Geburt. Die Königin des Waginger Friedhofs hat ihre Hände in den Taschen des schwarzen Dienstmantels vergraben, unter dem sie, wie immer, ihre verwaschene, mehrfach geflickte, blaue Arbeitsschürze trägt, und lässt den Blick über die Trauernden streifen.»Was für eine überüberübergroße Anteilnahme beim Hans seinem Tod«, stellt sie fest.
»Ja, ja, überüberüber, oh mei, Tante, alles ist bei dir überüberüber. Und das wird eine überüber-Katastrophe mit dem Sarg, der ist nie und nimmer ein Einsachtziger. Der ist locker ein Zweimeter«, beharrt Wastl.
»Wer arbeitet denn seit Jahren hier? Du oder ich?«, entrüstet sich die Tante und rückt ihren schwarzen abgewetzten Hut zurecht, den sie seit ewigen Zeiten bei Beerdigungen und Einkäufen im Ort zu tragen pflegt. Wastl mustert seine schmale Tante um etwas mehr als eine Kopflänge von oben herab, während der Chor den Prozessionsgesang anstimmt: »In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres.«
Nur noch Haut und Knochen ist sie, und mit den Jahren geschrumpft. Mittlerweile reicht die alte Frau ihrem Neffen nur noch bis zur Schulter.
Vor einigen Monaten hatte die Totengräberin ihren neunzigsten Geburtstag gefeiert. Man bereitete ein kleines Fest für sie, das Wohnzimmer war geschmückt, man hatte schöne Musikplatten ausgesucht, fröhliche Schlager, so wie Rosa sie mochte. Man hätte sich all die Mühe sparen können. Von der Torte, die Rosas Tochter Weibi liebevoll gebacken und verziert hatte, probierte die alte Frau lediglich ein kleines Stückchen, legte die Gabel geringschätzig zur Seite und erhob sich. »Ich muss rüber ins Steghäusl, könnt wer gestorben sein«, erklärte sie, stand auf und ließ die Geburtstagsgäste allein zurück.
Nur keinen Anruf eines Hinterbliebenen verpassen, war und ist ihre Devise. Beim Tod immer zur Stelle sein, ansonsten könnte man im Ort tuscheln, die Wegscheiderin sei zu alt und ihrem Beruf nicht mehr gewachsen. Deswegen muss sie immer erreichbar sein, in der Nähe ihres Telefons warten, weil diese tragbaren Dinger, diese Handys, nichts anderes als überflüssiges neumodisches Zeug sind. Außerdem haben sie eine viel zu lange Nummer, die man sich beim besten Willen nicht merken kann. 370 nebst Vorwahl, 370, so kurz muss die Telefonnummer einer Totengräberin sein. »Niemand mehr hier in Waging hat noch eine dreistellige Nummer. Nur die Totengräberin«, erklärt sie jedem, dem sie diese Nummer ans Herz legt. Dabei ist sich die Wegscheiderin sicher: 370 ist mindestens genauso wichtig wie 110 oder 112.
»Wir beide arbeiten schon seit Jahren hier«, antwortet Wastl schließlich, »du und ich, wir bestatten seit so vielen Jahren zusammen. Vergessen, Tante? Knapp dreißig Jahre sind es jetzt statt der drei, wie es anfangs ausgemacht war, als du angeblich in Rente gehen wolltest.«
Die Wahrheit aber ist: Ans Aufhören denkt die Wegscheiderin mitnichten. Ihren Beruf als Totengräberin würde sie mit ins eigene Grab nehmen, sagen die Leute im Ort zu Wastl immer lachend, wenn sie ihm auf dem Friedhof begegnen.
Wastl ist jetzt knapp fünfzig Jahre alt, unverheiratet, kinderlos, ein eigenwilliger, wortkarger Mann mit Schnauzbart, einem großen Herzen und unbeirrbarer Gutmütigkeit. Die braucht man auch, um die Totengräberin über so lange Zeit hinweg zu begleiten, ohne restlos zu verzweifeln oder wahnsinnig zu werden. Wastl betreibt einen kleinen, weit abgelegenen Bauernhof, an dem die Straße, die durch Wald und Felder führt, endet. Der Bauer lebt dort allein mit seinen Kühen, die von Jahr zu Jahr mehr werden, weil er es nicht übers Herz bringt, die eine oder andere zum Schlachter zu bringen.
»Drei Jahrzehnte statt drei Jahre«, wiederholt er jetzt kopfschüttelnd, während der Pfarrer ein Gebet spricht.
»Pssst«, mahnt sie und legt den Finger auf den Mund. Tante und Neffe beobachten nun, wie die Träger die Gurte umlegen, um den Sarg ins Grab sinken zu lassen. »Schaut gut aus, dieses Mal, das wird eine gute Beerdigung, Wastl«, tuschelt die Tante. Die Totengräberin wirkt zufrieden, endlich mal wieder eine Beerdigung, bei der alles klappen würde.
In letzter Zeit war nämlich so manches schiefgegangen. Einem Träger riss der Gurt, der Sarg krachte auf den Boden. Ein anderes Mal verplapperte sich die Totengräberin bei ihren Beerdigungsansagen andauernd, vergaß Namen und verwechselte die Wirtschaften, in die es zum Leichenschmaus hätte gehen sollen. Lauter blöde Missgeschicke, die die alte Wegscheiderin, sobald sie zu Hause in der Küche saß, vor Scham und Wut weinen ließen. Die Wut bezog sich dann selbstverständlich auf andere, wie zum Beispiel auf Wastl, den Pfarrer, die Träger und viele andere.
»Wir übergeben den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder zum Leben erwecken«, spricht der Pfarrer. Rosa blickt ungeduldig auf die Uhr. »Heut ist er besonders langsam, unser neuer Herr Pfarrer«, meckert sie, »der alte war schneller.« Wastl stupst seine Tante seitlich an und flüstert ihr zu: »Kannst eh nix ändern. Und das ist gut so.«
Am Grab kommt Unruhe auf, die Trauernden drängen sich nach vorne, recken die Köpfe. Aufgeregtes Gemurmel ist zu hören. Der Geistliche schaut regungslos in das Erdloch, einer der Träger blickt Richtung Totengräberin, schüttelt den Kopf und macht ein Zeichen, dem zu entnehmen ist, dass der Sarg zu groß für das Grab ist. »Ich hab’s ja gewusst«, raunt Wastl der Tante zu, »dass das eine überübergroße Überraschung heut geben wird, Tante, jetzt steckt er schief drinnen im Grab, Kopf voran, der arme Wimmer Hans, das wird ihm nicht gefallen.« Die alte Frau starrt geradeaus, keine Regung in ihrem Gesicht. Nur auf ihrer Stirn bildet sich eine tiefe Zornesfalte.
Nachdem alles vorbei ist, die zornigen und enttäuschten Trauergäste verschwunden sind, Stille über dem Friedhof liegt, beginnt es leise zu regnen. Tropfen fallen auf den schiefen Sarg im zu kleinen Grab. Wastl und die Träger hocken derweil im Friedhofskammerl und trinken ein Bier. »Bloß nix sagen«, rät der Älteste von ihnen, »trinkt’s schnell aus, und dann schauen wir, dass wir uns schleichen von da.« Er grinst Wastl an. »Auwei, du Armer, musst noch graben, dir blüht sicher noch was.« Die Bestatterin, die im Nebenraum ihre Schuhe gegen Gummistiefel gewechselt hat, kommt in den Raum. »Komm, Wastl, Grab fertig machen, bevor ’s noch mehr regnet.«
Dann stehen sie da vor dem Loch, Rosa und Wastl, Tante und Neffe, aneinandergeschweißt durch den Tod und die Aufgaben, die dieser den Menschen stellt. Der Regen hat zugelegt, das Wasser sickert in die schwarze Erde, tropft auf Blumen und Kränze und den stecken gebliebenen Sarg. Die Totengräberin schüttelt den Kopf und wirft wütend die Schaufel auf die Erde. »Wastl, ich warn dich! Sag bloß nicht zu mir: ›Ich hab’s gewusst, oder hab ich doch gesagt oder irgendeinen anderen Schmarrn.‹«
»Ich hab’s aber gesagt, Tante Rosa, hab immer gesagt, der Sarg braucht zwei Meter, nicht ein einsachtziger Grab. Aber du hast darauf bestanden!«
»Aber ich hab dir auch geraten, dass du vorher nochmals nachmessen musst«, gibt die Totengräberin pampig zurück, »und was hast nicht gemacht, obwohl ich es dir aufgetragen hab? Was?« Sie sieht ihn forschend an. »Ich geb dir gleich die Antwort, nix hast gemacht, nix gemessen!«
»Es ist wie immer«, erwidert der genervte Neffe, »du bist wieder fein raus, weil immer die anderen einen Fehler machen, nur du nie.«
Die alte Frau nickt zufrieden. »Schön, dass du deine Fehler wenigstens einsiehst.« Sie zeigt auf die Schaufel. »Jetzt richt das Grab gscheit her«, befiehlt sie.
Während sie mit energischen Schritten davonstapft, beginnt es über Waging zu stürmen. Wastl steht knöcheltief im Matsch, schaufelt die schwere, nasse Erde aus der Grube, damit der Sarg in die gewünschte Waagrechte gelangen kann.
Nach einer Weile taucht die Tante wieder auf. »Was ist, Wastl, haben wir’s bald?«, fragt sie ungeduldig. »Wird bald dämmrig.« Wasser tropft von ihrem Hut.
»Was heißt hier wir?«, erwidert Wastl mürrisch. »Sowieso wir«, fährt es aus Rosa heraus, »weil ich ja alles machen muss, mein ganzes Leben schon, alles allein, ohne Hilfe, weißt eh, Wastl, mir hat niemand geholfen.« Der Neffe verdreht die Augen, wieder die alte Leier, er kennt sie zur Genüge. Auch wenn er weiß, dass es vollkommen zwecklos ist, ihr eine Antwort zu geben, wie etwa die: »Ach, niemand hilft dir, Tante? Und wer gräbt hier im Regen gerade ein Grab, weil du die falschen Maße angegeben hast?« Trotzdem erwidert er: »Gräbst du jetzt oder ich?«
Rosa kickt mit dem Fuß etwas Erde nach unten. »Stell dich nicht so an, Wastl, das bisschen Graben. Ohne mich könntest dich und deinen Hof nicht über Wasser halten, so viel Geld, wie du bei mir verdienst.« Wastl schaufelt stumm weiter und hält kurz inne, als die Tante hinzufügt: »Ja, ja, viel Geld und das bei so wenig Arbeit. Wastl, ihr könnt ja alle nicht arbeiten, wisst ja nicht, wie das geht, hättest mich mal sehen sollen, als ich jünger war.«
»Ja, ja, Tante«, fällt Wastl ihr ins Wort. »Dein Leben war so hart, ich weiß, das hätt keiner geschafft außer dir.«
»Genauso ist es«, sagt die alte Frau zufrieden, »endlich hast es kapiert, mein kleiner Wastl, und jetzt beeil dich, ich werde nass bei dem Sauwetter.« Mit dem Zeigefinger deutet sie auf den Sarg. »Der Wimmer Hans hat auch endlich seine Ruh verdient. War ein rechtschaffener Mann. Und schade um den Sarg, wenn er so nass wird, obwohl das ja nur der sandfarbene Kiefersarg für 975 Euro ist, die Tochter hätte auch die italienische Nusstruhe für 2 500 Euro nehmen können. Was meinst, Wastl, die sind doch so stinkreich, wär für den Huber ein gutes Geschäft gewesen, das hätt ich ihm gegönnt.«
»Besser wäre eine Urne gewesen«, merkt Wastl an. »Dann hätte es weniger zu graben gegeben. Außerdem wär der Wimmer Hans dann jetzt schon friedlich unter der Erde, und ich würd hier nicht wie ein Depp schaufeln.«
Dem Neffen wäre es recht gewesen, wenn die Tante endlich gegangen wäre, denn sie ist anstrengender als der schlimmste Regen, der über Waging niedergehen kann. Er blickt nach oben ins Grau des Himmels. Der Kopf der Totengräberin ist verschwunden. Erstaunliche Stille, ungewohnt auf dem Friedhof, denn wenn die alte Wegscheiderin sich dort befindet, gibt es keine Ruhe, eine wandernde Kommandozentrale ist sie, wenn sie über ihren Gottesacker marschiert. »Mach dies, mach das, hier musst ausgrasen, beim Brunnen ist der Abfluss verstopft, die Gießkannen liegen nicht richtig …« Wastl steigt aus dem Erdloch. Dann sieht er die alte Frau, keine fünf Meter entfernt, am gemauerten Familiengrab stehen. Sie hat den Kopf gesenkt und wischt sich eine Träne von den runzligen Wangen. Mühsam kniet sie nieder, um etwas Unkraut zu rupfen. »Gibt’s doch nicht, direkt vorm Anderl seinem Grab«, murmelt die Alte. »Das muss ich dem Weibi sagen, dass sie da besser aufpasst. So weit kommt’s noch, dass auch hier Unordnung herrscht, das darf nicht sein, Wastl, was sagst du?« Sie stopft die Grashalme in die Tasche ihres Mantels, stützt sich am Grab ab und zieht sich in die Höhe. Wastl tritt hinter sie und ergreift ihren Arm. »Tante, ich bring dich ins Kammerl, da wartest auf mich, bin gleich fertig.« Unwirsch schüttelt sie ihn ab.
»Komm, du frierst, holst dir hier noch den Tod. Und eine Totengräberin, die auf dem Friedhof stirbt, das hat’s sicher noch nie gegeben«, insistiert Wastl. Die alte Wegscheiderin hebt ihren Kopf: »So was wie mich hat’s noch nie gegeben, glaub mir’s.«
Er nickt. »Hast recht, liebe Tante.« Sie stemmt die Arme in die schmalen Hüften. »Und niemand anders kennt den Boandlkramer so gut wie ich. Weil hier …«, sie lässt ihren Finger über den Friedhof kreisen, »weil hier sein und mein Zuhause ist.« Dann stapft sie durch den Regen fort, Richtung Kammerl. Wastl gräbt weiter, eine Schaufel Erde nach der anderen. Wie ein Roboter funktioniert er, er weiß nicht, das wievielte Grab er gerade schaufelt. Dieses hier hat jedoch die Besonderheit, dass der Sarg schon neben ihm liegt, beziehungsweise steckt, während er gräbt, Kopf voran nach unten, der arme Wimmer Hans. Der Sarg rutscht ein paar Zentimeter in die Waagrechte. Bald hat er es geschafft. Oben ist es verdächtig ruhig geworden, die Totengräberin hat seit geraumer Zeit nichts mehr von sich hören lassen. Wastl lugt aus der Grube hervor. Niemand da. Nur der Regen hat an Erbarmungslosigkeit zugelegt. Auf dem Rasen bilden sich Pfützen, Rinnsale laufen den Sarg hinab und tropfen in das dunkle Wasser, in dem Wastl steht. Der Himmel über Waging wird schwarz, die Nacht bricht herein, keine gute Zeit für die Totengräberin, weiß Wastl, denn nur eines fürchtet die alte Wegscheiderin mehr als den Friedhof zu nächtlichen Stunden: Es ist der Tod selbst.
* * *
Erzähl mir vom Tod.«
»Schwarz ist der Boandlkramer und dürr, dürrer noch als Onkel Hans. Er hat eine Sense und einen schwarzen Mantel. Er besteht aus Knochen, die bleich sind und im Wind klappern. Auf seinem Totenschädel trägt er einen großen Hut. Der Tod schleicht überall herum, sieht einen jeden und holt sich, wen er will. Und wann er mag. Glaub mir, ein heimtückischer Gauner ist er, wenn er sich verkleidet und keine Sense in den Händen hält. Bei der Oma, da kam der Boandlkramer als Baum daher, als großer, starker Baum, der sie erschlug. Genau hier geschah es, wo wir gerade sind.«
Das war im Jahr 1920 gewesen, am 29. Dezember im tiefen Wald bei Weitmoos. Die Zözenberger Bäuerin war gerade einmal dreiundvierzig Jahre alt, als sie sterben musste. Sie hatte vier Kindern das Leben geschenkt. Hans, ihr jüngstes, war sieben Wochen alt und lag unweit von diesem Unglücksort in einem kleinen Körbchen, als seine Mutter unter dem schweren Fichtenstamm begraben wurde, den die Männer soeben gefällt hatten. Später errichtete man ihr an dieser Stelle zur ewigen Erinnerung ein kleines Denkmal.
»Jetzt musst fleißig beten, Nanni, weil der Boandlkramer hier sein könnt«, flüsterte Rosa ihrer Schwester zu. »Da, wo die Oma gestorben ist, muss man immer beten, das musst dir dein Leben lang merken.« Die beiden kleinen Mädchen blickten zum Marterl hoch. Jesus hing dort am hölzernen Kreuz, sein Haupt zur Seite geneigt. Neben ihm auf dem Querbalken hatte ein Vogel sein Nest gebaut, Moosfetzen und Zweiglein ragten über den rechten Arm des Heilands. Darunter stand geschrieben:
Für mich und für die Meinen,
Die alle wehmutsvoll um sie,
Mit mir, dem Vater, weinen.
Wie seufzt mein gramerfülltes Herz!
Wie tief durchdringt mich der Schmerz
Bei meiner Kinder Tränen.
»Ich habe heut früh schon gebetet.« Nanni hatte sich einen Zipfel ihrer Schürze in den Mund gestopft und kaute darauf herum. Rosa klopfte ihrer Schwester auf die Hand. »Lass des, kriegst sonst Ärger daheim, wennst wieder so eingesaut bist. Außerdem sieht der Boandlkramer alles.«
»Woher weißt du, dass der Boandlkramer hier sein könnt?«, fragte Nanni bang.
»Weil ich ihn kenn, ich hab ihn schon mal gesehen. Ich kenn ihn, den Schlingel, der treibt sich gern in unserer Gegend rum.« »Ah«, antwortete Nanni.
»Bei der Oma zum Beispiel.« Rosa zeigte auf das Marterl. »Als er sie geholt hat, hab ich ihn gesehen.« Sie sah Nannis erstauntes Gesicht und setzte hinzu: »Im Traum natürlich hab ich ihn gesehen, weil da waren wir ja noch nicht auf der Welt, du Depperl, ist ja schon zwanzig Jahre her.«
Die kleinen Mädchen standen mitten im Wald, neben ihnen lag ein Korb mit Pilzen. Es sollte Schwammerlsuppe am Abend geben, aber die Kinder hatten für die vielen Menschen, die auf dem Zözenhof lebten, zu wenig gefunden.
Da waren nämlich der Großvater, der zu früh Witwer geworden war, und seine vier Halbwaisen, unter ihnen die Mutter von Rosa und Nanni. Weil Rosas Mutter das älteste Kind der verstorbenen Zözenbäuerin war und bereits verheiratet, trug sie nun seit dem Unglück im Wald die Verantwortung über den großen Haushalt und die Erziehung der Kinder: sowohl der eigenen als auch die ihrer Nichten und Neffen.
Sie alle lebten auf dem Zözenberg, einer Anhöhe nahe des Waginger Sees. Der Familie gehörte dort ein altes Gehöft, wie sie in dieser Gegend häufig zu finden waren. An dem Hof zerrte die Zeit. Wind, Schnee, Hagel, die Launen der vielen Jahreszeiten, die an dem Gebäude vorbeigezogen waren, hatten allesamt ihre Spuren an Dach, Holz und Steinen hinterlassen. Die Bewohner hatten weder Kraft, Zeit noch Geld, die Schäden zu beseitigen und alles in Ordnung zu halten. Um den Hof herum gab es tagein, tagaus ein lautes, quirliges Durcheinander von Menschen, schnatternden Gänsen, Enten, einem großen Wachhund, einigen Schweinen, wenigen Kühen, zwei Ochsen, Hasen und ein paar Katzen. Und wenn Rosas Vater mal wieder Vieh zum Handeln eingekauft hatte, muhten und blökten unzählig viele Kälber und Schafe in den Pferchen. Einen großen Obstanger gab es auch und rundherum Wiesen, hinter denen der Wald begann. Auf dem Zözenberg war das Leben hart und karg, voll beschwerlicher Arbeit, Zorn, Ungerechtigkeit, bisweilen auch Gewalt. Vor allem die Frauen und Mädchen hatten darunter zu leiden, sie waren die Schwachen. Am schlimmsten meinte das Schicksal es mit den Jüngsten von ihnen: Rosa und Nanni, die eine acht Jahre alt, die andere sechs.
»Wir haben zu wenig Schwammerl gefunden«, sagte Rosa zur Schwester, nachdem sie fertig gebetet hatten. »Nanni, die meisten habe übrigens ich gefunden, du hättest die Augen besser aufmachen können.« Nanni fing an zu weinen. »Wenn’s aber doch wahr ist«, setzte Rosa hinzu.
»Hätte der Boandlkramer damals die Oma nicht geholt, wär alles besser aufm Hof, sagt die Mutter immer«, erklärte Rosa. Sie faltete die Hände. »Los jetzt, beten, Nanni, beten wir für die Oma und für die Mutter und den Vater, dass er gesund heimkommt und viele Viecher dabeihat.« Nanni strich sich die Schürze glatt und faltete ebenfalls die Hände. »Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade«, murmelte sie. Und Rosa beendete: »Der Herr ist mit dir.«
Nanni hob die gefalteten Hände in die Höhe und rief laut: »Und Mutter Gottes, sei so lieb und mach, dass wir jetzt ganz viele Schwammerl finden, am besten Steinpilze, die mag der Opa am liebsten, Beeren wären auch gut, die schmecken mir so gut!«
»Meinst, die Mutter Gottes hat nichts Wichtigeres zu tun, als dir die Schwammerl zu zeigen?« Rosa schüttelte den Kopf. »Naa, naa, Nannerl.«
Nach dem Gebet packten sie den Korb und gingen tiefer hinein in den dichten Wald. Ihre Suche führte sie durch hohe Farne, über moosbedeckte Äste und Baumstämme, die in der Erde verfaulten. Sie machten halt, um ein paar Heidelbeeren zu pflücken und sie sich in den Mund zu stopfen, zogen weiter, fanden drei Pfifferlinge, gingen tiefer in den Wald, ein paar Maronen landeten im Körbchen. Sie kämpften sich durch hohes Pfeifengras und befanden sich im Moor, just an der Stelle, an der der alte Ferdl Neunteufel und seine Frau Maria gerade Torf stachen und die Heerschar ihrer vielen Kinder um sie herumwuselte und ihnen dabei half. Nanni blieb stehen. »Will nicht weiter, fürcht mich vor den Neunteufeln«, sagte sie. Rosa verschränkte die Arme vor der Brust. »Also, Nannerl, ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass die nicht Neunteufel heißen, weil sie neun Teufel sind. Hier wohnen auch keine neun Teufel. Teufel wohnen in der Hölle und nicht in Waging, schon gar nicht im Moor, weil Teufel mögen Feuer und keine Erde. Und außerdem gibt es nur einen einzigen Teufel. Gibt ja auch nicht neun Boandlkramers auf der Welt, stimmt’s?« Sie winkte dem Torfstecher zu. »So, so, gehts in die Schwammerl?«, rief der und hieb die Schaufel in den Boden. Rosa nickte und zog Nanni am Ärmel. »Komm, wir drehen um, wird sonst zu spät.« Sie kamen an der Kapelle Maria Tann vorbei, bekreuzigten sich kurz und gingen weiter, verließen den Wald und gelangten schließlich auf den Forstweg, der sie am Ödhof vorbeiführte. Dort lebten Anderl, sein Bruder und die Eltern, fleißige Bauersleute, die ähnlich hart zu arbeiten hatten wie die Zözenbauern. Anderl schob gerade einen Schubkarren auf den Misthaufen, balancierte ihn geschickt auf dem schmalen Brett nach oben. Dann kippte er ihn aus. »Sieh an«, lachte er, »die Rosa und das Nannerl, wollt ihr einen Schluck Milch?« Die Mädchen nickten, und Anderl führte sie zum Stall, wo er mit einer Kelle frische Milch aus einem Eimer schöpfte. »Ihr könnt es brauchen, so dürr wie ihr seid.«
Rosa mochte Anderl, er war schon erwachsen, siebzehn Jahre älter als sie. Immer freundlich und lustig war er. In den Sommermonaten arbeiteten sie oft Feld an Feld zusammen, denn die beiden Höfe teilten sich den großen Wiesengrund am Waldesrand. Anderl konnte durch Löwenzahnstängel pfeifen wie ein Vogel aus dem Wald. »Wir müssen uns beeilen, der Opa wartet auf die Schwammerl«, sagte Rosa, nachdem sie die Milch getrunken hatten. Anderl zeigte auf den Korb. »Ist nicht gerade viel, was ihr gefunden habt, wartet einen Moment, bin gleich wieder da.« Er verschwand und kehrte mit einem großen Teller voller Maronen und Pfifferlingen zurück. »Hab ich heute in der Früh gefunden, schenk ich euch.« Freudig und voller Dankbarkeit zogen die Mädchen weiter. »Der Anderl, der ist der beste Mann, den ich kenn, einen netteren und lieberen gibt es nicht«, sagte Rosa zur Schwester.
Wortlos gingen sie weiter, sie fürchteten sich vor dem, was sie zu Hause erwartete.
»Du, Rosa, hast ihn wirklich gesehen, den Boandlkramer?«, fragte Nanni schließlich.
»Hab ich.«
»Hast Angst vor ihm gehabt?«
»Was denkst denn du?«
»Und warum hat er dich nicht mitgenommen?«
»Ich bin stark, dem Boandlkramer, dem hab ich’s gezeigt, das kannst mir glauben. Stark musst sein im Leben, Nanni, sonst kommt der Tod.«
Die kleine Schwester war nicht stark, sie war zu dünn, aß schlecht, nichts wollte ihr richtig schmecken, weil der Magen schmerzte. Die dunklen Augen lagen tief in ihrem schmalen, zarten Gesicht. Sie kränkelte oft, lag mit Fieber im Bett, die Nase voller Rotz, die Augen verheult. Rosa fühlte Mitleid mit ihr, bisweilen auch Wut, wenn sie Nannis Aufgaben im Haushalt übernehmen musste. Die kleine Schwester nahm jetzt Rosas Hand. »Ich fürcht mich vorm Boandlkramer«, sagte sie, »und ich fürcht mich vor daheim, ich fürcht mich mein ganzes Leben schon. »Ich pass auf dich auf, immer pass ich auf dich auf, mein kleines Nannerl«, antwortete Rosa ruhig. »Mein ganzes Leben lang.«
Die beiden Mädchen bogen um die Kurve, von Weitem sahen sie den heimatlichen Hof mit dem gewohnten Treiben, dem Hin und Her von Menschen und Tieren. Mittendrin in dem Gewusel tapste der Jüngste umher, der kleine Konrad. Als er seine Schwestern sah, winkte er ihnen zu. Rosa hob den Arm und lächelte.
»Unser kleiner Konni, ich hab ihn schon gern, der weiß noch nicht, wie’s ist, wenn man älter wird.«
»Aber wir sind doch auch noch nicht alt«, erwiderte Nanni.
»Du nicht mit deinen sechs Jahren, aber ich bin ja schon acht, und unser kleiner Konni ist erst …«
»Drei«, ergänzte Nanni.
»Genau, und mit drei muss man noch nicht arbeiten, so wie wir.« Rosa begann, die Pilze im Korb zu zählen. »Immer noch zu wenig. Das wird was geben, oh mei«, flüsterte sie und nahm ihre Schwester an der Hand. »Wenigstens haben wir beim lieben Anderl eine Milch gekriegt«, flüsterte Nanni zurück.
Auch dieser Tag neigte sich dem Ende zu, irgendwie ging alles vorbei, wovor man Angst hatte.
Jeder auf dem Zözenberg lag in seinem Bett, nur der Vater der Mädchen war unterwegs. Und Rosa wusste, es würde deswegen eine kurze Nacht für sie werden.
Rosas Vater war Viehhändler. Einmal in der Woche packte er seinen Rucksack, nahm die Laterne in die Hand und machte sich auf den langen Weg vom Zözenberg über das Zollhaus Freilassing nach Salzburg. Dort fand wöchentlich der große Nutzviehmarkt statt. Der Vater wählte dort die schönsten Kälber oder Schafe aus, was auch immer die Bauern im Waginger Umland kaufen wollten. Er wartete, bis es draußen dunkel wurde, Mond und Sterne am Himmel standen, und trieb das Vieh im Schutz der Dunkelheit auf kleinen Wegen von Österreich nach Deutschland. Nachts gab es keine Kontrollen, nachts war niemand zugegen, der Steuer hätte eintreiben können.
In diesen Nächten, lange noch bevor die Sonne aufging, trat Rosas Mutter ans Bett ihrer ältesten Tochter. Sie schüttelte sie an der Schulter: »Kind, aufstehen, zum Vater gehen.« Um vier Uhr morgens verließen die beiden den Zözenhof. Auf schmalen Pfaden, die durch Wiesen und Wälder führten, gingen sie dem Vater entgegen. Die Mutter trug einen Rucksack mit Brotzeit und Getränken auf dem Rücken, die kleine Rosa hielt die Laterne in der Hand. Stunde um Stunde schlugen sie sich durch die finstere Nacht, bis der Morgen zu grauen begann. Jeden Stein, jeden Strauch, jede Wurzel kannte Rosa inzwischen, so oft war sie den Weg schon gegangen. Das Licht der Laterne warf Schattenbilder, die Geräusche der Nacht, der Ruf des Käuzchens, das Bellen der Füchse und das Rascheln im Gehölz, wenn ein Tier erwacht war und die Flucht ergriff; es waren Nächte, in denen das Mädchen bisweilen arge Furcht verspürte. Sie suchte die schützende Hand der Mutter, doch die sagte: »Bist alt genug zum Alleingehen, Kind.« Und dann vernahm man in der Ferne, irgendwo im Wald das Huschen von Leibern, ein Trampeln, Blöken, ab und zu ein Muhen. Der Vater war nicht mehr weit, bald könnte man umdrehen, freute sich Rosa, der die nackten Füße schmerzten, denn sie stieß sich an Wurzeln und Steinen.
Eine kurze Rast gab es, wenn die Eltern zusammentrafen, schweigend nebeneinander irgendwo hockten, schweigend Kaffee tranken, schweigend ihr Kind betrachteten, dann in den schwarzen Wald blickten, in dem der Pfad verschwand.
Und wenn sie sich dann gemeinsam auf den Rückweg zum Zözenberg machten, hatte Rosa voranzugehen. Mit ihrer Laterne beleuchtete sie für alle den Weg, während Vater und Mutter das Vieh zusammenhielten und weitertrieben. Dabei kam es auch vor, dass der Vater ein Kalb auf den Schultern trug, das auf dem Weg geboren worden war. Manchmal geschah es auch, dass ein Tier im Wald verloren ging oder der Boandlkramer seine Beute holen wollte.
»Nanni, schläfst schon?«, fragte Rosa ins Dunkel der Nacht. »Kann nicht schlafen, ich fürcht mich«, antwortete die Schwester.
»Dann erzähl ich dir eine Geschichte«, schlug Rosa vor. »Ich erzähl dir mal, wie der Boandlkramer zwei Kälber holen wollte, als ich mit dem Vater die Viecher heimgetrieben habe.« Nanni kletterte aus ihrem Bett und schlüpfte zur Schwester unter die Decke. »Erzähl«, sagte sie und nahm einen Bettzipfel in den Mund.
»Ich habe den Boandlkramer in der Nacht gesehen, als der Vater sechs Kühe und zwei Kälber übergeführt hat. Schrecklich finster war’s, und die Laterne hat nimmer geleuchtet und geregnet hat’s die ganze Zeit, der Wind hat gepfiffen, dass es in den Ohren wehgetan hat. Huhuuuuuuuuu.«
»Und dann?«, bohrte Nanni ängstlich nach.
»Dann hat der Boandlkramer die Kälber zu sich gerufen ins schwarze tiefe Wasser. Er hat sie in den See gelockt, weißt, in den, der hinterm Wald liegt, da wo das Schilf so hoch wächst. In dem ist er gehockt, der Boandlkramer …« Nanni krallte sich jetzt mit beiden Händen an Rosas Arm fest.
»Soll ich aufhören?«, fragte Rosa.
»Erzähl weiter.«
»Also«, fuhr Rosa fort, »die Kälber sind in den See gelaufen, immer tiefer rein. Und der Vater hat geschrien: ›Die ertrinken uns, Rosa, treib’s raus aus dem Wasser.‹ Dann hat er mir zwei Säcke gegeben und mir befohlen, ich soll in das tiefe Wasser gehen, die Säcke über die Köpfe von den Kälbern stülpen und sie dann raus ans Ufer treiben.« Rosa atmete geräuschvoll aus. »Puh, Nanni, ich war ja noch kleiner, noch jünger als du jetzt bist, ich hab mich so gefürchtet. Das Wasser wurde immer tiefer, je weiter ich reingegangen bin, es stand mir dann bis zum Hals, und ich hab Angst gehabt, dass ich mit den Viechern ertrink, von denen hat nur noch der Kopf aus dem Wasser geschaut. Und soll ich dir was sagen, Nanni? Da hab ich den Boandlkramer gesehen. Im Schilf hat er sich versteckt, gelacht hat er und darauf gewartet, dass wir ersaufen und er uns schnappen kann.« Rosa nahm die Schwester in den Arm. »Genauso war das, aber ich hab’s geschafft, die Kälbchen hab ich gerettet. Und mich auch!« Sie puffte Nanni seitlich in die Rippen. »Jetzt ist aber Zeit, dass du wieder in dein Bett gehst, schlafen müssen wir endlich, weil gleich kommt die Mutter und nimmt mich mit auf den langen Weg in die finstere Nacht, dem Vater und dem Vieh entgegen.«
* * *
An finstere Nächte konnte sich Rosa Wegscheider nie gewöhnen, nicht einmal nach all den Jahren, in denen sie mit dem Tod und seinen Folgen ein Geschäft führte. Deswegen war sie auch nie zugegen, wenn es auf dem Friedhof zu dämmern begann, sondern verzog sich rechtzeitig in ihr Haus.
Tagsüber aber war sie auf ihrem Gottesacker unermüdlich zugange, wie eh und je, obwohl sie mittlerweile schon siebenundsiebzig Jahre alt war.
Die Waginger Gemeinde hatte sie nämlich amtlich damit beauftragt, das zu tun, was sie ohnehin schon seit Jahren aus eigenem Antrieb heraus getan hatte: den Friedhof in Ordnung zu halten. Meistens hatten ihr dabei Nanni oder irgendwelche Waginger geholfen, die Rosa dann großzügig mit dem Geld bezahlte, das sie mit der Totengräberei und dem Ferkelfahren verdiente. Jetzt aber bekam sie endlich ihre ersten echten, offiziellen Mitarbeiter. Der Grund: Man hatte in Deutschland den Ein-Euro-Job eingeführt. Arbeitskräfte für einen Euro, das gefiel der Totengräberin, die diese Leute dann als ihre persönlichen »Angestellten« bezeichnete.
Man sah die Wegscheiderin dann täglich auf dem Friedhof zwischen den Gräbern mit hocherhobenem Kopf herumstolzieren, ihr folgten auf dem Fuß diverse und häufig wechselnde Ein-Euro-Jobber.
An diesem Tag waren es drei Neuankömmlinge, junge Kerle namens Laszlo, Timo und Sabeer, die schlurfend und sichtlich lustlos hinter ihr herstapften. Herrisch fuchtelte die Wegscheiderin mit dem Finger herum, zeigte mal nach links, mal nach rechts. »Eine Sauerei ist das, das muss alles weg, das Unkraut.« Die Totengräberin hielt an der Kapelle an, wo Wastl gerade das Werkzeug für eine Grabaushebung herausholte, und wandte sich an ihre drei »Angestellten«. »Also, dann fangen wir mal an.« Wie immer trug sie ihren geblümten Arbeitskittel, ihre Füße steckten, wie nahezu jeden Tag, wenn sie auf ihrem Gottesacker war, in Gummistiefeln. »Ich bin die Rosa Wegscheider, ab heute eure Chefin«, sagte sie, »und ihr seid jetzt meine Angestellten. Verstanden?« Die drei nickten gelangweilt. »Ihr seid’s ja Männer, hab bisher keine guten Erfahrungen gemacht mit Männern, die meisten taugen nichts, können nicht arbeiten. So wie wir Frauen.« Sie zeigte auf Timos weiße Adidas-Turnschuhe. »Was willst denn mit den Dingern? Die wirst dir hier ganz schön dreckig machen, aber selbst schuld, wenn man zur Arbeit so was anzieht.« Timo zuckte mit den Schultern. Rosa blickte zu Wastl, der grinste. »Das kann ja was werden, Wastl, so wie die dreinschauen.« – »Ihr seid’s jetzt in meinem Reich, auf meinem Gottesacker«, setzte sie die Einweisung fort.
»Gottesacker, was ist?«, fragte Sabeer verständnislos.
Rosa schüttelte den Kopf. »Kennt nicht mal einen Gottesacker.«
Wastl übersetzte: »Man kann auch Friedhof dazu sagen.«
»Von wo seid’s ihr überhaupt her?«, wollte Rosa jetzt wissen. »Ungarn«, antwortete Laszlo. Sabeer kam aus Marokko und Timo aus Berlin.
»Berlin, ah ja«, bekundete Rosa, »das kenn ich in- und auswendig, jeden einzelnen Fleck.«
»Geh, Tante, was erzählst denn schon wieder«, schüttelte Wastl den Kopf.
»Freilich, wir waren doch oft da mit den Leichen, wenn wir sie raufgefahren haben, die Berliner, weil’s bei uns im See ersoffen sind, kam nämlich öfters vor, gell, Wastl, ein ersoffener Berliner.«
Wastl legte Spaten und Schaufel in den Schubkarren. »Wie könnt ich diese Fahrten vergessen, Tante?«
Waging–Berlin, Berlin–Waging: 1 600 Kilometer mit dem Leichenwagen in einem Rutsch. Man könnte doch mal zum Brandenburger Tor fahren oder zum Reichstag, wenn man schon mal in der Hauptstadt sei, hatte Wastl wiederholt vorgeschlagen. Wieso unnötig in einer Stadt herumfahren, die man ohnehin aus dem Fernsehen kannte, war Rosa Wegscheiders Haltung zu überflüssigen Rumkurvereien in der ohnehin zu großen und hektischen Stadt gewesen.
»In Ungarn waren wir auch, gell, Wastl?«, sagte Rosa jetzt.