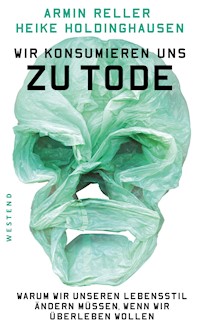12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Heilung von der Ölsucht Öl wird teuer und knapp, das steht fest. Doch ist damit das Ende des Ölzeitalters bereits eingeläutet? Und wie kann der Übergang in eine postfossile Welt gelingen? Armin Reller und Heike Holdinghausen zeigen, welche Chancen wir nutzen sollten, damit nach dem Öl die Zukunft beginnen kann. Erneuerbare Energien aus Wind und Sonne, geschickt an regionale Bedürfnisse angepasst; recycelbare Kunststoffprodukte, die lange genutzt werden; Verfahren, die Kohlenstoff aus Kohlendioxid als Rohstoffbasis nutzen. Welche Wege sollten wir weitergehen? Die Autoren klären auf, machen aber auch klar: Technik allein ist niemals nachhaltig, immer kommt es darauf an, wie sie genutzt wird. Unsere Verantwortung für die Erde verlangt von uns, überlegt und bewusst mit den Ressourcen umzugehen. Die Umgestaltung unserer Wirtschaft wird nur gelingen, wenn wir Bürger an Infrastruktur- oder Industrieprojekten beteiligt werden. Bildung und Demokratie sind daher vielleicht die wichtigsten Ressourcen der Rohstoffwende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
WESTEND
Ebook Edition
Armin Reller/Heike Holdinghausen
DER GESCHENKTEPLANET
Nach dem Öl beginnt die Zukunft
WESTEND
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-548-7© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2014Satz: Publikations Atelier, DreieichDruck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, LeckPrinted in Germany
Inhalt
Vorwort
1 Ein reich beschenkter Planet
2 Öl – »Dallas« kommt nicht wieder
3 Raps – eine Pflanzenkarriere im Ölzeitalter
4 Lein – den Faden wieder aufnehmen
5 Weizen – von Kern und Korn
6 Holz – ein kunstvoller Stoff
7 Kohlendioxid spricht für sich
8 Algen – an der Quelle zur Energie
9 Bakterien – die Zelle lebt
10 Eisen – alles auf Anfang
11 Gallium – der Lichtbringer der Zukunft
12 Abfall – aus Müll werden schillernde Rohstoffe
13 Ressourcen für die Rohstoffwende
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Geschenke haben es in sich: Sie bereiten Freude, aber man muss sie annehmen, so wie sie sind. So geht es auch dem Menschen mit dem geschenkten Planeten Erde. Sein Klima ermöglicht Leben, die Sonne liefert Energie und der Boden das Substrat für die Nahrungsmittelproduktion. Wir leben von der Photosynthese und sind Teil der großräumigen, vielmals erdumspannenden Stoffkreisläufe, die regenerieren, was das irdische Leben an Ressourcen erfordert. Ohne unser Dazutun haben sich vor unserem Auftreten auf der Erdenbühne riesige Vorräte fossiler Kohlenstoffverbindungen, Produkte einer überschwänglichen Photosyntheseaktivität, als Erdgas, Erdöl und Kohle angehäuft. Der Boden, die Geosphäre, hält weitere wertvolle und nützliche Geschenke bereit – mineralische Materialien und Metallerze. Es war eine lange, lehr- und entbehrungsreiche Zivilisations- und Kulturgeschichte nötig, mit Katastrophen und Blütezeiten, bis der Mensch die Fülle der planetarischen Geschenke erkannte. Das war möglich nicht zuletzt dank der globalisierten, hoch dynamischen Geld- und Warenwirtschaft.
Aber, wie gesagt, Geschenke machen nur dann Freude, wenn man sie akzeptiert, wie sie sind, und nicht, wie man sie sich erwünscht: Das Kinderlied De Hansdampf im Schnäggeloch sowie das Märchen Der Fischer und seine Frau berichten das schon lange. Bisher sind wir Menschen mit den geschenkten Ressourcen aus Biosphäre und Geosphäre weder sparsam noch weitsichtig oder gerecht umgegangen. Immerhin haben wir mit ihnen eine Technosphäre aufgebaut, die einem kleinen Teil der Erdbevölkerung Annehmlichkeiten wie Mobilität, Kommunikationsmittel, Gesundheitssysteme und Luxusprodukte beschert. Aber wir haben es verpasst, mit den Geschenken haushälterisch umzugehen – doch für einen haushälterischen Umgang sind sie optimiert. Wir verschwenden den Kredit der fossilen Kohlenstofflager und belasten damit die lebensnotwendigen Stoff- und Energiekreisläufe, wir verteilen unwiederbringlich Unmengen nützlicher und oft seltener Metalle auf dem Erdball. Wir beeinträchtigen die Biodiversität und lassen gleichzeitig durch unsere enormen Produktionsaktivitäten die Diversität der Materialien explodieren.
Mit diesem Buch wollen wir aber kein Klagelied auf die aus der Balance geratene Erde anheben. Vielmehr möchten wir versuchen, die Geschenke des Planeten in ihrer raum-zeitlichen Nutzbarkeit besser kennenzulernen, um sie gegebenenfalls genießen zu können. Wir wollen von ihrem Werden und Gehen erzählen, indem wir sie in Stoffgeschichten gießen und ihre Bedeutung für unsere Gegenwart sowie für die nachfolgenden Generationen kritisch bewerten.
Ein Geschenk wollen wir nicht unerwähnt lassen, sondern uns herzlich dafür bedanken: die Geduld, Gründlichkeit und Energie, mit denen Rüdiger Grünhagen vom Westend Verlag die Entstehung dieses Buches begleitet hat.
Heike Holdinghausen und Armin Rellerim März 2014
1 Ein reich beschenkter Planet
Auf ihrer vorerst letzten Marsmission machte die US-Weltraumbehörde NASA einen sensationellen Fund: Ihr Weltraumgefährt »Curiosity« fand Spuren von Wasser. Ein Forscherteam lobte, dies sei nicht nur wissenschaftlich interessant, das Wasser sei an diesem ungewöhnlichen Ort auch eine bemerkenswerte Ressource.1 Und das All bietet noch mehr. Anfang des Jahres 2013 rauschte der Asteroid 2012 DA14 an der Erde vorbei und faszinierte viele Menschen. Das Unternehmen Deep Space Industries teilte erfreut mit, wenn der Himmelskörper nur zu zehn Prozent aus Eisen und Nickel bestünde, sei er zu aktuellen Marktpreisen hundertdreißig Milliarden Dollar wert. Man plane einen Rohstoffabbau auf Asteroiden, allerdings erst ab 2020. Wer den Leitspruch »If you can dream it, you can be it« teilt, den laden die Firmenchefs aus Virginia ein zu investieren (Achtung, Interessenten, in der Information für Investoren wird vor dem Risiko eines Totalverlusts gewarnt). Für ähnliche Projekte fanden sich schon einmal prominente Geldgeber: Der Regisseur James Cameron etwa, Google-Chef Larry Page oder der Hedgefondsmanager Ross Perot jr. stellten einen Teil ihrer Milliarden zur Verfügung, um die »fliegenden Geldbörsen« (Handelsblatt) zu plündern. Während sie sich die Star-Wars-Spiele ihrer Kindheit ins Erwachsenendasein gerettet haben – ein durchaus sympathischer Zug –, richten andere den Blick besorgt nach unten. »Die Grenzen des Wachstums rücken näher«, ist die Einleitung des neuesten Berichts des Club of Rome überschrieben. Die Zukunft des Menschen im Zeitalter schwindender Ressourcen – sie erscheint düster in der Warnschrift der honorigen Vereinigung von Wissenschaftlern aus aller Welt.
Deep Space Industries und der Club of Rome bilden so etwas wie die Pole möglicher Reaktionen auf die großen Umweltprobleme unserer Zeit: auf den Klimawandel und die absehbare Knappheit essentieller Ressourcen, auf die steigende Zahl von Menschen und auf die Ausbreitung des westlichen Konsum- und Lebensstils auf den Rest der Welt. Da sind eine große Sorglosigkeit und grenzenlose Technologiegläubigkeit auf der einen Seite, gepaart mit der Überzeugung, bisher habe die Menschheit noch für jedes Problem den richtigen Ingenieur hervorgebracht. Dem gegenüber steht ein tiefer Pessimismus, der bisweilen in – wissenschaftlich wohl begründeten – Weltuntergangszenarien mündet. Wer Recht hat? Die Wahrheit liegt nicht, wie sonst meistens, dazwischen, sondern ganz woanders. Die Produktions- und Konsumweisen der Industriestaaten lassen sich weder regional auf Dauer noch global kurzfristig weiterführen – und trotzdem: Für ein gutes Leben für alle reicht es auf der Erde durchaus. Sie ist ein unendlich reich beschenkter Planet.
Zunächst einmal hat sie sich eine äußerst günstige Flugbahn ausgesucht; sie umkreist die Sonne in genau dem richtigen Abstand, fern genug, um nicht zu verbrennen, nah genug, um von ihr eine ungeheure Energiemenge zu empfangen. Die Sonne stellt fünftausendmal mehr Energie zur Verfügung, als die Menschheit derzeit benötigt. Zudem verfügt der Blaue Planet über riesige (wenn auch nicht unerschöpfliche) Vorräte an Wasser. So unwahrscheinlich günstig ist die Temperaturverteilung auf der Erdoberfläche, dass das Wasser in seinen drei charakteristischen Aggregatzuständen Dampf, Flüssigkeit und Eis vorkommt. All diese Bedingungen sind sozusagen ein Geschenk des Himmels oder der kosmischen Konstellationen und bieten die physikalischen Randbedingungen für den lebensnotwendigen Wasserkreislauf. Aber auch die sechs grundlegenden chemisch-stofflichen Elemente, die den Pflanzen, Tieren und Menschen das Leben ermöglichen, wandern unablässig in gewaltigen Kreisläufen durch Atmosphäre, Geosphäre, Biosphäre und Teile der von uns Menschen aufgebauten Technosphäre: Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel. Sie sind, in großen oder geringsten Mengen, notwendig für die Photosynthese, diese geniale Erfindung der Pflanzen, Bakterien und Algen, mit der sie sich die Lichtenergie der Sonne nutzbar machen. Sie vermögen das Sonnenlicht, die solare Strahlungsenergie, in stofflich gebundene chemische Energie, also in Biomasse umzuwandeln und können sie somit speichern. Die aus Licht, Wasser und den Elementen entstandenen Strukturen von Zucker, Eiweiß und Fett wiederum bieten Nahrung für Tiere und Menschen.
Wir leben bekanntlich nicht vom Brot allein: Die Nutzung von Metallen und Mineralien prägt die menschliche Kultur seit Jahrtausenden. Diese Geschenke lagern als Schätze im Boden, tief im Inneren der Erde oder an ihrer Oberfläche. Einige Metalle wie Eisen gibt es nicht nur in großen Lagerstätten auf allen Kontinenten, sie durchziehen unsere gesamte Lebenswelt. Als essentielles Spurenelement spielt Eisen eine vitale Rolle im Stoffwechsel fast aller Lebewesen. Pflanzen benötigen Eisen, um zusammen mit dem Magnesium enthaltenden Chlorophyll, dem Blattgrün, bestimmte Teilprozesse der Photosynthese zu katalysieren. Ein Mangel an Eisen stört die Blutbildung bei Mensch und Tier, darum muss es notwendig mit der Nahrung aufgenommen werden. Als Material kennen und verarbeiten Menschen das harte Metall seit rund viertausendzweihundert Jahren, es gab der Eisenzeit seinen Namen. In Form von Korrosionsprodukten, also Rost, trägt es seit Menschengedenken – beginnend mit den wunderschönen Höhlenmalereien des Neolithikums – als Farbpigment in den (Erd-)Farbtönen Ocker, Siena und Umbra vielerorts zur Verschönerung unserer Lebenswelt bei. Heute werden jährlich rund drei Milliarden Tonnen Eisenerz gefördert und zu Werkzeugen, Stahlträgern und tausenden von weiteren eisenbasierten Produkten verarbeitet.
Aber unser Planet Erde bietet noch ganz andere mineralische Präsente: Da ist zum Beispiel das silberweiße, weiche Gallium, eine Entdeckung des neugierigen 19. Jahrhunderts; nur geringe Mengen gibt es in der Erdkruste. Es existieren keine wirtschaftlich auszubeutenden Lagerstätten, nur als »Beiwerk«, als Kuppelprodukt in Bauxit-beziehungsweise Aluminium-, Zink- und Kupfererzen taucht das Metall auf. Nicht einmal hundert Tonnen werden jährlich gewonnen. Wirtschaftlich bedeutsam ist Gallium erst, seitdem es auf energieeffiziente Weise unsere Wohnungen und Büros erhellt: als Bestandteil von LED-Leuchten. Gewitzte Anwendungen haben wir uns für das Element überlegt – wie wir es aber für unsere Nachkommen erhalten wollen, wissen wir noch nicht. Deutschland, das sich gerne »Recyclingweltmeister« nennt, steht noch ganz am Anfang, wenn es gilt, effiziente Strukturen aufzubauen, um einmal verwertetes Gallium erneu(er)t zu benutzen.
Dabei ist das doch das Wunderbare an Metallen: Sie sind unendlich oft wiederzuverwerten. Mit dem Kupfer, aus dem sich ein geschickter Handwerker vor achttausend Jahren eine Axt schmiedete, könnte ein Elektrotechniker heute problemlos hunderte von Leiterplatten für Mobiltelefone bestücken. Es wäre interessant zu wissen, was unseren Nachfahren in weiteren achttausend Jahren zu Kupfer oder Gallium einfällt. Wir sind allerdings dabei, deren Möglichkeiten enge Grenzen zu setzen. Am Ende ihrer Lebens- und Nutzungsdauer verbrennen wir Computer, Smartphones und Leuchten oder wir verteilen sie als Schrott in meist winzigen Mengen auf dem Planeten. Die wertvollen Bestandteile darin verlieren wir dabei aus den Augen – und warnen zugleich vor drohenden Rohstoffknappheiten. Gedankenlos, ohne dass wir genügend über die Konsequenzen wüssten, gewinnen wir Metalle, setzen sie frei oder verbinden sie zu neuen Werkstoffen. Nachdem wir beispielsweise reines Gallium gewonnen haben, verbinden wir es mit Arsen, Phosphor oder Indium, um es in LED-Leuchten einzusetzen. Wir setzen den Stoff in Bewegung, machen ihn »mobil«. Diese Mobilisierung von Ressourcen gilt es im Blick zu behalten (das betrifft nicht nur Metalle, sondern ganz massiv auch unsere fruchtbaren Böden). Ein Mangel an Ressourcen besteht auf der Erde wahrlich nicht. Wir verwenden sie nur falsch.
Als Inbegriff eines verderblichen, schwindenden Rohstoffs gilt das Erdöl. Dutzende von Büchern, die eine Welt »im Ölrausch« oder »Geschichten von Gier, Krieg, Macht und Geld« beschreiben, zeugen vom traurigen Schicksal dieser wertvollen Ressource. Nicht Geld, vielmehr Erdöl bewegt die Welt. Die Folgen sind verheerend: Autos und Lastwagen nehmen mit ihren Verbrennungsmotoren den Bewohnern der Städte buchstäblich die Luft zum Atmen, weil Feinstaub und Ruß die Luft verdrecken. Zudem ist der Verkehr mit seinem hohen Ausstoß von Treibhausgasen einer der großen Treiber des Klimawandels. Und in Kunststoff verwandelt, verschmutzt Öl die Landschaft und vor allem die Ozeane und belastet deren Metabolismen inzwischen in bedrohlichem Ausmaß – einmal benutzt, landen Plastiktüten oder -flaschen in ihren Strudeln und lassen sich erst in Jahrhunderten abbauen.
Öl liefert aber auch die Unmengen an Energie für die hochproduktive industrielle Landwirtschaft mit ihrem immensen Bedarf an Düngern, Pflanzenschutzmitteln und Maschinen. Trotz der »Grünen Revolution« des vergangenen Jahrhunderts müssen fast eine Milliarde Menschen auf der Erde hungern, weil ihnen nicht genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Die Geschichte der öl- und eiweißreichen Rapspflanze zeigt, warum: Wir benutzen fruchtbare Böden, Wasser, Dünger und viel Energie, nur um die Ernte an Tiere zu verfüttern oder in Automotoren zu verbrennen.
Es sind bisher nicht unbedingt Erfolgsgeschichten, sondern vielmehr Dramen, die von Eisen und Gallium, von Erdöl und Raps zu erzählen sind. Doch welch mannigfaltigen Stoff für ganz andere, wunderbare Geschichten bieten sie! Erdöl nämlich ist nichts anderes als während Millionen von Jahren photosynthetisch gesammelte und fossil gespeicherte Sonnenenergie. Das kunterbunte Stoffgemisch lässt sich in sinnvolle Produkte verwandeln und ist als Rohstoff nur schwer zu ersetzen, etwa für Medikamente, Düngemittel oder auch Kunststoffe. Letztere können, sofern intelligent produziert und in Stoffströmen klug gemanagt, erneut verwertet werden. Kunststoffartikel müssen keine Wegwerfprodukte sein, auch sie können so produziert werden, dass sie lange halten und neu genutzt werden können; auch mineralischer Dünger wird erst dann ein Problem, wenn er im Übermaß auf sowieso schon gute Böden gebracht wird, um diesem ein paar mehr Tonnen Getreide abzutrotzen. Auf ausgelaugten Böden etwa in vielen Regionen Afrikas wäre ein bisschen mehr davon durchaus sinnvoll.
Es ist bezeichnend, dass wir mit den Produkten aus Erdöl so gedankenlos umgehen und sie für nur kurze Nutzungsdauern konzipieren, während wir für den in der Geschichte schon immer knappen, nur mühsam zu erringenden Rohstoff Holz viel selbstverständlicher lange Gebrauchsketten entwickelt haben – die erfolgreiche Geschichte des Altpapiers erzählt davon. Bis auf die vergangenen zweihundert Jahre war Holz immer eine der wesentlichen Energiequellen, so wie auch die Produktion vieler Alltagsgegenstände auf pflanzlicher Basis erfolgte. Die »Bioökonomie« ist also keine neue Erfindung profithungriger Chemie- und Biotechnologiekonzerne, sondern war bis auf eine kurze Ausnahme in der Menschheitsgeschichte Alltag.
Die Petrochemie hat viele erfolgreiche Konzepte daraus verdrängt, die wir nun wiederentdecken müssen – oder können: Der grandiose, heute nur noch selten genutzte Lein liefert Öl für die Ernährung und Fasern für Textilien. Mit dem Klima in Mitteleuropa kommt die himmelblaue Blume blendend zurecht und stellt nur geringe Anforderungen an den Boden, auf dem sie wächst. Mit der Basisressource Lein lassen sich sinnvolle, regionale Wirtschaftskreisläufe aufbauen – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen.
Die gesamte Biosphäre funktioniert in Kreisläufen. Jeder Gärtner weiß, dass er die verblühten Pflanzen als Kompost wieder in seinen Boden einbringen muss, will er dessen Fruchtbarkeit erhalten. Es ist eine historische Einmaligkeit, dass unsere hauptsächliche Rohstoffquelle derzeit vor allem aus Material besteht, das vor Millionen von Jahren aus den Kreisläufen von Kohlenstoff oder Stickstoff entfernt und in Senken gespeichert wurde. Metalle konnten der Erdkruste nur unter größten Mühen abgerungen werden, entsprechend umsichtig gingen die Menschen früher mit ihnen um. Gerätschaften, Werkzeuge, Waffen wurden immer und immer wieder repariert. Noch heute ist Schmidt (in vielen Varianten) der zweithäufigste Nachname in Deutschland. Kein Wunder, fast in jedem noch so kleinen Ort wohnte ein Schmied, der sich auf die Reparatur von Gegenständen aus Metallen verstand. Erst seit uns fossile Energien dabei helfen, Erze und Mineralien in großen Mengen auch aus unzugänglichsten Tiefen zu gewinnen und zu bearbeiten, haben wir diesen selbstverständlichen, nachhaltigen Umgang mit ihnen vergessen und glauben heute, was kaputt sei, müsse durch Neues ersetzt werden. Dabei sollten uns gerade diese Mengen zu Umsicht anregen: Seit Beginn der Industrialisierung plündern wir den Planeten in historisch unbekanntem Ausmaß.
1873 beschrieb der italienische Geologe Antonio Stoppani, es gäbe eine neue »Macht, die es an Kraft und Universalität mit den großen Gewalten der Natur« aufnehmen könne: den Menschen. Er sah nach dem Holozän, der Wärmeperiode der vergangenen zehntausend Jahre, Anfang des 18. Jahrhunderts mit Beginn der Industrialisierung ein neues Erdzeitalter heraufziehen, das Anthropozän.2 Dieser Begriff ist gerade schwer in Mode; so treffend er ist, darf er aber nicht den Blick darauf verstellen, dass Menschen schon immer das Gesicht der Erde mitgeprägt haben. Die Landschaften Europas, mögen sie noch so urtümlich erscheinen, sind durch Jahrtausende lange landwirtschaftliche Nutzung gestaltet worden, und auch die nordamerikanische Prärie ist durch Brandrodung entstanden, nur waren die europäischen Siedler nicht in der Lage, diese Bewirtschaftung und Kulturtechnik der Einheimischen zu erkennen. Der Mensch ist kein Eindringling, er gehört zur Natur. Das Ausmaß des anthropogenen Eingriffs in den Planeten aber ist neu.
Der Chemiker Paul J. Crutzen, der den Begriff Anthropozän am Anfang des 21. Jahrhunderts wieder ins Gespräch brachte, nennt als Begründung für die neue Qualität unter anderem die menschlichen Treibhausgasemissionen, die die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre schon verändert haben und noch weiter dramatisch verändern; ferner würden inzwischen dreißig bis fünfzig Prozent der Erdoberfläche von Menschen genutzt und umgestaltet; die steigende Weltbevölkerung mit voraussichtlichen knapp zehn Milliarden Menschen mitsamt ihrem Vieh in der Mitte des 21. Jahrhunderts würde gigantische Mengen an Ressourcen verbrauchen, ersichtlich schon jetzt am rasanten Verschwinden der Regenwälder und der Fischbestände; sowie die Unmengen an Phosphat- und Stickstoffdünger, die den in irdischen Ökosystemen gespeicherten Stickstoff längst überträfen. In seinem kurzen Text, in dem er die Idee des Anthropozän skizziert, ist sich Crutzen der daraus folgenden Lehre gar nicht sicher. Vielleicht würde, mutmaßt er, auch ein international abgestimmtes Geo-Engineering notwendig, also großräumige technische Maßnahmen, um Probleme wie den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Das hieße aber, den gewaltigen kulturellen und ideengeschichtlichen Umbruch zu unterschätzen, den das Anthropozän bedeutet. Der Glaube an Fortschritt umfasst zwar immer auch die Entwicklung neuer Technologien, die neue Verarbeitung und Anwendung der vielfältigen Stoffe, die uns umgeben. Doch das fossile Zeitalter hat gezeigt: Dieser Fokus ist zu eng! Alleine wird es Ingenieuren, Biologen, Chemikern und Physikern nicht gelingen, Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhunderts zu finden.
Ein Fortschrittsglaube (wo kämen wir ohne ihn hin?), der in die Zukunft führt, weiß nicht nur um den technischen Erfindergeist des Menschen, sondern auch um seine Fähigkeit zur Selbstorganisation. Menschen haben es immer wieder geschafft, begrenzte Ressourcen gemeinsam so zu nutzen, dass sie erhalten blieben. Darum ist die Geschichte der Allmende nicht tragisch, wie es die Anhänger von Garrett Hardins These von der »Tragik der Allmende« vermuten, sondern in vielen Fällen vorbildlich. Bauern haben Wälder nach selbstbestimmten und streng kontrollierten Bedingungen dauerhaft gemeinschaftlich als Viehweide und Holzlieferant genutzt; und Fischer regelten so die Nutzung von Fischbeständen in Seen und Flüssen. Diese Fähigkeit des Menschen zu Selbsterhalt und Selbstorganisation gilt es zu aktivieren und zu nutzen, um neue, bessere Geschichten der Stoffe zu erfinden; Geschichten, die um die Verwundbarkeit des Planeten wissen.
Wer die Geschichte von Aufklärung und Industrialisierung als Geschichte der Zerstörung und Ausbeutung erzählt, gewichtet einen ihrer wesentlichen Bestandteile zu gering: Auch Demokratie und Emanzipation der Bürger gehören dazu. Um künftig nicht nur neun, zehn Milliarden Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, sondern auch ihren Kindern und Enkeln, brauchen wir die Bedürfnisse, aber auch das Wissen und die Erfahrung möglichst vieler. Es gibt ja schon erste Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit: Von den Ingenieuren der Recyclingunternehmen, von Schneiderinnen, die Kleidung aus fair und ökologisch produzierten Stoffen herstellen, aber auch von der wirksamen Umweltgesetzgebung der Europäischen Union und von Schulen, in denen Schüler Altpapier sammeln. Sie alle arbeiten an resilienten Technologien oder Verhaltensweisen.
Wir können unsere Lebensweise nur schrittweise, nur in Suchbewegungen ändern, Irrtum immer eingeschlossen. Dazu brauchen wir rückholbare Techniken und Verfahren. Die Atomenergie ist allein deshalb ein Auslaufmodell, weil ihre Abfallprodukte die Menschheit in alle Ewigkeit belasten. Ein vollständiger »Ausstieg« ist deshalb schon gar nicht mehr möglich, nur noch ein Ausstieg aus der neuen Produktion von strahlendem Müll. Wir brauchen Gesetzgebungs- und Förderstrukturen, die es Unternehmen möglich machen, Technologien zu erproben – und sie auch wieder aufzugeben, wenn sie nicht wie erwartet Probleme lösen. Das lehrt die Erfahrung der Biokraftstoffe.
Die Transformation unserer fossilen Industriegesellschaft in eine Wirtschaft, die die Wege der Stoffe kennt, achtet und sie in kaskadenartigen Nutzungsweisen, idealerweise in Kreisläufen organisiert, stellt uns vor gewaltige Aufgaben. Sie zwingt uns, bewährte Techniken und Lebensstile vergangener, auf nachwachsenden Rohstoffen beruhender Wirtschaftsweisen zu regenerieren. Genauso wichtig ist es, ganz neue Technologien und Verhaltensweisen zu entwickeln. Diese grundlegende Transformation, die Energie- und Rohstoffwende wird nur dann gelingen, wenn die Möglichkeit zur individuellen und gemeinsamen Teilhabe an Entscheidungen über Produkte, Technologien und Technologieentwicklungen, aber auch an Infrastrukturprojekten gewährleistet ist. Das setzt Wissen und Kenntnisse über die stofflichen Grundlagen unseres Alltags voraus. Der wiederum wird geprägt von unzähligen Stoffen, deren Geschichten wir kaum überblicken. Immer komplexer werden die Gegenstände und Gebrauchsgüter, die wir nutzen und die uns umgeben: Handys und Lampen, die aus Dutzenden von Metallen bestehen; Kleidung aus Fasern, die aus den Kohlenstoffverbindungen des Erdöls gesponnen wurden; und künftig vielleicht Schaumstoffmatratzen aus Zucker, den Bakterien produzieren. All diese Dinge haben wir täglich in den Fingern und vor Augen, aber die Geschichte ihrer Stoffe bleibt uns trotzdem oft verborgen. Doch es ist wichtig, sie zu kennen, um ihr und damit auch unser Schicksal mitschreiben zu können.
Darum geht es in dem Transformationsprozess, der uns und den nächsten zwei, drei Generationen – also unseren Kindern und Enkeln – unweigerlich bevorsteht: Einfluss darauf zu nehmen, wie die Stoffe gewonnen und nutzbringend in unserer Obhut bewahrt werden. Letztlich sind es nicht Sonne und Wind, sondern Bildung und Demokratie, die die wichtigsten Ressourcen der anstehenden Transformationen darstellen. Um wirklich neue, interessante und spannende Stoffgeschichten auszudenken, auf Durchführbarkeit zu prüfen und dann Kapitel um Kapitel zu realisieren, brauchen wir nicht zu den Sternen greifen, zu Asteroiden oder dem Mars. Es gibt für uns genug zu tun, wenn wir die Nutzung der Geschenke dieses Planeten in Raum und Zeit mit Bedacht planen wollen; dazu müssen wir nicht nur präzise beschreiben, wo welche Ressourcen wie vorkommen, sondern auch, wie wir sie verteilen und wohin wir sie bewegen.3 Es gilt also, eine angemessene Ressourcengeographie zu erstellen, als Teil einer Ressourcenstrategie, die auch in Zukunft tragfähig ist. Das könnte bedeuten, den Aufbau professioneller Recyclingstrukturen in Westafrika zu fördern, dort, wo Industrie- und Schwellenländer zurzeit ihren giftigen Elektronikschrott abladen und ihn buchstäblich den Händen von (Kinder-)Arbeitern überlassen; oder ein Schulbuch über den bisher unbeachteten, unabsichtlich Schaden nach sich ziehenden Lebensweg einer Plastiktüte zu schreiben – das wären lohnende Rohstoffprojekte für die Millionen von Larry Page.
2 Öl – »Dallas« kommt nicht wieder
Auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen, in den Pressemitteilungen der Unternehmen oder in Studien ihrer Lobbyverbände ist gerade eine ganz neue Energiewende zu beobachten: Seit zwei, drei Jahren wird die Renaissance des Erdöls ausgerufen. Während ein Forschungszentrum der Bundeswehr noch 2010 die Folgen des Förderhöchststandes »Peak Oil« analysierte und forderte, die Sicherheitspolitik Deutschlands müsse sich auf ein Ende der wichtigsten Energieressource einstellen, drängen nun neue Töne in den Vordergrund. Es gebe kein »Problem knapper Reserven mehr«, analysierte etwa der Bundesnachrichtendienst im Herbst 2013 und folgerte, nun werde der Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid zunehmen und die Umwelt weiter belasten. »Der Verteilungskampf wird darum gehen, wer künftig wie viel CO2 emittieren darf«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den deutschen Auslandsgeheimdienst.1 Die Mineralölwirtschaft kommt argumentativ aus der Defensive. Der Mineralölwirtschaftsverband MWV publizierte im Herbst 2013 eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu der Frage, »was das Auto von morgen antreibt«.2 Ergebnis: Bis ins Jahr 2040 würden Benzin und Diesel als Energieträger in Verbrennungsmotoren als Rückgrat für einen überwältigenden Teil aller Autos erhalten bleiben. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie veröffentlichte ebenfalls zusammen mit dem MWV die gemeinsame Erklärung »Für eine nachhaltige Entwicklung des Industriestandorts Deutschland«. Zufrieden stellen sie darin fest, entgegen landläufiger Meinung bleibe Mineralöl noch für Jahrzehnte in Deutschland ein zentraler Energieträger.3
Gleichzeitig überprüfen Explorationsunternehmen die heimischen Vorkommen daraufhin, ob sie wirtschaftlich zu bergen sind – auch wenn die Reserven global gesehen winzig sind: Gerade einmal 55 Millionen Tonnen vermutet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Deutschland, in Österreich schätzt sie Reserven und Ressourcen auf insgesamt 17 Millionen Tonnen (und die Schweiz geht ganz leer aus). Weltweit soll die Erde mehr als eine halbe Billion Tonnen bergen. In Deutschland sind die Vorkommen dort konzentriert, wo vor über 250 Millionen Jahren das warme, flache Zechsteinmeer an seine Ufer schwappte. Es erstreckte sich von Großbritannien und Skandinavien bis nach Mitteleuropa und bot beste Bedingungen für die Entstehung von Erdöl und Erdgas. Unter Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Westpolen liegt daher genügend »schwarzes Gold«, um das Interesse mittelständischer Ölförderunternehmen zu wecken. 2016 oder 2017 wollen sie damit beginnen, etwa in der brandenburgischen Lausitz Öl zu fördern. Weil Öl nicht Bestandteil der Stromerzeugung sei, behindere es auch keinesfalls die Energiewende, sondern sei für die Mobilität der Menschen ganz einfach unverzichtbar, verkündet der Geschäftsführer der Central European Petroleum GmbH mit Sitz in Kanada und Berlin und lädt Journalisten bereitwillig zu seinen Ölerkundungstouren in die ostdeutsche Provinz ein.
Bislang gilt der Peak der deutschen Ölförderung schon 1968 als erreicht, die bestehenden Türme und Plattformen, etwa in Lütow auf der Ostseeinsel Usedom oder im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, können mit zwei bis drei Prozent den deutschen Verbrauch nur noch geringfügig abdecken. Die strategischen Gewinne in der Auseinandersetzung zwischen den Vertretern und Profiteuren der fossilen Energie und denen der erneuerbaren Energien sind aber nicht zu unterschätzen. Zwar ist der Zeitpunkt von Peak Oil seit je her ausgesprochen umstritten, fast jeder Experte nannte und nennt je nach Rechenmethode eine andere Jahreszahl. Das liegt auch an der äußerst unsicheren Datengrundlage: Die Bergbaubehörden der Welt unterteilen Bodenschätze in Ressourcen und Reserven. Als Reserven bezeichnen sie nachgewiesene, mit heutiger Technik und zu heutigen Preisen förderbare Rohstoffe. Nun aber kommt Spekulation ins Spiel: Ressourcen nämlich sind »nachgewiesene, aber derzeit technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewinnbare sowie nicht nachgewiesene, aber geologisch mögliche, künftig gewinnbare Energierohstoffmengen«.4 In der Kurzfassung: Könnte sein, dass da was liegt. Abgesehen davon gehen gerade die OPEC-Staaten, die weltweit über das meiste Öl verfügen, nicht gerade transparent mit ihren Daten um. So kann sich also jeder aussuchen, was er möchte: Die Energy Watch Group, ein internationales Netzwerk aus Parlamentariern und Wissenschaftlern, nahm 2008 an, der Förderhöchststand sei schon überschritten. Die Internationale Energieagentur sah ihn 2010 erst im Jahre 2035 kommen.5
Doch ganz egal, wie lange die Experten der Ära der billigen Energie noch geben: Ein Ende des Öls ist in all die verschiedenen Szenarien eingerechnet; die Existenz von Peak Oil an sich leugnen ernsthaft nur noch Prinzen aus Saudi-Arabien. Wer derzeit geboren wird, für den wird als Erwachsener allzeit verfügbares, bezahlbares Erdöl also keine Selbstverständlichkeit mehr sein. In einem Beitrag für die taz formulierte der Journalist Manfred Kriener 2008, in Bezug auf Erdöl »breite sich das Aroma der Endlichkeit aus«. Der Schmierstoff der Weltwirtschaft bekam damit etwas alarmierend Gestriges, die Notwendigkeit von Alternativen lag auf der Hand. Diese Übereinkunft, Erdöl als knappe Ressource zu betrachten, ist bislang ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste politische Treiber der Rohstoffwende gewesen – hin zu erneuerbaren Energien, nachwachsenden Rohstoffen und effizienteren Produktionstechniken. Politisch mündete das weltweit in finanziell gut ausgestattete Forschungsprogramme für den Einsatz erneuerbarer und nachwachsender Rohstoffe. 2,4 Milliarden Euro Fördergelder für einen Zeitraum von sechs Jahren sah die »Nationale Forschungsstrategie Bioökonomie« der schwarz-gelben Bundesregierung 2010 vor. Das entsprechende Programm »National Bioeconomy Blueprint« der USA ist ebenfalls milliardenschwer und Brasilien ist vor allem im Bereich Biokraftstoffe ein Vorreiter.
Doch ausgehend von Nord- und Südamerika schiebt sich mittlerweile die Überzeugung in die Debatte, dass es so schnell mit fossilem Öl vielleicht doch nicht vorbei sein könne. Für eine Rohstoffwende bliebe demnach mehr Zeit als gedacht. Die Hoffnungen liegen dabei auf sogenannten »unkonventionellen Erdölvorkommen«. Unkonventionell ist dabei keine chemische oder geologische Definition, sondern beschreibt Öl, das nicht leicht und flüssig aus dem Bohrloch sprudelt wie etwa in Saudi-Arabien oder Norwegen. Unkonventionelles Öl, das ist zum einen Schieferöl, Schwerstöl und Bitumen (oder Ölsand); aber auch schwer erreichbare Lagerstätten, etwa in der Tiefsee oder der Arktis, werden als unkonventionell bezeichnet. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe geht davon aus, dass von insgesamt noch vorhandenen 585 Milliarden Tonnen Erdöl 258 Milliarden Tonnen als Ölsande, Schwerstöl oder Schieferöl vorliegen. Auf Letzterem beruht der derzeitige Ölboom in den Vereinigten Staaten, der die Debatte über fossile Energien in den vergangenen Jahren so sehr verändert hat. 387 Millionen Tonnen Rohöl haben die Vereinigten Staaten 2012 gefördert, 2011 waren es 346 Millionen Tonnen und 2006 307 Millionen Tonnen. Damit rücken die USA mit einem Anteil von inzwischen 9,3 Prozent an der Weltjahresproduktion langsam an die beiden führenden Nationen Russland und Saudi-Arabien heran. China hat Nordamerika bereits als größten Ölimporteur der Welt abgelöst, weil die US-Eigenproduktion so stark angestiegen ist.
Gewonnen werden Schieferöl und -gas vor allem mit einer Technologie, die zwar schon lange bekannt ist, aber noch nie so intensiv angewendet wurde wie derzeit: Fracking. Weil Öl und Gas üblicherweise leichter sind als das Wasser im Untergrund, wandern sie so lange durch Gesteinsporen und -risse nach oben, bis sie auf undurchlässige Schichten treffen. Dort bilden sie unterirdische Lagerstätten. Werden diese angebohrt, steigen Öl und Gas zunächst von alleine nach oben und können bei abnehmendem Druck abgepumpt werden. So funktioniert Ölförderung in den großen Feldern, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder im Irak. Schieferöl hingegen befindet sich in nicht ausreichend durchlässigen Speichergesteinen und strömt bei einer Bohrung deshalb nicht einfach heraus. Schiefergas, Tight Gas oder Kohleflözgas gehören ebenfalls in diese Kategorie. Teilweise über mehrere Quadratkilometer im Gestein verteilt, braucht man zur Förderung dieser Vorkommen daher aufwändige und teure Technik. Um das Öl vom Speichergestein zu lösen, wird es erschüttert, dann wird mit hohem Druck Wasser und Sand in das Gestein gepresst. Durch die entstehenden Risse kann das Öl entweichen und abgesaugt werden. Bislang sind dazu zahlreiche, zum Teil giftige Chemikalien nötig, um etwa die Gesteinsrisse frei von Bakterien zu halten. Außerdem stehen die künstlichen Erschütterungen im Verdacht, Erdbeben auszulösen. Im dicht besiedelten Europa haben deshalb etwa Frankreich und Deutschland beschlossen, vorerst auf Fracking zu verzichten.
Weitere große unkonventionelle Erdölreserven finden sich in der Nachbarschaft der Vereinigten Staaten: Im Boden Kanadas liegen Schwerstöle und Bitumen, ein Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe, das Asphalt ähnelt und dort in Form von Ölsanden vorliegt. Während Schwerstöl viel langsamer fließt als gewöhnliches Erdöl, sind Ölsande bei Umgebungstemperatur gar nicht fließfähig. 170,8 Milliarden Barrel an Vorräten werden in Kanada insgesamt vermutet. Damit verfügt das Land nach Saudi-Arabien und Venezuela über die drittgrößten Erdölvorkommen der Welt. Allerdings lässt sich der Reichtum unter den borealen Wäldern des Nordens nur mit hohem Einsatz von Landschaft, Energie und Wasser ausbeuten. Die Ölsande werden in der Regel im Tagebau gewonnen – dort verwandeln sich nordische Wälder anschließend in eine teils vergiftete Mondlandschaft. Die indigenen Bewohner der Region, die »First Nations«, kämpfen bislang vergeblich gegen den Teersandabbau in ihrer Heimat, der Wild, Fische und Wasser verseucht oder vernichtet. So geht beispielsweise der Bestand an Karibus, dem Rentier Nordamerikas, drastisch zurück.
Auch Schwerstöl, mit einer ähnlichen Dichte ebenso schwer wie Wasser (gewöhnliches Erdöl ist leichter), findet sich in Kanada; noch größere Mengen liegen im Osten Venezuelas, im Orinoko-Gürtel. Im Grunde beruht die gesamte Wirtschaft des südamerikanischen Landes auf diesem Ölreichtum: Beispielsweise hängen mehr als 95 Prozent der Exporte Venezuelas am »schwarzen Gold«.6 Benzin muss das Land trotzdem importieren, weil es nicht über genügend eigene Raffinerien verfügt, um Öl zu verarbeiten. Zugleich zählt Transparency International Venezuela zu den zehn korruptesten Ländern der Welt. Das Land, in dem bis zu seinem Tod im Jahr 2013 Hugo Chávez herrschte, steht im Bann des Ressourcenfluchs. Dieser Begriff bezeichnet den Zusammenhang zwischen reichen Bodenschätzen und schlechter Regierung: Der Reichtum an Rohstoffen bringt Geld nur in die Kassen weniger, die ihre Privilegien teils mit Gewalt verteidigen. Der Aufbau nachhaltiger wirtschaftlicher Strukturen wird so verhindert.
An der Erschließung des venezolanischen Schwerstöls ist auch Russlands Staatskonzern Gazprom beteiligt – genau wie am Wettrennen um die Ölschätze der Arktis. Russland, Europa und Amerika, sie alle blicken begehrlich nach Norden. Rund 13 Prozent aller unentdeckten Ölvorkommen sowie 30 Prozent der unentdeckten Gasvorkommen schätzt der US-amerikanische Geologische Dienst USGS (United States Geological Survey) dort. Es geht um Milliarden von Dollar. Die Arktis ist ein besonders sensibler Naturraum, weil sich die dort lebenden Pflanzen und Tiere in Millionen von Jahren an seine extremen Bedingungen angepasst haben. Extreme Kälte, kurze Vegetationsperioden und Lichtmangel halten nur wenige Pionierpflanzen aus: Flechten, Moose, Gräser und Kräuter. Auch wenige spezialisierte Säugetiere wie Eisbär, Rentier, Walross, Walarten wie Narwale, Belugas und Grönlandwale sowie vergleichsweise viele Vögel und zahlreiche Fische kommen mit diesen Verhältnissen zurecht. Doch die Lebenskunst von Elfenbeinmöwe und Krabbentaucher, von Lachs, Kabeljau, Seelachs, Heilbutt, Schellfisch und Königskrabbe wird ihnen nun zum Verhängnis. Ändert sich ihre sehr spezielle Heimat nämlich grundlegend, haben sie als Art kaum Überlebenschancen. Das Zusammenspiel von Tieren und Pflanzen ist störanfällig. So sind winzige Wassertiere wie der Ruderkrebs – das Zooplankton – von der Algenblüte entlang der Eiskante abhängig, sie stellt eine wichtige Nahrungsgrundlage dar. Die Krebschen wiederum bilden die Hauptspeise vieler Fische. Wird ein Glied in dieser Nahrungskette beschädigt, geraten alle in Gefahr. Dies gilt es zu beachten, wenn entlang der Küstenregionen Russlands, Grönlands, Norwegens, der USA oder Kanadas – also der Staaten, die das arktische Eismeer umschließen – Bohrplattformen installiert werden.
Als im Jahr 2010 Mensch und Technik auf der Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko versagten, blieb das offene Bohrloch im angenehm warmen Wasser der südlichen Gefilde für Monate außer Kontrolle. Die britische Betreiberfirma BP musste hilflos zusehen, wie Millionen Liter Erdöl ins Meer flossen – und feilschte anschließend um Straf- und Entschädigungszahlungen. Die Bedingungen in der Arktis sind ungleich schwieriger, die Folgen eines Unfalls noch dramatischer. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte: Die Industrie- und Schwellenländer tauen mit ihren Treibhausgasemissionen die Arktis auf, und diese gibt ihnen zum Dank ihre Schätze frei. Um etwa fünf Grad Celsius ist die Temperatur dort in den vergangenen hundert Jahren gestiegen. Nach einer Studie des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung erwärmt sich das Tiefenwasser der Grönlandsee zehnmal schneller als die Weltmeere im Durchschnitt. Das ewige Eis auf dem Meer schmilzt, der Permafrostboden zu Lande taut. Mikroorganismen beginnen, gefrorene Pflanzenreste abzubauen und setzen dabei das äußerst klimaschädliche Methan, aber auch Kohlendioxid, Stickoxide und Phosphat frei. Je mehr fossile Energieträger wir benutzen, desto mehr verstärkt sich dieser Prozess. Es gehört zu den Unwägbarkeiten der Erderwärmung, dass wir nicht wissen, wie diese Nährstoffzufuhr sich lokal und global auswirken wird.
Genau wie die Arktis und die kanadischen Wälder ist die Tiefsee nur in Sonntagsreden und in den Präambeln internationaler Verträge gut geschützt. In der Realität sind zahlreiche Projekte im Golf von Mexiko und vor den Küsten Westafrikas und Brasiliens geplant. Bis zu 5 000 Meter, teilweise bis zu 7 000 Meter tief wollen die Firmen bohren. Die Risiken solcher Förderanlagen sind 2010 im Golf von Mexiko überdeutlich geworden. Es ist aufschlussreich, sich mit Geologen aus der Ölbranche über diesen Unfall zu unterhalten. Die »Erdwissenschaftler« (für die die Erdölindustrie ein naheliegender Arbeitgeber ist) befassen sich in ihrer Ausbildung intensiv mit der Geschichte unseres Planeten. Sie bekommen einen weiten Blick auf das Geschehen und denken nicht in Zeiträumen von tausenden, sondern von Millionen von Jahren. Die Geschichte des Menschen erscheint in ihren Dimensionen von Neoproterozoikum und Mesoproterozoikum, in denen sich zum Beispiel die Erdölvorkommen gebildet haben, wie ein Wimpernschlag. Diese Sichtweise mündet dann etwa in der Einschätzung eines deutschen Geologen, der seit Jahrzehnten weltweit nach Öl sucht, das im Golf von Mexiko ausgetretene Öl schade ja nicht der Natur an sich. Diese habe sich in den vergangenen Jahrmillionen ganz gut an den Naturstoff Öl gewöhnt und gelernt, mit ihm umzugehen. Die verschiedensten Bakterien hätten sich auf den Abbau des Stoffgemischs spezialisiert, Störungen – verklebte Vögel, tote Fische – seien immer nur vorübergehend. Zu einer »Katastrophe« werde ein Leck im Bohrloch nur im Blick der Menschen, die in ihrer Existenz bedroht würden, etwa als Fischer oder Hoteliers. Natürlich gelte es ihre – kurzfristigen – Interessen zu berücksichtigen, so der Geologe, schließlich seien sie legitim. Wer aber ein gültiges Urteil über den Vorfall fällen wolle, der möge bedenken, dass er eben nur in dieser kurzfristigen Perspektive eine Katastrophe sei.
Abgesehen davon, dass die Meinung eines verklebten Kormorans dazu einmal interessant wäre – schöner kann man ein Denken nicht zum Ausdruck bringen, das die Herausforderungen des Anthropozäns noch nicht verstanden hat. Der Mensch ist längst kein leichtgewichtiger und nur zeitweiliger Gast auf der Erde mehr, dessen Spuren im Sand schnell wieder vom Wüstenwind verweht und verwischt sein werden. Vielleicht ist es für einen Geologen schwieriger als für andere Berufsgruppen zu akzeptieren, dass mit dem Anthropozän ein neues Zeitalter angebrochen ist und dass mit den Möglichkeiten von Milliarden hochtechnisierter Menschen auch neue Verantwortlichkeiten entstanden sind. Im Laufe der Erdgeschichte war es sicher üblich, dass immer mal wieder Erdöl aus der Erdkruste austrat; absolut neu hingegen ist, dass weltweit systematisch natürliche, für die Biosphäre aber trotzdem giftige Kohlenwasserstoffe aus der Tiefe an die Erdoberfläche befördert und mobilisiert werden. Rohöl, hellgelb oder auch schwarz, ist schließlich ein Stoffgemisch aus mindestens 500 Bestandteilen; es besteht aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen, aus Naphthensäuren, Phenolen, Harzen, Aldehyden, organischen Schwefelverbindungen, auch geringe Mengen Nickel, Kobalt, Blei, Arsen und Chrom sind enthalten.
Umweltpolitiker und -aktivisten haben heute vor allem die Klimawirkungen der Ölverbrennung im Blick, wenn sie einen »Stoffwechsel« fordern. Doch auch die Auswirkungen der Ölförderung vor Ort sind beträchtlich. Vor allem Staatskonzerne wie der größte Ölförderer der Welt, Saudi Aramco aus Saudi-Arabien, oder PEMEX aus Mexiko und die mehrheitlich in öffentlicher Hand befindliche Rosneft in Russland, nehmen kaum Rücksicht auf Natur und Bevölkerung in den Förderregionen. Oft sind sie in Ländern ohne eine freie Presse und Zivilgesellschaft beheimatet, mit entsprechenden Folgen. Traurige Berühmtheit haben etwa die löchrigen Pipelines in Russland erlangt, die eine schmutzige Spur durchs Land ziehen.
Die Bundesrepublik ist als Mahner hier allerdings nicht sehr glaubwürdig. Um an die vorhandenen Braunkohlereserven zu gelangen, ist ihr kein Opfer zu groß. Während sie rund 98 Prozent ihres Erdölkonsums durch Importe decken muss, besitzt sie reichhaltige eigene Braunkohlevorkommen: Mit einem Potential von rund 78 Milliarden Tonnen verfügt sie nach Russland und Australien über die weltweit drittgrößten Bestände des Klimakillers. Noch immer werden in den großen Tagebaugebieten Brandenburgs und Nordrhein-Westfalens Dörfer ausgelöscht und ganze Landschaften abgebaggert, um an Kohle zu gelangen. Die Aufforderung aus Deutschland etwa an Ecuador, seine Erdölvorkommen doch zum Schutz des Regenwaldes im Boden zu belassen, klingt vor diesem Hintergrund äußerst doppelzüngig. Unglaubwürdig sind solche Forderungen aber vor allem angesichts des immensen Verbrauchs fossiler Energien in Deutschland – an dem eine ganz breite Koalition aus Wirtschaft und Politik auch unverdrossen festhält. Mit dem Argument, der Industriestandort Deutschland müsse erhalten werden, haben Sozial- und Christdemokraten die Energiewende in Deutschland vorerst politisch ausgebremst. Es gibt keinen Wirtschaftskongress, auf dem Industrievertreter nicht die Wettbewerbsnachteile beklagen, die sie durch das Öl- und Gaswunder der USA erleiden.
Doch ist dort wirklich das »Dallas« der Achtziger zurückgekehrt? Natürlich nicht. Mahner wie die Energy Watch Group und selbst die Protagonisten des angeblichen Ölbooms sehen bereits Anzeichen für das absehbare Ende des Hypes in den USA: So bekannte der Chef des niederländischen Ölkonzerns Shell im Oktober 2013, die Schiefergas- und Schieferölförderung sei für seinen Konzern »ganz eindeutig nicht so erfolgreich wie gedacht«7. Die US-Rohstoffbehörde USGS fügt in eine Analyse über die arktischen Energierohstoffe nüchtern ein, die Resultate würden ohne Bezug zu den Kosten von Entwicklung und Exploration vorgestellt, die in der untersuchten Region vielerorts erheblich sein würden.8 Die Internationale Energieagentur, die sowohl Vorräte als auch Verbrauch fossiler Energien bisher eher zu positiv eingeschätzt hat, konstatiert in ihrem letzten Energieausblick 2013, die Welt befinde sich nicht an der Schwelle einer neuen Zeit des Ölüberflusses. Ein stetig steigender Ölpreis, der 2035 bei 128 Dollar pro Barrel liegen werde, werde die Entwicklung Erneuerbarer Energien unterstützen.9 Und auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), ebenfalls keine begeisterte Lobbyistin erneuerbarer Energien, stellt in ihrem letzten Energiegutachten nüchtern fest, angesichts der langen Zeiträume, die für eine Umstellung auf dem Energiesektor erforderlich sind, sei die rechtzeitige Entwicklung alternativer Energiesysteme notwendig: »Die zunehmende Nutzung nicht-konventioneller Erdölvorkommen führt langfristig nicht zu einem Paradigmenwechsel.«10
Der Boom in den USA folgt denn auch sehr genau der Logik von Peak Oil. Die Ausbeute von Lagerstätten, die bislang nicht im Visier der Manager lagen, lohnt ja nur deswegen, weil kein neues, leicht zu gewinnendes Öl mehr entdeckt wird. In einem Lehrbuch über Erdöl und Erdgas von 1995 ist zu lesen, solche Lagerstätten stellten eine Zukunftsreserve dar, die erst dann genutzt werden könne, wenn die Preise die Grenze von 50 Dollar pro Barrel (also pro Fass mit einem Fassungsvermögen von rund 159 Litern) überschreite.11 Rund zwanzig Jahre später ist das längst eingetreten, der Ölpreis liegt stabil bei 100 Dollar pro Barrel. Dieser extrem hohe Ölpreis (der Verbraucher über die Heiz- und Mobilitätskosten übrigens viel stärker belastet als der viel diskutierte Strompreis) macht es rentabel, sogenannte unkonventionelle Lagerstätten zu erschließen, also Schieferöl oder Teersande. Auch Öl in der Tiefsee, bislang in unerreichbaren Tiefen unter dem Meeresgrund gelagert, wandelt sich auf einmal von der theoretischen Ressource zur tatsächlich verfügbaren Reserve. So wurden beispielsweise in Brasilien laut Internationaler Energieagentur in den vergangenen zehn Jahren mehr sogenannte »supergiant fields« entdeckt als in jedem anderen Land. Diese Felder enthalten jeweils mehr als fünf Milliarden Barrel Öl und liegen allesamt in der Tiefsee. Allerdings warnt die IEA in ihrem »World Energy Outlook« auch, die Aussichten des südamerikanischen Landes als Energieproduzent hingen wesentlich davon ab, ob das Investitionsniveau hoch gehalten werden könne.
Wie viel Erdöl verfügbar ist, bleibt eben immer eine Frage des Preises. Die unkonventionellen Vorkommen werden das billige Öl nicht zurückbringen, weil sich ihre Förderung nur bei hohen Preisen lohnt. Das stetige Lamento nach angeblich notwendiger billiger Energie ist kurzsichtig, so wie das kurzfristige Angebot an billigem Öl und Gas – beispielsweise der Fracking-Boom in den Vereinigten Staaten – einer Wirtschaft eher schadet, weil so die Suche nach alternativen Technologien und Verhaltensweisen als weniger dringlich erscheint, als sie wirklich ist. Die »Renaissance des Erdöls«, die Wirtschaftsverbände, einzelne Gewerkschaften und andere Lobbygruppen ausrufen, ist daher nur hohle Rhetorik, der verzweifelte Versuch, einen Rohstoffgebrauch von gestern salonfähig zu halten. Diese Rhetorik dient auch dazu, um Restriktionen abzuwehren, etwa strengere CO2-Grenzwerte für die Automobilindustrie. Die europäische Öffentlichkeit, die Regierungen und die Wirtschaft sollten darauf nicht hereinfallen und schneller reagieren. Denn eines steht fest: Erdöl wird langfristig teurer. Unternehmen, die Produktion und Vertrieb ihrer Waren nicht an dieser Erkenntnis ausrichten, werden auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein.
Was schade ist: Umweltpolitiker finden es seit einiger Zeit chic, als Industriepolitiker aufzutreten. Der Sozialdemokrat und neue Energie- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gefiel sich während seiner Zeit als Umweltminister in dieser Rolle; und der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer saß dem Industrieausschuss des vergangenen EU-Parlamentes vor. Andersherum wird aber kein Schuh draus: Für das Wirtschaftsministerium ist der Begriff »Umwelt« noch immer gleichbedeutend mit »überflüssiger Bürokratie« und »Wettbewerbsnachteil«. Dabei würden Wirtschaftspolitiker den Unternehmen ihrer Länder einen Gefallen erweisen, wenn sie die Industrie durch entsprechendes Fordern und Fördern zu energie- und ressourcensparendem Verhalten zwängen, zumal sich – die eingangs erwähnte Äußerung etwa des Bundesnachrichtendienstes zeigt es – der Ressourcenbegriff in Zukunft wandeln wird.