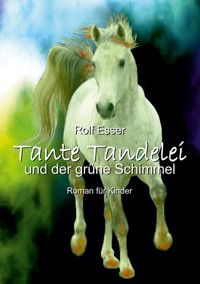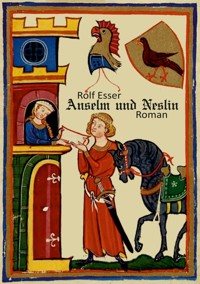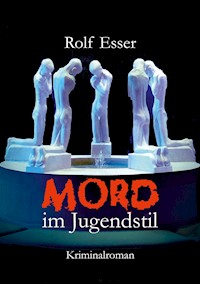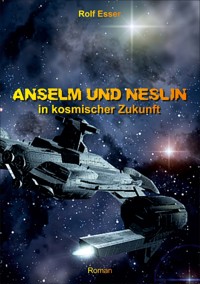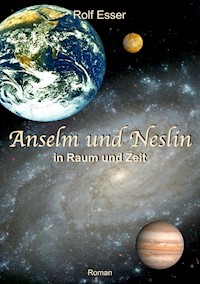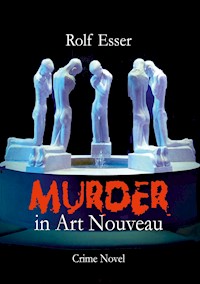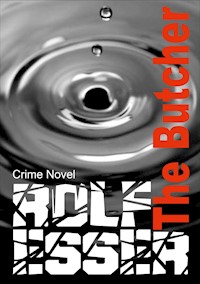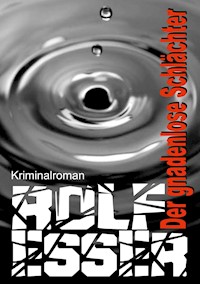
5,00 €
Mehr erfahren.
Ein neunjähriger Junge muss in einem Konzentrationslager erleben, wie sein Vater auf grausame Weise umgebracht wird. Er wird für den Rest seines Lebens traumatisiert, denn er kann die Namen jener Männer, die an dem Mord beteiligt waren, nie mehr vergessen. Der Junge kommt in die USA, wird dort adoptiert und erlebt eine glückliche Jugend. Er studiert und beginnt nach dem Studium eine Karriere bei einer New Yorker Werbeagentur. Genau zu jener Zeit geschehen überall auf der Welt grauenhafte Morde. Die Kriminalisten sind ratlos. Weder die Motivlage, noch der oder die Täter lassen sich auch nur ansatzweise erkennen. Von Paraguay über Italien bis nach Ägypten wird fieberhaft ermittelt. In New York schließt sich am Ende der Kreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der gnadenlose Schlächter
Rolf Esser
Impressum
Autor: Rolf Esser © 2022
Umschlaggestaltung & Layout: Rolf Esser © 2022
ISBN:
Softcover 978-3-347-69221-3
Hardcover 978-3-347-69222-0
E-Book 978-3-347-69223-7
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Rolf Esser
Der gnadenlose Schlächter
Kriminalroman
Inhalt
1945
Kapitel 1 – Im Konzentrationslager
1945 - 1965
Kapitel 2 – Jugend, Studium, Beruf
Kapitel 3 – In Argentinien
Kapitel 4 – In Ägypten
Kapitel 5 – In der Schweiz
Kapitel 6 – In Paraguay
Kapitel 7 – In Kanada
Kapitel 8 – In Ungarn
Kapitel 9 – In Italien
Kapitel 10 – In Deutschland
Kapitel 11 – Das Finale
Kapitel 12 – Der Brief
1945
Kapitel 1
Im Konzentrationslager
Es ist fünf Uhr morgens. Es herrscht Ordnung hier. In deutscher Gründlichkeit stehen die Männer in Reih und Glied, eingeteilt in Gruppen, erkenntlich an ihren Abzeichen, den sogenannten Winkeln, die man ihnen an ihre gestreifte Kleidung genäht hat: Politische, Kriminelle, Emigranten, Bibelforscher, Homosexuelle, Asoziale und Juden. Zusätzlich müssen sie eine Nummer tragen. Der Mensch wird zur Nummer. Er hat keinen Namen mehr, er verliert Ansehen und Ehre.
Die Männer stehen zu dieser frühen Stunde stramm auf dem großen Platz vor den Holzbaracken, bereit für den Zählappell. Schon um vier Uhr wurden sie geweckt und mussten die elenden Räume ihrer Unterkünfte reinigen. Es ist noch dunkel, grelle Scheinwerfer erhellen das Geschehen. Der April des Jahres 1945 ist schon weit fortgeschritten, der Morgen ist aber immer noch kühl und die dünnen, ausgemergelten Gestalten frieren. Nicht zu vergleichen mit jener Nacht im Januar des überaus strengen Winters, als sie als Strafe für die Flucht zweier Häftlinge kollektiv bei eisiger Kälte hier stehen und ausharren mussten. Für fünfzehn Männer war es der Tod.
Sie stehen da und haben im Grunde keine Kraft dafür. Sie alle sind Häftlinge. Am Morgen müssen sie die Tortur des Apells aushalten, die sich am Abend wiederholt. Dazwischen werden sie in den ebenso entkräftenden Arbeitseinsatz geschickt: Straßenbau, Bäume fällen, Bauarbeiten, Waffenfabrik – jede Sklavenarbeit ist denkbar, solange ein Gewinn daraus erzielt wird.
Im Lager herrscht eine Typhusepidemie. Die Baracken des Krankenreviers sind überfüllt. Diejenigen Kranken, die noch auf den Beinen stehen können, müssen auch zum Zählapell antreten und werden zur Arbeit geprügelt. Viele von ihnen werden den Abend nicht mehr erleben.
All diese Männer wurden in Schutzhaft genommen und kamen in die Hölle. Mit dem Unterschied, dass es in dieser Hölle nicht nur einen Teufel gibt, Teufel treten hier gleich im Dutzend auf. Neun davon stehen vor ihnen, allesamt Männer der SS-Totenkopfverbände. Das Sagen hat der SS-Obersturmbannführer Fritz Meinert, der 1. Schutzhaftlagerführer. Dem Schutzhaftlagerführer untersteht die Leitung des Häftlingslagers im Konzentrationslager. Sein direkter Vorgesetzter ist der Lagerkommandant Eduard Weiter. Ihn hat man in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Das schmutzige Geschäft erledigen nun seine gnadenlosen Untergebenen.
Der Schutzhaftlagerführer Meinert ist gefürchtet für die Durchführung von Strafmaßnahmen und Exekutionen. Noch im letzten September ließ er neunzig russischen Gefangene hinrichten. Er ist unbeherrscht, tritt auf die Gefangenen ein, schlägt sie mit einer Peitsche oder hetzt Hunde auf sie.
Sie stehen da – zu Tausenden in Schach gehalten von neun Männern, die stolz ihre SS-Uniformen tragen und sich als Herrenmenschen fühlen, als Herren über Leben und Tod. Auch an diesem Morgen dringt die gellende Stimme Meinerts tief in ihr Gehirn. Sie werden sie nie mehr vergessen, sollten sie dieses Lager je überleben. „Rücksichtslos werde ich jeden vernichten, der sich nicht mit allem Einsatz der täglichen Arbeit widmet. Ihr seid ein jämmerlicher Haufen von Drückebergern, täuscht Krankheiten vor, um euch der Pflicht zu entziehen. Habt ihr euch je gefragt, warum man euch in Schutzhaft genommen hat? Ich will es euch sagen: weil ihr ohne Ausnahme faules, arbeitsscheues Gesindel seid, das die staatlichen Wohltaten und die Güte des Führers schamlos ausnutzt.“
So hören sie es jeden Morgen. Vor Meinert war es ein anderer Schutzhaftlagerführer. Sie sind alle von derselben Sorte, diese SS-Täter, beseelt von einem Vernichtungsauftrag, den ihnen der Reichsführer SS Heinrich Himmler immer und immer wieder eingebläut und mit Befehlen und Verordnungen untermauert hat.
In seinem neuesten Erlass jedoch befiehlt Himmler, die Arbeitskraft der Häftlinge zu gewährleisten. Die Häftlinge sind die Einzigen, die die Rüstungsproduktion für den noch tobenden und längst verlorenen Krieg in Gang halten können. Sie dürfen daher nicht mehr unnötig bestraft oder gequält werden. Einen wie Meinert erreicht ein solcher Erlass nicht. Nicht umsonst nennen sie ihn im Lager den „Schlächter“.
Allein, wie Meinert Neuankömmlinge begrüßt, wenn sie das Lagertor durchschritten haben, ist entlarvend. Der ganze Sadismus dieses SS-Mannes entfaltet sich in seinem ersten Satz, den er herausschleudert: „Hier hat niemand zu lachen! Der einzige, der hier lacht, ist der Teufel, und der Teufel bin ich!“ Auch vergisst er niemals zu erwähnen, dass es nur einen Weg aus dem Lager gibt, nämlich den durch den Schornstein des Krematoriums.
Das Lager ist umgeben von einem hohen Stacheldrahtzaun, der zudem unter Strom steht. Auf acht Wachtürmen sitzen je zwei SS-Wachen mit Maschinengewehren. In der Postenpflicht ließ Himmler niederschreiben, auf Häftlinge müsse ohne Aufruf und ohne warnenden Schreckschuss sofort geschossen werden. Bei zahlreichen unnatürlichen Todesfällen geben die KZ-Wächter einfach an, man habe Häftlinge bei einem angeblichen Fluchtversuch erschossen. Als Fluchtversuch gilt schon, wenn man nur den breiten Sicherheitsstreifen längs des Zaunes betritt. Ein tatsächlicher Fluchtversuch aber ist fast immer tödlich. Und gelingt er einmal, so erfasst man die Geflohenen fast immer schnell wieder, foltert sie entsetzlich und erschießt sie dann vor aller Augen.
Seit einer halben Stunde müssen sie sich schon die geifernden verbalen Exzesse Meinerts anhören. In der ersten Reihe einer Gruppe steht Hermann Glockenspiel. Zwei gelbe aufeinander gesetzte Winkel in der Form des Davidsterns an seiner Jacke, den die Nazis „Judenstern“ nennen, kennzeichnen ihn als Juden, wie alle hier in dieser Gruppe. In den Augen der SS bilden die jüdischen Häftlinge die niedrigste Stufe der Lagerhierarchie. Selbst in der unter den Häftlingen herrschenden Rangordnung stehen sie ganz unten.
Hermann Glockenspiel ist krank, er hat ebenfalls Typhus. Er konnte sich gerade noch auf den Platz schleppen. Neben ihm steht der neunjährige Erich, sein Sohn. Langsam schwinden Hermann die Sinne, dann wird er ohnmächtig, stürzt nach vorn und schlägt der Länge nach auf dem Boden auf.
Es ist, als habe Fritz Meinert nur auf einen solchen Vorfall gewartet. Sofort baut er sich vor dem Ohnmächtigen auf und schreit: „Du verdammte Judensau, willst dich nur vor der Arbeit drücken! Das werden wir dir austreiben, ein für alle Mal!“ Ein Wink von ihm und zwei SS-Sturmbannführer eilen herbei und greifen sich den armen Hermann Glockenspiel, dessen Nase von dem Sturz blutet. Sie schleifen ihn in die Mitte des Platzes. Dort steht eine Art Galgengerüst, das für alle Arten von schlimmsten Bestrafungen genutzt wird.
Die SS-Männer binden Hermann die Arme auf den Rücken und ziehen ihn mit einem Strick rücklings an dem Galgenpfahl hoch. Pfahlhängen – eine Bestrafung, die von der SS-Führung gar nicht mehr gern gesehen wird. Wegen der Erhaltung der Arbeitskraft. Meinert kümmert das nicht. Bei dieser mittelalterlichen Folter durchleidet der Delinquent unvorstellbare Schmerzen und Qualen.
Hermann ist immer noch ohnmächtig. Nun zerren ihm die SS-Schergen noch die Jacke herunter, sodass sein Oberkörper frei wird. Meinert zieht die Peitsche aus dem Gürtel, die er immer bei sich trägt, und schlägt wie besessen auf Hermann Glockenspiel ein. Ob der verstärkten Schmerzensflut erwacht Hermann aus seiner Ohnmacht und muss nun mit all seinen noch vorhandenen Sinnen schlimmste Qualen erdulden. Er schreit sein ganzen Elend hinaus. Dann wird er wieder ohnmächtig.
Der kleine Erich muss das alles mitansehen. Als der Vater zu schreien beginnt, will er sofort zu ihm eilen. Ein jüdischer Mithäftling, der hinter ihm steht, kann ihn gerade noch zurückhalten und hinter sich ziehen. Erich beginnt jämmerlich zu weinen. Der Mithäftling hält ihm den Mund zu. Nicht auszudenken, was geschieht, würde Meinert das bemerken. Der 1. Schutzhaftlagerführer macht auch vor Kindern nicht Halt.
Dann rücken die Häftlinge aus zum Arbeitseinsatz. Erich muss in die Munitionsfabrik, wo er Patronenhülsen zu sortieren und zu transportieren hat. Er muss sich sehr zusammenreißen, den ganzen Tag denkt er an den Vater.
+++
Nach dem Morgenapell will Fritz Meinert wie immer ein zweites Frühstück einnehmen. Er muss ja auch jeden Morgen in aller Frühe raus. Das hat er diesen Bastarden hier zu verdanken. Er begibt sich hinüber in das streng abgeteilte SS-Gelände, das doppelt so groß ist wie der Häftlingsbereich. Hier sind SS-Übungslager mit Kasernen und Schulungsräumen, Werkstätten, in denen auch Häftlinge arbeiten, Mannschaftsbaracken und Offizierswohnungen, eine Bäckerei sowie das Verwaltungsgebäude.
Meinert bewohnt mit seiner Frau eine geräumige Offizierswohnung. Als er die Wohnung betritt, duftet es schon nach frischen Kaffee. Seine Frau Gisela kennt seinen Arbeitsrhythmus genau, sie hat alles für das Frühstück vorbereitet. Gisela ist eine dünne, verhärmte Frau. Jede Art von Lebenslust scheint ihr abzugehen. Im Grunde weiß sie genau, was ihr Mann dort im Lager treibt, allein, sie will es nicht wahrhaben. Darauf ansprechen darf sie ihn schon gar nicht. Eine arische Frau hat ihre Pflicht zu erfüllen. Sie muss treu sein, opferbereit, leidensfähig, selbstlos. In ihrer Mutterrolle sorgt sie für stählerne, kampfbereite Nachkommen, sie ist die Quelle der Nation und die Bewahrerin hochwertigen Erbguts. Die Entscheidungen darüber treffen die Männer.
Die Meinerts haben einen erwachsenen Sohn, der sich schon zu Kriegsbeginn, da war er gerade 21 Jahre alt geworden, nach London abgesetzt hat. Mit den Nazis und ihrer fatalen Sehnsucht nach Krieg wollte er nichts zu tun haben. Obwohl Fritz Meinert den Knaben fast blutig prügelte, weigerte der sich sogar, der Hitlerjugend beizutreten. Ein solcher Sohn ist für einen SS-Mann eine Schande. Für Fritz Meinert ist er gestorben.
Am Frühstückstisch lässt der SS-Obersturmbannführer es sich gut gehen. Es mangelt an nichts. Brot, Wurst, Käse, alles da. Er hat es auch dringend nötig. Der Tag ist noch lang, wer weiß denn, wie sehr ihn das Häftlingspack noch ärgern wird? „Dieser Jude!“ entfährt es ihm und er schüttelt den Kopf. Gisela zuckt zusammen. Insgeheim hat sie eine Vorstellung von dem, was ein SS-Mann mit einem Juden macht, der seinen einzigen Sohn derart durchprügelt, wie sie es von Fritz erlebt hat.
Gisela weicht aus. „In der Früh wurde eine Rede von Hitler im Radio übertragen“, sagt sie. „Und? Was hat er gesagt?“ „Wir sollen durchhalten, dem Feind die Stirn bieten.“ Ja, das ist typisch Hitler, denkt Meinert. Von dem hat er nie viel gehalten. Nie kamen klare Aussagen, klare Befehle. Immer nur Durchhalteparolen. Was soll man von einem Österreicher auch schon erwarten? Der sieht ja nicht einmal wie ein Arier aus. Jetzt sitzt er wahrscheinlich in seinem Bunker, während draußen die Soldaten um ihr Leben kämpfen. Da sind Männer wie Himmler schon anders gestrickt. Da gibt´s kein Wenn und Aber.
Ansprachen vom Führer, Durchhalteparolen, das alles interessiert Fritz Meinert herzlich wenig. Für ihn ist wichtig, dass er da, wo man ihn einsetzt, seine Pflicht tut. Ein richtiger deutscher Mann tut immer seine Pflicht. Und ein SS-Mann ist immer ein richtiger deutscher Mann. Pflicht, das heißt in seinem Fall: Gnadenlos und ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefühle die vorgegebene Ordnung des Konzentrationslagers durchsetzen. Was zählt schon der einzelne Mensch, wenn es um etwas so Grandioses wie die nationalsozialistische Idee geht? Beseelt von diesen Gedanken macht sich Meinert auf ins Verwaltungsgebäude, um die Akten zu ergänzen, allein schon, um die eigene hervorragende Pflichterfüllung zu dokumentieren. Niemals hat es in Deutschland, da ist sich Fritz Meinert sicher, Institutionen gegeben, die ihre Aufgaben und Pflichten und die daraus resultierenden Ergebnisse genauer schriftlich festgehalten haben. Da muss man stolz sein, der Nachwelt solche Dokumente hinterlassen zu können.
+++
Als die Häftlinge am Abend nach Einbruch der Dunkelheit wieder ins Lager kommen, hängt Hermann Glockenspiel immer noch an dem Pfahl. Erneut vollzieht sich das Ritual des Strammstehens zum Apell. Der Mithäftling, der am Morgen den kleinen Erich zur Seite gezogen hat, nimmt den Jungen wieder beiseite und stellt sich mit ihm in die Reihe ganz hinten. Dort kann er den Vater nicht sehen.
Nach einer schier endlosen Litanei Meinerts mit wüsten Drohungen und Beschimpfungen folgt das anschließende Durchzählen. Während der Zählappell in der Frühe nicht zu lange dauern darf, weil die Arbeit rechtzeitig beginnen soll, ist es am Abend äußerst selten, dass er weniger als eineinhalb Stunden dauert, häufig sind es zwei Stunden. Wenn nur einer der Häftlinge einen Fehler macht, beginnt alles von vorne. Die Prozedur kann so Stunden dauern. Sollte das Zählen jedoch zur Folge haben, dass ein Häftling fehlt, so zieht das eine kollektive Bestrafung nach sich. Weiteres Strammstehen auf dem Platz bis zum Umfallen, Essensentzug, die ganze Palette dessen, was ein verbrecherisches SS-Hirn sich auszudenken vermag. Häftlinge, die schon lange im Lager sind, wissen zu berichten, dass einmal alle Lagerinsassen eine ganze Nacht und einen ganzen Tag ununterbrochen stehen mussten. Dabei durfte man sich nicht rühren.
Heute stimmt die Zahl. Die Häftlinge dürfen in ihre Baracken. Zeit für die Abendmahlzeit. Ob man das, was sie hier bekommen, als Mahlzeit bezeichnen kann? 350 Gramm Brot gibt es als Tagesration. Abends erhalten sie vier Mal wöchentlich 20 bis 30 Gramm Wurst oder Käse und dreiviertel Liter Tee. Drei Mal wöchentlich wird ihnen ein Liter dünne Suppe zugeteilt. Zieht man davon den permanenten Essensentzug für alle Arten von Vergehen ab, so bleibt kaum genug Nahrung fürs Überleben, wenn man bedenkt, dass sie den ganzen Tag lang hart arbeiten müssen.
Kurz vor der absoluten Nachtruhe um 21 Uhr erschallt aus den Lagerlautsprechern die verhasste Stimme des 1. Schutzhaftlagerführers: „Allen zur Warnung gebe ich hiermit bekannt: Der arbeitsscheue Jude hat sich erdreistet, sich einer weiteren Bestrafung zu entziehen und ist verreckt. Wer meint, sich beim Morgenapell durch Umfallen der Arbeit entziehen zu können, der muss mit drakonischen Strafen rechnen. Wir werden keinerlei Verweigerung dulden!“
Die Lautsprecher knacken, dann ist Ruhe. Alle haben es gehört. Der arme, am Pfahl aufgehängte Hermann Glockenspiel ist tot. Der Tod ist in diesem Lager ein täglicher Begleiter. Jeden kann es jeden Tag treffen. Keiner der Häftlinge ist daher überrascht oder sonderlich erschüttert.
Der kleine Erich aber hat es auch gehört. Der Vater ist tot. Nun hat er niemanden mehr. Die Mutter hatte man schon 1938 während der Novemberpogrome ergriffen, weil sie in einem jüdischen Laden in Berlin einkaufen wollte. Sie konnte und wollte den SA- und SS-Horden nicht nachgeben. Sie war eine starke Frau. Es wurde ihr auch zum Verhängnis, dass sie mit einem jüdischen Mann verheiratet war, obwohl sie selbst nicht Jüdin war. Rassenschande nannten die Nazis das. Man brachte sie in das KZ Sachsenhausen. Später dann wurde sie nach Auschwitz deportiert, wo sie in der Gaskammer ermordet wurde. Das jedoch wird Erich erst sehr viel später erfahren. Damals war er erst zwei Jahre alt. Sicher hat er unbewusst das plötzliche Fehlen der Mutter verinnerlicht.
Hermann Glockenspiel wollte trotzdem Deutschland nicht verlassen. Er war zwar jüdischen Glaubens, aber er war ja Deutscher. Den jüdischen Glauben hatte er im Grunde nie gepflegt. Sein tief gläubiger jüdischer Vater hatte im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft und war an der Westfront gefallen. Hermanns Mutter war bald darauf gestorben. Nach Beginn des unsäglichen, von Hitler 1939 entfachten Krieges wurde die Lage für die Juden in ganz Deutschland immer bedrohlicher. Der Bruder und die Schwester von Hermann Glockenspiel waren eines Tages verschwunden, dann auch weitere Verwandte wie Onkel, Tante, Cousinen, Neffen. Die jüdische Gemeinde in Berlin wurde von den Nazis systematisch dezimiert. Zunächst konnte Hermann sich mit Erich bei nichtjüdischen deutschen Freunden verstecken. Auch solche Menschen gab es. Als dann 1942 klar wurde, dass der Holocaust, die Judenvernichtung, im Machtbereich der Nationalsozialisten beschlossene Sache war, entschloss sich Hermann Glockenspiel, auch um die Freunde nicht in Gefahr zu bringen, mit seinem Sohn in die Schweiz zu fliehen. Fast im Angesicht der Schweizer Grenze wurden sie ergriffen und in dieses KZ verschleppt.
Verlassen und zu Tode betrübt sitzt Erich auf seiner verlausten Schlafstelle, einem elenden Verschlag in einer elenden dreistöckigen Konstruktion. Schlafen kann er nicht. Ohnehin muss er dieses Bett, das man wohl kaum so nennen kann, mit anderen Häftlingen teilen. Es ist eng geworden. Insgesamt gibt es 34 Baracken in zwei Reihen, mittig ist die Lagerstraße angeordnet. Unter einem früheren Kommandanten erhielten die Wohnbaracken die Bezeichnung „Blöcke“. Jeder Wohnblock besitzt zwei Waschanlagen, zwei Toiletten und vier „Stuben“. Jede Stube hat einen Wohn- und einen Schlafraum. Pro Stube sollen eigentlich 52 Personen untergebracht werden, das bedeutet 208 Häftlinge pro Wohnblock. Jetzt aber müssen sich bis zu 1.600 Gefangene einen Wohnblock teilen, das sind 300 bis 500 Personen pro Stube.
Es ist schon merkwürdig. Noch 1942 deportierte die SS alle jüdischen Häftlinge in das Vernichtungslager Auschwitz. Erich und sein Vater kamen erst später hierher in dieses Lager, was schon wie ein Wunder anmutet, da Juden in der Regel ohne Umschweife in die Vernichtungslager im Osten deportiert werden. Ab letztem Herbst aber und verstärkt seit Beginn dieses Jahres kommen immer neue Transporte mit Häftlingen aus dem Osten an. Es geht das Gerücht, dass die Russen immer weiter vordringen. Auch von Westen her sollen die Amerikaner auf dem Vormarsch sein. Welchen Sinn macht da die Räumung anderer Lager noch? Aber die Transporte gehen weiter. Inzwischen drängen sich etwa 35.000 Häftlinge auf engstem Raum. Jeden Tag treffen neue Eisenbahnzüge mit kranken und erschöpften Häftlingen ein. Als der Todestransport aus dem Lager Compiègne ankommt, sind von 2.521 Häftlingen bereits 984 tot. Nun ist das Lager völlig überfüllt. Für die Insassen wird das Leben, wenn man denn von Leben sprechen will, vollends unerträglich.
Jeder Häftling, der neu ankommt, ist auf die Hilfe der Mitgefangenen angewiesen. Sie müssen ihm die neuen Verhaltensregel erklären und ihm die wichtige Hoffnung auf ein Überleben machen. Die meisten Neuzugänge erleiden bei der Aufnahme-prozedur einen regelrechten Schock, der nicht selten mehrere Tage andauern kann. Die anfängliche Bestürzung weicht der Empörung, die wiederum Entsetzen auslöst. Der Schock zieht umso verheerendere Folgen nach sich, je weniger man psychisch auf diese Situation vorbereitet ist. In der ersten Zeit sind die Neulinge besonders bedroht, da sie von der SS bevorzugt schikaniert werden. Die höchste Sterblichkeit ist in den drei Monaten nach dem Eintreffen im Lager zu verzeichnen. In dieser Zeit kommen die Schwachen, die Kranken und diejenigen ums Leben, die nicht in der Lage sind, sich den brutalen Lebensverhältnissen anzupassen.
Die Blöcke im Lager sind nach Nationalitäten geordnet. Die Lebensbedingungen vieler Häftlinge orientieren sich daran, welcher Nationalität sie angehören. Mit der Ankunft neuer Häftlingsgruppen einer anderen Nationalität rücken die bereits anwesenden in der Sozialstruktur auf. Mit der Ankunft der Tschechen etwa bekamen die österreichischen Häftlinge oder die deutschen „Asozialen“ einen höheren Status. Mit der Ankunft der Polen und Russen rückten wiederum die Tschechen in der Hierarchie auf.
Der Alltag der Häftlinge ist ausgefüllt mit Arbeit, Hunger, Müdigkeit und Angst vor Krankheit und der Brutalität der sadistischen SS-Bewacher. Bereits der erste Lagerkommandant hat im Jahr 1933 eine Disziplinar- und Strafordnung erstellt, die später auch für alle anderen Konzentrationslager Gültigkeit bekam. Lagerkommandanten handeln seitdem in einem rechtsfreien Raum. Sie können nach Belieben schalten und walten. Es liegt im Ermessen eines jeden SS-Bewachers, angebliche Vergehen der Häftlinge festzustellen, und es ist zumeist vollkommen unvorhersehbar, was den Zorn eines SS-Mannes erregt und damit eine sogenannte Strafmeldung bewirken kann. Ein abgerissener Knopf an der Jacke oder ein Fleck auf dem Fußboden der Baracke, eine kurze Verschnaufpause bei der Arbeit, oder eine falsche Antwort – jeden Häftling kann zu jeder Zeit eine Strafmeldung treffen, was oftmals einem Todesurteil gleichkommt. Zu den häufigsten Strafen gehörte die Prügelstrafe, bei der der Häftling über einen dafür angefertigten Holzbock geschnallt wird und die Schläge des Ochsenziemers laut bis 25 mitzählen muss. Verliert er das Bewusstsein, so wird die Strafe wiederholt.
Das besonders Infame an all den Strafmaßnahmen ist die Tatsache, dass in den meisten Fällen alle Gefangenen dem Vollzug beiwohnen müssen. Nicht selten sind es auch Hinrichtungen. So können sie sich ausmalen, was ihnen täglich, stündlich drohen kann. Selbst der kleine neunjährige Erich und die anderen Kinder im Lager werden nicht verschont. Auch sie müssen das miterleben und werden so für ihr ganzes weiteres Leben psychisch geschädigt und traumatisiert. Wobei es gewiss für Erwachsene ebenso unerträglich ist. Für Erich ist es besonders schlimm. Er musste mitansehen, welches Leid seinem Vater angetan wurde.
Nicht nur die ständigen Repressalien ihrer Bewacher quälen die Insassen. Zusätzlich trägt die sogenannte Häftlings-Selbstverwaltung dazu bei. Die SS ernennt bestimmte Häftlinge zu Aufsehern über die Pflichten der Insassen. Das sind die Funktionshäftlinge. Sie sollen starken Druck auf andere Häftlinge ausüben, beispielsweise hinsichtlich der Ordnung und Reinlichkeit in den Baracken und bei der Kleidung. Die von Häftlingen besetzbaren Positionen bleiben überwiegend in den Händen politischer Gefangener, die sich schon früh lagerintern organisiert haben, da sie zumeist am längsten inhaftiert sind, viele seit Errichtung dieses Lagers im Jahre 1933. Aus ihrer politischen Vergangenheit bringen sie ein hohes Maß an Solidarität mit.
So wird der Betrieb und der Unterhalt des Lagers weitgehend selbständig von Häftlingen organisierte. Vom sogenannten „Lagerältesten“, der als Sprecher und Repräsentant der Gefangenen gegenüber der SS verantwortlich gemacht wird, bis zum „Stubenältesten“, der für eine „Stube“ innerhalb einer Häftlingsbaracke für Betteneinteilung, Sauberkeit, Essensverteilung usw. zuständig ist, ist das Lager straff hierarchisch organisiert. Die Arbeitsgruppen werden von Vorarbeitern, sogenannten Kapos, beaufsichtigt und angeleitet. Zu Kapos werden zumeist kriminelle Häftling ernannt, vielleicht, weil sie brutaler sind.
Sobald die Funktionshäftlinge ihre Aufgabe nicht zur Zufriedenheit erledigen, verlieren sie ihren Status wieder. Dann haben sie Reaktionen ihrer Mithäftlinge zu fürchten, wenn sie sich als verlängerter Arm der SS verstanden und sich so Vorteile verschafft haben. Mitte April suspendierte die SS Johan Meansarian und Albert Wernicke. Sie steckten die beiden von den Häftlingen gefürchteten Funktionshäftlinge in den Bunker. Man weiß nicht genau, was sie falsch gemacht haben in den Augen der SS. Ihre Mithäftlinge jedenfalls haben sie in erschreckender Weise drangsaliert.
Es gibt aber auch Funktionshäftlinge, die auf der Seite ihrer Mitgefangenen stehen. So wurde kürzlich Karl Wagner der Position des Lagerältesten enthoben, weil er sich geweigert hat, einen Häftling auszupeitschen. Auch er kam in den Bunker, obwohl alle erwartet hatten, dass man ihn sofort erschießen würde.
Unter Bunker ist zunächst das Lagergefängnis zu verstehen. Aber die kranken SS-Hirne haben sich noch eine andere Form des „Bunkers“ ausgedacht: den Stehbunker. Das ist eine Holzkiste, etwa 70 x 70 cm breit und knapp 2 Meter hoch. In dieser Kiste ist kein Fenster, so dass es dort immer dunkel ist. Die Holzbretter sind sehr nah nebeneinander gestellt, was die Sauerstoffströmung verhindert. Diese Strafe ist besonders grausam, da der Häftling jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl verliert und er in der Kiste weder sitzen noch liegen kann. Er bekommt kaum Luft. Zudem quälen den Betroffenen, neben schrecklichem Hunger und Durst, Tausende von Läusen, die in dem warmen Verschlag optimale Bedingungen haben. Es gibt Häftlinge, die dort acht Tage und Nächte verbringen mussten. Da sie die Kiste während dieser Zeit nicht verlassen durften, verätzte ihnen ihr Kot und ihr Urin die Haut. Sie wurden fast verrückt, abgesehen von den körperlichen Schäden, die sie erlitten.
Eine solche KZ-Umgebung muss für ein neunjähriges Kind wie ein Albtraum sein. Eigentlich kann Erich das alles nicht begreifen. Was tun diese schlechten Menschen da? Warum tun sie das? Jeder Tag eine einzige Qual, jeder Tag ein Inferno der Angst und der Gefühle. Die Ereignisse stürzen über Erich zusammen, er kann sie nicht mehr ordnen. Der Tod des Vaters treibt ihn in eine unendlich tiefe Depression, eigentlich möchte er auch tot sein. Er hat jetzt keinen Menschen mehr, der seine schützende Hand über ihm hält. Eines aber hat sich für alle Zeiten in sein kindliches Gehirn eingebrannt. Die Namen jener neun SS-Männer, die aktiv oder passiv am Tod des Vaters beteiligt waren, diese Namen wird er nie mehr vergessen.
Irgend etwas Entscheidendes ändert sich in diesen Tagen im Lager. Die Gerüchte scheinen sich zu bewahrheiten, die Amerikaner sind wohl schon weit vorgerückt. Die Häftlinge können bereits Geschützdonner vernehmen. Funktionshäftlinge berichten, dass im Bereich der Lagerkommandantur Akten verbrannt werden. Vom Kommandanten Eduard Weiter keine Spur. Hat er sich bereits abgesetzt?
Am 23. April kommt der Befehl, dass sich die mehr als 2000 jüdischen Häftlinge auf dem Appellplatz zum Abmarsch aufzustellen haben. Sie werden in Eisenbahnwaggons verladen, die bis zum 26. April wegen fortgesetzter Luftangriffe nicht abfahren. Die Vertreter der nationalen Häftlingsgruppen haben sich verabredet und sind entschlossen, die Evakuierung des Lagers soweit nur irgend möglich zu sabotieren. Die jüdischen Kinder haben sie versteckt und vor dem Abtransport bewahrt. So blieb auch Erich dieses Los erspart.
Am Morgen des 26. April wird eine neue Anweisung ausgegeben. Alle „reichsdeutschen“ und sowjetischen Häftlinge müssen sich zum Abmarsch auf dem Appellplatz aufstellen. Die Häftlingsgruppen können sich dem nicht widersetzen, man hätte jeden erschossen. Bis zum späten Abend verlassen 6887 Gefangene in Gruppen von je 1500 das Lager und marschieren in Richtung Süden los. Später erfährt man, dass unterwegs Hunderte erschossen werden, sobald sie nicht mehr weiter können, oder sie sterben an Hunger, Kälte und Erschöpfung. Erst Anfang Mai werden die einzelnen Marschkolonnen von amerikanischen Truppen übernommen, nachdem die begleitenden SS-Wachmannschaften unmittelbar vorher das Weite gesucht haben.
Der 29. April, ein Sonntag, ist angebrochen. Schon seit gestern ist die Spannung im Lager groß. Mitten in der Nacht, um drei Uhr, wird die beklemmende Stille plötzlich von Maschinengewehrfeuer und dem Geknatter von Handfeuerwaffen unterbrochen. Die 42. Infanterie-Division und die 45. Infanterie-Division der 7. US-Armee stehen vor dem Lager. Die wenigen zurückgebliebenen Männer der Waffen-SS, hauptsächlich die Schützen auf den Wachtürmen, bieten kaum Widerstand. Genau um 5.28 Uhr – nach der Uhr der Kommandantur – öffnet sich das große Lagertor. Beim Anblick der ersten amerikanischen Soldaten löst sich die Spannung der letzten Tage und Stunden und der Jubel der Gefangenen bricht los. Alle, die sich nur irgendwie auf den Beinen halten können, eilen auf den Appellplatz, um die Soldaten persönlich zu sehen, sie zu begrüßen, ihnen zu danken oder von der Ferne zuzujubeln, und mit einem Mal wehen neben der weißen Fahne der Kapitulation die einzelnen Länderflaggen der Gefangenen, die heimlich vorbereitet worden sind. Das Konzentrationslager ist befreit.
Die gesamte übrige SS-Mannschaft des Lagers aber ist verschwunden. Sie sind nicht nur sadistisch und gnadenlos, sie sind auch feige bis auf die Knochen. Aber warum sollte das NS-Personal sich heldenhafter verhalten als ihr ach so bewunderter Führer Adolf Hitler? Der wird sich am morgigen Tag der Verantwortung entziehen und sich erschießen. Einen Tag später wird ihm sein Propaganda-Großsprecher Goebbels mitsamt seiner Frau folgen, die auch ihre bedauernswerten sechs Kinder mit Zyankali umbringen lässt. Das Tausendjährige Reich hat nur zwölf Jahre überstanden.
Die amerikanischen Befreier sehen sich vor gewaltige Aufgaben gestellt: die Versorgung von mehr als 30.000 unterernährten Häftlingen, die medizinische Versorgung von Tausenden, die Eindämmung der noch immer herrschenden Typhusepidemie und die Bestattung der Toten. Die amerikanischen Militärbehörden stellen das Lager zunächst unter Quarantäne, um eine Ausbreitung der Epidemie zu verhindern.
+++
Sergeant Joe Harris ist einer der ersten Amerikaner, die das Lagertor durchschreiten. Er weiß zwar, dass im Lager eine Typhusepidemie herrscht, aber die amerikanische Soldaten sind gegen alle möglichen Krankheiten geimpft. So geht Joe auch unbefangen auf die Häftlinge zu und freut sich über ihren Jubel. Er macht einen Rundgang durch das Lager. In einem Verschlag hinter einer Baracke findet er zahllose Leichen, achtlos hingekippt wie Müll. Auf einem Bahngleis am Ende des Lager steht ein Waggon, ebenfalls bis zum Rand gefüllt mit Leichen. Joe Harris ist erschüttert.
Dann geht er noch in eine der Baracken. Er will alles sehen und alles wissen. Die Baracke ist leer, weil die nun befreiten Häftlinge alle draußen auf dem Platz sind. So leben nicht einmal Hunde, denkt er. Er geht durch alle Räume, überall das gleiche Bild. Der Eindruck einer kompletten Verwahrlosung, gepaart mit einem Gestank, der an Verwesung erinnert. Aber da, was ist das? Da sitzt ja noch jemand. Joe geht heran und kann es nun erkennen. Da sitzt ein kleines, ausgehungertes Kerlchen und starrt mit leeren Augen vor sich hin. Es ist Erich. Er kann sich nicht freuen wie die anderen, er kann gar nichts mehr.
Den Kleinen kann ich hier nicht sitzen lassen, denkt sich Joe. Er ist ein fürsorglicher Mensch und wenn es um Kinder geht, dann ist er zu allem bereit. „Come on“, sagt er und hält dem Jungen die Hand hin. Erich schreckt auf. Erst jetzt bemerkt er den großen Mann, der vor ihm steht. Er sieht die ausgestreckte Hand. Plötzlich hat er das Gefühl, dass er diese Hand ergreifen muss, wenn es für ihn überhaupt noch eine Zukunft geben soll. Wie ein rettender Strohhalm erscheint sie ihm. So legt er seine kleine, schmutzige, fast nur noch aus Knochen bestehende Hand in die große des Amerikaners.
Mit dem Jungen verlässt Joe den Lagerbereich und steigt vor dem Tor in seinen dort stehenden Jeep. Er fährt in das Feldlager, das die Amerikaner im Außenbereich der nahen Ortschaft errichtet haben. Dort begibt er sich zuerst in das Feldlazarett. „Gebt diesem Kerlchen mal ein Antibiotikum“, sagt er dem Arzt, „im Lager grassiert Typhus. Ich glaube nicht, dass der Junge krank ist, aber sicher ist sicher. Und auch sonst könnt ihr ihn mal untersuchen. Er sieht doch recht geschwächt aus. Ich glaube, er hat auch Läuse.“
Während Erich medizinisch versorgt wird, sucht Joe in den Zelten des Feldlagers nach einem Kollegen, von dem er weiß, dass er Deutsch kann. Schließlich findet er ihn in der Kantine. „Hi Bertram“, spricht er ihn an, „ich habe in diesem schlimmen Lager einen kleinen deutschen Jungen aufgetrieben und möchte wissen, wie es um ihn steht, wo er normalerweise wohnt, ob er noch Verwandte hat und so weiter. Kannst du ihn mal interviewen? Er ist im Augenblick im Lazarettzelt.“ „Klar, kein Problem“, meint Bertram und macht sich gleich auf. Bertrams Eltern gingen in den 1930er Jahren nach Amerika. Da war Bertram 15 Jahre alt. Er kann also noch sehr gut Deutsch.
Zunächst muss Bertram das Vertrauen des Jungen gewinnen, denn es sieht so aus, als habe Erich seine Sprache verloren. Er erzählt ihm, wie er in Deutschland in die Schule gegangen ist und dass seine Eltern dann nach Amerika wollten. Das habe ihm zunächst gar nicht gefallen, weil er all seine Freunde verlieren würde. Dann waren sie in Amerika und er musste die fremde Sprache lernen. Das sei ihm leichter gefallen als gedacht. Und auch neue Freunde habe er schnell gefunden. Dann sei der Krieg ausgebrochen und er habe sich schließlich entschlossen, Soldat zu werden, weil es um Deutschland und um die Befreiung ging. So wurde es dann möglich, dass man auch ihn befreien konnte aus dem Konzentrationslager.
Langsam fast Erich Vertrauen in den jungen Mann, der so freundlich mit ihm spricht und ihm seine Geschichte erzählt. Freundlichkeit von fremden Menschen ist er nicht mehr gewohnt. Nach und nach kann Bertram nun den Jungen ausfragen und erfährt alles von ihm, soweit dieser sich erinnern kann. Auch von dem schrecklichen Ende seines Vaters Hermann Glockenspiel.
Bertram verabschiedet sich von Erich: „Ich schicke dir den Joe wieder, der wird sich um dich kümmern. Das ist ein guter Kerl!“ Er geht zurück in die Kantine, wo Joe Harris gerade eine Mahlzeit einnimmt. „Ja, Joe“, sagt er, „da hast du einen schwierigen Fall erwischt. Der kleine, dünne Junge heißt Erich. Er stammt aus Berlin. Sein Vater, ein Jude, wurde hier im Lager umgebracht. Von seiner Mutter und ihrer Verwandtschaft weiß Erich nichts. Er kann sich erinnern, dass die Verwandten des Vaters alle aus Berlin verschwanden, als er sechs Jahre alt war. Sie waren auch alle Juden und wurden wohl deportiert. Erich ist jetzt neun Jahre alt. Typhus hat er nicht, meint der Arzt. Aber er hat Läuse. Der Arzt rät, ihn erst einmal unter die Dusche zu stellen und dann ein Entlausungsmittel anzuwenden. Außerdem hat der Junge entsetzlichen Hunger, aber man muss ihn erst langsam an normales Essen heranführen. Was willst du jetzt machen mit dem Jungen?“ „Darüber muss ich erst mal nachdenken. Aber er ist ein Waisenkind. Wenn nicht etwas Außergewöhnliches passiert, dann wird er in einem Waisenhaus landen. Wieder eine Art Lager. Ob er das ertragen kann? Ich glauben kaum.“
Joe Harris bedankt sich bei Bertram und macht sich auf ins Lazarettzelt. Dort sitzt Erich auf einer Liege und spielt versonnen mit leeren Medikamentendosen, die man ihm gegeben hat. „Hey, little man“, sagt Joe, „come on and let´s see what we can do for you.” Das versteht Erich zwar nicht, aber er vertraut dem großen Mann. Joe lässt sich das Entlausungsmittel geben. Der nächste Weg führt ihn und Erich in das Materialzelt, wo auch Bekleidung ausgegeben wird. „Habt ihr irgend etwas an Kleidung, das diesem kleinen tapferen Soldaten passen könnte?“, fragt Joe. „Du wirst lachen, Joe“, sagt der Kamerad, „aber wir haben sogar Kinderkleidung dabei. Ich weiß nicht, wer in der US-Army auf diese Idee kam, aber es muss schon ein sehr weitsichtiger Mensch gewesen sein.“ Schnell finden sie passende Sachen.
Dann geht es weiter zum Hygienezelt. Die Amerikaner sind hervorragend ausgerüstet. Joe bedeutet Erich, seine Häftlingskleidung abzulegen. Dann geschieht für den Jungen etwas Sensationelles. Joe stellt ihn unter eine Dusche und von oben rinnt sauberes, warmes Wasser auf einen kleinen Körper, bei dem man jede einzelne Rippe zählen kann. Erich kann gar nicht genug davon bekommen, erstmals seit langem stiehlt sich ein Lächeln in sein Gesicht. Joe lässt ihn gewähren.
Ehe das dünne Kerlchen gänzlich aufweicht, dreht Joe das Wasser ab. Er trocknet ihn ab und stäubt ihn mit dem Entlausungsmittel ein. Zum guten Schluss wird Erich neu eingekleidet. Die Häftlingskleider nimmt Joe mit spitzen Fingern auf. Sie gehen auf eine freie Fläche zwischen den Zelten, Joe zückt ein Feuerzeug und schon geht der verhasste gestreifte Anzug in Flammen auf. Für Erich ist es, als würde auch seine gequälte Seele durch diesen Akt der Verbrennung ein wenig befreit werden.
Dann gehen sie zur Kantine und Joe bestellt für den Jungen einen Haferbrei. Der Koch wundert sich. Haferbrei wird von Soldaten eher nicht verlangt. Aber gut! Erich verschlingt den Brei in Windeseile, denn es war das Gesetz des Lagers, dass man sein dürftiges Essen schlingen musste. Er möchte noch mehr davon, aber Joe bedeutet ihm durch Handzeichen, dass man es langsam angehen muss. Er rührt auf seinem Bauch herum und Erich versteht: Es könnte ihm sonst übel werden. Ein Glas warme Milch gönnt ihm Joe aber noch. Milch! Wann hat er zuletzt Milch getrunken?
Joe Harris hat noch etwas Wichtiges vor. Aber erst muss er Erich noch irgendwo unterbringen. Er nimmt ihn mit in seine Unterkunft, in das Zelt, in dem er mit einigen anderen Kameraden schläft. Zwei davon sind schon da und spielen Karten. „Hey, Joe“, fragt einer scherzhaft, „hast du ein Kind bekommen?“ „Ja“, sagt Joe, „aber es war eine Jungfrauengeburt.“ Die Jungs lachen.
Joe baut eine weitere Liege neben seiner auf und legt Decken darauf. Er bedeutet Erich, dass das nun sein Lager ist. Erich staunt. Richtige Decken, die auch warm aussehen. Er legt sich auf die Liege, deckt sich zu und ehe Joe es sich versieht, schläft der Junge ein. Das ist der Stress, denkt er. „Passt ein wenig auf den Kleinen auf“, sagt er zu seinen Kameraden, „ich muss mal zum Colonel.“
Joe begibt sich zum Befehlshaber der Einheit, Colonel Sparks. Der sitzt in seinem Zelt und brütet über Bergen von Papieren. „Kann ich Sie kurz sprechen, Colonel, Sir?“, fragt Joe. „Aber nur ganz, ganz kurz, Sergeant“, lacht der Colonel, „ich habe keine Ahnung, wie ich all die Lagerprobleme in absehbarer Zeit lösen soll. Was gibt es denn?“
„Sir, ich habe heute einen Rundgang durch das KZ gemacht. Einfach nur grauenhaft. Überall Leichen. Wie kann ein kultiviertes Volk wie die Deutschen nur solche Verbrecher schalten und walten lassen? Bei diesem Rundgang nun stieß ich auf einen kleinen, neunjährigen Jungen. Er ist, wie sich herausstellte, ein Waisenkind. Seinen Vater hat man vor kurzem hier im Lager ermordet. Er macht einen ziemlich traumatisierten Eindruck. Ich habe ihn mit hergebracht und ihn erst einmal mit dem Nötigsten versorgt. Ich weiß, wir können nicht alles Elend lindern, aber in diese Fall fühlte ich mich an meine menschlichen Pflichten der Nächstenliebe gebunden. Ich habe mich entschlossen, den Jungen mit nach Amerika zu nehmen. Ist das denkbar?“
„Aha, Sergeant, Kollaboration mit dem Feind! Scherz beiseite! Es ehrt Sie, dass sie sich um das Kind kümmern wollen. Wenn ich es recht überblicke, dann werden Sie ja ohnehin in Kürze wieder in die Heimat versetzt. Sie sind schon sehr lange bei der Offensive dabei. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob ein Soldat ohne Weiteres ein Kind mitnehmen darf. Ich kenne aber auch keine Verordnung, die dagegen spricht. Und Kinder können wir in Amerika immer gebrauchen. Vorschriften hin, Vorschriften her, ich schreibe Ihnen einfach einen Befehl, den Jungen mit in die USA zu nehmen. Dann müssen Sie allerdings sehen, wie Sie damit klar kommen unterwegs.“
„Danke, Sir, das ist sehr großzügig von Ihnen. Ich denke, ich werde schon klar kommen.“
„Bestens, Sergeant. Aber jetzt ganz geschwind: abtreten! Die Papiere, die Papiere!“ Und schon wälzt der Colonel wieder die Akten.
Erich schläft bis zum nächsten Morgen durch. Das Soldatenleben um ihn herum, das auch nachts ständig abläuft, stört ihn nicht im Mindesten. Als er dann endlich aufwacht, ist er zunächst verwirrt. Wo bin ich, denkt er. Dann kommt die Erinnerung. Der große Joe hat ihn aus dem Lager geholt, das Duschen, die neuen Kleider und das Verbrennen der alten.
Joe hat heute frei, weil er drei Tage hintereinander Dienst geschoben hat. So kann er sich um den Jungen kümmern. Zunächst gehen sie frühstücken. Da hat der Koch ein Buffet aufgebaut, dass dem spindeldürren Erich die Augen übergehen. So etwas hat er noch nie gesehen. Er weiß nur, dass seit dem Kriegsbeginn Schmalhans Küchenmeister war. Im Lager dann war sogar dieser Küchenmeister gänzlich verschwunden.
Joe zeigt ihm, was er am besten essen sollte. Cornflakes mit warmer Milch, das schmecke gut, macht Joe in Zeichensprache deutlich. Ja wirklich, das schmeckt herrlich. Dann darf er noch einen Toast mit Käse essen. Aber immer langsam! Der Magen muss sich erst gewöhnen.