
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Drei Kinder verleben Ende der 1950er Jahre, Anfang der 1960er Jahre ihre Ferien bei ihrer Tante, die einen merkwürdigen Namen hat. Die Tante wohnt in einem Haus inmitten von Bahndämmen, Bombentrümmern und einem verlassenen Dachdeckerlager. Ein großer, geheimnisvoller Garten gehört auch zum Haus. In diesem Garten lebt ein Schimmel, den die Tante einmal von einem Bauern gekauft hat. Der Schimmel erweist sich als Wundertier, das Menschen in besondere Situationen versetzen kann. Er nimmt in dem Augenblick, in dem das Wunder geschieht, eine grüne Farbe an. Die Kinder vergnügen sich auf dem Grundstück und besonders auch auf dem Dachboden und im Keller des Hauses. Dank des Wunderpferdes geschieht es dann aber bald, dass sie in abenteuerliche Geschichten verstrickt werden. So werden denn die Ferien für die Kinder zu einer Serie von unvermuteten Abenteuern, die ihnen viel Mut und Einfühlungsvermögen abverlangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tante Tandelei
und der grüne Schimmel
Rolf Esser
Impressum
Autor: Rolf Esser © 2022
Umschlaggestaltung, Layout, Grafik: Rolf Esser © 2022
ISBN Paperback: 978-3-347-70665-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-70666-8
ISBN E-Book: 978-3-347-70667-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Rolf Esser
Tante Tandelei
und der grüne Schimmel
Roman für Kinder
Inhalt
Kapitel 1 – Die Tante und ihre Welt
Kapitel 2 – Das Wunderpferd
Kapitel 3 – Wie im Märchen
Kapitel 4 – Mit Tom und Huck am Mississippi
Kapitel 5 – Das Grab im Garten
Kapitel 6 – Unser ganz normales Leben
Kapitel 7 – Eiskalte Weihnachtsferien
Kapitel 8 – Auf den Spuren Frankensteins
Kapitel 9 – Unter Rittern
Kapitel 10 – Unter Dinos
Kapitel 11 – Schulstress, Erdbeeren und Gladiatoren
Kapitel 12 – Unter Künstlern
Kapitel 13 – Im Reich der Kobolde
Kapitel 14 – Auf Nemos Spuren
Kapitel 15 – Das Ende aller Wünsche
Nachtrag
Verzeichnis der Bildquellen
Kapitel 1
Die Tante und ihre Welt
Tante Tandelei, dieser Name war für uns Kinder der Inbegriff all unserer Kinderwünsche. Mit ihm verbanden wir die Lust auf großartige Abenteuer, unerklärliche Geschehnisse und heimliche Sehnsüchte. Es war nicht so, dass wir von Tante Tandelei Sensationen erwarteten. Es waren vielmehr die alltäglichen Überraschungen, die sie in unerschöpflicher Weise bereithielt und mit denen sie uns zu begeistern wusste. Aber sie war durchaus auch für Fabelhaftes und Unerklärliches gut. Immer wieder konnten wir in neue Welten eintauchen, jedenfalls kamen sie uns neu vor, obwohl sie doch mitunter so naheliegend waren, gewissermaßen vor unseren Augen ausgebreitet. Dennoch sahen wir sie erst, wenn Tante Tandelei sie vor uns entfaltete.
Woher kam eigentlich dieser merkwürdige Name? Andere Tanten hießen Tante Ingrid oder Tante Amalie, aber Tandelei? So genau wusste das niemand. Irgendwann in grauer Vorzeit hatte ihr jemand den Namen verpasst. Das musste aber schon lange her sein, denn die Tante war schon ziemlich alt, wie wir Kinder fanden. Vielleicht steckte ein tiefer Sinn hinter dem fremdartigen Begriff Tandelei. Vielleicht kam der Name auch daher, dass die Tante gerne alte Sachen sammelte, die andere Menschen als Tand bezeichnen würden. Wir haben sie nie nach dem Ursprung ihres komischen Namens gefragt, weil er uns einfach so selbstverständlich erschien.
Nun könnte man meinen, eine Tante mit solch einem verwunschenen Namen wohnte wie die Hexe aus Hänsel und Gretel tief im Wald an einem sprudelnden Bächlein, über das Rehe springen und denen Füchse auf der Jagd folgen.
Nein, Tante Tandeleis Reich war nicht ganz so idyllisch gelegen, aber nicht weniger aufregend für uns Kinder. Ihr Haus war das Haus am Bahndamm, zu dem eine schmale, lange Zufahrt, eher ein Weg, führte. Ein gedrungener, roter Backsteinbau, von außen eher trist und ohne jeden Schmuck. Links von der Zufahrt stieg das Gelände an, nach rechts hin ging es ziemlich steil hinunter zu doppelten Bahngleisen, die rund um die Uhr von schnaubenden, dampfenden Zügen aller Art befahren wurden. Sie kamen von irgendwo her und fuhren nach irgendwo hin. Wer wusste das schon genau?
Am Ende der Zufahrt, geradeaus, hockte gewissermaßen wie eine brütende Henne das Haus. Seine Fenster blickten recht trostlos in die Gegend, als wollten sie die Stimmungslage der Hausbewohner spiegeln. Die schrundige, zerklüftete Giebelwand zu den Gleisen hatte keinerlei Fenster. Unter der Wand duckte sich ein maroder Schuppen. Das alles sah wenig einladend aus, doch es war der pure Schein, denn für uns war es ein kleines Paradies.
Blickte man über die Gleise hinweg, so sah man auf ein konservativ-hässliches Schulgebäude, ebenfalls aus Backstein. Rechts daneben, hinter einer grauen Mauer, befand sich das wenig einladende Lager einer Kohlenhandlung, von der fast ohne Unterbrechung wütendes Hundegekläff herüber drang. Wer Kohlen oder Briketts haben wollte, der musste sich zunächst vor dem Kläffer fürchten. Die unzähligen, täglich am Haus vorbei rauschenden Züge nahm man nach einiger Zeit kaum noch wahr. Für uns jedoch waren die Züge pures Abenteuer. Wir wagten uns nahe an die Schienen heran, was natürlich verboten war. Man durfte sich eben nicht erwischen lassen. Dann spürten wir den Sog der Züge und atmeten den dicken Dampf, der aus allen Poren der Loks zu kommen schien. Wir legten Nägel auf die Schienen, die von den Wagen des Zuges völlig platt gewalzt wurden und hielten am Ende mit Begeisterung ein Stück »Nagel-Blech« in den Händen.
Mehr noch als die Züge aber war es der Garten, der uns anzog. Ein hoher Lattenzaun und dahinter ein grüner undurchdringlicher Urwald, fern jeder menschlich pflegenden, gärtnernden Hand, voller Geheimnisse und Mythen. Niemandsland, Fremdland, begehrt und doch unerreichbar. Für uns Kinder, die wir hier im Haus am Bahndamm zu Gast waren, schien es der Garten Eden zu sein. Welche süßen Früchte mochte er bergen, welche geheimen Verstecke könnte er unseren neugierigen Blicken offenbaren? Der Garten war immer verschlossen, wir durften nicht hinein und es gab auch auf den ersten Blick keine Möglichkeit, einmal heimlich hinein zu gelangen. Tante Tandelei war da sehr eigen, was ihren Garten anging. Wir verstanden es nicht so recht. Warum konnte man nicht mal in den schönen Garten gehen und sich umschauen?
Eine Besonderheit jedoch offenbarte uns der Garten. Direkt hinter dem hohen Lattenzaun zum Haus hin gab es eine Wiese am Rande des grünen Urwalds, an deren Seite sich ein Stall befand. Auf der Wiese graste den ganzen Sommer über ein Schimmel. Im Winter war er im Stall am Wiesenrand, wo er Heu bekam. Das war nicht einfach ein Pferd. Manchmal stand der Schimmel da und schaute einen direkt an und man fühlte sich auf irgend eine Weise regelrecht ertappt. Manchmal blickte er auch in eine uns unbekannte Ferne. Dieser Schimmel, so wollte es uns scheinen, barg ein Geheimnis, das nur Tante Tandelei kannte.
Immerhin, wenn es schon nicht der Garten war, so gab es Ausweichmöglichkeiten für Entdecker und Eroberer zu Hauf, hier am Bahndamm. Die Zufahrt zum Haus mündete unten in die Straße. An der Straße war eine Bahnschranke, gegenüber stand das Bahnwärterhäuschen. Wir kannten die Bahnwärter. Wenn sie gut drauf waren, durften wir rüber kommen und die Schranke hochkurbeln. Wenn sie schlecht drauf waren, sahen sie, wie wir unten bei den Schienen waren und machten ein Heidentheater. Erwischen konnten sie uns nicht, denn sie durften ihren Platz nicht verlassen.
Das Haus am Bahndamm. Eigentlich falsch, denn es gab gleich zwei Bahndämme. Der zweite Damm war eine hohe Mauer auf der anderen Seite des Hauses hinter dem Garten. Sie mochte etwa sieben, acht Meter hoch sein. In einer langen Linie wurde das Haus so einseitig abgeschottet. Man guckte gegen die Wand. Insgesamt entstand der Eindruck, als stünde das Haus auf einer Insel zwischen den Bahngleisen, losgelöst von Raum und Zeit. Was der Hexe ihr Wald, das war der Tante ihre Insel zwischen den Bahngleisen.
Denn oben auf der Mauer fuhren ebenfalls Züge. Es waren nicht die schnellen Fernzüge und die Güterzüge der unteren Bahnlinie. Da oben wurde Eisenerz transportiert und Koks, Schlacke, alles, was zum Betrieb eines Hochofens nötig war. Tag und Nacht. Auch an diese Geräuschkulisse gewöhnte man sich, wenn man, wie Tante Tandelei, hier seit unendlich vielen Jahren wohnte.
Weit hinter dem Haus war oben auf der Mauer die Waage mit dem Waagenhaus. Dort wurden die einzelnen Zugwagen mitsamt ihrem Inhalt gewogen. Das war auch spannend für uns. Denn es gab Rangierer dort oben, die den Zugverkehr auf der Waage überwachten. Sie hatten Trillerpfeifen und bestimmte Signalpfiffe: Zug stopp! Zug weiter fahren! Mit der Zeit hatten wir die Pfiffe raus. Uiiii-uiiii-uiiii-iiii pfiffen wir und schon fuhr der Zug los und aus dem Waagenhaus stürzte entnervt der Waagenmann und schrie die entgeisterten Rangierer an, die nicht wussten, wie ihnen geschah. Das machte Spaß!
Das Haus am Bahndamm. Von Zügen bedrängt. Im Schatten des Hochofens. Wir sahen den Hochofen nicht, aber wir waren trotzdem seine Augenzeugen. Er legte seinen täglichen unübersehbaren Schatten über das Haus. Aus dem im Hochofen gewonnenen Eisen sollte Stahl werden. Thomasstahl. Das flüssige Roheisen kam in die Thomasbirne und wurde ausgeblasen. Wie bei einem Vulkanausbruch färbte sich der ganze westliche Himmel hinter dem Haus dann rot. Nein, es war mehr ein bräunlich-roter Ton, ein Gemisch aus dem Widerschein glühenden Erzes und den austretenden Gasen und Stäuben. Diese Stäube nannte man Thomasmehl, wurde uns gesagt. Das Thomasmehl lag zentimeterdick auf den Fensterbänken des Hauses und ließ die Scheiben erblinden. Thomasmehl dämpfte draußen alle Farben. Im Sommer sahen die Pflanzen aus wie verschleiert. Der verschlossene Garten machte dadurch einen noch etwas verwunscheneren Eindruck. Im Winter erschien der Schnee rings um das Haus drecksgrau statt weiß. Und Thomasmehl war wohl auch nicht gesund.
Wir Kinder kannten die Zusammenhänge nicht. Wir hatten genug anderes zu tun. Denn es gab noch mehr zu entdecken zwischen den beiden Bahnlinien. Kam man aus der Haustür und ging rechts um die Ecke, dann sah man eine kleine Holzhütte, die sich mühsam an die hohe Bahnmauer zu klammern schien. Wir näherten uns der Hütte nur, wenn es unbedingt nötig war, denn dort stank es erbärmlich. Sie war das Plumpsklo des Hauses. Zwei nebeneinander liegende Holztüren führten in zwei Kammern, in denen jeweils eine Bank angebracht war mit einem großen Loch in der Mitte der Sitzfläche. Darunter befanden sich die Jauchegruben, die einmal im Jahr von einem Tankwagen mit Pumpe geleert wurden. Zum Abwischen nahm man Zeitungspapier. Wer kannte damals schon Toilettenpapier in Rollenform? Gab es das überhaupt? Im Sommer stieg die Geruchsbelästigung proportional zum Thermometer, im Winter fror man sich den Allerwertesten ab. Tante Tandelei jedoch weigerte sich beharrlich, ihr Haus zu modernisieren. Es war schon immer so und es war gut so. Was muss man so modernen Kram wie eine Toilette im Haus haben?
Das hatte natürlich zur Folge, dass man sommers wie winters auch nachts hinaus musste, wenn man musste. Wenn es draußen Stein und Bein fror, konnte man das vergessen. Man wäre auf den Sitzflächen des Plumpsklos festgefroren. Zum Glück stellte uns die Tante im Winter immer einen Nachttopf hin, den man zur Not benutzen konnte.
Wir mieden, wenn wir draußen unterwegs waren, das Plumpsklo möglichst und liefen ein paar Schritte weiter hinter das Haus. Abenteuer pur! Eine von Bomben zerrissene Gebäuderuine, ein Überrest des Krieges, öffnete ihren Kellerschlund, aus dem sich Sträucher und kleine Bäume empor wanden und zum Licht reckten. Links neben der Ruine ging der Weg weiter. In den zerrissenen Keller trauten wir uns nicht. Es sah ziemlich gefährlich aus, wie die Wände und Stürze da auf halb acht hingen. Am Rand der Ruine stapelten sich Dachpfannen, kaputte, ganze. Dahinter Teerfässer, kaputte, ganze. Es war wohl das Lager eines Dachdeckers. Gab es die Firma noch? War sie vielleicht im Krieg auf der Strecke geblieben? Wir stellten uns die Fragen nicht und wenn wir es getan hätten, wären uns die Antworten ziemlich egal gewesen. Wir wussten nichts vom Dachdecker. Und wir wussten nichts vom Krieg und seinen Folgen und warum hier alles so kaputt war, obwohl die Tante oft davon erzählte. Für uns war kaputt gleichbedeutend mit aufregend. Alles andere konnten wir uns nicht vorstellen.
In heißen Sommern lief der Teer aus den lecken Fässern heraus auf den Boden. Manchmal lag der Teer auch schon da in Form von schwarzen, harten Klumpen, die in der Sonnenglut weich wurden. Wir fanden dann oft Vögel aller Art in diesen Teerfallen. Die Vögel lebten noch, aber man konnte sie nicht befreien. Und wäre es möglich gewesen, die Vögel hätten keine Füße oder Beine mehr gehabt. Wir nahmen einen großen Ziegelstein und warfen ihn auf die armen Vögel, die sofort tot waren. Wir waren gewiss Tierfreunde. Was sonst hätten wir tun können? Mit Tierquälerei hatte das nichts zu tun, sondern mit Erlösung. Manchmal tappten wir Kinder selbst in die Teerfallen und hatten dann den ekligen Teer an unseren Händen oder Füßen. Dann musste die Tante ran. Sie nahm keinen Ziegelstein, sondern Margarine. Margarine war ihr Geheimmittel gegen Teer.
Hinter den Teerfässern an der Mauer gab es was ganz Besonderes. Dort stand schräg angelehnt ein eisernes Gerüst, riesig und merkwürdig anzusehen. Wir wussten zunächst nicht, was es damit auf sich hatte, bis es uns jemand erklärte. Das Gerüst war ein Lastwagenanhänger. Wenn man es wusste, konnte man es auch erkennen. Die Achsen ragten nach oben und die unbereiften Eisenringe der Räder stemmten sich auf der einen Seite unten in den Boden und waren oben frei zugänglich. Wir konnten an dem Gerüst hochklettern, die beiden Räder oben ließen sich noch drehen. Nun waren wir wahlweise selbst Lastwagenfahrer, Schiffskapitäne oder Kranführer. Von hoch oben hatten wir den Überblick und konnten die Welt ansteuern. Unter der Schräge des Anhängergerüsts konnten wir bequem an der Wand entlang durchgehen, gut versteckt hinter den Teerfässern und Dachpfannen davor. Es war, als erkundeten wir eine Höhle.
Folgte man dem schmalen Pfad zwischen dem Anhängergerüst und der Kellerruine, zwischen Dachpfannen und Fässern hindurch, und bog dann rechts um die Ecke, gelangte man an einen Wellblechschuppen mit blinden Fenstern. Wir hatten es aufgegeben hindurch zu starren. Man sah sowieso nichts. Drinnen gab es, das wussten wir, noch mehr Teerfässer, alte Dachrinnen, Balken, aber auch das Heu für den Schimmel, das die Tante hier ballenweise stapelte. Also weiter! Viel interessanter waren die dichten Holundersträucher beim Schuppen. Holunder war toll! Man konnte prima Stöcke daraus schneiden und aus ihnen das Mark herauspuhlen. Dann hatte man ein Blasrohr, durch das man mit den Holunderbeeren schießen konnte.
Wenn wir beim Schuppen hinten links um die Ecke bogen, wurde es besonders spannend. Denn dort ging es im Gebüsch steil aufwärts. War man oben, hatte man die Höhe des Waagenhauses erreicht und konnte sehen, was dort eigentlich los war. Auf der Höhe stand ein einsamer Kirschbaum, der im Sommer herrliche helle, weiß mit Thomasmehl gepuderte Kirschen trug. So kletterten wir mit Vorliebe auf den Kirschbaum, naschten die leckeren vollgestaubten Früchte und betrachteten die unter uns liegende Reihe der Werkszüge, die gewogen wurden, aus der Vogelansicht.
Wo lebte Tante Tandelei nun eigentlich? Es war eine Umgebung, die geprägt war von Verfall, Chaos, Gesundheitsgefahren, Verkehr und Schwerindustrie. Aber es war auch eine Umgebung mit vielen Überraschungen und Abenteuern und einem geheimnisvollen Garten, in dem ein ebenso geheimnisvoller Schimmel sein Dasein fristete. Es war ihr Zuhause. Es war ihr Hexenwald.
Die Umgebung war das Eine. Das Andere war das unscheinbare rote Ziegelhaus selbst. Betrat man es, so betrat man eine andere Welt. Durch die Haustür gelangte man in einen langen, dunklen Flur, von dem rechts und links je zwei Türen abgingen. Am Ende war eine Treppe, die nach links oben ins Dachgeschoss führte. Unter der Treppenschräge gab es eine weitere Tür, hinter der die Kellertreppe verborgen war.
Durch die erste Tür rechts im Flur gelangte man in die Küche. Die Küche war der eigentliche Stammplatz von Tante Tandelei. Hier schaltete und waltete sie, umgeben von einer Unzahl von Tiegeln und Töpfen, Kannen und Pfannen. Ihr strategischer Mittelpunkt war der Herd, ein riesiges Gebilde. Oben gab es drei runde Öffnungen, die man mit etlichen einsetzbaren Ringen je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern oder gänzlich verschließen konnte. Die gesamte Herdplatte war umgeben von einer massiven verchromten Stange, so, als müsse man sich daran festhalten, wenn einen das Kochen zu sehr überforderte.
Vorne hatte der Herd mehrere Klappen. Zwei davon gehörten zu Backröhren, die anderen dienten der Befeuerung und der Ascheentnahme. Beheizt wurde der Herd ausschließlich mit Briketts, die Tante Tandelei unermüdlich mit einem kleinen Handwagen von der gegenüber liegenden Kohlenhandlung herbeischaffte. Rund um die Uhr war der Herd in Betrieb und man konnte jederzeit aus dem ständig vor sich hin blubbernden Wasserkessel heißes Wasser für einen Tee entnehmen, ein Kotelett braten oder ein Brot backen. Zudem standen am hinteren Rand der heißen, immerfort glühenden Herdplatte zwei eiserne Bügeleisen bereit, mit denen man ohne Umschweife Wäsche plätten konnte.
Der Herd verbreitete eine nachhaltige Wärme in der Stube, was wintertags höchst angenehm war, an heißen Sommertagen jedoch durchaus anstrengend. Tante Tandelei schien sich auch dann in ihrer Küche wohl zu fühlen, denn sie machte keinerlei Anstalten, einmal Fenster und Türen für einen ordentlichen Durchzug zu öffnen.
Wie auch immer, die Küche war ein Ort, an dem man gerne war. Ein stabiler Eichentisch und vier Stühle standen am Fenster. Neben dem Herd an der Wand ragte ein uralter Küchenschrank aus Weichholz auf, gefüllt mit buntem Geschirr, das die Tante einst selbst getöpfert hatte. Die Wand neben dem Tisch wurde ausgefüllt von einem Regal, in dem tausenderlei Gewürze, Teesorten und getrocknete Kräuter in Dosen und großen Gläsern zu finden waren.
Am Küchentisch saßen wir gerne und sahen der Tante zu, wie sie den Teig knetete oder Plätzchen mit Formen ausstach, wobei wir beim Ausstechen auch immer gerne halfen. Oder wir malten ihr Bilder von ihrem Haus oder ihrem verwunschenen Garten, während sie am Herd herrliche Gerichte brutschelte.
Ging man im Flur in die erste Tür links, so kam man in die Gute Stube. Die Gute Stube enthielt nichts weiter als einen schmalen Ofen mit einem langen Ofenrohr, einen großen ovalen Tisch mit unzähligen Stühlen, unter denen sich ein Perserteppich ausbreitete, und einen ausladenden Schrank, den Bennies Vater immer als Gelsenkirchener Barock bezeichnete. Es war ein wuchtiges Möbel mit gebauchten, ornamentreichen Türen, hochglänzend und edelholzfurniert. In der oberen Abteilung standen hinter Glasscheiben fein geschliffene Trinkgläser aller Sorten, unten war hinter geschlossenen Türen Porzellan verstaut, Berge von Tellern, Schüsseln und Terrinen, die die Tante einmal geerbt hatte. Das in Schubladen untergebrachte Besteck zeichnete sich dadurch aus, dass das Silber stark angelaufen war, die Messer, Gabeln und Löffel für unsere Kinderhände unglaublich groß ausfielen und die Zinken der Gabeln allesamt verbogen waren. Nur die kleinen Löffel waren so beschaffen, dass wir Kinder sie auch für die Suppe nahmen.
Die Gute Stube war für die Tante so etwas wie ein Heiligtum. Sie wurde grundsätzlich nicht betreten, es sei denn an hohen Feiertagen. Dann saß man dort steif wie ein Brett am Tisch und nahm vornehm ein Mahl ein, das die Tante höchst selbst aus der Küche herbeitrug. Es gehörte zur Vornehmheit, dass man den kleinen Finger spreizte, wenn man ein Glas oder ein Tasse hob. Für uns Kinder war es eher eine Qual, so still und unbeweglich dasitzen und einem Ritual folgen zu müssen, dessen Sinn uns absolut nicht einleuchtete. Der Tante aber schien eine ausgesuchte Feierlichkeit ungeheuer wichtig, obwohl sie eigentlich für Feiertage nichts übrig hatte.
Die zweite Tür auf der rechten Seite des Flures führte in das Schlafzimmer von Tante Tandelei. Auch dieses Zimmer war für uns Tabuzone. Da hatten wir einfach nichts zu suchen. Ab und zu konnten wir durch einen Türspalte einen Blick hinein werfen. Sonderlich Interessantes gab es da nicht zu sehen. In der Mitte stand ein großes Doppelbett mit ausufernden Hügeln aus Federbetten. An der einen Wand sah man eine Kommode aus dunklem Holz, darauf eine Waschschüssel. An der anderen Wand stand ein zur Kommode passender Kleiderschrank, der fast bis an die Decke reichte. Der Boden bestand, wie überall im Haus, aus groben Eichendielen. Insgesamt ein sehr spartanisch eingerichtetes Zimmer, das der kargen Guten Stube in Nichts nachstand. Aber es entsprach dem Wesen der Tante, die ein sehr bescheidenes Leben führte und kaum Ansprüche hatte.
Schließlich noch das vierte Zimmer, hinten links im Flur. Das war das Zimmer, in dem die Besucher nächtigten, wobei die Besucher im Wesentlichen wir Kinder waren, denn wir besuchten die Tante, wann immer es uns möglich war. In diesem Zimmer standen genau drei Betten. Eins für mich, eins für Lila und eins für Bennie, Lilas Bruder. In welcher Weise und ob überhaupt ich mit ihnen verwandt war, wusste ich nicht genau. Durch familiäre Beziehungen blickte ich als Kind nie so recht durch. Lila hieß eigentlich Louise, aber sie wurde immer nur Lila genannt. Eigentlich hätte Lila als Mädchen nicht mit uns Jungs zusammen in einem Zimmer schlafen sollen, aber darüber machten wir uns keine Gedanken. Zuhause hatten Lila und Bennie auch nur ein gemeinsames Zimmer. Es war auch wirklich egal, denn wir steckten ohnehin oft zusammen und wenn wir an schulfreien Tagen zum Schwimmen an die Talsperre fuhren, dann sprangen wir ohne Hemmungen gemeinsam nackt in den See.
In unserem Schlafzimmer standen noch ein großer Kleiderschrank, eine Waschkommode und ein schmales Regal. Das Regal hatte es in sich, denn in ihm stapelten sich einerseits unzählige Spiele, die die Tante eigens für uns Kinder angeschafft hatte. Andererseits reihte sich ein Kinderbuch an das andere. So war dafür gesorgt, dass uns auch an Regentagen nie langweilig wurde. An die Wände des Zimmers durften wir bunte Kinoplakate hängen. Mich schaute beim Einschlafen immer Charlie Chaplin an.
So sah es im Erdgeschoss des Hauses aus. Vier mehr oder weniger zweckmäßige Zimmer, von denen die Küche wohl das Zentrum war. Die wahren Schätze des Hauses verbargen sich aber ganz woanders. Es gab ja noch den Dachboden und den Keller. Die Treppe hinten im Flur führte hinauf auf den Dachboden. Dorthin zog es uns immer wieder und wir konnten uns stundenlang da aufhalten.
Der Dachboden, das war ein in sich geschlossener Kosmos mit ganz eigenen Regeln. Die Tante hatte nichts dagegen, dass wir dort waren, aber wir mussten ihr versprechen, mit allem, was wir vorfanden, äußerst vorsichtig umzugehen.
Es gab im Dach nur zwei winzige Dachluken und so herrschte auf dem Dachboden immer ein geheimnisvolles, schummriges Licht. Eine elektrische Beleuchtung gab es nicht. Schien einmal ein Sonnenstrahl direkt in eine der Luken hinein, so erhoben sich mitunter bizarre Formen aus dem Dunkel der Umgebung.
Schon wenn man die letzten Treppenstufen erklommen hatte, fuhr einem immer wieder aufs Neue der Schreck in die Glieder. Plötzlich war man umringt von Gestalten, die sich rechts und links des Treppenaufgangs reihten. Bei näherem Hinsehen erkannte man, dass es sich um Schaufensterpuppen handelte, die sich hier versammelt hatten. Es mögen zehn oder zwölf gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Warum aber ausgerechnet auf dem Dachboden der Tante Schaufensterpuppen in so großer Zahl waren, das wusste niemand. Auch der Tante war dazu nichts zu entlocken.
Die Puppen machten einen äußerst lebensechten Eindruck. Hätte man eine von ihnen an eine Straßenbahnhaltestelle gestellt, sie wäre nicht aufgefallen. Und jede der Puppen hatte einen ganz eigenen Charakter. Da war die Schönheit, die jeden Wettbewerb gewonnen hätte. Sie trug eine ziemlich knappes Kleid, hatte eine wallende Haarmähne und führte mit einem breiten Lächeln ihr makelloses Gebiss vor. Da war die Ernste, die vor ihrer Tätigkeit als Schaufensterpuppe vermutlich Sekretärin war und ihrem Chef sorgfältig alle Termine aufgeschrieben hatte. Ihre Kleidung war streng und funktional, ihre Haare zurückgekämmt und zu einem Knoten gebunden. Da war die mädchenhafte Jugendliche mit einem verschmitzten Gesicht und einem weit schwingenden Rock, die gewiss keinen Rock´n´Roll-Tanzabend ausgelassen hatte. Es gab auch eine männliche Puppe, die sich im Kreise der holden Weiblichkeit gewiss wohl gefühlt hat. Das Gesicht kantig geschnitten, ein Lächeln allenfalls in den Mundwinkeln andeutend, in einen sportlichen Anzug gekleidet, machte sie den Eindruck eines Börsenmaklers oder eines Trainers für eine Reitermannschaft.
Jedenfalls waren die Schaufensterpuppen schon mal ein gelungenes Begrüßungskomitee. Hatte man sie passiert, so ging das Abenteuer Dachboden erst richtig los. Unter den Dachschrägen stapelten sich in endloser Reihe Kisten, Fässer, Kästen und Körbe in allen möglichen Ausmaßen. Dazwischen drängten sich die verschiedensten Gegenstände, angefangen bei einer uralten Nähmaschine mit Tretpedal über ein Schaukelpferd bis hin zu einer geschnitzten Madonnenfigur mit einem ziemlich tristen Gesichtsausdruck, wohl, weil ihr die Nase fehlte. Ganz dahinter stand noch ein großer Spiegel, bei dem die spiegelnde Schicht sich mehr und mehr auflöste.
In den Körben fanden sich alte Kleidungsstücke, Schuhe, verbrauchte Glühbirnen, Christbaumschmuck oder knorrige Wurzeln, wie man sie in Aquarien verwendet. Die Kleidungsstücke hatten es uns angetan. So war darunter ein zwar deutlich schäbiger, aber immerhin Frack. Einen Frack kannten wir gar nicht. Bennie zog ihn an. Die langen Schöße reichten bis auf den Boden, die Ärmel fast auch. In der Brusttasche war sogar noch ein Einstecktuch. Bennie sah in dem Frack aus wie ein unförmiger Pinguin. Zu dem Frack gehörte auch eine Hose, die so überdimensional war, dass wir sie zu dritt anzogen und uns bald krümelig lachten, so wie wir darin steckten.
Besonders das Stöbern in den vielen Kisten und Kasten machte uns immer Spaß. In einer Kiste fanden wir uralte Zeitungen, die völlig vergilbt waren und die sich fast auflösten, wenn man sie in die Hand nahm. Weiß der Himmel, warum man die aufbewahren musste. In einer anderen Kiste lag eine Sammlung von Familienalben. Viele fremde Gesichter schauten uns aus den sepiafarbenen Fotos an. Waren das unsere Ahnen? Irgendwo mussten auch Fotos der Tante in den Alben sein, aber wir konnten uns nicht vorstellen, wie sie in jungen Jahren ausgesehen haben mochte.
In einem weiteren Kasten entdeckten wir eine komplette Mannschaft von Handpuppen. Damit spielten wir höchst erstaunliche Aufführungen, die jedem Puppentheater zur Ehre gereicht hätten. Bennie war der Kasper, ich der Seppl und Lila das Krokodil. Da ging uns oft die Fantasie durch und das Ganze endete in einem wilden Gewühle, in dem die drei Figuren heftig aufeinander einprügelten.
Was gab es noch auf dem Dachboden? Ordner, jede Menge Ordner. Sie enthielten in der Mehrzahl sauber abgeheftete Rechnungen und Quittungen, die auch schon Jahrzehnte vor sich hin staubten, wie man aus den Datierungen ablesen konnte. Auf einem großen Karton stand ein wunderbares Modell eines Segelschiffes. Vielleicht war es das Schiff von Kolumbus. Die Spinnweben, die es überzogen, sahen aus wie eine zusätzliche Takelage. Eine Kiste war gefüllt mit verbogenen Kleiderbügeln, eine andere barg Hunderte leere Garnrollen. Was wollte man noch damit? Offenbar konnte die Tante sich von nichts trennen.
An der gegenüber liegenden Giebelwand lehnten einige Ölgemälde. Von den Rahmen blätterte das Gold. Auf einem Bild konnte man das Motiv gar nicht mehr erkennen, weil die Farbe gänzlich ausgeblichen war. Ein zweites Bild zeigte ein Seestück mit einem Segel- oder Fischerboot. Auf einem dritten Gemälde war eine ernst dreinblickende Familie verewigt, Vater, Mutter, Tochter. Wir waren der Meinung, dass das abgebildete Mädchen doch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer Tante Tandelei hatte.
Lila entdeckte in einer Ecke noch etwas, was sie völlig verzückte. Es war ein winziger Puppenherd, ganz ähnlich dem Herd in der Küche unten, nur eben wie geschrumpft. Dazu gehörten ebenso winzige Töpfe, eine Pfanne und ein Wasserkessel. Lila musste diesen Herd ausprobieren. Man konnte ihn an den elektrischen Strom anschließen. Sofort rannte sie hinunter, um die Tante um Erlaubnis zu fragen. Wenn es ums Kochen ging, dann war die Tante sehr großzügig. So durften wird den kleinen Herd mit in die Küche nehmen, ihn anschließen und sofort hantierte Lila mit den Töpfen und der Pfanne wie eine Große. Mit ein wenig Hilfe der Tante rührten wir einen Teig an und dann buk Lila winzig kleine Pfannkuchen in der winzig kleinen Pfanne auf dem winzig kleinen Herd. Nie haben uns Pfannkuchen besser geschmeckt.
Neben dem Dachboden war da noch der Keller, dessen Treppe genau unter der Treppe nach oben lag. Der Keller bestand aus zwei düsteren Gewölben, jeweils erhellt von einer einsamen Glühbirne niedrigster Wattzahl, die in der Mitte von der Decke herab baumelte. Das eine, etwas kleinere Gewölbe war die Waschküche, die auch gleichzeitig das Badezimmer des Hauses war. Da gab es in der Ecke zwei große, gemauerte Becken mit Abfluss. Daneben stand auf einem gemauerten Sockel ein runder Kupferkessel mit Deckel. In dem Sockel war eine Öffnung. Dort wurde der mit Wasser gefüllte Kessel befeuert, sodass die Wäsche in ihm kochen konnte. Wollte man baden, dann ließ man das heiße Wasser des Kessels, in dem dann natürlich keine Wäsche war, einfach in eines der gemauerten Becken laufen. Mit einer Gießkanne voll heißen Wassers konnte man sogar duschen. Das war einfach, aber zweckmäßig.
Mitten im Raum stand die Waschmaschine, die aussah wie ein überdimensionales Weinfass. Denn sie bestand aus Holzscheiten, die mit Eisenringen zusammen gehalten wurden. Oben war ein hölzerner Deckel, auf dem in der Mitte der Wassermotor befestigt war. An den Rand des Waschbottichs war eine Wringmaschine angeschraubt. Mittels einer Handkurbel konnte man damit die gewaschene Wäsche auswringen.
Einmal im Monat wusch die Tante ihre Wäsche und auch unsere, wenn wir da waren. Dann war sie den ganzen Tag in der Waschküche beschäftigt. Zuerst wurde der Kupferkessel mit einem Schlauch von der Wasserleitung her mit Wasser befüllt. Dann wurde Feuer unter ihm gemacht. Es dauerte bei dem großen Kessel eine ganze Weile, bis das Wasser ordentlich heiß war. Dann gab die Tante ein großes Stück Kernseife hinein, das sich alsbald auflöste. Nun kam die Wäsche hinzu, die dann einige Zeit vor sich hin kochte. Schließlich schöpfte die Tante das Seifenwasser aus dem Kessel mit einem Eimer in die Waschmaschine und beförderte danach auch die Wäsche dorthin.
Nachdem der Deckel geschlossen war, kam der Wassermotor zum Einsatz. Er war direkt mit einem Schlauch an der Wasserleitung angeschlossen. Drehte man das Wasser auf, so bewegte es in dem Motor einen Kolben, der durch einen besonderen Mechanismus immer hin und her bewegt wurde und der in der Waschmaschine eine Art doppeltes, auf einer Achse befestigtes Paddel ebenso hin und her trieb. Hinten lief das Wasser aus dem Motor heraus auf den Kellerboden und versickerte in einem Gully. Der Wassermotor war ein lärmender Apparat. Stundenlang war nun das Geräusch im ganzen Haus zu hören – umph, amph, umph, amph.
Nach der Bearbeitung in der Waschmaschine hievte die Tante die Wäsche in die gemauerten und mit klarem Wasser gefüllten Becken in der Ecke. Im ersten Becken wurde die Wäsche mit einem langen Holzstiel ordentlich umhergeschwenkt, um die Seife auszutreiben, dann kam sie in das zweite Becken, wo sie ebenso bearbeitet wurde. Danach sollte die Wäsche frei von Seifenresten sein.
Zum Abschluss musste die Tante noch die vielleicht mühsamste Arbeit erledigen, das Durchmangeln der Wäsche durch die Wringmaschine. Trotz dieser Mühe war die Wäsche immer noch reichlich feucht und musste natürlich zum Trocken aufgehängt werden. Im Sommer geschah das auf Wäscheleinen vor dem Gartenzaun. Im Winter wurde sie hier in der Waschküche aufgehängt, wo das Trocknen natürlich ungleich länger dauerte.
Wir versuchten immer zu helfen so gut wir konnten, aber wir hatten meistens den Eindruck, im Wege zu stehen. So stand die Tante dann den ganzen Tag im wabernden Dampf der kochenden Wäsche, der trotz der geöffneten Kellerfenster kaum abzog, während sie mit nackten Füßen im Wasser stand.
Das zweite, größere Gewölbe des Kellers war der Aufbewahrung von Vorräten und Werkzeugen gewidmet. Hier waren die schmalen Kellerfenster von innen mit Holzplatten verrammelt. Tageslicht hatte dieser Keller wohl niemals gesehen.
Auf der einen Seite des Raumes gab es drei Holzverschläge. In dem hinteren lagerten Briketts, was doch verwunderlich war, da die Tante ihre Briketts immer direkt von der Kohlenhandlung holte, wenn sie zur Neige gingen. Vielleicht war dies der Vorrat für schlechte Zeiten, denn die Tante hatte ja die Not im Krieg erlebt, der noch gar nicht so lange her war, wie sie uns immer erzählte.
Im zweiten Verschlag warteten Holzscheite auf ihre Verwendung. Man brauchte sie, um einen Ofen anzuzünden, denn ein Brikett musste erst ordentlich angefeuert werden, bevor es zu glühen anfing. Dass der Herd in der Küche einmal ausging, war eher unwahrscheinlich. Aber der Kessel in der Waschküche musste zuerst mit Holzscheiten bestückt werden, bevor man Briketts nachlegen konnte. Und den Ofen in der Guten Stube musste man die wenigen Male im Jahr allerdings auch eigens anzünden, sonst wäre man an den Festtagsessen erfroren. Außerhalb der Feiertage blieb der Ofen aus, wodurch die Gute Stube immer recht ungemütlich wirkte, ganz abgesehen von der strengen Möblierung.
Im dritten Holzverschlag waren Kartoffeln. Oder vielmehr das, was von ihnen noch zu erkennen war. Dieser Notvorrat aus früheren Zeiten hatte die Jahre nicht überdauert. Sämtliche Kartoffeln waren in sich zusammengeschrumpelt und glichen eher Mumien. Viele davon hatten noch ausgekeimt und so hatte sich in dem Verschlag ein undurchsichtiges Gemenge von vertrockneten Kartoffeln und Keimen gebildet. Seltsamerweise gab es keinen Schimmel, was daran liegen mochte, dass der Keller erstaunlich trocken war. Die Tante kellerte Kartoffeln, das wussten wir, nicht mehr ein. Sie kaufte sie lieber frisch, denn es gab sie inzwischen das ganze Jahr über.
Auf der anderen Seite des Kellers gab es eine große Werkbank, darüber waren Hängeschränke angebracht. Auf ihnen stand eine Sammlung von Farb- und Lackdosen. In den Schränken gab es alle Arten von Werkzeugen in allen Größen: Schraubenschlüssel, Bohrer, Schraubenzieher, Kneifzangen, Flachzangen, Rohrzangen, Hämmer und Feinsägen. Hinten auf der Werkbank standen lauter Dosen mit Nägeln, Schrauben, Dichtungen und Dübeln, alle wohlgeordnet. Unter der Werkbank lagen auf einem Brett noch mehrere große Bügelsägen und Fuchsschwänze.
Neben der Werkbank in der Wandecke standen allerlei Bretter und runde und eckige Holzleisten verschiedener Größe und Dicke. Auch ein hohes Gestell mit einer langen Stange, an der unten und oben ein Rad befestigt war, war zu sehen. Unten war ein Fußpedal, oben eine biegsame Welle, in die man einen Bohrer einspannen konnte. Was war das nur für ein merkwürdiger Bohrapparat? Er sah nicht so aus, als könnte man damit vernünftig Holz oder gar dicke Bretter bohren. Neben dem Bohrgestell bot ein rostiges Fahrrad ohne Vorderrad einen traurigen Anblick.
Der Überfluss an Werkzeug verwunderte uns Kinder sehr, hatten wir die Tante doch niemals mit dergleichen hantieren sehen. Ihre Werkzeuge waren die vielfältigen Küchengeräte. Uns aber machte es große Freude, all das unter der funzeligen Lampe auszuprobieren. In die beiden großen Schraubstöcke der Werkbank konnte man prima alle möglichen Gegenstände einspannen. So spannten wir Bretter ein, sägten sie zurecht und nagelten sie zu kleinen Regalen zusammen, oder wir bohrten Löcher ins Holz, in die wir Holzstangen steckten. Das machte nicht unbedingt immer Sinn, hielt uns aber bei Laune und führte dazu, dass wir auf dem Gebiet der Werkzeuge und ihres Gebrauchs zu regelrechten Experten wurden.
Direkt neben der Kellertreppe schließlich gab es noch ein recht breites Regal, das bis zur Decke reichte. Darin standen – sorgsam aufgereiht – gefüllte Einmachgläser, eins neben dem anderen, eine Reihe über der anderen. Nun war auch dies seltsam, denn wir hatten niemals gesehen, dass die Tante auch nur eine Birne eingemacht hätte, schon gar nicht aus ihrem wundersamen Garten, den sie nicht zu beernten pflegte. Die Tante kochte immer nur frische Zutaten. Selbst Konserven lehnte sie ab. Obst gab es nicht aus ihrem Garten, von dem wir nicht einmal wussten, ob es in ihm überhaupt Obst gab. Sie kaufte es.
Schaute man sich die Einmachgläser hier im Keller einmal näher an, so machten sie keinen sehr Vertrauen erweckenden Eindruck. Das Eingemachte darin sah merkwürdig aus. Zum Teil hatte es sich auch aufgelöst und in dem Glas dümpelte eine undurchsichtige Brühe. Andere Inhalte sahen eher zum Fürchten aus. Ich hatte einmal ein Foto in einem Magazin gesehen. Es war eine Abbildung aus der Sammlung eines medizinischen Instituts. Das Foto zeigte ein Glas mit einer Flüssigkeit, in der eine einzelne Hand schwamm, fahl und bleich, fast farblos. Ganz genauso sah das Eingemachte in den Gläsern in diesem Kellerregal aus. Als ich Bennie und Lila von dem Foto erzählte, da gruselte es sie doch mächtig. Fortan sahen wir immer abgehackte Hände und Füße, Ohren und Nasen in den Einmachgläsern der Tante schwappen.
Ja, der Dachboden und der Keller! Das waren herrliche Spielorte für uns Kinder. Dorthin verzogen wir uns immer, wenn das Wetter draußen nicht sehr anregend war. Allerdings – im Winter wurde es oben wie unten doch sehr kalt. Da saß man doch lieber in der warmen Küche am Tisch und spielte und malte, während die Tante kochte.
Aber was wäre das Haus ohne Tante Tandelei gewesen? Sie war die gute Seele des Hauses, erst durch sie erhielt es das gewisse Etwas, das wir so liebten. Dabei war die Tante keineswegs eine auffällige Person, die in irgend einer Weise im Vordergrund stehen wollte. Sie war immer sehr zurückhaltend, aber in ihren Ansichten und Wünschen umso bestimmter. Und sie war in allem, was sie tat, sehr genau. Diese Maßstäbe legte sie auch bei Anderen an. Nachlässigkeiten duldete sie nicht, auch nicht bei uns Kindern. So bemühten wir uns redlich, so gut es ging ihren Wünschen zu entsprechen. Wobei ihre Wünsche und Anordnungen, die sie an uns herantrug, wirklich überschaubar blieben. Insgesamt gesehen hatten wir zumeist freie Bahn in unserem kindlichen Überschwang.
Dabei war die Tante durchaus eine fröhlicher Mensch. Oft genug trällerte sie bei ihrer Hausarbeit Lieder vor sich hin, die uns unbekannt waren. Sie muss sie wohl in ihren jungen Jahren in sich aufgesogen haben. Es waren überaus lustige Lieder. So sang sie von einem
»kleinen grünen Kaktus« und dass sie gerne ein Huhn sein wollte.
Das seien Lieder der Comedian Harmonists, erklärte sie uns einmal. Damit konnten wir nichts anfangen, aber interessant war es schon, dass die Tante so etwas singen konnte.
Und auch sonst hatte die Tante viel Sinn für Humor. Auf unsere kindlichen Späße ging sie gerne ein und man merkte dabei, dass sie sehr viel für Kinder übrig hatte und sich eine ordentliche Portion kindlicher Unbefangenheit bis ins Alter hinein aufbewahrt hatte.
Gekleidet war die Tante ebenso unauffällig, wie es ihrem bescheidenen Wesen entsprach. Eine dunkle Bluse, ein dunkler langer Rock, dunkle Strümpfe, das war´s auch schon. Darüber trug sie, wenn sie kochte, einen bunten Kittel. Da sie tagsüber fast immer kochte, sah man sie auch nie ohne ihren bunten Kittel, der immer derselbe war und der offenbar nie gewaschen werden musste. Vielleicht besaß sie auch zehn gleichartige Kittel, denn jener Kittel, den sie gerade trug, war immer sauber und niemals bekleckert. Eigentümlicherweise trug sie an den Füßen ausschließlich Holzschuhe. Deswegen lief sie auch in der Waschküche immer barfuß herum. Holzschuhe hätten dem ständigen Wasserschwall kaum standgehalten.
Holzschuhe, das war eine Fußbekleidung, die man eigentlich bei einem Holländer erwarten würde. Wir hatten nichts gegen Holzschuhe, aber morgens störten sie uns doch sehr. Denn die Tante stand immer ziemlich früh auf und dann klapperten ihre hölzernen Fußkleider auf den harten Dielen in erheblicher Lautstärke. Für uns war es dann vorbei mit dem Schlafen. Wir sprangen jedoch nie sofort aus unseren Betten, sondern dämmerten bis zum Frühstück noch ein wenig dahin und hingen unseren Träumen nach. Wir haben uns aber nie bei der Tante ob ihrer klappernden Holzschuhe beschwert, es hätte sie womöglich verletzt.
Wir verbrachten viel Zeit bei der Tante, überwiegend waren es die Ferien, denn während der Schulzeit konnten wir uns diesen Freuden leider nicht hingeben. Aber wenn Ferien waren, dann war auch Tantezeit, dann hielt es uns nicht bei den Eltern, mich schon gar nicht. Dazu wirst du später mehr erfahren. Verreist wurde bei uns ohnehin nicht, dafür war kein Geld da. Auch die Familie von Bennie und Lila verreiste nie, obwohl sie ein gutes Auskommen hatte. Sie leistete sich lieber andere Dinge. Ehe uns also daheim die große Langeweile überkam, suchten wir unser Heil lieber im Haus und dem abenteuerlichen Umfeld der Tante. Wir bedauerten alle anderen Kinder, die eine solche Tante nicht hatten. Und wenn wir nach den Ferien in der Schule von unseren Abenteuern erzählten, dann spürten wir oft, dass ein wenig Neid aufkam. Hätten ich doch auch so eine Tante, mag da mancher unserer Schulkameraden gedacht haben. Da konnten wir leider nicht helfen.
Kapitel 2
Das Wunderpferd
Die Herbstferien standen mal wieder bevor und das bedeutet: Lila, Bennie und ich würden den Mittelpunkt unseres Lebens wie immer in den Ferien ins Haus der Tante verlagern. Sobald die Schule zu Ende war, warf ich meinen Ranzen in die Ecke, packte meine sieben Sachen in eine Tasche, verabschiedete mich daheim und machte mich auf den Weg. Wir wohnten am äußersten Rand der Stadt und bis zur Tante schien es mir immer wie eine kleine Weltreise zu sein. Mit der Linie 7 der Straßenbahn musste ich zunächst bis zum Hauptbahnhof fahren und dort umsteigen. Dann konnte ich die Linien 1, 2 oder 3 nehmen. Auf halber Strecke stieg ich aus und ging die Hördenstraße hoch bis zum Bahnübergang.
Vorbei kam ich an dem Milchgeschäft, der Kneipe an der Ecke der rechts abzweigenden Bebelstraße und dem Kaufladen an der gegenüber liegenden Ecke, wo man von Zitronen bis zum Nähgarn so ziemlich alles bekommen konnte, was man zum täglichen Leben brauchte. In das Milchgeschäft und den Kaufladen gingen wir Kinder oft, um für die Tante einzuholen. Im Milchgeschäft gab es auch Butter, Käse und Sahne. Die Tante gab uns immer drei Groschen zusätzlich, wenn wir dort einkaufen gingen. Dafür kauften wir uns leckere Sahnehörnchen. Es war schon allein ein Genuss zuzusehen, wie die Frau im Laden die Sahne aus dem Sahneapparat in die Hörnchen spratzeln ließ.
Vorbei musste ich auch an der Kohlenhandlung und war immer froh, wenn das Gittertor geschlossen war und der kläffende, zähnefletschende Hund dahinter blieb. War das Tor offen, so kam er oft herausgeschossen bis auf die Straße, wo er einem auf furchterregende Weise den Weg versperrte. Das erlebten wir Kinder oft genug, wenn wir einkaufen waren. Wir warteten dann immer, bis ein Erwachsener kam und den Hund verscheuchte. Vor Erwachsenen hatte er wohl Respekt. Manchmal eilte auch der Kohlenhändler aus seinem Verschlag und zerrte das Tier äußerst brutal am Halsband zurück auf den Hof. Später fanden wir zufällig heraus, dass dieser Hund alles andere als gefährlich war.
Endlich war ich am Bahnübergang und ging den Weg dahinter zum Haus hinauf. Ob Lila und Bennie schon da waren? Die Beiden wohnten in ähnlicher Entfernung von der Tante wie ich. Ihre Eltern brachten sie immer. Sie besaßen sogar ein Auto, eine Seltenheit in diesen Zeiten. Es war ein ziemlich klappriger Opel Olympia, aber immerhin. Oft genug stand der Wagen auch nur herum, wie Bennie und Lila erzählten, weil kein Geld für ein Ersatzteil da war.
Im Grunde ging es fast allen Familien in der Nachkriegszeit ähnlich. Das Geld war knapp, viele waren arbeitslos und das Arbeitsleben entwickelte sich erst langsam wieder im Zuge des Wiederaufbaus. In weiten Teilen der Stadt sah es nicht anders aus als hinter Tante Tandeleis Haus. Überall, wo man hinschaute, Trümmergrundstücke, überall Zerstörung. Man konnte es sich als Kind kaum vorstellen, wie das gewesen sein musste, als die Flieger kamen und die Bomben vom Himmel fielen. Unsere Eltern redeten kaum davon und die Tante erzählte nur sehr zögerlich von jenen schlimmen Tagen.
Nun waren wir wieder bei der Tante vereint und freuten uns auf eine schöne Zeit. Der Herbst war schon fortgeschritten und zeigte sein buntes Kleid, wobei die Buntheit durch den pudernden Überzug des Thomasmehls hier zwischen den Bahndämmen etwas blass wirkte. Das Wetter war wunderbar, Altweibersommer nannte das die Tante. Es war nicht zu warm und nicht zu kalt und wir konnten uns den ganzen Tag draußen am Spiel zwischen den Teerfässern ergötzen.
Es wurde schon früh dunkel und am Abend saßen wir nach dem Essen meist in der Küche am Tisch und spielten all die Spiele der Reihe nach durch, die die Tante für uns bereit hielt. Die Tante selbst spielte eigentlich nie. Nur wenn wir »Mensch ärger´ dich nicht« spielten, dann war sie dabei und hatte einen Heidenspaß.
Wieder einmal saßen wir da und spielten, was das Zeug hielt. Es war schon spät, aber wir waren vertieft in unser Scrabble-Spiel. Das sei ein Spiel, meinte die Tante, das hierzulande noch kaum Verbreitung gefunden habe. Das habe mal ein Amerikaner erfunden und sie habe es einem Engländer abgekauft. Beim Scrabble müssen die Spieler aus zufällig gezogenen Buchstaben Wörter legen und können dabei verschiedene Bonusfelder auf dem Spielbrett nutzen.
Langsam wurden wir müde vom Wörterlegen und Lila schaute ziemlich unkonzentriert zum Fenster hinaus in die Dunkelheit. Allerdings – so dunkel war es gar nicht, denn wir hatten Vollmond. Die kleine Wiese hinter dem Lattenzaun des Gartens wurde vom direkt darüber stehenden Mond fast taghell erleuchtet.
Plötzlich zuckte Lila zusammen und schrie auf: »Der Schimmel – der Schimmel – er ist grün!« Das ging nun gar nicht. Ein Schimmel ist immer weiß, wie sollte er grün sein? Von einem »grünen Schimmel« zu reden ist so ähnlich wie »alter Knabe« zu sagen. Ein Widerspruch in sich.
So stürzten wir zum Fenster, um zu sehen, was Lila so erschreckt hatte. Nur die Tante schien sich dafür nicht zu interessieren. Tatsächlich, im Mondlicht sah der weiße Schimmel reichlich grün aus. Er stand mitten auf der Wiese und sah den Mond über ihm an. Und dann geschah etwas, was uns völlig aus der Fassung brachte. Langsam, ganz langsam hob der grüne Schimmel vom Boden ab und schwebte nun in einer Höhe von etwa 50 Zentimetern über der Wiese.
In diesem Augenblick passierte auch etwas mit mir. Ich konnte plötzlich Gedanken lesen. Die Gedanken der Tante, zum Beispiel. Sie dachte gerade: »Ich muss es den Kindern sagen.« Lila dachte:«Ist das ein fliegendes Pferd?« Und Bennie konnte nicht glauben, was er da sah. »Ich denke, dass ich das jetzt träume«, dachte er.
Plötzlich verschwand der Mond hinter einer Wolke. Wir konnten nichts mehr sehen. Der grüne Schimmel war in der Dunkelheit verschwunden. Und ich konnte nur noch meine eigenen Gedanken lesen. Was war das gerade gewesen? In den Gesichtern meiner Freunde sah ich eine ähnliche Ratlosigkeit.
»Tante«, fragte Lila entgeistert, »ist der Schimmel nun wirklich grün und kann er schweben?« Die Tante seufzte. Es wäre ihr wohl lieber gewesen, sie hätte sich dazu nicht äußern müssen.
»Setzt euch mal wieder her«, sagte sie, »ich glaube, ich muss euch das genauer erklären.« Und dann erzählte sie uns etwas, das klang, als habe sie Grimms Märchen auswendig gelernt.
»Was ich euch jetzt erzähle, Kinder, das dürft ihr niemals jemandem verraten. Man würde mich vermutlich in ein Irrenhaus einweisen. Versprecht mir das!«
Natürlich versprachen wir es ihr. Wenn es um Geheimhaltung ging, dann waren wir drei verschlossen wie ein Banktresor.
Die Tante begann nun mit ihrem unglaublichen Bericht: »Der Schimmel in meinem Garten ist schon sehr alt. Ich habe ihn einmal einem Bauern abgekauft, der ihn gerade zum Pferdeschlächter bringen wollte. Bei mir sollte er sein Gnadenbrot bekommen. Mein Schimmel ist, wie alle anderen Schimmel auch, weiß. Meist steht er auf der Wiese und grast. Im Winter, bei Schnee und Eis, ist er im Stall und frisst Heu, das ich ihm bringe.
Von Anfang an schien es mir aber so, als habe dieser Schimmel etwas Besonderes, als sei ein Geheimnis mit ihm verbunden. Denn manchmal stand er lange regungslos da und schaute in den Himmel. Manchmal bäumte sich auch ohne Anlass ganz plötzlich auf und drehte sich im Kreise. Und wenn ich zu ihm in den Garten ging, dann legte er unvermittelt seinen Kopf auf meine Schulter und es war mir, als flüsterte er mir etwas ins Ohr.
Eines späten Abends jedoch ging ich noch einmal hinaus, um nach dem Pferd zu sehen. Es war Vollmond. Als ich am Gartenzaun ankam, sah ich genau das, was ihr gerade auch gesehen habt. Mein weißer Schimmel war plötzlich grasgrün und schwebte ein wenig über dem Boden. Ich war völlig verwirrt und traute meinen Sinnen nicht, denn es war ja unglaublich – ein grüner schwebender Schimmel. Ich kniff mir in den Arm, aber was ich sah, das sah ich.
Im gleichen Augenblick hatte ich das Gefühl, dass auch mit mir etwas Unerklärliches vorging. Ich war von all dem so fassungslos, dass ich mir wünschte, ich stünde an meinem Herd und würde einen Kochtopf sehen anstelle eines schwebenden Pferdes. Ehe ich mich versah, stand ich tatsächlich am Herd, von einer Sekunde zur anderen. Ich lief sofort hinaus, wo der Schimmel immer noch im Mondlicht schwebte und wünschte mir dasselbe noch einmal. Schon stand ich wieder in der Küche am Herd.«
»Aber Tante Tandelei«, warf Lila ein, »dann ist der Schimmel ja ein Wunderpferd.«
»Ich konnte sogar«, sagte ich, »eure Gedanken lesen, als ich den Schimmel draußen sah, auch deine Gedanken, Tante.«
»Mir war auch irgendwie komisch«, meinte Bennie.
»Ja«, sagte die Tante, »mein Schimmel scheint wirklich Wundersames zu bewirken. Und es treten wohl sehr unterschiedliche Erscheinungen auf, je nach dem, was man gerade selbst denkt. Ich habe aber feststellen können, dass der Schimmel sich nicht nur bei Mondschein in ein Wunderpferd verwandelt. Das passiert manchmal auch, wenn es blitzt und donnert, also bei Gewitter. Und auch, wenn die Uhr Mitternacht schlägt oder die Sonne mittags im Zenit steht, wobei sie auch durch Wolken verdeckt sein kann. Aber wie gesagt, manchmal, nicht immer. Nach welchen Regeln das funktioniert, habe ich noch nicht heraus bekommen. Wenn es denn überhaupt welche gibt. Mindestens zweimal am Tag kann also aus meinem Schimmel ein wundersames Wesen werden. Wenn man nicht darauf achtet, fällt es einem nicht auf. Aber nachdem ich dieses erste Erlebnis hatte, habe ich das Tier ständig beobachtet und bin dann darauf gekommen, dass manchmal das Wunder eintritt.
So stand ich einmal genau zur Mittagsstunde hier am Fenster und sah die Wandlung des Schimmels zum grünen Pferd. Ich machte dann den Versuch und wünschte mir, auf dem Dachboden zu sein. Schon stand ich am Treppenaufgang neben den Schaufensterpuppen. Es genügt offenbar, den grünen Schimmel mit eigenen Augen zu sehen oder in seiner Nähe zu sein, damit ein Wunder eintritt.«
»Aber Tante, das ist ja herrlich«, begeisterte sich Lila, »dann können wir uns doch alle möglichen Wünsche erfüllen.«
»Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Diese Art der Wunder haben gewiss nichts damit zu tun, dass man sich nun wünschen kann, unermesslich reich zu sein. Es muss sich um die Erfüllung andersartiger Wünsche handeln. Und ich bin sehr im Zweifel, ob man sich ernsthaft damit befassen sollte. Man weiß nie, was auf einen zukommt und es könnte unter Umständen sogar böse enden.«
Die Tante hatte nichts dafür übrig, sich mit den wunderbaren Fähigkeiten des Zauberschimmels näher zu befassen. Alte Menschen neigen nicht zu Abenteuern. Sie haben schon zu viel erlebt im Leben.
Für uns Kinder galt das Gegenteil. Wir wollten es ganz genau wissen.
Wann trat das Wunder ein? Was war los mit dem grünen Schimmel?
Was konnte er bewirken? Auf welche Weise konnten wir gedanklich darauf Einfluss nehmen? Die Ferien versprachen spannend zu werden. Beseelt von abenteuerlichen Vorstellungen aller Art gingen wir an diesem Abend ins Bett und träumten die sonderbarsten Dinge von grünen, roten, blauen oder buntgescheckten schwebenden Pferden.
Die kommenden Ferientage waren nun für uns verplant. Der eigentlich weiße Schimmel stand nun unter unserer besonderen Beobachtung. Schon am nächsten Mittag, als die Sonne am höchsten stand, lugten wir durch den Lattenzaun und nahmen das Pferd ins Visier. Nichts geschah. Weder wurde das Tier grün, noch machte es Anstalten, sich vom Boden zu erheben. Enttäuscht wandten wir uns ab und dem normalen Spielgeschäft zu. Aber wir hatten noch Hoffnung. Es war ja immer noch Vollmond.
Am Abend saßen wir recht unkonzentriert bei unseren Spielen und warteten auf die Dunkelheit und den Vollmond. Wir mussten vorsichtig sein. Die Tante sollte nicht merken, dass wir unsere Aufmerksamkeit so auf das Wunderpferd richteten. Sie hatte ja deutlich genug gesagt, dass sie davon nicht viel hielt.
Dann war der Mond da und Lila, die nahe beim Fenster saß, hob den Daumen. Das bedeutete, dass der Schimmel hell erleuchtet auf der Wiese stand.
«Ich glaube, ich gehe mal kurz vor die Tür«, sagte Bennie,«ich habe irgendwie Kopfschmerzen vom vielen Spielen bekommen.«
»Komm, wir gehen mit ihm«, sagte Lila, »frische Luft tut uns auch gut.«
So standen wir vor der Haustür und starrten hinüber auf die Wiese und den Schimmel in Erwartung des wiederkehrenden Wunders. Aber auch dieses Mal geschah nichts. Keine Farbänderung, keine physikalische Anomalie. Nicht einmal Gedanken konnten wir lesen. Was war denn nur in das Wundertier gefahren? Auf was sollte man sich eigentlich noch verlassen können, wenn nicht einmal Wunder verlässlich eintreten? Enttäuscht gingen wir zurück in die Küche.
»Na, geht´s wieder, Bennie«, fragte die Tante. «Ja, ja, alles in Ordnung«, antwortete der abwesend.
Dann gingen wir ins Bett. Keineswegs, um zu schlafen. Wir wollten unbedingt bis Mitternacht wach bleiben und dann noch einmal nach dem Schimmel sehen. Bennie hatte eine Taschenlampe und leuchtete alle fünf Minuten auf den Wecker, damit wir ja die Zeit nicht verpassten. Mir fielen immer wieder die Augen zu.
Plötzlich rüttelte er mich. »Es ist soweit«, flüsterte er. Leise schlichen wir durch den dunklen Flur in Richtung Küche, Bennie mit der Taschenlampe voran. Dass uns nur die Tante nicht hörte! Das Fenster in der dunklen Küche schien durch den Mond wie hell erleuchtet. Wir schauten nach draußen. Es war Punkt Mitternacht.
Und da stand er, der grüne Schimmel und sah den Mond an. Und dann schien eine unsichtbare riesige Hand ihn in die Höhe zu ziehen. Das Wunder war wieder eingetreten. Nur – was war mit uns? Ich konnte weder Bennies noch Lilas Gedanken lesen.
»Gebt mir eure Hände«, sagte Lila. Wir fassten uns an und im selben Augenblick fühlten wir, dass wir an einem anderen Ort waren. Aber wo? Bennie knipste die Taschenlampe an. Wir waren auf dem Dachboden.
»Das habe ich mir gewünscht, das wir drei auf dem Dachboden wären, genau wie die Tante«, erklärte Lila, »und es hat funktioniert.«
Wir standen genau vor dem großen Karton, auf dem das Segelschiff aufgebaut war. Wir hatten immer geglaubt, dass es ein Modell des Schiffes von Christoph Kolumbus sein musste und uns vorgestellt, wie es wäre, mit Kolumbus in die Neue Welt zu segeln. »Auf diesem Schiff müssten wir jetzt sein«, dachte ich so. Die Folgen meines Gedankens waren dramatisch.
*
Die Dielen, auf denen wir standen, schwankten mit einem Mal bedrohlich, aber es waren nicht mehr die Dielen des Dachbodens. Unter unseren Füßen erstreckten sich die groben Planken eines Schiffsdecks und wir klammerten uns an einen Mast.
»Wo sind wir?«, schrie Lila in den tosenden Sturm hinein.
»Ich habe nur auf dem Dachboden an das Segelschiff gedacht«, schrie ich zurück.
Über uns am Mast zerrte der Sturm an riesigen Segelflächen. Beim Blick voraus sahen wir gewaltige Wasserberge, die sich auftürmten und dann das Deck mit aller Kraft überspülten. Wir konnten uns kaum halten, als die Gischt über uns schoss. Wir waren völlig durchnässt in unseren Schlafanzügen, die wir ja anhatten.
Vor uns mühte sich an einem bemerkenswert großen Holzrad ein Seemann, den Kurs zu halten in dieser Wasserwüste. Daneben stand noch einer, der sich mit einem Tau festgebunden hatte, und gab Befehle, die in dieser Situation ebenso sinnwie zwecklos waren. An dem Mast vor uns mühten sich etliche Männer mit den Segeln. Sie wollten sie wohl zusammen rollen, damit der Sturm nicht mehr auf sie einwirken konnte. Selbst in dieser gefährlichen Lage kletterten sie noch in dem Mast und auf den Stangen, die die Segel hielten, umher.
»Wir sind auf einem Segelschiff, mir ist kalt und ich bin von oben bis unten nass«, stellte Bennie lauthals fest und wir waren ihm sehr dankbar für diese segensreiche Erkenntnis.
»Wir müssen hier weg«, schrie ich, »haltet euch an mir fest und wir versuchen, zwischen den Wellenbergen nach hinten zu dem Schiffsaufbau zu kommen.«
Es gelangt uns gerade eben vor der nächsten Wasserfront, den Aufbau zu erreichen, eine der Türen aufzureißen und hinein zu stürzen in den dahinter liegenden Raum. Die Tür mussten wir gar nicht mehr selbst schließen, das besorgte die gerade auflaufende große Welle mit einem gewaltigen Schlag.
Wir befanden uns in einer Art kleinem Vorraum, von dem aus eine steile Treppe nach unten in den Schiffsbauch führte. Vorsichtig stiegen wir hinab, denn durch die von uns abtropfende Nässe hätten wir leicht ausrutschen können. Unten tat sich ein größerer Raum auf, in dem viele Hängematten an den Seiten hingen. In einigen der Matten lagen Männer. Sie sahen verwundert und überrascht auf, als sie uns drei Kinder erblickten.
Einer der Männer fragte etwas, aber wir konnten seine Sprache nicht verstehen. Wohin hatte uns das grüne Pferdewunder nur verschlagen, fragte ich mich. Man musste anscheinend mit seinen Gedanken und Wünschen sehr vorsichtig sein.
Schließlich sprangen zwei der Männer aus ihren Hängematten. Einer ging durch den hinteren Ausgang nach oben. Der andere gab uns durch Zeichen zu verstehen, unsere nassen Schlafanzüge auszuziehen und überreichte uns Ersatzkleidung. Die Hosen und Jacken waren bei Weitem zu groß für uns, aber sie waren trocken und fühlten sich daher sehr angenehm an. Dann trocknete der Mann uns noch die Haare und wir bedankten uns herzlich bei ihm.
»Aleman?« fragte er. Wir hatten keine Ahnung, was er meinte.
»Fernando! Aleman!« rief er und ein weiterer Mann kam aus seinem Lager hervor.
»Ihr deutsch?« fragte Fernando uns. Na, Gott sei Dank, er konnte deutsch sprechen.
Seine Deutschkenntnisse waren allerdings nicht perfekt und es schien uns, als spräche er ein etwas altertümliches Deutsch. Er wollte wissen, wo wir denn herkämen. Was sollten wir ihm da sagen? Dass ein grünes Pferd uns vom Dachboden der Tante herbeigezaubert hatte?
Dann kam der andere Mann zurück. An seiner Seite war ein weiterer Mann, der ein Uniform trug.
»Woher kommen die Kinder?«, fragte der Uniformierte. Das Seltsame war, dass er eine fremde Sprache sprach, die wir plötzlich verstehen konnten.
Die anwesenden Männer konnten es natürlich nicht sagen, sie hatten ja auch keine Ahnung, woher wir kamen.
»Ich will nicht annehmen, dass jemand aus der Mannschaft Kinder auf mein Schiff geschmuggelt hat«, brüllte er in den Schiffsbauch in einer Lautstärke, dass es selbst jene Matrosen, die auf den Masten mit den Segeln kämpften, gehört haben mussten.
»Woher kommt ihr, Kinder?« fuhr er uns an. »Sie sind Deutsche«, wandte Fernando ein, aber der Mann in Uniform wischte seinen Einwand weg und sah uns streng an.
»Wir wissen auch nicht, wie wir auf dieses Schiff gekommen sind«, sagte mit einem Mal Bennie in der fremden Sprache und Lila und ich waren völlig überrascht. Wir konnten also die Sprache nicht nur verstehen, sondern auch sprechen. Da waren ohne Zweifel mit dem grünen Pferdewunder noch ein paar nützliche Kleinigkeiten verbunden.
»Wir haben auf dem Dachboden unserer Tante mit einem kleinen Segelschiff gespielt«, ergänzte Bennie in aller Unschuld, »und plötzlich standen wir oben auf dem Deck und wurden pitschnass. Da muss sich wohl ein Wunder ereignet haben.«
Du bist aber mutig, Bennie, dachte ich, wer soll denn das glauben? Doch der Mann in Uniform schien plötzlich nachdenklich zu werden.
»An Bord schleichen konnten sich diese Kinder gewiss nicht und auch von der Mannschaft konnte niemand sie mitnehmen. Dazu waren die Kontrollen zu streng beim Beladen des Schiffes«, dachte er laut nach. »Wenn mir keiner erklären kann, wie sie mitten auf See, noch dazu in einem Sturm, plötzlich hier auftauchen konnten, dann muss es sich wirklich um ein Wunder handeln.« Entgeistert schüttelte er den Kopf.
»Wer sind Sie denn eigentlich«, wagte ich ihn zu fragen. Da stahl sich ein Lächeln in das Gesicht des strengen Mannes.
»Endlich mal eine sinnvolle Frage, mein Junge«, lachte er und strich mir mit der Hand über die Haare. »Ich bin der Kapitän dieses Seglers und der Kommandant einer Flotte, die sich anschickt, die Welt zu umsegeln. Mein Name ist Ferdinand Magellan. Männer«, fuhr er laut fort, »als gläubige Christen sind uns Wunder nicht fremd. Diese drei Kinder hier sind offensichtlich durch eine besondere Fügung auf unser Schiff gelangt. Ich betrachte es als außerordentlich gutes Zeichen für unsere Mission. Geht daher mit diesen Kindern freundlich und sorgsam um. Es soll ihnen, so weit das möglich ist, hier an Bord an nichts mangeln. Sie werden in dem kleinen Verschlag hinter meiner Kapitänskajüte untergebracht.«
Das Segelschiff auf dem Dachboden war also nicht das Modell eines Kolumbus-Schiffes, sonders das des Kapitäns Magellan. Kolumbus kannten wir Kinder, davon hatten wir schon in der Schule gehört. Aber Magellan? Nun ja, man würde sehen. Jedenfalls verstanden wir jetzt, warum die Tante so zurückhaltend gewesen war bezüglich der Wünsche im Zusammenhang mit dem grünen Schimmel. Man konnte wirklich nicht wissen, was auf einen zukam.
Fernando führte uns zu dem vom Kapitän genannten Verschlag. Es war eng hier und Fernando konnte gerade eben drei Hängematten aufhängen, wobei er zwei übereinander anbringen musste. Aber es war auch irgendwie gemütlich. Allerdings nicht in diesem Augenblick. Denn das Schiff stampfte und rollte immer noch im wütenden Sturm wie von Teufel angetrieben. Uns wurde mehr und mehr flau im Magen. Besonders Lila schien sehr mitgenommen. Wir legten uns erst einmal in die Hängematten und harrten der Dinge, die da kommen mochten.
Wir mussten wohl eingeschlafen sein, denn Fernando rüttelte uns der Reihe nach wach. »Raus aus den Betten, Kinder«, rief er, »es gibt Frühstück.«
Wir gingen mit ihm nach oben auf das hintere Oberdeck. Ein weiteres Wunder war geschehen. Es war Tag, der Sturm hatte sich gelegt und die See bot einen leichten Wellengang, während ein steter Wind die Segel blähte, die komplett gehisst waren. Zwar schien die Sonne, aber es war doch recht kalt.



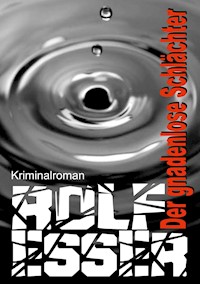

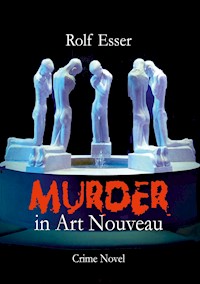
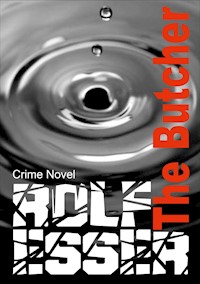











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










