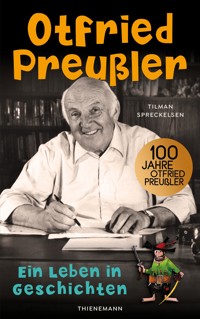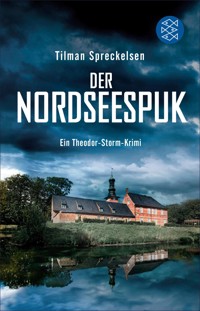11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich werde über Märchen sprechen, obwohl ich weiß, dass ich mich schlecht gerüstet auf ein Abenteuer einlasse. Das Märchenland, das Reich der Feen und Elben, ist ein Land voller Fährnisse, wo Fallen den Unbedachten und Kerker den Tolldreisten erwarten.« J. R. R. Tolkien Tilman Spreckelsen ist seit seiner Kindheit ein Liebhaber von Märchen und ein ausgewiesener Kenner. Im vorliegenden Essay beschäftigt er sich hauptsächlich mit den Märchen der Brüder Grimm und stellt hierzu seine eigenen – wie sollte es anders sein – drei Thesen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tilman Spreckelsen
Der goldene Schlüssel
Zu Märchen
Essay
Mit Zeichnungen von Otto Ubbelohde
DÖRLEMANN
Für Christa und Kay Spreckelsen
eBook-Ausgabe 2020 Alle Rechte vorbehalten © 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Fotos von akiyoko/Shutterstock.com Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-963-8www.doerlemann.com
Inhalt
»Ich werde über Märchen sprechen, obwohl ich weiß, dass ich mich schlecht gerüstet auf ein Abenteuer einlasse. Das Märchenland, das Reich der Feen und Elben, ist ein Land voller Fährnisse, wo Fallen den Unbedachten und Kerker den Tolldreisten erwarten. Und für tolldreist könnte auch ich gelten, denn zwar bin ich ein Liebhaber der Märchen, seit ich lesen kann, und habe zeitweise auch über sie nachgedacht, doch habe ich mich nicht wissenschaftlich mit ihnen befasst. Ich bin kaum mehr als ein neugieriger Reisender (oder Eindringling) in diesem Land gewesen, in dem es nicht an Wundern, doch an Auskünften mangelt.«
Diese Worte stammen von J. R. R. Tolkien, aber ich kann sie ebenfalls an den Anfang meines Textes stellen, und das, was die bescheidene Rüstung angeht, mit größerem Recht als damals der Philologe aus Oxford. Tolkien hielt seinen Vortrag »Über Märchen« 1939, in einer anderen Zeit also und im Zusammenhang einer anderen literaturkritischen Diskussion, aber auch vor dem Hintergrund einer anderen Tradition: Er bezieht sich in seinen Beispielen meist auf eine Sammlung von insgesamt zwölf Märchenbüchern mit höchst heterogenem Inhalt, die der schottische Autor Andrew Lang zwischen 1889 und 1910 publizierte, er wägt und prüft, erkennt einiges an und scheidet vieles aus: »Reine Tierfabeln« etwa, in denen »die Tiergestalt nur Maske über dem menschlichen Antlitz ist«, gehören für Tolkien nicht in das Corpus der Märchen. Ebenfalls keine Gnade finden jene Wunderreisegeschichten, in denen einer aufbricht wie Gulliver, um in einer entlegenen Ecke unserer realen, sterblichen Welt etwas ganz Ungewohntes zu finden: Riesen, Zwerge, sprechende Tiere zwar, aber im Prinzip doch den Gesetzen unterworfen, denen auch wir unterworfen sind.
Was aber lässt Tolkien gelten? Was macht für ihn das genuine Märchen aus?
Märchen, sagt Tolkien, befriedigen die Wünsche derer, die sie hören oder lesen: Sie wollen »die Tiefen von Raum und Zeit erkunden«, denn Märchen »stoßen eine Tür in die andere Zeit auf, und wenn wir über die Schwelle treten, und sei es nur für einen Augenblick, stehen wir außerhalb unserer Zeit, vielleicht außerhalb der Zeit überhaupt.« Wer Märchen liest, wünscht sich die »Zwiesprache mit anderen Lebewesen, mit Tieren oder Pflanzen«, er findet »Wiederherstellung, Trost und Fluchtgelegenheiten«, heißt es weiter in Tolkiens Vortrag, und besonders das letzte dieser Versprechen, das Eröffnen von »Fluchtgelegenheiten« also, zielt auf einen bis heute an Märchen so gut wie an die literarische Fantasy gern gerichteten Vorwurf: Beides leiste dem Eskapismus der Leser oder Hörer Vorschub; wer sich mit Märchen oder mit Büchern wie Tolkiens Der Herr der Ringe beschäftige, gebe sich einer Weltflucht hin und weiche so unserer Realität aus, zu seinem Schaden und letztlich auch zum Schaden der Welt, vor der er flieht und die er, indem er in ihr Geschehen nicht eingreift, auch nicht zu einer besseren macht.
Natürlich kennt Tolkien diese Vorwürfe, die in seiner Zeit, als die literarische Phantastik noch mit größerem Misstrauen beäugt wurde als in unserer, umso rigider geäußert wurden – dass sich das mittlerweile geändert hat, ist nicht zuletzt Tolkiens eigenem literarischen Schaffen geschuldet. Aber auch in der Betrachtung von Märchendichtung spielt die Frage nach deren Verhältnis zur Realität eine gewichtige Rolle – in Tolkiens Vortrag von 1939 ebenso wie in der Zeit seither bis heute, und womöglich mehr denn je. Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie historisch, literaturwissenschaftlich oder rezeptionsästhetisch argumentieren, und wer wie Tolkien im eingangs erwähnten Zitat das »Märchenland« als einen Bereich ansieht, den man »als neugieriger Reisender (oder Eindringling)« tatsächlich betreten kann, der wird naturgemäß anders antworten als ein Skeptiker dieses Konzepts.
Wenn ich nun drei Thesen zum Märchen zur Diskussion stelle – es müssen natürlich drei sein, und die jüngste These kriegt am Ende die Prinzessin und das Königreich –, dann ist auch mit ihnen die Frage zum Verhältnis von Märchendichtung und Realität eng verwoben.
Die Thesen lauten:
Im Märchen kommt jeder zu sich selbst
Im Märchen wird für alles bezahlt
Im Märchen kommt man nie an ein Ende
Zuvor aber möchte ich einen Blick auf eine besondere historische Situation und eine Reihe besonderer Menschen werfen, die das wesentlich geprägt haben, was wir meinen, wenn wir heute von Märchen sprechen.
Wenn ein Gemälde »Kurfürst Wilhelm der Erste durchfährt das Wilhelmshöher Tor« heißt, dann kann man sich ganz gut vorstellen, was darauf zu sehen ist. Tatsächlich sieht man auf besagtem Bild einen Reiterzug, der sich von links nach rechts bewegt, eine Kutsche, in der man sich den hessischen Kurfürsten vorstellen mag, vor allem aber einen klotzigen Bau im Hintergrund, der ein Säulenportal der Allee zuwendet, auf der die Kutsche rollt.
Wenn man nun ganz genau hinschaut, erblickt man auf dem flachen Dach über den Säulen zwei Gestalten, die das Geschehen beobachten. Es sind Jacob und Wilhelm Grimm, die damals den zweiten Stock bewohnten. Um auf jenes Dach zu gelangen, mussten sie aus dem Fenster klettern. Das taten sie oft, besonders bei schönem Wetter – einmal notierte Wilhelm Grimm: »Nachts noch auf der Althane geseßen, die Lindenblüthen erfüllten die ganze Luft.« Jedenfalls muss der Blick einmalig gewesen sein: Links fing hinter dem Wilhelmshöher Tor die aufblühende Residenzstadt Kassel an, nach rechts schweifte der Blick über die fast noch häuserlose Straße, die heute dicht bebaut ist und »Wilhelmshöher Allee« heißt. Schnurgerade führt sie als kilometerlange Blickachse zum Schloss im Bergpark, und etwas weiter weg kann man mit etwas Glück sogar den Turm der Löwenburg entdecken.
Auch abgesehen von dem Ausguck war die Wohnung im nördlichen Torwächterhaus nicht ohne Reiz. Jacob und Wilhelm lebten darin in enger Lebens- und Arbeitsgemeinschaft seit dem Jahr 1814 in fünf Zimmern. Hier entstanden Werke wie die Deutschen Sagen, der erste Teil der Deutschen Grammatik (beide stammen von Jacob Grimm) und vor allem die wesentlich veränderte zweite Auflage der Kinder- und Hausmärchen von 1819, bei der Wilhelm Grimm das Lektorat übernahm und mit seiner entschlossenen Überarbeitung die Grundlage für den Welterfolg der Sammlung schuf. Ein weiterer Bruder Grimm, der Maler Ludwig Emil, der sich ganz in der Nähe eine Wohnung gemietet hatte, hielt das Treiben im Wächterhaus in zahlreichen Bildern und Skizzen fest, darunter auch die Kutschfahrt des Kurfürsten im Jahr 1820.
Ein knappes Jahr später rollte die Kutsche dann in die andere Richtung, und der Kurfürst war damals schon nicht mehr unter den Lebenden – es war sein Leichenzug, der am 13. März 1821 kurz vor Mitternacht von der Residenzstadt in den Park unterwegs war.
Wieder waren Jacob und Wilhelm Grimm unter den vielen, die den Zug beobachteten, wieder erwies sich der Ausguck auf dem Vordach als günstiger Ort dafür. Sie waren Zeuge, als das gewaltige Gefolge, die insgesamt fünf Kutschen plus Leichenwagen, die Reitknechte mit Fackeln vor und nach den Wagen, die Husaren und alles, was der Hof an Würdenträgern zu bieten hatte, den Weg zum Schloss einschlugen. Der Junker Christian von Eschwege hatte die Ehre, in schwarzer Rüstung auf einem ebenfalls schwarzgewappneten Pferd den Trauerzug anzuführen. Er war 28 Jahre alt, seine Familie galt etwas in Hessen, und wahrscheinlich schwitzte er nicht nur wegen seines schweren Harnischs. Seinem toten Herrn hätte der ritterliche Anblick jedenfalls gefallen.
Was aber dachten sich Jacob und Wilhelm Grimm? Ohne den bauwütigen Monarchen, das wussten sie, gäbe es weder das Schloss im Park noch die Löwenburg, vom Tor und seinen Wächterhäusern, von ihrer Wohnung also ganz zu schweigen. Beide Brüder hatten ihm als Bibliothekare gedient, und schon der elfjährige Jacob hatte ihn nach dem Tod des Vaters, den Ruin der Familie vor Augen, über eine Verwandte um Unterstützung gebeten. Die letzte Begegnung aber an diesem Frühlingsabend ist auch die zwischen einem hoffnungslos rückwärtsgewandten Autokraten und zwei Forschern, Sammlern und Erzählern, die schon dabei waren, die Grundlagen für ein halbes Dutzend wissenschaftlicher Disziplinen unserer Zeit zu legen.
Angefangen hat das in Hanau, sowohl für den damaligen Erbprinzen Wilhelm, den sein Vater schon früh aus Kassel hierher abgeschoben hatte, wie auch für die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, geboren 1785 und 1786 in Hanau, Jacob also im selben Jahr, in dem der hessische Prinz aus der Stadt abreiste, um nach dem Tod seines Vaters in Kassel den Thron zu besteigen. Hier aber hinterließ er Spuren, die bis heute sichtbar geblieben sind: Natürlich die hinreißende Anlage Wilhelmsbad, dann aber die künstliche Burgruine auf einer ebenso künstlichen Insel, von außen wildromantisch, von innen so bequem, wie es sich ein Fürst jener Zeit nur bereiten konnte. Zugleich zeigte Wilhelm dynastischen Sinn: Sein Hofmaler Anton Wilhelm Tischbein malte insgesamt 16 Porträts von Wilhelms Vorfahren, die im Inneren der Ruine angebracht wurden.