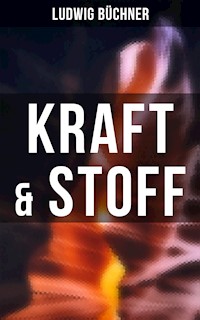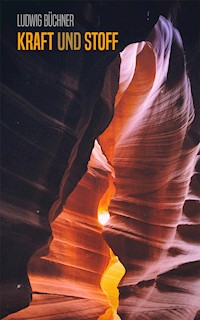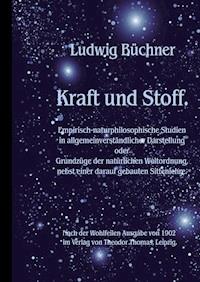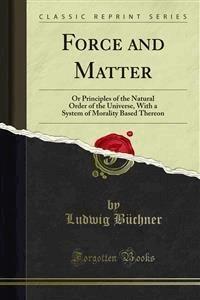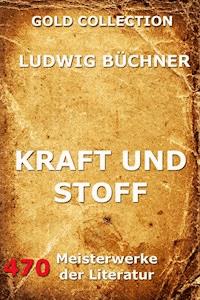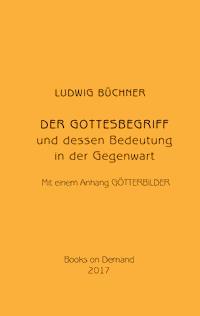
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Schrift Ludwig Büchners erschien 1874 in Leipzig. Der Autor argumentiert, dass der Gottesbegriff, wie er zu seiner Zeit allgemein verstanden wurde, nicht haltbar ist. Er schreibt: "Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Aufklärung sind ... bessere Lehrmeister der Menschheit als der phantastische, zu so vielen hässlichen Zwecken ausgebeutete Gottesglaube."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach der Originalausgabe von 1874
herausgegeben und erweitert mit einer
Sammlung von Götterbildern aus aller Welt
von Wolfgang Buddrus.
Einbandgestaltung: Wolfgang Buddrus.
INHALT
Biographie Ludwig Büchners
Der Gottesbegriff Vorwort des Verfassers
Vortragstext
Anzeige des Verlages
Götterbilder
Ludwig Büchner wird am 29. März 1824 in Darmstadt geboren. Er ist der jüngere Bruder des Dichters Georg Büchner (u.a. die Dramen »Dantons Tod«, »Woyzeck«).
Ludwig studiert Medizin im französischen Straßburg und in Gießen, wo der berühmte Chemiker Justus Liebig lehrt.
Nach seinem medizinischen Staatsexamen wird er als Privatdozent an die Universität Tübingen berufen. Er doziert dort gerichtliche Medizin sowie mehrere praktisch-medizinische Fächer. Daneben veröffentlicht er verschiedene naturwissenschaftliche Aufsätze in Zeitschriften für die allgemeine Bildung.
Angeregt durch Jacob Moleschotts gerade erschienenes Buch »Der Kreislauf des Lebens«, verfaßt Büchner seine »empirisch-naturwissenschaftlichen Studien“ in einem Buch, das er Kraft und Stoff nennt. Mit diesem Buch wird er »über Nacht« berühmt, das Werk erlebt über 20 Auflagen und wird in fünfzehn Sprachen übersetzt!
Die in diesem Buch vertretenen Ansichten finden auch heftigen Widerspruch; er muß die Universität verlassen und arbeitet als praktischer Arzt in seiner Vaterstadt Darmstadt. Neben der Tätigkeit in seiner ärztlichen Praxis widmet er sich immer stärker seiner schriftstellerischen Arbeit. Es erscheinen u. a.
1857 »Natur und Geist«.
1861 – 75 »Physiologische Bilder«, 2 Bände.
1868 »Sechs Vorlesungen über die Darwinsche Theorie von der Verwandlung der Arten und die erste Entstehung der Organismenwelt«.
1869 »Der Mensch und seine Stellung in der Natur und Gesellschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft«.
1874 »Der Gottesbegriff und dessen Bedeutung in der Gegenwart«. 1874 »Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien in allgemeinverständlicher Darstellung oder Grundzüge der natürlichen Weltordnung, nebst einer darauf gebauten Sittenlehre.«
1876 »Aus dem Geistesleben der Tiere. Staaten und Taten der Kleinen«.
1887 »Über religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung«.
1889 »Das künftige Leben und die moderne Wissenschaft«.
1894 »Meine Begegnung mit Ferdinand Lassalle, Ein Beitrag zur Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland. Nebst 5 Briefen Lassalles«.
1898 »Am Sterbelager des Jahrhunderts«.
1899 »Im Dienste der Wahrheit«, gesammelte Aufsätze zu verschiedenen medizinischen, philosophischen und politischen Themen.
1909 »Die Macht der Vererbung«.
1881 gründet er mit Freunden den »Deutschen Freidenkerbund«.
Am 1. Mai 1899 stirbt Ludwig Büchner in Darmstadt.
Der Gottesbegriff und dessen Bedeutung in der Gegenwart.
Vorwort.
Der nachstehende Vortrag ist in mehreren Städten Amerikas und Deutschlands in den Wintern 1872-73 und 1873-74 gehalten worden und wird hier mit fast denselben Worten, in denen er gesprochen wurde, nur in etwas erweiterter Ausführung, einem größeren und allgemeineren Publikum vorgelegt. Zwar ist das Wesentliche seines Inhalts bereits in früheren Schriften des Verfassers, namentlich in „Kraft und Stoff“ enthalten; aber nichtsdestoweniger glaubt er, dem Wunsch und Bedürfnis einer nicht geringen Anzahl von Lesern durch diese Zusammenstellung und Erweiterung der auf den wichtigen Gottes-Begriff bezüglichen Erwägungen und Betrachtungen der materialistischen oder Einheits-Philosophie, soweit dieses in den begrenzten Rahmen eines Vortrages paßt, entgegenzukommen. Auch mag eine solche Veröffentlichung imstande sein, einen erneuten Anstoß zur endlichen und definitiven Eliminierung eines Begriffes zu geben, der, wie der Verfasser glaubt, unsrer ganzen geistigen, sozialen und politischen Entwicklung, wie kein anderer, hindernd im Wege steht. Die Unverträglichkeit dieses Begriffes und aller ihm anhängenden Konsequenzen mit unsrer modernen wissenschaftlichen Bildung und der daraus folgende Zwiespalt zwischen Sein und Scheinen, zwischen Leben und Wissen, zwischen Bildung und Unbildung, zwischen Ideal und Wirklichkeit wirkt, wie es dem Verfasser scheint, lähmend auf die Gemüter und verwirrend auf die Geister und erzeugt und unterhält jene geistige Indifferenz oder Blasiertheit, die das allgemeine Leben der Gegenwart mehr oder weniger charakterisiert und die der ärgste Feind des allgemeinen Fortschritts ist.
Endlich soll diese Veröffentlichung auch noch den nebensächlichen Zweck haben, gegenüber den mancherlei schiefen und entstellenden Berichten der Organe der öffentlichen Meinung über diese Vortrag und seinen Inhalt das, was wirklich gesagt worden ist, dem öffentlichen Urteil vorzulegen und anheimzustellen. Dieses Urteil wird voraussichtlich von der einen und mächtigeren Seite her ebenso ungünstig und verwerfend, wie von der andern weniger mächtigen her zustimmend sein, sie das der Verfasser von seinen früheren Publikationen her bereits gewohnt ist. Aber da das Suchen nach Wahrheit von jeher ein schwieriges und mit mancherlei Gefahren verbundenes Geschäft gewesen ist und immer bleiben wird, namentlich sobald es sich von der großen und offiziell erlaubten Heerstraße entfernt, so wird dabei durchaus nichts zu verwundern oder zu ärgern bleiben. Es kann sehr wohl möglich sein, daß der Verfasser im Ganzen oder im Einzelnen sich geirrt hat, da ja Irrtum vom Aufsuchen der Wahrheit unzertrennlich ist; und sollte dieses der Fall sein, so wird ihn der Nachweis dieses Irrtums mit positiven Gründen (nicht mit Schimpfen oder Bibelsprüchen) im Interesse der Wahrheit nicht minder erfreuen, als der glänzendste Erfolg seiner eignen Meinung.
Was die einzelnen Beweise für das Dasein Gottes und ihre Widerlegung selbst betrifft, wo wird man zwar von philosophischer Seite aus darauf hinweisen, daß eine solche Widerlegung eine gänzlich unnötige Wiederholung einer in der Philosophie längst getanen und abgetanen Arbeit sei. Aber der aufmerksame Leser wird bemerken, daß eine gründliche und allgemeinverständliche Widerlegung dieser angeblichen Beweise, die trotz aller philosophischen Kritik halb bewußt, halb unbewußt die Geister beherrschen, nur vom naturwissenschaftlichen und speziell naturphilosophischen Standpunkte aus möglich ist und daß hierbei Betrachtungen, die zum Teil erst aus den jüngsten Erwerbungen jener Wissenschaften gewonnen worden sind, eine hervorragende Rolle spielen. Endlich hat sich ja die Philosophie durch Beibehaltung des Gottesbegriffes als moralischen Postulats im Widerspruch mit ihrer eignen Kritik für den Gottesbegriff und dessen Schwächen mehr oder weniger verantwortlich gemacht und muß sich daher auch eine erneute Widerlegung und namentlich den Nachweis seiner Entbehrlichkeit von moralischen Gesichtspunkten aus gefallen lassen. Wäre das aber auch nicht der Fall, so würde jene Widerlegung mit Rücksicht auf den Zweck und die Absicht dieser Veröffentlichung doch immer noch ihr volles Recht behalten.
Grade so, wie in der politischen Welt alles auf die allmähliche Ersetzung der Monarchie durch die Republik hindrängt, so muß auch in der geistigen Welt die Republik des Weltalls allmählich an die Stelle der Monarchie des Weltalls treten!
Leipzig, im Februar 1874.
Der Verfasser.
Hochgeehrte Anwesende!
Wer unter Ihnen hätte nicht die Iliade gelesen, jenes herrlichste Gedicht des Altertums, dessen poetische Schönheiten zum Teil heute noch unerreicht dastehen? Und wer erinnerte sich nicht, wie hier der Kampf zweier Völker nicht bloß auf der Erde, sondern gleicherweise auch in idealisierter Gestalt im Himmel geführt wird! Wie die hoch oben auf dem Olympos in ewiger Seligkeit thronenden Götter nicht bloß das lebhafteste Interesse an den Kämpfen der Menschen nehmen, sondern wie sie auch direkt in diese eingreifen und wie sie dabei ganz von den gleichen Gefühlen, Erregungen, Leidenschaften und Schwächen beseelt sind wie die Menschen auch! Wie namentlich der alles beherrschende Gott-Vater, der Zeus oder Jupiter, von seinem goldnen Throne herab grade so regiert und seinen niederen Göttern befiehlt, wie das ein irdischer König seinen Untergebenen zu tun pflegt! Wie sie alle vor ihm zittern und wie der sich menschlich benimmt, nur mit dem Unterschiede, daß alles großartiger, gewaltiger, erhebender gedacht oder vorgestellt wird! Sogar seine Person und sein Aussehen erscheinen unter dem Bilde eines idealisierten Menschen; und er wird von Homer ungefähr in derselben Weise vorgestellt, wie sich auch wohl heute noch ungebildete Menschen Gott vorzustellen pflegen, als ein alter ehrwürdig aussehender Mann mit langem Barte und herabwallenden Locken, der, wenn er sich bewegt, Himmel und Erde erzittern macht. Denn als Thetis, die Mutter des Achilles, bei Zeus Rache erfleht für ihren beleidigten und schwer gekränkten Sohn, da gewährt dieser nach der homerischen Erzählung die Bitte, indem er seine Rede mit einem gnädigen Kopfnicken begleitet:
„Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion!
Und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts
Von dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höh'n des Olympos!“
Und als das Heer der Achäer von der Pest heimgesucht wird und so viele dahinsterben, ohne daß ein Widerstand möglich ist, da weiß das Homer nicht besser zu erklären, als aus den fernhintreffenden Pfeilen des Gottes Apollo, der den Achäern übelwill und sich auf diese Weise an ihnen zu rächen sucht. Oder als der Held Achilles das Totenfeuer für seinen erschlagenen Freund Patroklus angezündet hat, das aber nicht recht brennen will, da weiß er sich keinen besseren Rat als den, daß er die Wind-Geister oder Wind-Götter herbeiruft, welche nun in der Tat auf seinen mächtigen Ruf herbeistürzen und das Feuer zu stärkerem Entflammen bringen.
Ich hätte Ihnen keine besseren Beispiele als diese zu geben gewußt für den sogenannten Anthropomorphismus oder die Vermenschlichung Gottes, die ja nach Ludwig Feuerbach die Quelle und den Anfang alles und jedes Gott- und Götter-Glaubens bildet und die uns bei den Griechen und bei deren größtem Dichter Homer in ihrer kindlichsten und naivsten Gestalt, aber auch zugleich in herrlicher poetischer Verklärung entgegentritt.
Diese poetische Verklärung des Gottesbegriffes bei den Alten fehlt uns heutzutage; und es ist uns nur jener nackte, kalte, abstrakte und hohle Begriff übriggeblieben, der uns logisch wissenschaftlich nicht zu befriedigen und poetisch nicht zu erwärmen vermag – ein Mangel, der durch den bekanntlich unser großer Dichter Schiller zu seinem berühmten Gedichte an die Götter Griechenlands veranlaßt wurde, in welchem er die antike und die moderne Welt-Anschauung einander gegenüberstellt und der ersteren den Vorzug gibt.
Übrigens würden Sie irren, wenn Sie glauben wollten, daß der Anthropomorphismus oder jene Selbst-Idealisierung des Menschen in Gott im Altertum nicht grade so als solcher erkannt und entlarvt worden wäre, wie dieses heutzutage geschehen ist. Der Ludwig Feuerbach des Altertums war der griechische Philosoph Xenophanes, der 450 vor Chr. lebte und als Gründer der sogenannten eleatischen Philosophie sowie als der furchtbarste Feind und Bekämpfer der griechischen Götter berühmt geworden ist.
„Den Sterblichen“, so sagt Xenophanes, „scheint es, als ob die Götter ihre Gestalt, Kleidung und Sprache hätten. Die Neger dienen schwarzen Göttern mit stumpfen Nasen, die Thraker Göttern mit blauen Augen und mit blonden Haaren. Und wenn die Ochsen und Löwen Hände hätten, um Bilder zu machen, so würden sie Gestalten der Götter zeichnen, wie sie selbst sind.“
Xenophanes tat diese Äußerung ungestraft vor 2400 Jahren, während ich heutzutage niemandem raten möchte, eine ähnliche Äußerung in katholischen Ländern einem Christusoder Marien-Bilde gegenüber zu tun. Aber auch in Griechenland blieb die Reaktion nicht aus, da nur hundert Jahre später der Sophist Protagoras aus Athen verbannt wurde, weil er von den Göttern gesagt hatte, man könne nicht wissen, ob sie existierten oder ob sie nicht existierten; und da ungefähr um dieselbe Zeit der Philosoph Sokrates, ebenfalls wegen seiner Opposition gegen die griechischen Götter, den Giftbecher trinken mußte.1