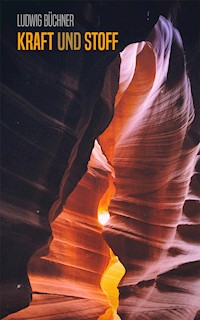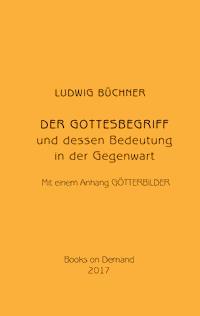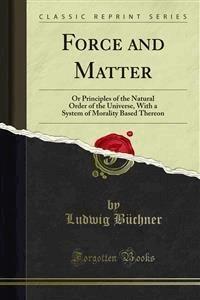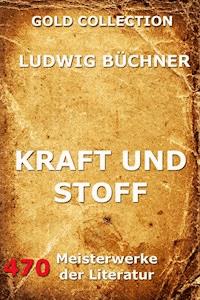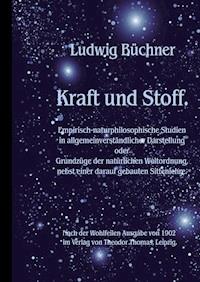
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Wesen von Materie und Energie; Himmel und Erde; Urzeugung; Gehirn und Seele; die Gottesidee, Leben und Sterben; die Moral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Biographie
Vorwort zur ersten Auflage
Kraft und Stoff
Unsterblichkeit des Stoffs
Unsterblichkeit der Kraft
Unendlichkeit des Stoffs
Wert des Stoffs
Die Bewegung
Die Form
Die Naturgesetze. I.
Die Naturgesetze. II.
Der Himmel
Die Erde
Urzeugung
Nachzeugung
Die Zweckmäßigkeit
Der Mensch
Gehirn und Seele
Der Gedanke
Das Bewußtsein
Sitz der Seele
Angeborene Ideen
Die Gottesidee
Persönliche Fortdauer
Die Lebenskraft
Die Tierseele
Der freie Wille
Die Moral
Schlußbetrachtung
Anzeigen des Verlages
Friedrich Karl Christian Ludwig Büchner
geboren in Darmstadt am 29. März 1824 als jüngerer Bruder des durch sein Trauerspiel „Dantons Tod“ berühmt gewordenen und schon im 23. Lebensjahr verstorbenen Georg Büchner, bezog, nachdem er auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt die Maturität (Zeugnis der Reife) und ein glänzendes Abgangszeugnis erlangt hatte, die dortige höhere Gewerbeschule, um sich naturwissenschaftlichen Studien zu widmen, und ein Jahr danach (Frühjahr 1843) die Universität Gießen, wo er sich zunächst allgemeinen philosophischen Studien, später aber auf Wunsch seines Vaters und entgegen eigener Neigung dem speziellen Studium der Medizin zuwandte. Neben den medizinischen setzte Büchner seine philosophischen und ästhetischen Studien unter Hellebrand, Adrian, Carriere und Krönlein fort. Nachdem Büchner zwischendurch auch in Straßburg medizinische Vorlesungen in französischer Sprache gehört hatte, bestand er im Frühjahr des stürmischen Jahres 1848 sein Fakultäts-Examen magna cum laude (mit großem Lob) und verließ im Herbst desselben Jahres Gießen, nachdem er seine Inaugural-Abhandlung „Beiträge zur Hall'schen Lehre von einem excitomotorischen Nervensystem“ geschrieben und öffentlich eine Reihe akademischer Thesen, unter denen sich auch die These befand „Die persönliche Seele ist ohne ihr materielles Substrat undenkbar“, verteidigt hatte, um in seine Vaterstadt zurückzukehren.
Hier setzte er seine bereits in Gießen in radikalem Sinne begonnene politische Tätigkeit so lange fort, bis die Niederschlagung des Aufstandes in Baden aller revolutionären Bewegung ein Ziel setzte. Zur weiteren Berufsausbildung folgte nun ein längerer Aufenthalt in Würzburg, wo damals Virchow dozierte, und in Wien, wo Skoda, Dumreicher, Hebra, Rokitanski u. a. die Hauptanziehungspunkte bildeten. Vorher aber besorgte Büchner noch die Herausgabe der nachgelassenen Schriften seines Bruders Georg und verfaßte die Lebensbeschreibung als Einleitung dazu (Frankfurt a. M., Sauerländer, 1850). Nach seiner Rückkehr von Wien befaßte sich Büchner unter Anleitung seines Vaters teils mit ärztlicher Praxis, teil mit gerichtlich-medizinischen Arbeiten. Einige von ihm verfaßte und in der „Vereinten deutschen Zeitschrift für Staatsarzneikunde“ veröffentlichte gerichtlich-medizinische Ober-Gutachten fanden einen solchen Beifall, daß der Verein badischer Ärzte den Verfasser im Jahre 1855 zu seinem korrespondierenden und Ehrenmitglied ernannte und ihm im Jahre 1860 die silberne Medaille für literarische Verdienste um Staatsarzneikunde verlieh.
Im Jahr 1852 nahm Büchner eine Stellung als Assistenzarzt an der medizinischen Klinik in Tübingen und als Privatdozent daselbst an. Er dozierte neben gerichtlicher Medizin mehrere praktisch-medizinische Fächer und veröffentlichte neben einer Reihe von Facharbeiten in medizinischen Zeitschriften auch verschiedene naturwissenschaftliche Aufsätze populärer Tendenz in Zeitschriften für die allgemeine Bildung. Im Jahre 1854 schrieb Bücher die Berichte über die in diesem Jahre in Tübingen stattgehabte Naturforscherversammlung für den Württembergischen Staatsanzeiger und für die Augsburger Allgemeine Zeitung. Diese Arbeiten sowie die Lektüre der um jene Zeit erschienenen bekannten Schrift Moleschotts „Der Kreislauf des Lebens“ gaben Büchner die erste Anregung zur Abfassung seiner später so berühmt gewordenen Schrift „Kraft und Stoff“, in der er den kühnen Versuch unternahm, die bisherige theologisch-philosophische Weltanschauung auf Grund moderner Naturkenntnis und einer darauf gebauten natürlichen Weltordnung total umzugestalten. Tendenz und Art der Darstellung gewannen dem zuerst im Jahre 1855 bei Meidinger in Frankfurt a. M. erschienenen Buche eine solche Teilnahme, daß schon nach wenigen Wochen eine neue Auflage nötig wurde, der bald danach eine ganze Reihe weiterer Auflagen folgten. Für den Verfasser selbst aber hatte das Buch die unangenehme Folge, daß er seinen Lehrstuhl in Tübingen aufgeben und zur praktischen Tätigkeit als Arzt in seine Vaterstadt zurückkehren mußte.
Hier suchte er den von allen Seiten auf ihn einstürmenden Angriffen teils durch eine Reihe von Vorreden zu den verschiedenen Auflagen seiner Schrift, teils durch eine Reihe von Journal-Aufsätzen zu begegnen, die später als gesammelte Aufsätze „Aus Natur und Wissenschaft“ in zwei Bänden (18862, 1864, 3. Aufl. 1886) erschienen sind. Den beiden in der von ihm angeregten Streitfragen einander bekämpfenden Standpunkten oder Gegensätzen suchte Büchner durch eine in dialogischer Form geschriebenen Schrift „Natur und Geist oder Gespräche zweier Freunde über den Materialismus und über die realphilosophischen Fragen der Gegenwart“ (Leipzig, 1857; 3. Aufl. 1874) gerecht zu werden; auch schrieb er um diese Zeit den ersten Band seiner „Physiologischen Bilder“ (1861, 3. Aufl. 1886), deren zweiter Band aber erst lange danach im Jahre 1875 das Licht der Welt erblickte.
Nachdem der erste Sturm etwas ausgetobt hatte, unternahm Büchner eine Übersetzung und populäre Bearbeitung der Schrift des berühmten englischen Geologen Lyell über das Alter des Menschengeschlechts (1864). Eine zweite Auflage dieser Übersetzung erschien 1874.
Im Jahre 1868 erschienen „Sechs Vorlesungen über die Darwinsche Theorie“, und diese Schrift fand einen solchen Anklang bei dem lesenden Publikum, daß rasch hintereinander fünf Auflagen nötig wurden. Die fünfte Auflage erschien 1890.
Im Jahre 1869 veröffentlichte Büchner seine große Schrift über den „Menschen und seine Stellung in Natur und Gesellschaft“ mit solchem Erfolg, daß 1889 die dritte, sehr vermehrte Auflage erscheinen konnte.
Darauf folgten zwei Schriften aus dem Gebiet der Tierseelenkunde: „Aus dem Geistesleben der Tiere“ (1876) und „Liebe und Liebesleben in der Tierwelt“ (1885), von denen die erste vier, die letzte zwei Auflagen erlebte.
Im Jahre 1882 erschien „Licht und Leben. Drei Beiträge zur Theorie der natürlichen Weltordnung“, von dem vor Jahren bereits eine zweite Auflage erschien; im Jahre 1887 „Tatsachen und Theorien aus dem naturwissenschaftlichen Leben der Gegenwart; im Jahre 1889 „Das künftige Leben und die moderne Wissenschaft“; im Jahre 1890 „Fremdes und Eignes aus dem geistigen Leben der Gegenwart“; im Jahre 1891 „Das goldene Zeitalter oder das Leben vor der Geschichte“; im Jahre 1892 „Das Buch vom langen Leben oder die Lehre von der Dauer und Erhaltung des langen Lebens“. Sein letztes und reifstes Werk „Am Sterbelager des Jahrhunderts“ (1898) bildet eine Zusammenfassung der Resultate seiner reichen schriftstellerischen Tätigkeit, einen Rückblick auf das, was er gewirkt und erstrebt und einen Ausblick in die Zukunft vom Standpunkt eines Mannes, der Zeit seines Lebens bis zum letzten Atemzug ein überzeugter Anhänger einer auf naturwissenschaftlicher Erkenntnis gegründeten Welt- und Lebensanschauung gewesen.
Außer diesen größeren Werken veröffentlichte Büchner eine Anzahl kleinerer Schriften in Broschürenform: „Der Fortschritt im Lichte der Darwinschen Theorie“ (1884); „Über religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung“ (1887); „Zwei gekrönte Freidenker“ (1890); „Darwinismus und Sozialismus“ (1894); „Meine Begegnung mit Ferdinand Lassalle“ (1894).
An Übersetzungen von Büchners Schriften in fremde Sprachen fehlt es selbstverständlich nicht. So wurde „Kraft und Stoff“ in nicht weniger als fünfzehn lebende Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Polnisch, Schwedisch, Holländisch, Griechisch, Russisch, Dänisch, Armenisch, Rumänisch, Tschechisch, Litauisch) übersetzt und in Amerika in deutscher und englischer Sprache mehrmals nachgedruckt. Die französische Ausgabe hat bis jetzt sieben, die englische vier, die italienische drei, die ungarische und holländische je zwei Auflagen erlebt. Auch die meisten übrigen Schriften Büchners sind in Frankreich, England, Italien, Spanien, Holland, Polen, Rußland, Ägypten (Arabisch) usw. übersetzt und zum Teil mehrmals aufgelegt worden.
Während der Kriegsjahre 1866 und 1871 beteiligte sich Büchner lebhaft an der Verpflegung und ärztlichen Behandlung der Kranken und Verwundeten, sowohl im Felde als zu Hause und wurde dafür durch Verleihung österreichischer, preußischer, hessischer und sächsischer Ehrenzeichen ausgezeichnet. Auch verdiente er sich den Dank vieler Invaliden und Soldatenfamilien durch Verteilung von Geldmitteln, die ihm aus Amerika für diesen Zweck zugekommen waren.
Den Winter 1872–73 brachte Büchner in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zu, wo er infolge einer von verschiedenen deutschen Vereinen an ihn ergangenen Einladung in ungefähr 32 verschiedenen Städten eine Reihe von ca. einhundert Vorlesungen über verschiedene naturwissenschaftliche und naturphilosophische Gegenstände mit großem Erfolg hielt.
Seitdem lebte er, neben ärztlicher Praxis mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, ruhig im Schoße einer zahlreichen Familie in seiner Vaterstadt Darmstadt, wobei diese Ruhe nur zeitweise durch Vorlesungsreisen in Deutschland selbst unterbrochen wurde. Die Aufnahme, die Büchner während seiner Reisen in einer Reihe von Städten, wie Berlin, Wien, Prag, München, Dresden, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Wiesbaden usw. fand, war durchweg eine sehr enthusiastische. Eine am Hofe des freidenkerischen Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha gehaltene Vorlesung über Lebensdauer trug ihm den Titel „Professor“ ein. Nicht weniger als fünfzehn wissenschaftliche freidenkerische Vereine im In- und Ausland haben ihm den Charakter als korrespondierendes und Ehrenmitglied verliehen. Im Jahre 1881 gründete Büchner im Verein mit einer Anzahl Gesinnungsgenossen den „Deutschen Freidenkerbund“ und trat an dessen Spitze, vertrat auch denselben mehrmals auf den internationalen Freidenker-Kongressen und bei der Einweihung des Diderot-Denkmals in Paris im Jahre 1880, wo er im Namen der deutschen Freidenker vor einer unzählbaren Menschenmenge eine Ansprache in französischer Sprache hielt. Der Bund hat sich seitdem unter seiner fortdauernden Führung kräftig entwickelt.
In dem öffentlichen Leben seines engeren Vaterlandes und seiner Vaterstadt war Büchner insoweit tätig, als er während neun Jahren die Stelle eines hessischen Landtagsabgeordneten und während sechs Jahren diejenige eines Darmstädter Stadtverordneten bekleidete. Beide Stellen legte er wegen Mangel an Zeit freiwillig nieder. Dagegen hat er während eines Zeitraums von nicht weniger als dreißig Jahren der großen Darmstädter Turngemeinde als erster Sprecher vorgestanden – mit einer kurzen Unterbrechung durch seine amerikanische Vortragsreise.
Am ersten Mai des Jahres 1899 entschlief er sanft, nachdem er noch am Morgen seines Todestages die Durchsicht seines letzten großen Werkes „Am Sterbelager des Jahrhunderts“ für die bereits notwendig gewordene zweite Auflage beendet hatte.
In den beiden seinem Ableben folgenden Jahren erschienen dann noch zwei Bände gesammelte Aufsätze unter dem Titel „Im Dienst der Wahrheit“ (1900) und „Kaleidoskop“ (1901).
Büchner hat sich durch seine radikalen, seiner Zeit weit vorausgeeilten Standpunkte in Wissenschaft und Leben und durch seine Angriffe auf entgegenstehende Lehrmeinungen eine große, erbitterte und zum Teil mächtige Gegnerschaft auf den Hals geladen, die in den bestehenden Zeitverhältnissen eine starke Unterstützung fand und findet. Ein abschließendes Urteil über Büchners Stellung in Philosophie und Wissenschaft sowie zu den herrschenden geistigen Strömungen seiner Zeit wird daher wohl nicht zu erlangen sein, so lange die dadurch angeregten Gegensätze und aufgeregten Leidenschaften nicht zum Ausgleich und zur Beruhigung gekommen sind. Erst einer entfernteren Zukunft dürfte die Erfüllung einer solchen Aufgabe möglich sein.
Daß die wohlfeile Ausgabe, die seinerzeit in einer Auflage von 10 000 Exemplaren gedruckt wurde, heute bereits einer Neuauflage bedurfte, scheint uns der beste Beweis dafür, daß Büchners Weltanschauung auch in weiten Kreisen des deutschen Volkes tiefere Wurzel geschlagen hat, als es äußerlich unter dem Druck der Verhältnisse scheinen mag.
Die Verlagsbuchhandlung.
Vorwort zur ersten Auflage.
Die folgenden Blätter machen keinen Anspruch darauf, ein erschöpfendes Ganze oder ein System zu sein; es sind zerstreute, wenn auch untereinander mit Notwendigkeit zusammenhängende und sich gegenseitig ergänzende Gedanken und Anschauungen aus dem fast unendlichen Gebiete empirisch-naturphilosophischer Betrachtung – die wegen des für einen Einzelnen nur schwer zu beherrschenden materiellen Umfangs aller jener naturwissenschaftlichen Gebiete, die hier zur Sprache kommen mußten, eine milde Beurteilung von Seiten der Fachgenossen für sich in Anspruch nehmen. Wenn die Blätter es wagen dürfen, sich selbst zum Voraus ein Verdienst oder einen Charakter beizulegen, so mag sich derselbe in dem Entschluß ausdrücken, vor den ebenso einfachen als unvermeidlichen Konsequenzen einer vorurteilslosen empirisch-philosophischen Naturbetrachtung nicht zimperlich sich zurückziehen, sondern die Wahrheit in allen ihren Teilen einzugestehen. Man kann einmal die Sachen nicht anders machen, als sie sind, und nichts scheint uns verkehrter, als die Bestrebungen angesehener Naturforscher, die Orthodoxie in die Naturwissenschaften einzuführen. – Wir berühmen uns dabei nicht, etwas durchaus Neues, noch nicht Dagewesenes vorzutragen. Ähnliche oder verwandte Anschauungen sind zu allen Zeiten, ja zum Teil schon von den ältesten griechischen und indischen Philosophen vorgetragen worden; aber die notwendige empirische Basis dazu konnte erst durch die Fortschritte der Naturwissenschaften in unseren Jahrhunderten geliefert werden. Daher sind auch diese Ansichten in ihrer heutigen Klarheit und Konsequenz wesentlich eine Eroberung der Neuzeit und abhängig von den neuen und großartigen Erwerbungen der empirischen Wissenschaften. Die Schulphilosophie freilich, wie immer auf hohem, wenn auch täglich mehr abmagerndem Rosse sitzend, glaubt derartige Anschauungen längst abgetan und den Aufschriften „Materialismus“, „Sensualismus“, „Determinismus“ u. a. in die Rumpelkammer des Vergessenen geschoben oder, wie sie sich vornehmer ausdrückt, „historisch gewürdigt“ zu haben. Aber sie selbst sinkt von Tag zu Tag in der Achtung des Publikums und verliert in ihrer spekulativen Hohlheit an Boden gegenüber dem raschen Emporblühen der empirischen Wissenschaften, die es mehr und mehr in Zweifel setzen, daß das makrokosmische wie das mikrokosmische Dasein in allen Punkten seines Entstehens, Lebens und Vergehens nur mechanischen und in den Dingen selbst gelegenen Gesetzen gehorcht. – Ausgehend von der Erkenntnis jenes unverrückbaren Verhältnisses zwischen Kraft und Stoff als unzerstörbarer Grundlage muß die empirisch-philosophische Naturbetrachtung zu Resultaten kommen, die mit Entschiedenheit jede Art von Supranaturalismus und Idealismus aus der Erklärung des natürlichen Geschehens verbannen und sich dieses letztere als gänzlich unabhängig von dem Zutun irgendwelcher äußeren, außer den Dingen stehenden Gewalten vorstellen. Der endliche Sieg dieser real-philosophischen Erkenntnis über ihre Gegner scheint uns nicht zweifelhaft zu sein. Die Kraft ihrer Beweise besteht in Tatsachen, nicht in unverständlichen oder nichtssagenden Redensarten. Gegen Tatsachen aber läßt sich auf die Dauer nicht ankämpfen, nicht „wider den Stachel lecken“. – Daß unsere Auseinandersetzungen nichts mit den leeren Phantasien der älteren naturphilosophischen Schule zu tun haben, braucht wohl kaum angedeutet zu werden. Diese sonderbaren Versuche, die Natur aus dem Gedanken, statt aus der Beobachtung, zu konstruieren sind dermaßen mißlungen und haben ihre Anhänger so sehr in den öffentlichen Mißkredit gebracht, daß das Wort „Naturphilosoph“ gegenwärtig fast allgemein als ein wissenschaftliches Scheltwort gilt. Es versteht sich indessen von selbst, daß sich dieser unangenehme Begriff nur an eine bestimmte Richtung oder Schule, nicht an die natürliche Philosophie überhaupt anknüpfen kann, und gerade die Erkenntnis scheint jetzt allgemein werden zu sollen, daß die Naturwissenschaften die Basis jeder auf Exaktheit Anspruch machenden Philosophie abgeben müssen. „Natur und Erfahrung“ ist das Losungswort der Zeit. – Das Mißlingen jener älteren naturphilosophischen Versuche kann zugleich als der deutlichste Beweis dafür dienen, daß die Welt nicht die Verwirklichung eines einheitlichen Schöpfergedankens, sondern ein Komplex von Dingen und Tatsachen ist – den wir erkennen müssen, wie er ist, nicht wie ihn unsere Phantasie gerne ersinnen möchte. Wir müssen die Dinge nehmen, wie sie wirklich sind,“ sagt Virchow, nicht wie wir sie uns denken.“ – Wir werden uns bemühen, unsere Ansichten in allgemeinverständlicher Weise und gestützt auf bekannte oder leicht einzusehende Tatsachen vorzutragen und dabei jede Art philosophischer Kunstsprache zu vermeiden, die die theoretische Philosophie, namentlich aber die deutsche, mit Recht bei Gelehrten und Nichtgelehrten in Mißkredit gebracht hat. Es liegt in der Natur der Philosophie, daß sie geistiges Gemeingut sei. Philosophische Ausführungen, die nicht von jedem Gebildeten begriffen werden können, verdienen nach unserer Ansicht kaum die Druckerschwärze, welche man daran gewendet hat. Was klar gedacht ist, kann auch klar und ohne Umschweife gesagt werden. Die philosophischen Neben, die die Schriften der Gelehrten bedecken, scheinen mehr dazu bestimmt, Gedanken zu zu verbergen als zu enthüllen. Die Zeiten des gelehrten Maulheldentums, des philosophischen Scharlatanismus oder der „geistigen Taschenspielerei“, wie sich Cotta sehr bezeichnend ausdrückt, sind vorüber oder müssen vorüber sein. Möge unser deutsche Philosophie endlich einmal einsehen, daß Worte keine Taten sind und daß man eine verständliche Sprache reden müsse, um verstanden zu werden!
An Gegnern wird es uns nicht fehlen. Wir werden nur diejenigen beachten, die sich mit uns auf den Boden der Tatsachen, der Empirie begeben; die Herren Spekulativen mögen von ihren selbstgeschaffenen Standpunkten herauf unter einander weiterkämpfen und sich nicht im Wohne beirren lassen, allein im Besitze philosophischer Wahrheiten zu sein. „Die Spekulation“, sagt Ludwig Feuerbach, „ist die betrunkene Philosophie; die Philosophie werde daher wieder nüchtern. Dann wird sie dem Geiste sein, was das reine Quellwasser dem Leibe ist.“
Kraft und Stoff.
„Geht man auf den Grund, so erkennt man bald, daß es weder Kräfte noch Materie gibt. Beides sind von verschiedenen Standpunkten aus aufgenommene Abstraktionen der Dinge, wie sie sind. Vereinzelt haben sie keinen Bestand.“
Du Bois-Reymond.
Eine der einfachsten und zugleich folgewichtigsten Entdeckungen der heutigen, mit so großen Erfolgen gekrönten Naturforschung bildet die untrennbare Einheit von Kraft und Stoff. Eine Kraft, die nicht an den Stoff gebunden wäre, die frei über dem Stoffe schweben und denselben nach Willkür lenken oder gestalten würde, wie man dieses früher für möglich hielt, ist eine ebenso unwahre oder haltlose Vorstellung, wie die eines Stoffes ohne Kraft, oder, was dasselbe ist, ohne Form oder Bewegung. Alle Naturkundigen der Gegenwart sind einstimmig in der Verwerfung einer solchen Vorstellung, wofür zahlreiche, bestimmte Aussprüche der besten Autoritäten angeführt werden könnten. Kraft und Stoff sind daher im Grunde ganz dieselbe Sache, nur unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, oder Abstraktionen von dem Wirklichen. Sie können nur im Gedanken oder sprachlich voneinander getrennt werden, während sie in der Natur oder in Wirklichkeit eins und dasselbe sind. „Körper und Kraft lassen sich nur im Gedanken trennen; in Wirklichkeit machen sie eines aus.“ (A. Mayer) „Wie das Wasser aus den Händen davonfließt, so löst sich die Vorstellung des Stoffes auf, sobald man sie von der Vorstellung der Bewegung oder der Kraft, ebenso wie von derjenigen der Form zu trennen sucht.“ (A. Laugel)
Nur der Aberglaube oder die Unwissenheit früherer Jahrhunderte konnte die Existenz von Kräften in der Natur, die unabhängig vom Stoffe wären, für möglich halten, während die heutige Wissenschaft die Annahme derartiger Möglichkeiten gänzlich aus ihrem Bereiche verbannt hat. Ein wirklicher Begriff von dem, was Kräfte an und für sich sind oder sein könnten oder was Kraft außerhalb des Stoffes sein könnte, geht uns ebenso ab, wie ein Begriff von dem, was ein Stoff oder Stoffe ohne Kräfte sein würden. Wir können, streng genommen, heutzutage nicht mehr, folgend dem bisherigen Sprachgebrauch, von Licht reden, sondern nur von einem leuchtenden, wellenartig bewegten Stoff oder Körper; nicht von Wärme, sondern nur von einer äußerst raschen, zitternden, drehenden oder fortschreitenden Bewegung der kleinsten Teilchen eines Körperstoffes; nicht von Schwere, sondern nur von einem Körper, der durch Massenanziehung einen mechanischen Druck ausübt, usw. Die ehemalige Lehre von den sog. „Imponderabilien“, d h. von als unwägbare, für sich bestehende Stoffe vorgestellten, angeblich mitgeteilten Kräften, wie Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus, ist heutzutage vollständig verlassen. Alle diese Kräfte sind nichts anderes als verschiedenartige Bewegungszustände des den Raum in ununterbrochenen Zusammenhang erfüllenden Stoffs. Auch der in der Art seiner Fortbewegung dem Lichte ähnliche Schall ist kein Gehörstoff, der dem Ohre durch die Luft zugetragen wird, sondern nur die bewegte Luft selbst, die die ihr mitgeteilten Bewegung auf die Organe unseres Ohres überträgt. Die Schwingungen, die der Ton in der Luft erzeugt, können sogar chemische Zerlegungen von Substanzen, die durch sehr schwache chemische Verwandtschaften verbunden sind, auf rein mechanische Weise hervorbringen. In noch höherem Grade gilt dieses von den Schwingungen des Lichtes, die die auffallendsten chemischen Wirkungen hervorzubringen imstande sind. Auch dürfte die Zeit nicht mehr fern sein, wo man imstande sein wird, nicht bloß die sog. lebendigen Kräfte, wie Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus, sondern auch die sog. ruhenden oder Spannkräfte, wie chemische Verwandtschaft, allgemeine Massenanziehung, Kohäsion oder Zusammenhangskraft, aus Bewegungsfähigkeit oder aus Bewegung selbst herzuleiten.
Danach muß man einem ausgezeichneten modernen Schriftsteller (A. Mayer) Recht geben, wenn er sagt, der Gedanke, die Kraft habe außer den Körpern, denen sie anhängt oder ihnen die Fähigkeit zu ihrem eigentümlichen Verhalten verleiht, ein gesondertes Dasein, enthalte etwas so ganz Ungeheuerliches oder Unfaßbares, daß es nahezu einer Beleidigung des gesunden Menschenverstandes gleichkomme, dabei noch länger zu verweilen.
Welche allgemeine, unsere Weltanschauung bestimmende Folgerung läßt sich aus dieser ebenso einfachen wie natürlichen Erkenntnis ziehen? Daß die bisherige Annahme, als habe eine als für sich bestehend gedachte Schöpferkraft Natur und Welt aus sich selbst oder aus dem Nichts hervorgebracht, mit dem ersten und einfachsten Grundsatz einer auf Logik und Erfahrung gebauten Naturbetrachtung in unversöhnlichen Widerspruch gerät.
Weder konnte die Kraft den Stoff, noch der Stoff die Kraft erschaffen, da wir gesehen haben, daß eine getrennte Existenz der beiden eine Unmöglichkeit ist.
Noch unmöglicher ist die Vorstellung eines Nichts, das nicht bloß ein erfahrungsmäßiges, sondern auch ein logisches Unding ist. Niemals kann Nichts zu Etwas oder Etwas zu Nichts werden, wie in den folgenden Kapiteln über die Unsterblichkeit des Stoffes wie der Kraft im einzelnen gezeigt werden wird.
Daraus folgt aber weiter mit absoluter Gewißheit, daß die Welt nicht, wie die religiöse Weltanschauung lehrt, erschaffen sein kann, sondern daß sie ewig ist. Wollte man dennoch eine solche Weltschöpfung annehmen, so müßte man vor allen Dingen nachweisen, wie es möglich oder denkbar sei, daß Etwas aus Nichts entstehen könne, was eine Unmöglichkeit ist. Man müßte ferner nachweisen, wie es möglich oder denkbar sei, daß die als Weltursache gedachte Schöpferkraft ohne reale Existenz außer ihr ist, was gleichbedeutend ist mit der Vorstellung einer Kraft ohne Stoff. Will man aber im Einklang mit gewissen Schöpfungsmythen ein ursprüngliches Chaos oder eine ungeordnete Stoffmasse annehmen, in die die Schöpferkraft zu einer bestimmten Zeit Ordnung und Vernunft gebracht habe, so gibt man den Begriff der Schöpfung als solcher auf und kehrt zu der Ewigkeit der Welt zurück, die, wie noch näher gezeigt werden wird, jedes schaffende oder ordnende Prinzip ausschließt oder unnötig macht. Auch gibt man dabei den Grundsatz der Unzertrennlichkeit von Kraft und Stoff auf.
So bliebe nur eine dritte Möglichkeit übrig, d. h. die ebenso unnötige wie ungeheuerliche Vorstellung, es sei die Schöpferkraft plötzlich und ohne bestimmte Veranlassung aus dem Nichts emporgetaucht, habe die Welt geschaffen (woraus?) und sei mit dem Moment der Vollendung wieder in sich selbst versunken, habe sich also gewissermaßen an die Welt dahingegeben oder in dem All aufgelöst. Philosophen und Nichtphilosophen haben von je diese Vorstellung mit Vorliebe behandelt, weil sie auf diese Weise die allzu unbestreitbare Tatsache einer einmal festgesetzten und unabänderlichen Weltordnung mit dem aus uralter Unwissenheit verwachsenen und, wie es scheint, unausrottbaren Glauben an ein übernatürliches oder außerweltliches schaffendes Prinzip vereinigen zu können glaubten. Auch die meisten religiösen Vorstellungen lehnen sich mehr oder weniger an diese Idee an, nur mit dem Unterschiede, daß sie den Weltgeist nach der Schöpfung zwar ruhend, aber doch als fortbestehende höhere Macht denken, die nach der Art eines absoluten menschlichen Herrschers die gegebenen Gesetze jederzeit wieder aufheben oder abändern könne, oder die ein Vergnügen daran fände, von Zeit zu Zeit in den Gang der Ereignisse ordnend und helfend oder strafend und richtend einzugreifen. Für diejenigen, die das Welträtsel mittels des religiösen Glaubens auflösen, mag dieses genügen. Für diejenigen aber, die Vernunft und Logik zur Richtschnur ihres Denkens nehmen, ist jene Vorstellung ebenso unannehmbar wie die bereits widerlegten. Schon die Anwendung des endlichen Zeitbegriffes auf die Schöpferkraft enthält eine Ungereimtheit; eine noch größere ihre Entstehung aus dem Nichts. Eine Schöpferkraft, die sich selbst schafft oder aus dem Nichts emporzieht, gleicht auf ein Haar dem Freiherrn von Münchhausen, der sich an seinem eignen Schopfe aus dem Sumpfe zog. Legt man aber der Schöpferkraft, um dieser Schwierigkeit zu entgehen, das Merkmal der Ewigkeit bei, so ist dies nur ein anderer Ausdruck für die Ewigkeit der Welt selbst, die, wie schon erwähnt, jedes schaffende Prinzip unnötig macht. Das vergebliche Suchen der Philosophen nach einer Ursache der Welt ist ein Rückschreiten in das Unendliche und gleichbedeutend mit dem Besteigen einer endlosen Leiter, wobei die Frage nach der Verursachung der Ursache die Erreichung eines letzten Endzieles unmöglich macht. Jedenfalls ist ein Bestehen der Welt mit allen ihren Vollkommenheiten, Unvollkommenheiten, mit ihren ewig einander ablösenden Prozessen von Entwicklung und Rückbildung von Ewigkeit her für den den menschlichen Verstand leichter begreiflich als die ursachlose Entstehung einer als vollkommen gedachten Schöpferkraft aus dem ursachlosen Nichts.
Schon das Merkmal der Vollkommenheit schließt die Möglichkeit der Schöpfung aus, da ein vollkommenes Wesen ein zugleich sich selbst genügendes ist und daher jedes Antriebes oder Anlasses zu Veränderung seines Zustandes entbehrt, während der Übergang eines solchen Wesens zur Weltschöpfung notwendig den Begriff der Unvollkommenheit oder Selbstbeschränkung einschließt. Auch ist das von den Theologen geforderte Fortbestehen Gottes oder des Weltschöpfers neben und außer seiner sich selbst überlassenen Schöpfung eine ganz undenkbare Sache – ein dualistisches, aus Gott und Welt zusammengeflicktes Ungeheuer.1
Wenn also die Annahme einer in menschlicher Weise gedachten Schöpferkraft auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt, wenn endlich diese beiden, wie noch gezeigt werden wird, unsterblich oder unvernichtbar sind, so kann uns wohl kein ernstlicher Zweifel darüber bleiben, daß die Welt als solche nicht geschaffen oder durch einen außer ihr stehenden Willen in das Leben gerufen sein kann, sondern daß sie ewig ist. Was keinen Anfang oder kein Ende in der Zeit oder im Raum hat, kann auch keinen in der Existenz haben. Was nicht vernichtet werden kann, konnte auch nicht geschaffen werden. Mit andern Worten: die Welt als solche ist ursachlos, unentstanden und unvergänglich. –
So einfach und selbstverständlich uns heute und bei dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse die Unzertrennlichkeit der Begriffe von Kraft und Stoff erscheinen mag, so ist dieses doch nicht immer so gewesen, und es ist dem menschlichen Verstande erst nach dem Durchlaufen mehrerer und verschiedener Phasen der Erkenntnis oder des Irrtums gelungen, zur einfachen Wahrheit durchzudringen. Denn die einfachste Ansicht von einer Sache ist gerade diejenige, auf die der menschliche Geist sehr oft zuletzt verfällt. In der ersten Phase stellte man sich Kraft und Stoff als gänzlich getrennte und verschiedene Dinge vor und gab den für sich bestehenden Naturkräften oder deren Erscheinungsweisen, die man aus der Tätigkeit besonderer überirdischer Wesen (Götter) herleitete, auch besondere Namen. So erhielten Erde, Himmel, Luft, Wasser, Winde, Flüsse, Licht, Feuer, sonne, Finsternis, Tag, Nacht usw. jedes seinen besonderen Geist oder Gott. So war z. B. bei den Griechen Zeus der Gott des Donners und Blitzes, Apollo der Gott des Tages, Artemis die Göttin der Nacht. Uranus repräsentierte den Himmel, Gäa die Erde, Poseidon das Meer, Hephästos das Feuer, Äolus die Winde, Venus die Kraft der anziehung usw. Ähnliche Anschauungen nährten die alten Inder, Chinesen, Ägypter, Perser usw.
Auch die griechischen Philosophen, obgleich einige unter ihnen (die sog. Materialisten oder Kosmophysiker) bereits sehr geläuterten und den heutigen nahe kommenden Anschauungen huldigten, machten in ihrer Mehrzahl eine strenge Unterscheidung zwischen Kraft und Stoff und ließen den letzteren, die sie eigner Bewegung für unfähig hielten, von Außer her bewegen – eine Anschauung, die sich durch den mächtigen Einfluß der Aristotelischen Philosophie noch bis in die letzten Jahrhunderte hinein erhielt. – Auf diese erste Phase folgte die zweite, in der an die Stelle der vollständigen Trennung von Kraft und Stoff eine unvollständige Trennung beider Begriffe trat. Die Kraft wird dabei als etwas mit dem wägbaren Stoff Verbundenes, aber doch im Grunde davon ganz Verschiedenes und selbst als ein unwägbarer Stoff, als ein sog. Imponderabile, gedacht. Aus dieser Vorstellung floß beispielsweise die jetzt ganz beseitigte Emanations- oder Emissions-theorie des Lichtes, wonach dasselbe aus unendlich kleinen, mit ungeheurer Geschwindigkeit fortgestoßenen, unwägbaren Körperteilchen bestehen sollte, oder die Lehre vom Wärmestoff sowie vom elektrischen oder magnetischen Fluidum. Auch der Glaube an das ehedem so berühmte Phlogiston oder den Feuerstoff, der die Ursache der Verbrennung bilden sollte und der erst am Ende des vorigen Jahrhunderts durch die Entdeckung des Sauerstoffs beseitigt wurde, gehört hierher; desgleichen die Seele des Bernsteins, die schon der altgriechische Philosoph Thales für die Ursache von dessen eigentümlicher Anziehungskraft erklärt hatte, und Ähnliches. – Erst die dritte Phase oder diejenige der Neuzeit erkannte, daß es keine unwägbaren Stoffe gibt und entdeckte die Einheit, Unveränderlichkeit und Unzerstörbarkeit des kraftbegabten Atoms. Dieses ist die Phase der Einheit und Untrennbarkeit von Kraft und Stoff, in der man eingesehen hat, daß alle uns bekannten Kräfte oder Kraftwirkungen nur aus Zuständen oder Bewegungen der feinsten Teilchen der bestehenden Materie hervorgehen. Überall wo Stoff ist, da ist auch notwendig Kraft im Zustand von Bewegung, Spannung oder Widerstand, und umgekehrt.
Übrigens zeigen, wie nicht anders möglich, alle diese Phasen untereinander mannigfache Übergänge. Am schwierigsten gestaltete sich die Beseitigung der dualistischen oder zweiheitlichen Vorstellungen von Kraft und Stoff auf dem Gebiet der Lehre vom Leben, die wegen der zusammengesetzten und daher schwerer zu durchschauenden Verhältnisse des organischen Stoffwechsels dem Durchbruch einer besseren Einsicht am meisten Widerstand entgegensetzen mußte. Hier vertraten eine ganz Reihe nach und nach einander ablösender „Lebensgeister“ unter verschiedenen Namen die Stelle der Imponderabilien in der nicht-organischen Natur, bis sie sich schließlich in der lange Zeit hindurch die Wissenschaft beherrschenden, aber jetzt vollständig aufgegebenen Lehre von der Lebenskraft auflösten. Leider spukt dieses abgelebte Gespenst der Lebenskraft, von dem ein späteres Kapitel eingehender handeln wird, immer noch in manchen unklaren, namentlich philosophischen Köpfen. So lange dieses der Fall ist, kann man nicht sagen, daß die Wissenschaft vom Leben die zweite der geschilderten Phasen bereits vollständig überwunden habe, während die physikalischen und chemischen Wissenschaften längst in das dritte und letzte Stadium übergetreten sind. Die Chemie kann heutzutage einfach als die Mechanik der Atome, d. h. der kleinsten Teilchen chemischer Elemente und Grundstoffe, die Physik als Mechanik der Moleküle oder zusammengesetzter Atome bezeichnet oder angesehen werden.
1 Man vergleiche des Verfassers Schriftchen über den Gottesbegriff, S. 21–24.
Unsterblichkeit des Stoffs.
Aus Nichts wird Nichts. Nichts, was ist, kann vernichtet werden.
Demokrit
„Der große Cäsar, tot und Lehm geworden,verklebt ein Loch wohl vor dem rauhen Norden.O, daß die Erde, der die Welt gebebt.Vor Wind und Wetter eine Wand verklebt!“
Shakespeare
Mit diesen, aus tiefster Empfindung hervorgegangenen Worten deutete der große Brite schon vor dreihundert Jahren eine wissenschaftliche Wahrheit an, die trotz ihrer Klarheit und Einfachheit, trotz ihrer Unbestreitbarkeit immer noch nicht diejenige allgemeine Anerkennung gefunden zu haben scheint, die ihr in so hohem Grade gebührt. Der Stoff als solcher ist unsterblich, unvernichtbar; kein Stäubchen im Weltall kann verlorengehen, keines hinzukommen. Es ist das große Verdienst der Chemie, uns seit etwas mehr als hundert Jahren auf das Unzweideutigste darüber belehrt zu haben, daß die ununterbrochene Verwandlung und Umgestaltung der Dinge, die wir tagtäglich vor sich gehen sehen, das Entstehen und Vergehen organischer und unorganischer Formen und Bildungen nicht auf einem Entstehen vorher nicht dagewesenen Stoffs oder einem Vergehen eines dagewesenen beruhen, wie man wohl in früheren Zeiten ziemlich allgemein glaubte, sondern daß die Verwandlung in nichts Anderem besteht als in einem beständigen und unausgesetzten Kreislauf derselben Grundstoffe, deren Grundstoffe, deren Menge und Beschaffenheit an sich stets dieselbe und für alle Zeiten unabänderliche bleibt. Mit Hilfe der Waage ist man dem Stoff auf seinen vielfachen und verschlungenen Wegen gefolgt und hat ihn überall in derselben Menge und Beschaffenheit aus irgendeiner Verbindung wieder austreten sehen, in der man ihn eintreten sah. Die Berechnungen, die seitdem auf dieses Gesetz von der Unzerstörbarkeit der Grundstoffe gegründet worden sind, haben sich überall als richtig erwiesen. Wir verbrennen ein Holz, und es scheint auf den ersten Anblick, als müßten seine Bestandteile in Feuer und Rauch aufgegangen oder verzehrt worden sein. Aber es scheint nur so – denn die Waage des Chemikers belehrt uns darüber, daß nicht nur nichts von dem Gewicht jenes Holzes und der in ihm anwesenden Nebenbestandteile verloren worden, sonder daß im Gegenteil das Gesamtgewicht aller in dem Holz vorhandene Bestandteile vermehrt worden ist; sie zeigt, daß die aufgefangenen und gewogenen Produkte oder die bei der Verbrennung entwickelten Luftarten neben der zurückbleibenden Asche nicht nur alle diejenigen Stoffe wieder enthalten, aus denen das Holz vordem bestanden hat, wenn auch in anderer Form und Zusammensetzung, sondern daß in ihnen auch noch diejenigen Stoffe anwesend oder enthalten sind, die die Bestandteile des Holzes bei der Verbrennung aus der Luft an sich gezogen haben. Mit einem Wort, das Holz hat durch den Vorgang der Verbrennung das Gesamtgewicht seiner Bestandteile nicht vermindert, sondern vermehrt.
Oder wir begraben einen toten Körper und finden nach einer Reihe von Jahren an der Stelle nichts weiter vor, als ein mit Erde vermischtes Häufchen von Knochen. Der äußere Anschein erweckt den Glauben, als ob von den ehemaligen Bestandteilen des einst der Erde übergebenen Körpers außer jenen Überresten nicht mehr vorhanden sei; aber die Wissenschaft sagt, daß in Wirklichkeit auch nicht das kleinste Stäubchen davon verlorengegangen ist, sondern daß die ganz Veränderung nur darin besteht, daß die Grundstoffe jener Bestandteil ihre ehemaligen Verbindungen verlassen haben und wieder in den allgemeinen Kreislauf der Stoffe zurückgekehrt sind, um heute in dieser, morgen in jener Gestalt ihre ewigen Bahnen weiter zu verfolgen. Mit vollem Rechte hat daher die kühne Phantasie des britischen Dichters den Stoff, der einst des großen Cäsar Leib bilden half, bis zu dem Punkte verfolgt, wo er in Gestalt von Erde oder Lehm ein Loch der Wand verklebt.
Mit jedem Hauche, der aus unserem Munde geht, atmen wir einen Teil der Speisen aus, die wir genießen, des Wassers, das wir trinken. Wir verwandeln uns so rasch, daß man wohl annehmen kann, daß wir in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen stofflich ganz andre und neue Wesen sind – mit Ausnahme der festeren und daher der Veränderung weniger unterworfenen Stützorgane des Körpers. Die Atome oder kleinsten Teilchen der chemischen Grundstoffe wechseln fortwährend, und nur die Art der Zusammensetzung bleibt dieselbe. Diese Atome selbst aber sind an sich unveränderlich, unzerstörbar; heute in dieser, morgen in jener Verbindung bilden sie durch die Verschiedenartigkeit ihrer Lagerung oder ihres Zusammentritts die unzählig verschiedenen Gestalten, in denen der Stoff unseren Sinnen sich darstellt, in einem ewigen und unaufhaltsamen Wechsel und Fluß dahineilend. Dabei bleibt die Menge der Atome eines einfachen Grundstoffes im Großen und Ganzen unveränderlich dieselbe; kein einziges dieser Stoffteilchen kann sich neu bilden oder hinzukommen, keines, das einmal vorhanden, aus dem Dasein verschwinden; keines kann seine Natur ändern. Ein Sauerstoff-, ein Stickstoff-, ein Wasserstoff-, ein Eisenatom ist überall und unter allen Umständen ein und dasselbe Ding, begabt mit denselben und von ihm unzertrennlichen Eigenschaften oder Kräften, und kann nie und in alle Ewigkeit nicht etwas Anderes werden. Sei es, wo es wolle, überall wird es das nämliche Wesen sein; aus jeder noch so verschiedenartigen Verbindung wird es bei dem Zerfall derselben als dasselbe Ding wieder austreten, als das es eintrat. Nie und nimmer aber kann es neu entstehen oder aus dem Dasein verschwinden, es kann nur seine Verbindungen wechseln.
Dasselbe Atom, das heute den stolzen Gang eines Herrschers oder Helden vermitteln hilft, liegt vielleicht schon morgen als Straßenschmutz zu dessen Füßen. Dasselbe Atom, das heute in dem Gehirn eines Schafes kreiste, hilft vielleicht schon morgen an der Gedankenarbeit eines Denkers oder Dichters. Dasselbe Atom, das heute noch Unrat und Dünger bilden half, wiegt sich vielleicht schon morgen im Verein mit seinesgleichen als duftender Schmelz auf Blumenkelchen.
„Ein einfaches Grundatom“, sagt B. Stewart, „ist wirklich ein unsterbliches Wesen und erfreut sich des Vorzugs, unverändert und in seinem Wesen unberührt zu bleiben unter den mächtigsten Angriffen, die dagegen ausgeführt werden; es ist wahrscheinlich in einem Zustande unaufhörlicher Bewegung und Formveränderung, aber es bleibt doch immer dasselbe.“
Diesen ewigen und unaufhaltsamen Wechsel und Kreislauf der an sich unveränderlichen kleinsten Stoffteilchen hat der Gelehrt den Stoffwechsel genannt; und die Wissenschaft liefert Beispiel und Beweise für denselben in zahlloser Menge. Es genüge zu bemerken, daß die Wanderungen und Wandlungen, die der Stoff im Sein des Alls durchläuft, und denen der Mensch zum Teil mit Waage und Maß in der Hand gefolgt ist, millionen- und abermillionenfach, daß sie ohne Ziel und Ende sind. Auflösung und Zeugung, Zerfall und Neugestaltung reichen sich aller Orten in ewiger Kette einander die Hand. In dem Brote, das wir essen, in der Luft, die wir atmen, ziehen wir den Stoff an uns, der die Leiber unserer Vorfahren bereits vor tausend Jahren gebildet hat, ja wir selbst geben tagtäglich einen Teil des unsern Körper bildenden Stoffs an die Außenwelt ab, um ihn oder den von unsern Mitlebenden abgegeben Stoff vielleicht in kurzer Zeit von neuem einzunehmen.
Es ist eine bis zum Überdruß gehörte und mißbrauchte Redewendung vom „sterblichen Leib“ und vom „unsterblichen Geist“. Eine genauere Betrachtung wird den Satz vielleicht mit mehr Wahrheit umkehren lassen. Der Leib in seiner individuellen Form oder Gestalt ist freilich sterblich, nicht aber in seinen Bestandteilen. Nicht bloß im Tode, sondern bereits im Leben verwandelt er sich, wie wir gesehen haben, ohne Aufhören; aber in einem höheren Sinne ist er unsterblich, da nicht das kleinste Teilchen von ihm vernichtet werden kann. Dagegen sehen wird das, was wir Geist, Seele, Bewußtsein nennen, mit dem Aufhören der stofflichen Zusammensetzung schwinden, und es muß einem vorurteilsfreien Verstande scheinen, als habe dieses eigentümliche und durch sehr verwickelte Verbindungen bedingte Zusammenwirken vieler kraftbegabter oder in innerer Bewegung befindlicher Stoffteilchen eine Wirkung hervorgerufen, die mit ihrer Ursache oder mit dem Aufhören jener eigentümlichen Zusammensetzung ein Ende nehmen muß.
Heute ist die Unsterblichkeit oder Erhaltung des Stoffs eine wissenschaftlich festgestellte und nicht mehr zu leugnende Tatsache. Es ist interessant zu erfahren, daß auch frühere Denker und Philosophen eine Kenntnis dieser wichtigen Wahrheit besaßen, wenn auch mehr in unfertiger oder ahnender, als wissenschaftlich sicher erkannter und begründeter Weise. Den tatsächlichen Beweis dafür konnten uns erst unsere Waagen und chemischen Gläser liefern.
Sebastian Frank, ein Deutscher, der im Jahre 1528 lebte, sagte: „Die Materie war von Anfang an in Gott und ist deswegen ewig und unendlich. Die Erde, der Staub, jedes erschaffene Ding vergeht wohl; man kann aber nicht sagen, daß dasjenige vergehe, woraus es erschaffen ist. Die Substanz bleibt ewig. Ein Ding zerfällt in Staub, aber aus dem Staub entwickelt sich wieder ein neues. Die Erde ist, wie Plinius sagt, ein Phönix und bleibt für und für. Wenn er alt wird, verbrennt er sich zu Asche, daraus ein junger Phönix wird, aber der vorige, doch verjüngte.“
Noch unumwundener drücken die italienischen Philosophen des Mittelalters diese Idee aus. Bernhard Telesius (1509-1588) sagt:
„Der körperliche Stoff ist in allen Dingen gleich und bleibt ewig derselbe; die finstere, träge Materie kann weder vermehrt noch vermindert werden.“
Und endlich Giodano Bruno (der im Jahre 1600 in Rom verbrannt wurde):
„Was erst Samen war, wird Gras, hierauf Ähre, alsdann Brot, Nahrungssaft, Blut, tierischer Same, Embryo, ein Mensch, ein Leichnam, dann wieder Erde, Stein oder andere Masse, und so fort. Hier erkennen wir also etwas, was sich in alle diese Dinge verwandelt und an sich immer ein dasselbe bleibt. So scheint wirklich nichts beständig, ewig und des Namens Prinzip würdig zu sein, denn allein die Materie. Die Materie als absolut begreift alle Formen und Dimensionen in sich. Aber die Unendlichkeit der Formen, in denen die Materie erscheint, nimmt sie nicht von einem Anderen und gleichsam nur äußerlich an, sondern sie bringt sie aus sich selbst hervor und gebiert sie aus ihrem Schoß. Wo wir sagen, daß etwas stürbe, da ist dies nur ein Hervorgang zu einem neuen Dasein, eine Auflösung dieser Verbindung, die zugleich ein Eingehen in eine neue ist.“
Aber selbst eine noch viel ältere Zeit war nicht unbekannt mit den Grundzügen einer Wahrheit, die heutzutage als ein Grundpfeiler jeder exakten oder auf Tatsächlichkeit begründeten Philosophie angesehen werden muß. Empedokles, ein griechischer Philosoph, der 450 v. Chr. lebte, sagt:
Diejenigen sind Kinder oder Leute mit engem Gesichtskreis, die sich einbilden, daß irgend etwas entstünde, was nicht vorher dagewesen war, oder daß irgend etwas gänzlich sterben oder untergehen könne. Auch Nicht-Seiendem ist durchaus das Entstehen unmöglich, und ganz unmöglich, daß Seiendes völlig vergehe.“
Und schon vor ihm hatte der griechische Philosoph Anaxagoras (500 bis 428 v. Chr.) gelehrt: „Das Seiende im Raum mehrt sich nicht und vermindert sich nicht“, während sein Zeitgenosse Demokrit, der berühmte Vater der materialistischen Philosophie des Altertums und der Atomistik, den Satz von der Unzerstörbarkeit der Materie ebenfalls sehr richtig formuliert und die Sätze aufgestellt hatte:
„Aus Nichts wird Nichts; Nichts, was ist, kann vernichtet werden. Alle Veränderung ist nur Verbindung und Trennung von Teilen. Die Verschiedenheit aller Dinge rührt her von der Verschiedenheit der Atome nach Zahl, Größe, Gestalt und Ordnung“ usw.
Gleiche Aussprüche tat sein großer Schüler Epikur und dessen geistvoller Nachfolger, der Römer Lucretius Carus, der in seinem berühmten Lehrgedicht über die Natur der Dinge sagt:
„Nichts wird gänzlich zerstört, was wir heute lebendig um uns seh'n; Denn es bestehen ja Himmel und Meer und das Land und die Ströme, Same und Pflanzen und alles, was lebt, aus dem nämlichen Urstoff, der sich niemals vermehrt, noch vermindert er sich durch Zerstörung.“
Unsterblichkeit der Kraft.
In der Natur geht nichts verloren, weder an Stoff, noch an Kraft, noch an mechanischer Arbeit.
P. A. Secchi
Ebenso unerzeugbar, ebenso unvernichtbar, ebenso unvergänglich, ebenso unsterblich wie der Stoff ist auch die mit demselben verbundene Kraft. In unendlicher Menge an die unendliche Menge des Stoffs gebunden, durchläuft sie im innigsten Verein mit diesem und wie dieser einen rastlosen und nie endenden Kreislauf und tritt aus irgendeiner Form oder Verbindung in derselben Menge wieder aus, in der sie eingetreten ist. Wie es eine unzweifelhafte Tatsache ist, daß Stoff nicht neu erzeugt oder vernichtet, sondern nur umgestaltet werden kann, so muß es als eine absolut feststehende Erfahrung angesehen werden, daß es keinen einzigen Fall gibt, in dem eine Kraft aus nichts erzeugt oder in nichts übergeführt, mit anderen Worten, geboren oder vernichtet wird. In allen Fällen, wo Kräfte in die Erscheinung treten, kann man dieselben auf ihre Quellen zurückführen, d. h. man kann nachweisen, aus welchen andern Kräften oder Kraftwirkungen eine gegebene Menge Kraft direkt oder durch Umsetzung abgeleitet worden ist. Die Umsetzung geschieht nicht willkürlich, sondern derart nach bestimmten Äquivalenten oder Gleichgewichtszahlen, daß dabei ebenso wenig die geringste Menge Kraft verlorengehen kann, wie bei der Umsetzung der Stoffe die geringste Menge Stoff.
Ist die Unsterblichkeit oder Erhaltung des Stoffes eine seit ungefähr einem Jahrhundert wissenschaftlich ausgemachte und bekannte Sache, so verhält es sich nicht ebenso mit der Unsterblichkeit oder Erhaltung der Kraft, auf die trotz ihrer großen Einfachheit, ja Selbstverständlichkeit die Gelehrten doch erst vor vierzig oder fünfzig Jahren aufmerksam geworden sind – nicht ohne daß die neue Wahrheit anfangs mit fast unüberwindlichen Hindernissen ihrer allgemeineren Anerkennung zu ringen gehabt hätte. Einfach und selbstverständlich nannten wir dieselbe, weil sie zum ersten und ohne weiteres schon aus einer einfachen Überlegung über das Verhältnis von Ursache und Wirkung folgt, und weil ein einziger Fall, in dem der Grundsatz von der Erhaltung der Kraft verletzt würde, den schließlichen Untergang aller Bewegung in der Welt herbeiführen müßte; zum zweiten, weil das Gesetz von der Unzerstörbarkeit der Materie dasjenige von der Unzerstörbarkeit der Kraft in sich schließt. Als Lavosier im Jahre 1774 das Wesen der Verbrennung enthüllte und an die Stelle des Phlogistons oder Feuerstoffs den Sauerstoff setzte, da ergab sich der Satz von der Unsterblichkeit des Stoffs und von der Ewigkeit oder Unvernichtbarkeit der Atome einfach aus den Ergebnissen der Waage. Hätte man damals schon dieselben Vorstellungen wie heute über das Verhältnis von Kraft und Stoff gehabt, so hätte sich der Satz von der Unsterblichkeit der Kraft als notwendige Folgerung sofort daraus entwickeln müssen. Denn da die Kräfte im allgemeinsten Sinne die Eigenschaften der Stoffe darstellen, vermöge welcher Bewegung und Veränderung in das Leben tritt, so leuchtet von selbst ein, daß auch die gesamte, in der Natur vorhandene Kräftemenge, sei dieselbe ruhend oder lebendig, sich gleich bleiben muß, d. h. weder vermehrt noch vermindert werden kann. Aber da die Naturforscher ein mißtrauisches Volk sind und nur das als wahr annehmen, was sich durch Experiment oder Berechnung nachweisen läßt, und da es weit schwerer ist, Kräfte zu messen und zu berechnen, als Stoffe zu wägen, so blieb der dem Kreislauf der Stoffe analoge oder entsprechende Kreislauf der Kräfte noch länger als ein halbes Jahrhundert verborgen, bis derselbe durch die Arbeiten von F. Mohr (1839), R. Mayer (1842) und Joule (1843-49) zum heute unbestrittenen Lehrsatz erhoben wurde.
Nach Maßgabe dieses Lehrsatzes geht keine Bewegung in der Natur aus nichts hervor oder in nichts über, und wie in der stofflichen Welt jede Einzelgestalt nur dadurch ihr Dasein zu verwirklichen vermag, daß sie aus einem unendlichen, ewig sich gleichbleibenden Stoffvorrat schöpft, so schöpft jede Bewegung den Grund ihres Daseins aus einem unermeßlichen, ewig gleichen Kraftvorrat und gibt die von diesem entliehene Kraftmenge früher oder später auf irgendeine Weise an die Gesamtheit zurück. Eine Bewegungserscheinung kann wohl latent werden, d. h. für den Augenblick in scheinbare Verborgenheit übergehen, aber sie ist damit nicht verlorengegangen, sondern nur in andere ihrer Beschaffenheit nach verschiedene, aber doch äquivalente oder gleichwertige Kraftzustände übergegangen, aus denen sie später wieder in irgendeiner Weise hervorgeht. Bei diesem Hervorgange hat sie, wenn geändert, weiter nichts getan als ihre Form gewechselt. Denn Kraft kann im Weltall sehr verschiedene Formen annehmen, bleibt aber deswegen im Grunde stets das nämliche.
Die Wissenschaft der Physik oder die Lehre von der Kraft, ihrer Verwandlung und Umsetzung macht uns mit sieben oder acht verschiedenen Kräften bekannt, die, an den Stoffen haftend und unzertrennlich mit denselben verbunden „bilden und bauen die Welt“. Sie heißen Schwerkraft oder allgemeine Massenanziehung oder auch mechanische Kraft, Wärme, Licht, Elektrizität, Magnetismus, Affinität oder chemische Verwandtschaft, Kohäsion oder Adhäsion oder molekulare Anziehung, Molekularkraft – von denen Schwere, Kohäsion und Affinität auch als sog. ruhende Kräfte oder Spannkräfte, die übrigen als lebendige Kräfte gegenseitig ineinander übergeführt werden, und zwar in der Weise, daß bei dieser Überführung nichts verloren geht, sondern daß, wie gesagt, die neu entstandene Kraft der übergeführten äquivalent oder gleichwertig ist und als selbständige Kraft nun wieder neue Wirkungen entfalten kann.
Von der Verwandlung oder sog. Umsetzung der Kräfte wollen wir einige Beispiele heranziehen:
Durch Verbrennung oder Ausgleich chemischer Verschiedenheit wird Wärme und Licht erzeugt. Wärme wird weiter als Dampf in mechanische Kraft umgesetzt, die z. B. in der Dampfmaschine nutzbar wird; und die mechanische Kraft kann ihrerseits wieder durch Reibung in Wärme zurückverwandelt werden und in der magneto-elektrischen Maschine sogar rückwärts in Wärme, Elektrizität, Magnetismus, Licht und chemische Spaltung übergehen. Eine der häufigsten Kraftumsetzungen ist die von Wärme in mechanische Kraft umgekehrt. Reibt man zwei Stücke Holz aneinander, so erzeugt man Wärme und Entzündung. Heizt man dagegen eine Dampfmaschine, so läßt man umgekehrt Wärme in Reibung und Bewegung übergehen. Die Verwandlung der Wärme in mechanische Bewegung und umgekehrt läßt sich an einem Eisenbahnzuge auf das Einleuchtendste erläutern. Die durch Verbrennung erzeugte Wärme in der Lokomotive verwandelt sich in die Bewegung der Wagen, die, wenn durch die Bremse plötzlich eingehalten, sich wieder rückwärts in durch Rauch und Funken sich verratende Wärme verwandelt.
Während wir in der Dampfmaschine durch Verbrennung von Kohle chemische Verschiedenheit in Wärme umsetzen, die sich ihrerseits wieder in mechanische Kraft verwandelt, so verwandeln wir umgekehrt mechanische Kraft in Wärme, wenn wir von einer solchen ein Rad treiben lassen, das einen massiven hölzernen Kegel in einem eng anschließenden hohlen Metallkegel dreht. Dieser erhitzt sich bis zu einem solchen Grade, daß wir auf diese Weise imstande sind, vermittelst der Kraft eines Wasserfalles, eines Stromes, einer Windmühle und dergl. ein Zimmer zu heizen!
Im Schießpulver liegen chemische Verwandtschaften unbefriedigt nebeneinander. Sobald der entzündende Funke hinzukommt, wird die chemische Verschiedenheit ausgeglichen, und Wärme, Licht und mechanische Kraft kommen dafür zum Vorschein.
In der Elektrisiermaschine wird die mechanische Kraft des die Scheibe drehenden Armes, die selbst ihrerseits wieder von einer Ausgleichung chemischer Verschiedenheit herrührt (Atmung), in elektrische Spannung und Strömung umgesetzt, und diese kann je nach Umständen wieder als Anziehung (mechanische Kraft) oder als Licht, Wärme und chemische Verschiedenheit erscheinen.
Der englische Physiker Grove hat einen Apparat konstruiert, in dem er aus dem Lichte als anfänglicher Kraft zu gleicher Zeit fünf übrige Kraftarten (chemische Tätigkeit, Elektrizität, Magnetismus, Wärme und Bewegung) entwickelte. Ja man kann als Regel annehmen, daß, wenn man in einem Körper eine gewisse Kraft erregt, sich dabei auch alle anderen Kräfte tätig zeigen. Elektrisiert man z. B. schwefelsaures Antimon, so wird dasselbe gleichzeitig magnetisch, warm, leuchtend (wenn die Erregung über eine gewissen Grenze hinaus fortgesetzt wird), bewegt durch Ausdehnung und chemisch tätig durch Zersetzung, wobei also sechs verschiedene Kräfte in Tätigkeit treten. Dasselbe geschieht bei der Elektrisierung von Metallen; nur ist zweifelhaft, ob bei ihnen auch chemische Zersetzung stattfindet.