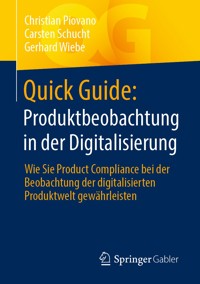87,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: InTeR-Schriftenreihe
- Sprache: Deutsch
Die rechtssichere Identifikation des Herstellers im europäischen Produktsicherheitsrecht hat sowohl für Unternehmen als auch für Marktüberwachungsbehörden eine erhebliche praktische und rechtliche Bedeutung. Denn jede Unsicherheit über die eigene Rolle als Hersteller im Wirtschaftsverkehr führt dazu, dass die abverlangten Vorkehrungen und Verpflichtungen nicht oder nur unzureichend erfüllt werden und weitere Maßnahmen nach sich ziehen können, zum Beispiel die Anordnung von Produktrückrufen oder das Auslösen zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche. Damit die beteiligten Wirtschaftsakteure im Rahmen der product compliance den produktverantwortlichen Hersteller rechtssicher identifizieren können, werden in diesem Werk spezifische Kriterien und konkrete Beispiele zur Auslegung jeder Fallgruppe des Herstellerbegriffs im Sinne des § 2 Nr. 14 ProdSG, wie beispielsweise für den sogenannten Quasi-Hersteller, beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Hersteller im europäischen Produktsicherheitsrechtz
von
Christian Piovano
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1752-7
© 2020 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main www.ruw.deDas Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Produktion: WIRmachenDRUCK GmbH, Mühlbachstr. 7, 71522 Backnang
Danksagung
Die vorliegende Arbeit wurde vom Promotionsausschuss der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz im Sommersemester 2020 als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung konnten bis zum April 2020 berücksichtigt werden.
Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter, Frau Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl, für ihre hervorragende Unterstützung und ihr persönliches Engagement bei der Betreuung dieser Arbeit. Durch ihre konstruktiven Anmerkungen und Hinweise hat sie entscheidend zum Gelingen meiner Arbeit beigetragen. Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Matthias Niedobitek für die freundliche Übernahme und Erstellung des Zweitgutachtens.
Mein größter Dank an dieser Stelle gilt meiner Familie, insbesondere meinen Eltern Susanne und Antonio Piovano, denen ich diese Arbeit widme. Ich danke beiden von Herzen, dass sie mir sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten stets eröffnet haben und mich auf meinem bisherigen Lebensweg vorbehaltlos unterstützt, gefördert aber auch gefordert haben, wodurch sie nicht nur die Basis für meine persönliche und berufliche Entwicklung legten, sondern auch im wesentlichen Maße zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.
München, Oktober 2020
Dr. Christian Piovano
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Verhältnis der Produktsicherheitsnormen zueinander
9
Abbildung 2:
Begründung der Herstellereigenschaft
11
Abbildung 3:
Darstellung Kern-Problematik
108
Abbildung 4:
Verhältnis zwischen Inverkehrbringen und Bereitstellen
136
Abbildung 5:
Ergebnis – Kurzcheck
203
Abkürzungsverzeichnis
A
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AfPS
Ausschuss für Produktsicherheit
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AIO
Internationale Arbeitsorganisation
AktG
Aktiengesetz
AMG
Arzneimittelgesetz
Art.
Artikel
ATEX
Atmosphères Explosibles
B
B2B
Business to Business
B2C
Business to Customer
BT-Drs
Bundestag Drucksache
C
CAD
computer-aided design
E
EEE
electrical and electronic equipment
EG
Europäische Gemeinschaft
EGBGB
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EG-FGV
EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EMV
Elektromagnetische Verträglichkeit
EMVG
Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz
E-RaPS
Entwurf zur Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit
EU
Europäische Union
F
FAQ
Frequently Asked Questions
FzTV
Fahrzeugteileverordnung
G
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GewO
Gewerbeordnung
GG
Grundgesetz, Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbhG
GmbH Gesetz
GPSG
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
GS
Geprüfte Sicherheit
GSG
Gerätesicherheitsgesetz
GtA
Gesetz über technische Arbeitsmittel
H
Hs.
Halbsatz
I
i.S.d.
im Sinne des
L
LASI
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
LFGB
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
lit.
littera
M
MarkenG
Markengesetz
N
NLF
New Legislative Framework
Nr.
Nummer
NS
Nationalsozialismus
O
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OHRIS
Occupational Health and Risk Managementsystem
OLG
Oberlandesgericht
P
PflanzenschutzG
Pflanzenschutzgesetz
PPE
Personal Protective Equipment
ProdSRL
Produktsicherheitsrichtlinie
R
RAPEX
Rapid Exchange of Information System
RaPS
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RED
Radio Equipment Directive
S
S.
Seite, Satz
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVZO
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
U
u.a.
unter anderem
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
V
VDI
Verein Deutscher Ingenieure
VO
Verordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
W
WELMEC
Western European Legal Metrology Cooperation
Inhalt
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Teil A: Problemaufriss
B. Teil B: Rechtsrahmen und Forschungsfrage
I. Gesetzliche Grundlagen
1. Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
2. Europäische Rechtsnormen
3. Verhältnis ProdSG, Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und sonstige sektoralen Harmonisierungsrechtsakten
4. Sachliche Anwendungsbereiche
5. Räumlicher Geltungsbereich
II. Gesetzliche Definition des Herstellerbegriffs
1. Definition des Herstellerbegriffs
2. Die Herstellereigenschaft im Produktlebenszyklus
3. Problematik der Definition
III. Klarstellungsinteresse
1. Klarstellungsinteresse aus Unternehmersicht
a) Produktsicherheitsrechtliche Herstellerpflichten im Einzelnen
aa) Pflichten vor dem Inverkehrbringen
(1) Besondere Pflichten bei Verbraucherprodukten
(2) CE-Kennzeichnungspflicht
(3) GS-Zeichen
bb) Pflichten nach dem Inverkehrbringen
b) Öffentlich-rechtliche Folgen
c) Zivilrechtliche Rechtsfolgen und Pflichten der Hersteller
aa) Deliktische Ansprüche
bb) Herstellerhaftung beim autonomen Fahren
cc) Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz
dd) Gewährleistungsrecht
ee) Wettbewerbsrechtliche Folgen
d) Ordnungswidrigkeits- und strafrechtliche Folgen
e) Notwendigkeit zur Klarstellung der Herstellereigenschaft
(1) Gesetzliche Pflicht zur Gesetzestreue („Organisationspflicht“)
(2) Pflicht zur Gesetzestreue durch Compliance-Strukturen
f) Zwischenergebnis
2. Klarstellungsinteresse aus staatlicher Sicht
a) Auswahlermessen
aa) Adressatenkreis
bb) Auswahl bei mehreren Wirtschaftsakteuren als Adressaten
cc) Kein spezieller Vorrang eines Wirtschaftsakteurs
dd) Der Effektivitätsgrundsatz
ee) „andere Person“
b) Zwischenergebnis
C. Teil C: Methodische Herangehensweise zur Schärfung des produktsicherheitsrechtlichen Rechtsbegriffs „Hersteller“
I. Methodik
1. Einführung
2. Auslegungsmethoden nach Savigny
3. Abgrenzung zur Rechtsfortbildung
a) Allgemeines
b) Abgrenzung der verschiedenen Kandidaten
4. Richtlinienkonforme Auslegung
a) Verhältnis zwischen europarechtskonformer und nationaler Auslegung
aa) Musterbeschluss
bb) EU-Richtlinien
b) Anwendbarkeit der Auslegungsmethoden nach Savigny auf eine europarechtskonforme Auslegung
5. Der Herstellerbegriff als unbestimmter Rechtsbegriff?
II. Rechtserkenntnisquellen
1. Rechtsnatur und Bindungswirkung von Leitfäden
a) Allgemeines
b) Leitfäden von öffentlichen, nationalen Stellen
c) Europäische Leitfäden
d) Leitfäden von privaten Organisationen
e) Zwischenergebnis
2. Erwägungsgründe
III. Zwischenergebnis Methodik
D. Teil D: Annäherung durch eine historische Betrachtung des Herstellerbegriffs im ProdSG
I. Einführung
II. Historischer Kontext des Produktsicherheitsrechts vom Spätmittelalter bis zum ersten deutschen Produktsicherheitsgesetz
1. Spätmittelalter
2. Frühindustrialisierung
3. Industrielle Revolution
4. Weimarer Republik
5. Nationalsozialismus
6. Zwischenergebnis
III. Das Gesetz über technische Arbeitsmittel – das erste deutsche Produktsicherheitsgesetz
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Schutzzweck des Gesetzes
3. Interpretation der historischen Norm hinsichtlich des Herstellerbegriffs
IV. Das Gerätesicherheitsgesetz – Novellierung des GtA
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Schutzzweck des Gesetzes
3. Interpretation der historischen Norm hinsichtlich des Herstellerbegriffs
V. Novellierung des GSG von 1992
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Schutzzweck des Gesetzes
3. Interpretation der historischen Norm hinsichtlich des Herstellerbegriffs
4. Exkurs: Einbeziehung der Betreiberpflichten aus der Gewerbeordnung in das GSG n.F.
a) Grund der Einbeziehung
b) Historischer Hintergrund der Gewerbeordnung
c) Schutzzweck der Gewerbeordnung und der §§ 24 ff. GewO
d) Herstellerbegriff in den §§ 24 ff. GewO
e) Zwischenergebnis
VI. Das Produktsicherheitsgesetz a.F. 1997
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Schutzzweck der Norm
3. Interpretation der historischen Norm hinsichtlich des Herstellerbegriffs
a) Hersteller nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ProdSG a.F.
b) Hersteller nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ProdSG a.F.
c) Hersteller nach § 3 Abs. 1 S. 2 1. Alt. ProdSG a.F. – Quasi-Hersteller
d) Hersteller nach § 3 Abs. 1 S. 2 2. Alt. ProdSG a.F.
4. Zwischenergebnis
VII. Entstehung des GPSG 2004
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Schutzzweck der Norm
3. Interpretation der historischen Norm hinsichtlich des Herstellerbegriffs
VIII. Novellierung 2011 – aktueller Gesetzesstand
1. Historischer Kontext zur Entstehung des Gesetzes
2. Interpretation der Norm hinsichtlich des historischen Herstellerbegriffs
IX. Zwischenergebnis – Implikationen für die Auslegung des Herstellerbegriffs des ProdSG n.F.
E. Teil E: Annäherung durch eine teleologische Betrachtung des europäischen Produktsicherheitsrechts
I. Einführung
II. Auswirkungen des europäischen Rechts im harmonisierten Bereich auf die Auslegung des Herstellerbegriffs
1. CE-Zertifizierung als innovative Form der Wirtschaftsüberwachung
2. Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarkts
3. Genereller Aufbau des CE-Systems
4. Modus des CE-Systems
5. (Keine) substituierende Wirkung
6. Funktionale Äquivalenz des CE-Systems
7. Grundsätze der Letzt- und Gewährleistungsverantwortung
a) Qualitätsanpassung bei arbeitsteiliger Fertigung
b) Wissensakquirierung durch Nutzbarmachung des Wissens Privater
c) Zeitliche und sachlich-inhaltliche Dynamik des Instruments
8. Auswirkungen auf die Auslegung des Herstellerbegriffs
III. Auswirkungen des europäischen Rechts im nicht harmonisierten Bereich auf die Auslegung des Herstellerbegriffs
1. Einführung
2. Europäische Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 AEUV
a) Schutzbereich des Art. 34 AEUV
b) Rechtfertigung der Beschränkung nach des Art. 36 AEUV
aa) Schutz der Gesundheit
bb) Verbraucherschutz
c) Verhältnismäßigkeit
3. Auswirkungen auf die Auslegung des Herstellerbegriffs
IV. Zwischenergebnis
F. Teil F: Originäre Auslegung des Herstellerbegriffs unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus D und E
I. Allgemeines
1. Person des Herstellers
a) Rechtsfähigkeit als Voraussetzung
b) Forderung nach Geschäftsfähigkeit?
c) Fall der ausländischen Wirtschaftsteilnehmer
2. „Im Rahmen einer Geschäftstätigkeit“
a) Definition der „Geschäftstätigkeit“
b) Forderung nach einer Gewinnerzielungsabsicht?
c) Abgrenzung im Internethandel
3. Sachlicher Geltungsbereich – Produkte
a) Einführung
b) Einbeziehung von Zulieferteilen im B2B-Bereich in den Anwendungsbereich
aa) Argumentation für die Anwendbarkeit auf Zulieferteile
bb) Argumentation gegen die Anwendbarkeit auf Zulieferteile
(1) Sinn und Zweck der Marktüberwachung
(2) Gesetzesbegründung des ProdSG
(3) Europarechtskonforme Auslegung
(4) Bestimmungsgemäße oder vorhersehbare Verwendung
(a) Unüberblickbare Weite an möglichen Verwendungsarten
(b) „Gebrauchsfertigkeit“ im harmonisierten Bereich
cc) Zwischenergebnis
II. Fallgruppen
1. Fallgruppe 1 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 1 ProdSG
a) Eigenständiges „Herstellen“ eines Produkts im engeren Sinn
b) Endhersteller/„Assembler“
c) Abgrenzung zwischen eigenständigen Herstellern und Entwicklern
aa) Ausschließlichkeit der Herstellereigenschaft
bb) Problematik der OEM-Geschäfte
cc) Tatbestandsmerkmal „Vermarktung unter eigener Marke“
(1) Argumente gegen ein Redaktionsversehen
(2) Unterscheidung zwischen Vermarktung und Bereitstellung auf dem Markt
(3) Zwischenergebnis
dd) Problemstellung: Lastenhefte/„Kern“ als Geschäftsmodell
ee) Verantwortung durch Information
d) Übertragung der Herstellerpflichten
aa) Öffentlich-rechtliche Natur des Produktsicherheitsrechts
bb) Qualitätssicherungsvereinbarungen/Qualitätsmanagementsysteme
cc) Auswirkungen auf den Herstellerbegriff
(1) Argumente gegen eine Disponibilität
(2) Widerspruch zum Prinzip der „Nähe zum Produkt“
(3) Enge Ausnahme im Anlagenbau
(4) Zwischenergebnis
dd) Abdingbarkeit der CE-Kennzeichnungspflicht
(1) Verpflichtung des Herstellers
(2) Pflicht zum Anbringen des CE-Kennzeichens
(3) Konformitätserklärung
e) Zwischenergebnis zu Fallgruppe 1
2. Fallgruppe 2 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. a) ProdSG: der Quasi-Hersteller
a) Allgemeines
b) Heranziehung der Grundsätze des ProdHaftG für die Auslegung
c) Tatbestandsmerkmale
aa) Kennzeichen
bb) „Ausgeben“
(1) Definition Hersteller- und Händlermarke
(2) Abgrenzung
(3) Unbefugtes Anbringen der Erkennungsmarke
d) Abdingbarkeit
e) Abgrenzung zur 1. Fallgruppe
f) Zwischenergebnis Fallgruppe 2
3. Fallgruppe 3 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 1 ProdSG und Fallgruppe 4 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG
a) Einführung
b) Gesetzliche Fiktionen der Herstellereigenschaft
c) Abgrenzungsbedürfnis zwischen den Fallgruppen
d) Privilegierung gebrauchter Produkte gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 ProdSG
e) Gebrauchtes Produkt
aa) Harmonisierter Bereich
bb) Nicht harmonisierter Bereich
cc) Maßgeblicher Zeitpunkt
(1) Verhältnis zwischen „Bereitstellung auf dem Markt“ und „Inverkehrbringen“
(2) Definition „Inverkehrbringen“
(3) Definition „Bereitstellung auf dem Markt“
(a) Abgabe
i. Übergang der faktischen Sachherrschaft
ii. Bloße Eigentumsübertragung als „überlassen“
iii. Argumente für das Ausreichenlassen einer bloßen Eigentumsübertragung als Abgabe
iv. Zwischenergebnis Eigentumsübertragung als „Abgabe“
v. Einzelfragen
(b) Zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung
dd) Inbetriebnahme
ee) Zwischenergebnis gebrauchtes Produkt
f) Abgrenzung zwischen „wiederaufbereiten“ und „wesentlich verändern“
g) Wiederaufbereiten
aa) Rekonstruktion
bb) Zwischenergebnis
h) Wesentliche Veränderung
i) Abgrenzung im Einzelnen
j) Maßstab für die Abgrenzung
aa) RAPEX-Leitlinien
(1) Beurteilungsmaßstäbe
(a) Schutzgüter
i. Personen
ii. Weitere Schutzgüter
(b) Verwenderkreis
bb) Einfluss technischer Normen
(1) Einführung
(2) Bedeutung der technischen Normen für das Vorliegen einer Sicherheitseigenschaft
(3) Ausnahmen bei der Konkretisierungswirkung
cc) Zwischenergebnis Risikoerhöhung
dd) Vorliegen einer wesentlichen Veränderung
ee) Kein Vorliegen einer wesentlichen Veränderung
ff) Einzelfragen
gg) Wesentliche Veränderung zur anschließenden Eigennutzung
k) Zwischenergebnis Fallgruppe 3 und Fallgruppe 4
4. Fallgruppe 5 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG
a) Einführung
b) Verbraucherprodukte
aa) Tatbestandsmerkmal Verbraucher
bb) Fallvariante 1: Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind gemäß § 2 Nr. 26 Var. 1 ProdSG
(1) Angaben des Wirtschaftsteilnehmers
(2) Mittels Bauart und Ausführung
(3) Physischer Kontakt
cc) Fallvariante 2: Produkte, die unter Bedingungen, die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, vom Verbraucher benutzt werden könnten gemäß § 2 Nr. 26 Var. 2 ProdSG
(1) Sinn und Zweck
(2) Vernünftiges Ermessen
(3) Einschränkung
dd) Fallvariante 3: Produkte, die dem Verbraucher im Rahmen einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden gemäß § 2 Nr. 26 Var. 3 ProdSG
ee) Zwischenergebnis Verbraucherproduktbegriff
c) Auslegung „Beeinflussung der Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts“
aa) Sicherheitsbegriff
bb) Allgemeine Sicherheitsparameter des ProdSG
cc) Tatbestandsspezifische Handlung – Beeinflussung
(1) Maßstab bei der Auslegung der „Beeinflussung“
(2) Anforderungen an ein Beeinflussen beziehungsweise Verändern
(3) Grenzen bei der Konstitution der Herstellereigenschaft
(4) Technische Normen
(5) Risikobeurteilung nach RAPEX
(6) Maßstab technischer Schwierigkeitsgrad – Kenntnisse eines Laien
(7) Konkretisierung des laienhaften, technischen Schwierigkeitsgrades durch die Rechtsprechung
(8) Handlungen der Schlussfertigung
d) Zwischenergebnis Fallgruppe 5
III. Zwischenergebnis Auslegung des Herstellerbegriffs
G. Teil G: Interdependenzen zum produkthaftungsrechtlichen Herstellerbegriff
I. Einführung
II. Der Herstellerbegriff im Spannungsfeld zwischen der Einheit der Rechtsordnung und der Trennung der Rechtsregime
III. Selbstständige Haftungsnormen
1. Haftung gemäß § 823 Abs. 1 BGB
2. Haftung gemäß § 1 ProdHaftG
a) Allgemeines
b) Wechselwirkungen der Herstellerbegriffe
c) Unterschiedliche Bedeutung der Prinzipien
d) Entstehen von Haftungslücken
e) Interpretation des Wortlauts
f) Zwischenergebnis
g) Besonderheit der Quasi-Herstellereigenschaft
IV. Verweisende Haftungsnorm – Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB
1. Allgemeines
2. Sonderrolle des Quasi-Herstellers im Sinne des ProdSG
H. Teil H: Interdependenzen in ausgewählten Einzelproblemen
I. 3D-Druck-Technologie
1. Einführung
2. Funktionsweise des 3D-Drucks
3. Hersteller des 3D-Druckers
4. Ersteller der CAD-Datei
5. Anwender des 3D-Druckers – „Ausdruckender“
a) Hersteller im Sinne der 1. Fallgruppe
b) Hersteller im Sinne der 4. Fallgruppe
c) Hersteller im Sinne der 2. Fallgruppe
6. Ergebnis
II. Industrie 4.0
1. Einführung
2. Sogenannte „Tote Produkte“
3. Anlagenbau
4. Ergebnis
I. Teil I: Schlussbetrachtung
I. Zusammenfassendes Ergebnis
1. Prinzip der „Nähe zum Produkt“
2. Prinzip der „Nähe zum Endverwender“
3. Herstellerbegriff – allgemeine Voraussetzungen
4. Fallgruppe 1
5. Fallgruppe 2
6. Fallgruppe 3 und Fallgruppe 4
7. Fallgruppe 5
II. Fazit und Ausblick
Quellenverzeichnis
A. Teil A: Problemaufriss
Eine effektive Gefahrenabwehr vor Produktrisiken setzt grundsätzlich beim Hersteller an. Er bringt vorrangig ein potenziell gefährliches Produkt in den Verkehr und besitzt das ergiebigste Wissen darüber. Daher ist es unerlässlich, dass der Hersteller als wesentlicher Wirtschaftsakteur1 des Produktsicherheitsrechts identifizierbar ist, um eine effektive Gefahrenabwehr zu gewährleisten.
Der Begriff „Hersteller“ ist trotz seiner Legaldefinition im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)2 und in den europäischen produktsicherheitsrechtlichen Normen unscharf. In der Legaldefinition des § 2 Nr. 14 ProdSG werden fünf verschiedene Fälle beschrieben,3 in denen ein Wirtschaftsteilnehmer4 als Hersteller anzusehen ist. Durch das Vorliegen mehrerer paralleler Fallgruppen, die mehrere Wirtschaftsteilnehmer gleichzeitig erfüllen können, entsteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Dies ergibt sich unter anderem aus der Sachlage, dass sich die Fallgruppen zum einen nach dem jeweiligen Wortlaut nicht trennscharf abgrenzen lassen und zum anderen jede einzelne Fallgruppe aufgrund der mangelnden Bestimmtheit des Wortlauts einer umfassenden Auslegung zugänglich ist.
In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, diese Rechtsunsicherheit durch eine Konkretisierung des Begriffs „Hersteller“ zu beseitigen. Das Bedürfnis zu dieser Konkretisierung ergibt sich zum einen aus dem mangelnden Kenntnisstand der betreffenden Wirtschaftsteilnehmer. Das Produktsicherheitsrecht ist in den Rechtsabteilungen vieler Unternehmen regelmäßig allenfalls ein in Grundzügen beherrschtes Terrain. Zum anderen findet eine rechtswissenschaftliche Begleitung allenfalls punktuell und aus Praktikersicht statt. Bislang besteht keine allgemeine, aus dem Produktsicherheitsrecht hervorgehende Annäherung. Somit spiegelt sich die beträchtliche praktische Bedeutung des europäischen Produktsicherheitsrechts nicht in der Aufarbeitung in der Rechtswissenschaft wider. Ferner hat im Gegensatz zum Produkthaftungsrecht das Produktsicherheitsrecht in der Rechtsprechung5 und der Literatur bisher wenig Resonanz gefunden.
Des Weiteren hat die dieser Ausarbeitung zugrunde liegende Forschungsfrage nach der Auslegung des Herstellerbegriffs im Produktsicherheitsrecht sowohl für die Wirtschaftsteilnehmer im europäischen Binnenmarkt als auch für die Marktüberwachungsbehörden eine erhebliche praktische und rechtliche Bedeutung. Erst mit der Konkretisierung beziehungsweise der begrifflichen Schärfung des Herstellerbegriffs lässt sich die erforderliche Rechtssicherheit im Produktsicherheitsrecht hinreichend gewährleisten. Denn jede Unsicherheit über die eigene Rolle als Wirtschaftsteilnehmer im Wirtschaftsverkehr führt dazu, dass die abverlangten Vorkehrungen und Verpflichtungen – etwa als Hersteller – nicht oder nur unzureichend erfüllt werden und weitere Maßnahmen nach sich ziehen, zum Beispiel die Anordnung von Produktrückrufen oder das Auslösen zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche.
Bei der Konkretisierung des Herstellerbegriffs ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsquellen im Produktsicherheitsrecht vorliegt und die Ausgestaltung der Rechtsnormen selbst für Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, nicht leicht zu handhaben ist. Aufgrund der aufgezeigten Handhabungsschwierigkeiten und mangelnder Kenntnisse im allgemeinen Produktsicherheitsrecht ist eine grundlegende Konkretisierung des Herstellerbegriffs anhand des deutschen Produktsicherheitsgesetzes und der europäischen Harmonisierungsvorschriften geboten.
Das Ziel ist es, jede Fallgruppe der Legaldefinition so weit zu konkretisieren, dass Wirtschaftsteilnehmer und Marktüberwachungsbehörden ohne erhebliche Hindernisse den hauptverantwortlichen Hersteller im Sinne des ProdSG für ein Produkt identifizieren können. Im Fokus steht die Herausarbeitung konkreter Kriterien, anhand derer eine Identifikation des Herstellers im produktsicherheitsrechtlichen Sinne möglich ist. Allerdings darf das allgemeine Sprachverständnis für den Herstellerbegriff nicht zu einer unzutreffenden Auslegung führen, die insbesondere für den Wirtschaftsteilnehmer, der seine Herstellereigenschaft verkennt, erhebliche negative Folgen haben kann.
Diese Untersuchung erfordert indes methodische Vorüberlegungen: Angesichts der praktischen Handhabbarkeit führt eine allein rechtsaktbezogene Untersuchung nicht weiter. Vielmehr muss ein Ansatz nach dem Sinn und Zweck der Regelungsmaterie verfolgt werden, der auf folgender Frage basiert: Wie lässt sich das Steuerungsziel „Produktsicherheit“ am effektivsten verwirklichen?
1
Wirtschaftsakteure sind nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 29 ProdSG Hersteller, Bevollmächtigte, Einführer und Händler im Sinne des ProdSG.
2
Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 I S. 131), das durch Art. 435 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wurde.
3
Siehe dazu instruktiv Teil F II.
4
Als Wirtschaftsteilnehmer werden in der vorliegenden Arbeit sämtliche natürlichen und juristischen Personen bezeichnet, die am Wirtschaftsleben teilhaben wie Wirtschaftsakteure und Personen, die nicht unter die Definition des Wirtschaftsakteurs fallen.
5
Bezeichnenderweise besteht die größte Anzahl der nationalen Rechtsprechung zum Produktsicherheitsrecht aus Urteilen zum Wettbewerbsrecht, unter anderem im Rahmen des § 3a UWG.
B. Teil B: Rechtsrahmen und Forschungsfrage
In diesem Kapitel werden die gesetzlichen Grundlagen des Herstellerbegriffs sowie dessen Unzulänglichkeiten im deutschen und europäischen Produktsicherheitsrecht dargestellt. Des Weiteren wird herausgearbeitet, weshalb es aus Unternehmersicht und aus staatlicher Sicht einer Schärfung beziehungsweise Konkretisierung dieses Begriffs bedarf.
I. Gesetzliche Grundlagen
Die Auslegung des Herstellerbegriffs erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage der Legaldefinition des Produktsicherheitsgesetzes in § 2 Nr. 14 ProdSG. Neben dieser Definition bestehen im Produktsicherheitsrecht weitere Herstellerdefinitionen in sektoralen Harmonisierungsrechtsakt6, Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz und speziellen Produktsicherheitsgesetzen. Die Definitionen gehen auf die Musterdefinition aus Art. R1 Nr. 3 des Beschluss 768/2008/EG zurück und sind aufgrund der europäischen Harmonisierung nach der „neuen Konzeption“ sowie der Verordnung (EG) 765/2008 und dem Beschluss 768/2008/EG nahezu identisch.7 Zu diesen Rechtsakten bestehen stellenweise Auslegungshilfen, wie Leitfäden,8 die aufgrund des Gleichlaufs der Herstellerbegriffe durch die europäische Harmonisierung in ihren Grundzügen auch Geltung für den Herstellerbegriff aus § 2 Nr. 14 ProdSG haben können. Umgekehrt entfaltet die Auslegung des Herstellerbegriffs des § 2 Nr. 14 ProdSG unter der Beachtung von sektoralen Eigenheiten im Wesentlichen auch Geltung für die Herstellerdefinitionen in den weiteren produktsicherheitsrechtlichen Rechtsvorschriften.
1.Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
Das zentrale Gesetz für die Beurteilung, welcher Marktteilnehmer in Deutschland als „Hersteller“ anzusehen ist, ist das Produktsicherheitsgesetz, das am 1. Dezember 2011 in Kraft getreten ist. Das Produktsicherheitsgesetz setzt die europäische „Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit“ 2001/95/EG9 in Deutschland nahezu eins zu eins in nationales Recht um. Die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG definiert Anforderungen für diejenigen Produkte, die nicht von einem sektoralen Harmonisierungsrechtsakt erfasst werden.
Das ProdSG dient insbesondere dem Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen (§ 3 Abs. 2 S. 1 ProdSG). Dazu werden in § 3 ProdSG verschiedene Anforderungen an das Produkt formuliert. Die Marktteilnehmer – und damit auch die Hersteller – dürfen nur sichere Produkte auf dem Markt bereitstellen.
2.Europäische Rechtsnormen
Neben das ProdSG als nationales Produktsicherheitsrecht, das die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG in nationales Recht umsetzt, tritt ein komplexes System weiterer europäischer Normen, die für die Auslegung des Herstellerbegriffs von maßgeblicher Bedeutung sind. Dies ergibt sich aus der europäischen Harmonisierung des Produktsicherheitsrechts und damit auch des Herstellerbegriffs. Dieses System besteht im Wesentlichen aus Rechtsvorschriften im Rahmen der sogenannten „neuen Konzeption“, dem sogenannten „Globalen Konzept“ und dem sogenannten „New Legislative Framework“ (NLF), der Europäischen Union, deren Sinn und Zweck beziehungsweise dessen Ziele als auslegungsleitende Grundsätze herangezogen10 und im Folgenden näher dargestellt werden.
Die sogenannte „neue Konzeption“ der Europäischen Union legt einheitliche, grundlegende Produktsicherheitsanforderungen in sektoralen Harmonisierungsrechtsakten fest, die auf der Grundlage des Art. 114 AEUV11 erlassen wurden und werden.12 Indem europaweit in den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten einheitliche Anforderungen an Produkte gestellt werden, soll dem freien europäischen Warenverkehr zur Durchsetzung verholfen werden. Ein Produkt, das unter den Anwendungsbereich eines sektoralen Harmonisierungsrechtsakts fällt, darf nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn die Konformität dieses Produkts mit den Anforderungen der darauf anwendbaren EU-Richtlinie(n) oder EU-Verordnung(en) bescheinigt wird (Konformitätserklärung) und durch das Anbringen des CE-Kennzeichens auf dem Produkt bestätigt wird.13 Der Hersteller erklärt mit dem Anbringen des CE-Kennzeichens auf dem Produkt gegenüber den Marktüberwachungsbehörden, dass er der Auffassung ist, die Anforderungen dieser Harmonisierungsrechtsakte eingehalten zu haben.14 Dadurch ist das Produkt mit dem CE-Kennzeichen im Europäischen Wirtschaftsraum frei verkehrsfähig.
Die „neue Konzeption“ wird durch das sogenannte „Globale Konzept“ ergänzt: Die nationalen Marktüberwachungsbehörden erkennen die Konformitätserklärungen von Herstellern aus anderen Mitgliedstaaten gegenseitig an.15 Dazu wurden gemeinsame Regeln für eine einheitlich gestaltete CE-Konformitätskennzeichnung geschaffen und die Konformitätsbewertung harmonisiert.16 Umgesetzt wurde das „Globale Konzept“ durch den „Beschluss über die in den Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module für die verschiedenen Phasen der Konformitätsbewertung und die Regeln für das Anbringen und Verwendung der CE-Konformitätskennzeichnung“.17 Dieser sogenannte „Modulbeschluss“ enthielt verschiedene Verfahren, wie die Konformität von Produkten festgestellt werden soll. Je nach Gefährlichkeit und Komplexität des Produkts ändern sich die Anforderungen an das Konformitätsbewertungsverfahren, wodurch ein entsprechendes Modul mit entsprechenden Anforderungen an das Konformitätsbewertungsverfahren anzuwenden war.18 Ein Modul schreibt beispielsweise vor, dass der Hersteller über ein vollständiges Qualitätssicherungssystem verfügen muss. Durch den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2008 „über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates“ wurde der Modulbeschluss unter Beibehaltung des Modulprinzips durch weitere Präzisierungen ersetzt.19 Für die ab 2008 erlassenen sektoralen Harmonisierungsrechtsakte bzw. für die Überarbeitung vorhandener Harmonisierungsrechtsakte galt bzw. gilt nun der Beschluss 768/2008/EG. Dieser enthält unter anderem gemeinsame Grundsätze und Musterbestimmungen für die Anwendung in allen sektoralen Harmonisierungsrechtsakten. Dieser Beschluss bildet einen allgemeinen umspannenden Rahmen für Rechtsvorschriften zur Harmonisierung des Binnenmarktes und enthält zudem verschiedene Definitionen für bestimmte grundlegende Begriffe, wie den Herstellerbegriff. Die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte, die auf der Basis des Beschlusses 768/2008/EG erlassen wurden und werden, beinhalten folglich grundsätzlich die gleichlautenden Definitionen des Beschluss 768/2008/EG. Zuvor wurde in den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten eine ganze Reihe von Begriffen verwendet, die teilweise nicht oder unterschiedlich definiert waren und deshalb zu einer rechtlichen Unklarheit in dem Mitgliedstaaten der Europäischen Union geführt haben. Dazu gehörte unter anderem auch der Herstellerbegriff.
Seit dem 1. Januar 2010 gilt der „New Legislative Framework“ der den Beschluss Nr. 768/2008/EG mit der EU-Verordnung Nr. 765/2008 und der Verordnung 764/2008/EG ergänzt. Die Verordnung (EU) 765/2008 gibt einen neuen allgemeinen Rechtsrahmen für die Überwachung der Sicherheit von Produkten in der EU vor. Auf der Grundlage dieser Verordnung sollen die einzelnen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission das System der Markt- und Produktüberwachung auf Verwaltungsebene organisieren, um die verschiedenen produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften gegenüber den Wirtschaftsakteuren zu kontrollieren und durchsetzen.
3.Verhältnis ProdSG, Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und sonstige sektoralen Harmonisierungsrechtsakten
Die Auslegung des Herstellerbegriffs findet zwar maßgeblich anhand der Definition in § 2 Nr. 14 ProdSG statt. Für die Auslegung werden jedoch auch Auslegungshilfen, wie Leitfäden zu sektoralen Harmonisierungsrechtsakten herangezogen, die Aussagen über den „Hersteller“ des entsprechenden Harmonisierungsrechtsakts enthalten. Die Heranziehung dieser Auslegungshilfen ist grundsätzlich möglich, da die Herstellerdefinitionen in den Harmonisierungsrechtsakte aufgrund der europäischen Harmonisierung durch den Musterbeschluss 768/2008/EG – wie bereits dargelegt – nahezu identisch sind. Die Auslegung des Herstellerbegriffs des Produktsicherheitsgesetzes entfaltet ferner allgemeingültige Geltung für den jeweiligen Herstellerbegriff aus den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass spezifische Modifikationen des Herstellerbegriffs bestehen können, die für den jeweiligen Sektor zu beachten sind. Dies ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG, die durch das ProdSG in nationales Recht umgesetzt wird und den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten:
Die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG hat keine übergeordnete Allgemeingültigkeit gegenüber den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten. Vielmehr stehen die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte auf der gleichen Ebene wie die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und können daher allenfalls modifizierend wirken. Der Revisionsentwurf20 zur Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG der Europäischen Kommission verdeutlicht in Art. 1 sowie in Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 E-RaPS, dass gegenüber den anderen sektoralen Harmonisierungsrechtsakten keine übergeordnete Geltung bestehen soll, sondern die Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG soll nur dann zur Anwendung kommen, wenn ein Produkt weder von einem Harmonisierungsrechtsakt noch von einer nationalen Vorschrift erfasst ist.21 Denn nach Art. 1 Abs. 2 RaPS gehen die Vorgaben der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit gegenüber den spezifischen Sicherheitsanforderungen22 im Gemeinschaftsrecht nur dann vor, soweit gewisse Aspekte, Risiken oder Risikokategorien darin nicht geregelt sind. Dazu heißt es im Wortlaut Art. 1 Abs. 2 RaPS:
„Jede Vorschrift dieser Richtlinie gilt insoweit, als es im Rahmen gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften keine spezifischen Bestimmungen über die Sicherheit der betreffenden Produkte gibt, mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird. Sind für Produkte in Gemeinschaftsvorschriften spezifische Sicherheitsanforderungen festgelegt, so gilt diese Richtlinie nur für Aspekte, Risiken oder Risikokategorien, die nicht unter diese Anforderungen fallen.“
Infolgedessen können in EU-Richtlinien und EU-Verordnungen auch geringere Sicherheitsanforderungen an ein Produkt gestellt werden, als sie in der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG beziehungsweise dem ProdSG konstituiert sind. Diese Möglichkeit ist bei näherer Betrachtung auch überzeugend, da dadurch in den sektoralen Harmonisierungsrechtsakten auf spezifische Eigenheiten eines speziellen Produkts und seines Einsatzfelds, zum Beispiel in der Zulieferindustrie, eingegangen werden kann.
Demnach würde eine Vorrangregelung dem System des EU-Produktsicherheitsrechts widersprechen. Dies ergibt sich daraus, dass die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte in erster Linie den Warenverkehr durch einheitliche Sicherheitsstandards zwischen den Mitgliedstaaten im EU-Binnenmarkt gewährleisten sollen.23 Würden durch nationale Umsetzungsgesetze oder durch Gemeinschaftsrechtsakte höhere Sicherheitsstandards mit einem Vorrang gegenüber der jeweiligen EU-Richtlinie statuiert, würden die sektoralen Harmonisierungsrechtsakte und die damit verbundene EU-Harmonisierung ihren Sinn verlieren, da in diesem Fall nur noch die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit benötigt werden würde.
4.Sachliche Anwendungsbereiche
Die Herstellerdefinition des ProdSG wird erst dann relevant, wenn der sachliche Anwendungsbereich des ProdSG eröffnet ist. Dies richtet sich maßgeblich nach dem jeweils hergestellten Produkt. Grundsätzlich sind alle Produkte vom ProdSG umfasst, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden. Ausnahmen bilden Lebensmittel, lebende Pflanzen und Tiere, Antiquitäten oder Militärprodukte. Für sie gelten spezielle Gesetze und Regelungen, die neben dem ProdSG stehen.24 Spezielle Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz (ProdSV) stellen besondere Anforderungen an Produkte, die zwar bereits vom ProdSG umfasst sind, aber den sachlichen Anwendungsbereich des ProdSG nicht erweitern. Die Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz wurden auf der Grundlage europäischer Richtlinien25 erlassen, die ihrerseits – wie bereits dargestellt – auf der Grundlage des Beschlusses 768/2008/EG erlassen wurden. Diese EU-Richtlinien26 teilen sich in zwei Arten auf: in die horizontalen (produktunabhängigen) Harmonisierungsrechtsvorschriften wie die EMV-Richtlinie27 oder die Niederspannungsrichtlinie28 und in die vertikalen Harmonisierungsrechtsvorschriften für spezifische Industriesektoren wie Maschinen29, Druckgeräte30 oder Funkanlagen31. Stellenweise wurden diese EU-Richtlinien nicht nur durch (nationale) Verordnungen, sondern auch durch Spezialgesetze in deutsches Recht umgesetzt, zum Beispiel durch das ElektroG. Ferner bestehen horizontale und vertikale europäische Verordnungen, die unmittelbar gelten wie beispielsweise die sogenannte REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die den sachlichen Anwendungsbereich des ProdSG jedoch ebenfalls nicht erweitern.
Durch die Regelungen für Verbraucherprodukte in § 6 ProdSG wird der sachliche Anwendungsbereich des ProdSG ebenfalls nicht erweitert. Vielmehr handelt es sich dabei um zusätzliche Anforderungen an Verbraucherprodukte, die bereits vom Anwendungsbereich des ProdSG umfasst sind. Das ProdSG stellt für die Verbraucherprodukte folglich eine Dachfunktion dar, indem es zusätzliche Anforderungen an deren Bereitstellung stellt32, ähnlich den Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz.
Abbildung 1: Verhältnis der Produktsicherheitsnormen zueinanderQuelle: eigene Darstellung
5.Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des ProdSG legt zwar fest, wo marktüberwachungsbehördliche Maßnahmen durch die deutsche Verwaltung gegenüber einem Hersteller im Sinne des ProdSG erlassen werden können, trägt aber nicht zur Konstitution eines Wirtschaftsteilnehmers als Hersteller im Sinne des § 2 Nr. 14 ProdSG bei. Der räumliche Geltungsbereich des ProdSG ist auf das Staatsgebiet Deutschlands beschränkt, indem die produktsicherheitsrechtlichen Handlungsweisen innerhalb des Staatsgebietes stattfinden müssen. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, „wo genau die Sachherrschaft in Bezug auf das Produkt wechselt“.33 Folglich muss der Hersteller nicht seinen Sitz in Deutschland haben, um als Hersteller im Sinne des ProdSG zu gelten. Dieser Schluss ergibt sich bereits aus § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ProdSG, nach dem das Anbringen der Kontaktdaten eines Einführers oder eines Bevollmächtigten auf einem Verbraucherprodukt nur für den Fall vorgesehen ist, dass der Hersteller nicht im Europäischen Wirtschaftsraum (also auch nicht in Deutschland) ansässig ist.34 Des Weiteren bestehen keine Regelungen im ProdSG, die festlegen, dass der Hersteller seinen Sitz in Deutschland haben muss.
Für den räumlichen Anwendungsbereich der sektoralen Harmonisierungsrechtsakten ist maßgeblich, in welchem Staat ein Produkt in Verkehr35 gebracht wird. Das ergibt sich unter anderem aus Artikel R2 Abs. 1 des Musterbeschlusses Nr. 768/2008/EG, in dem es heißt: „Die Hersteller gewährleisten, wenn sie ihre Produkte in Verkehr bringen, dass diese gemäß den Anforderungen von […] entworfen und hergestellt wurden.“ In den Harmonisierungsrechtsakten bestehen ebenfalls keine Regelungen, die festschreiben, dass der Hersteller innerhalb des räumlichen Anwendungsbereichs seinen Sitz haben muss. Die Harmonisierungsrechtsakte schreiben somit nicht fest, dass der Hersteller des Produkts in der Europäischen Union niedergelassen sein muss.36 Vielmehr muss der Hersteller, unabhängig davon, wo er niedergelassen ist, dieselben Anforderungen erfüllen wie ein in der Europäischen Union niedergelassener Hersteller. Eine Bedeutung für die Auslegung des Herstellerbegriffs resultiert daraus wie bereits beim ProdSG ebenfalls nicht. Da allerdings nur innerhalb des räumlichen Anwendungsbereichs der Harmonisierungsrechtsakten ein Inverkehrbringen vorliegen kann und das Inverkehrbringen für verschiedene Fallgruppen der Herstellerdefinition ein maßgebliches Tatbestandsmerkmal ist, ist der räumliche Anwendungsbereich der Harmonisierungsrechtsakte dennoch von entscheidender Bedeutung, wie noch zu zeigen sein wird.
6
„Sektoraler Harmonisierungsrechtsakt“ ist ein Sammelbegriff für EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, in denen spezifische Anforderungen an Produkte im europäischen Binnenmarkt gestellt werden.
7
Siehe dazu Teil D. VIII. Nr. 1.
8
Siehe dazu Teil C. II.
9
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit, ABl.
EG Nr.
L 11 S. 4.
10
Siehe dazu vertiefend Teil E.
11
Art. 114 AEUV ist die Nachfolgenorm zu Art. 95 EGV, auf dessen Grundlage ebenfalls EU-Richtlinien erlassen wurden.
12
Europäische Kommission, Leitfaden für die Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem Gesamtkonzept verfassten Richtlinien, Punkt 1.4, S. 12.
13
Beschluss der Kommission (2010/713/EU) vom 9. November 2010 über Module für die Verfahren der Konformitäts- und Gebrauchstauglichkeitsbewertung sowie der EG-Prüfung, die in den gemäß Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates angenommenen technischen Spezifikationen für die Interoperabilität zu verwenden sind (bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 7582) (Modulbeschluss), I B lit. b.; Schneider, Zertifizierung im Rahmen der CE-Kennzeichnung, S. 8.
14
Klindt, „Das Recht der Produktsicherheit: ein Überblick“, S. 299.
15
Schneider, Zertifizierung im Rahmen der CE-Kennzeichnung, S. 8.
16
Europäische Kommission, Ein globales Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen, KOM (89), 209 endg. V. 15.06.1989, Nr. C 267.
17
Modulbeschluss 93/465/EWG vom 22. Juli 1993.
18
Schneider, Zertifizierung im Rahmen der CE-Kennzeichnung, S. 46.
19
Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates, Erwägungsgrund 14.
20
Vorschlag der Kommission vom 13.02.2013 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Verbraucherprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 87/357/EWG des Rates und der Richtlinie 2001/95/EG (COM(2013) 78 final).
21
Adam, Die Mitteilungen der Kommission, S. 415 ff.; Klindt in: Klindt, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), § 1 Rn. 26 und 28 ff.
22
Beispielsweise regelt eine EU-Richtlinie nur mechanische, aber nicht thermische Risiken eines bestimmen Produkts. Dementsprechend gelten für diese thermischen Risiken die einschlägigen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit, wenn auch keine nationalen Sicherheitsanforderungen für diese thermische Risiken bestehen und es sich zudem um ein Verbraucherprodukt handelt.
23
Siehe dazu instruktiv Teil E. II. Nr. 2; Pfenninger, AJP/PJA 2014, 1157, 1166.
24
Als Beispiele dafür sind das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz oder das Artenschutzgesetz zu nennen.
25
Seit 1. Dezember 2009 mit Inkrafttreten des „Vertrags von Lissabon“: „EU-Richtlinie“.
26
Mit dem Ablauf der jeweiligen Umsetzungsfrist einer EU-Richtlinie, ohne einer nationalen Umsetzung der entsprechenden Richtlinie, entfaltet die EU-Richtlinie auch im nationalen Produktsicherheitsrecht direkte Wirkung, siehe dazu instruktiv Schucht, StoffR 2015, 192, 193.
27
Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
28
Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.
29
Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG.
30
Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt.
31
Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.
32
Lach/Polly, Produktsicherheitsgesetz, S. 4.
33
Schucht in: Klindt, Produktsicherheitsgesetz ProdSG, 2015, § 1 Rn. 35.
34
Klindt/Schucht in: Klindt, Produktsicherheitsgesetz ProdSG, 2015, § 2 Rn. 117.
35
Siehe zur Inverkehrgabe instruktiv Teil F II. Nr. 3 dd).
36
Blue Guide, C 272/29.
II. Gesetzliche Definition des Herstellerbegriffs
1.Definition des Herstellerbegriffs
Der Hersteller stellt einen Wirtschaftsakteur37 im Sinne des ProdSG dar und wird nach § 2 Nr. 14 ProdSG wie folgt definiert:
„jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet; als Hersteller gilt auch jeder, der
a) geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller ausgibt oder
b) ein Produkt wiederaufarbeitet oder die Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts beeinflusst und dieses anschließend auf dem Markt bereitstellt.“
Bereits nach dem Wortlaut der Legaldefinition in § 2 Nr. 14 ProdSG ist eine klare begriffliche Eingrenzung kaum möglich, welcher Wirtschaftsteilnehmer nun als Hersteller gelten soll. Es ergeben sich nämlich gleich mehrere Fallgestaltungen, nach denen ein Wirtschaftsteilnehmer zum „Hersteller“ werden kann:
– eigene Produktion des Produkts
– Herstellung des Produkts durch einen Dritten im Auftragsverhältnis bei Vertrieb des Produkts unter eigenem Namen
– Entwicklung des Produkts durch einen Dritten bei Vertrieb unter eigenem Namen.
– Aufbereitung einer Sache vor dem abermaligen Inverkehrbringen
– Beeinflussung der Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts
– wesentliche Veränderung eines Produkts
– Anbringen der Handelsmarke, Warenzeichen oder Firmennamen auf einem Produkt (sogenannter Quasi-Hersteller).
2.Die Herstellereigenschaft im Produktlebenszyklus
Abbildung 2: Begründung der HerstellereigenschaftQuelle: eigene Darstellung
Die Herstellereigenschaft wird grundsätzlich am Anfang des Produktlebenszyklus konstituiert, indem ein Wirtschaftsteilnehmer ein Produkt im Sinne des ProdSG selbst produziert (Fallgruppe 1 gem. § 2 Nr. 14 Hs. 1 ProdSG). Auf der Stufe des Vertriebs kann der vertreibende Wirtschaftsteilnehmer zum Hersteller im Sinne des ProdSG werden, indem er das Produkt bei einem Dritten herstellen lässt und unter seinem eigenen Namen vertreibt (Fallgruppe 1 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 1 ProdSG). Das Gleiche ist gegeben, wenn dieser Wirtschaftsteilnehmer das Produkt durch einen Dritten entwickeln ließ (Fallgruppe 1 gemäß § 2 Nr. 14 Hs. 1 ProdSG). Auf der Vertriebsstufe wird ferner die Quasi-Herstellereigenschaft konstituiert, indem auf ein Produkt die Handelsmarke, das Warenzeichen oder der Firmenname angebracht werden und es vertrieben wird (Fallgruppe 2 gem. § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. a) ProdSG). Der Unterschied zwischen den bereits dargestellten Fallgruppen besteht darin, dass das Produkt in diesem Fall nicht im Auftrag des (nunmehr) Quasi-Herstellers entwickelt oder produziert wurde. Sobald das Produkt in den Verkehr gebracht wurde, kann in einem weiteren Schritt des Produktlebenszyklus eine Herstellereigenschaft konstituiert werden. Dies ist dann der Fall, wenn ein Produkt durch einen Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit aufbereitet (Fallgruppe 3 gem. § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 1 ProdSG) oder wesentlich beeinflusst wird (Fallgruppe 4 gem. § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG) oder wenn die Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts beeinflusst wurden (Fallgruppe 5 gem. § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG) und das jeweilige Produkt erneut auf dem Markt bereitgestellt wird. Daran anschließend kann die Herstellereigenschaft an dem Produkt, auf das bereits eingewirkt wurde, wieder erneut durch eine Quasi-Herstellereigenschaft begründet werden oder durch eine erneute Einwirkung auf das Produkt und dessen Bereitstellung nach § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG oder § 2 Nr. 14 Hs. 2 lit. b) Alt. 2 ProdSG.
3.Problematik der Definition
Die vorangestellte Darstellung der verschiedenen Fallgruppen lässt bereits die Unzulänglichkeit des Herstellerbegriffs des ProdSG erkennen: Die verschiedenen Fallgruppen sind nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Ob ein Produkt durch den Produzenten im technischen Sinne selbst oder durch die Vorgaben eines Auftraggebers entwickelt wurde, lässt sich nicht einfach voneinander abgrenzen. Schließlich werden Produkte in einem arbeitsteiligen Arbeitsumfeld zumeist von verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern gemeinsam entwickelt. Bei technischen Produkten, die ein Zulieferbetrieb entwickeln soll, arbeitet der Auftraggeber mit Pflichten- und Lastenheften, welche die wesentlichen Eigenschaften des Produkts vorgeben. Schon das Ausarbeiten des Pflichten- und Lastenheftes könnte bereits als die Entwicklung des Produkts anzusehen sein, sodass einerseits der tatsächliche Produzent des Produkts der Hersteller im Sinne des ProdSG sein könnte, andererseits aber auch der Verfasser des Pflichten- und Lastenheftes.
Neben der Abgrenzung der einzelnen Fallgruppen voneinander besteht eine weitere Problematik darin, dass die Handlungsmodalitäten der einzelnen Fallgruppen durch unscharfe Begriffe beschrieben werden. Dabei erzeugt insbesondere die Frage Schwierigkeiten, wann eine Einwirkung auf ein Produkt anzunehmen ist. Dies könnte bereits dann der Fall sein, wenn nur eine einfache Eigenschaft des Produkts verändert wird wie beim bloßen Umlackieren.
Werden die einzelnen Fertigungsschritte des Produktentstehungs- und Lebenszyklus innerhalb der Lieferkette betrachtet, wird die Unzulänglichkeit des Herstellerbegriffs noch deutlicher: Wird ein Produkt von Wirtschaftsteilnehmer A entwickelt, von Wirtschaftsteilnehmer B produziert, wobei beide Wirtschaftsteilnehmer ihren Namen auf dem Produkt anbringen, von Wirtschaftsteilnehmer C in den Verkehr gebracht und schließlich von Wirtschaftsteilnehmer D eine Erkennungsmarke angebracht und weitervertrieben, stellt sich die Frage nach dem verantwortlichen Hersteller im Sinne des ProdSG. Die Frage wird noch weiter verschärft, wenn im Anschluss an den originären Vertriebszyklus von Wirtschaftsteilnehmer E – zum Beispiel einem Recycler – Einwirkungen auf das Produkt vorgenommen werden.
Somit könnte dieses Produkt nach dem ProdSG mehrere Hersteller haben. Allerdings kann immer nur ein Wirtschaftsteilnehmer für ein Produkt der Hersteller im Sinne des ProdSG sein.38 Dass für ein Produkt mehrere Wirtschaftsteilnehmer als Hersteller im Sinne des ProdSG infrage kommen, ruft folglich eine erhebliche Rechtsunsicherheit und dementsprechend ein hohes Klarstellungsbedürfnis bei den Wirtschaftsteilnehmern und den Marktüberwachungsbehörden hervor, was nachfolgend verdeutlicht wird.39
37
§ 2 Nr. 29 ProdSG nennt als Wirtschaftsakteure und damit als Verpflichtete im Sinne des § 27 Abs. 1 ProdSG sowie als Anordnungsadressaten die Hersteller, Bevollmächtigten, Einführer und Händler.
38
Bauer, Das Recht des technischen Produkts, S. 219.
39
Siehe dazu instruktiv Teil B. III.
III. Klarstellungsinteresse
Ein Klarstellungsinteresse, bezogen auf die Frage, welcher Wirtschaftsteilnehmer letztlich als Hersteller anzusehen ist, besteht sowohl aus Sicht der Unternehmen, die als Anordnungsadressat „Hersteller“ infrage kommen können, als auch aus Sicht der Marktüberwachungsbehörden. Aus Sicht des Herstellers, weil er die Pflichten des ProdSG erfüllen muss, sofern er als Adressat des ProdSG gilt. Aus Sicht der Marktüberwachungsbehörden, weil sie ihre Maßnahmen nur gegenüber den richtigen Adressaten rechtmäßig anordnen können.
1.Klarstellungsinteresse aus Unternehmersicht
Aus Unternehmersicht besteht daher ein Interesse an der Konkretisierung des Herstellerbegriffs, weil die Unternehmer im Innen- und Außenverhältnis dazu verpflichtet sind, die notwendigen Maßnahmen im Unternehmen einzuleiten, um die produktsicherheitsrechtlichen Pflichten zu erfüllen, die sich an die Herstellereigenschaft knüpfen. Ebenso sind sie verpflichtet, alle negativen Folgen von ihrem Unternehmen abzuwenden, die sich als Rechtsfolgen der Nichterfüllung der Pflichten ergeben könnten. Dafür muss der Wirtschaftsteilnehmer allerdings seine Rolle als Hersteller kennen. Denn nur, wenn dieses Wissen über die eigene Rolle vorhanden ist, wird der Unternehmer die richtigen Maßnahmen einleiten und negative Folgen wie vertriebsbeschränkende Maßnahmen seitens der Marktüberwachungsbehörden oder Schadensersatzansprüche anderer Wirtschaftsteilnehmer abwenden.
Zum besseren Verständnis werden im Folgenden die Verpflichtungen des Herstellers nach dem ProdSG dargestellt sowie die Rechtsfolgen, die eintreten, wenn der Unternehmer seine Pflichten nicht erfüllt.40 Ferner wird untersucht, aus welchen rechtlichen Verpflichtungen die Unternehmer im Innen- und Außenverhältnis dazu verpflichtet sind, die negativen Folgen zu verhindern, die aus der Nichterfüllung von Herstellerpflichten herrühren können. Die Pflicht zum Einhalten der produktsicherheitsrechtlichen Herstellerpflichten ergibt sich nicht nur aus dem ProdSG selbst, sondern auch aus der organisationsrechtlichen Pflicht, negative Folgen vom eigenen Unternehmen abzuwenden.41 Des Weiteren wird durch die Untersuchung der verschiedenen Herstellerpflichten herausgearbeitet, welche Anforderungen an einen Wirtschaftsteilnehmer zu stellen sind, damit dieser die Rolle des Herstellers im Sinne des ProdSG überhaupt erfüllen kann.42 Die Herstellerpflichten sind unzertrennlich mit der Herstellereigenschaft verknüpft. Im Rahmen der teleologischen Untersuchung des Herstellerbegriffs wird unter anderem von Bedeutung sein, welcher Wirtschaftsteilnehmer die Herstellerpflichten am effektivsten umsetzen kann.
a)Produktsicherheitsrechtliche Herstellerpflichten im Einzelnen
Bei den produktsicherheitsrechtlichen Herstellerpflichten im Sinne des ProdSG handelt es sich im Wesentlichen um produktbezogene, öffentlich-rechtliche Pflichten an die Hersteller. Dabei ist zwischen Herstellerpflichten vor und nach dem Inverkehrbringen zu unterscheiden.
aa)Pflichten vor dem Inverkehrbringen
Herstellerpflichten, die vor dem Inverkehrbringen eines Produkts ansetzen, betreffen insbesondere das Einhalten der Beschaffenheitsanforderungen für Produkte und Vorschriften über den Marktzugang. Grundsätzlich muss ein Produkt derart beschaffen sein, dass es bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nach § 3 ProdSG nicht gefährdet. Weitere Beschaffenheitsanforderungen ergeben sich aus Spezialgesetzen, EU-Richtlinien oder Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz. Beispielsweise muss ein Produkt, das vom Anwendungsbereich des EMVG (Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln), das die europäische EMV-Richtlinie 2014/30/EU in deutsches Recht umsetzt, umfasst ist, nach § 4 EMVG unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen sein und darf keine elektromagnetischen Störungen anderer Produkte verursachen (sogenannte elektromagnetische Verträglichkeit). Um diese verschiedenen Beschaffenheitsanforderungen zu gewährleisten, treffen den Hersteller öffentlichrechtliche Konstruktions43-, Produktions44- und Instruktionspflichten.45 Unter der Pflicht zur ordnungsgemäßen Konstruktion ist beispielsweise zu verstehen, dass der Hersteller bereits beim Design des Produkts und bei der Erstellung des Bauplans Fehler zu vermeiden hat. Indem der Hersteller diese Pflichten einhalten muss, soll im Sinne einer präventiven Gefahrenabwehr von vornherein verhindert werden, dass das Produkt Schäden verursachen kann.46
(1)Besondere Pflichten bei Verbraucherprodukten
Bei Verbraucherprodukten werden im ProdSG zusätzliche Anforderungen an das Inverkehrbringen vorgeschrieben. Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ProdSG hat der Hersteller dem Verwender des Produkts die Informationen zur Verfügung zu stellen, die er zur Risikobeurteilung benötigt, zum Beispiel durch das Beifügen geeigneter und verständlicher Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen, Sicherheits- und Warnhinweise (in deutscher Sprache) sowie sonstiger produktbezogener Angaben oder Informationen. Vor allem hat der Hersteller seinen Namen und seine Kontaktanschrift anzubringen sowie für die eindeutige Kennzeichnung zur Identifikation des Verbraucherprodukts zu sorgen, und zwar durch Angaben auf dem Produkt beziehungsweise auf der Verpackung von Produktbezeichnung, Artikel-/Chargennummer, Produktionsdaten und Lieferantencode.47 Indem diese Informationen vom Hersteller auf dem Produkt anzubringen sind, soll unter anderem sichergestellt werden, dass bei einem Produktrückruf die betroffenen Produkte und der verantwortliche Hersteller ohne Weiteres zu identifizieren sind, um einen möglichst schnellen und effizienten Rückruf durchzuführen, indem beispielsweise die Verbraucher über Pressemitteilungen oder Filialaushänge über die Gefahren eines Produktmodells mit einer bestimmten Chargennummer eines bestimmten Herstellers informiert werden können.
(2)CE-Kennzeichnungspflicht
Auf Produkte, die einer CE-Kennzeichnungspflicht nach einer EU-Richtlinie unterliegen, hat der Hersteller gemäß § 7 ProdSG diese Kennzeichnung vor der ersten Bereitstellung auf dem Markt anzubringen. Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Produkt oder seinem Typenschild angebracht sein. Nach § 7 Abs. 2 ProdSG sind sowohl das Unterlassen einer vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung als auch die Verwendung einer nicht vorgesehenen CE-Kennzeichnung verboten. Zur Erfüllung der CE-Kennzeichnungspflicht muss der Hersteller dafür sorgen, dass die technischen Unterlagen erstellt werden und das Produkt im Feld zurückverfolgt werden kann.48
(3)GS-Zeichen
Beim freiwilligen Anbringen des GS-Zeichens49 unterwirft sich der Hersteller den Pflichten aus den §§ 20–23 ProdSG. Hauptsächlich darf der Hersteller erst dann das GS-Zeichen auf seinen Produkten anbringen, wenn eine GS-Stelle auf Antrag des Herstellers das GS-Zeichen zuerkannt hat und das Produkt mit der eingereichten Baumusterbescheinigung übereinstimmt.
bb)Pflichten nach dem Inverkehrbringen
Nach dem Inverkehrbringen trifft den Hersteller insbesondere die Produktbeobachtungspflicht. Der Hersteller hat sich so zu verhalten, dass er auch nach dem Inverkehrbringen mögliche Gefahren des Produkts erkennen kann.50 Erhält der Hersteller durch diese Beobachtung oder auf anderem Weg Kenntnis davon, dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes Produkt unsicher ist, hat er nach Art. 5 Abs. 1 UAbs. 3 Buchst. b der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) die entsprechenden Maßnahmen zur Abwehr der Risiken zu ergreifen und gegebenenfalls eine Warnung auszusprechen oder sein Produkt zurückzurufen. Der Hersteller kann seiner Produktbeobachtungspflicht durch Überwachungsmaßnahmen nachkommen, zum Beispiel mit der Durchführung von Stichproben bei den auf dem Markt bereitgestellten Produkten und mit der Prüfung von Beschwerden im Sinne von § 6 Abs. 3 ProdSG. Zudem haben Hersteller gemäß § 6 Abs. 4 S. 1 ProdSG die zuständige Marktüberwachungsbehörde unverzüglich über die von ihren Verbraucherprodukten51 ausgehenden Risiken für die Gesundheit und Sicherheit von Personen zu unterrichten.52
b)Öffentlich-rechtliche Folgen
Werden die vorgenannten Pflichten nicht eingehalten, können die Marktüberwachungsbehörden gegenüber dem Wirtschaftsakteur, der als Hersteller auf dem Markt auftritt, eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Maßnahmen anordnen. Sie sind in § 26 Abs. 2 S. 2 ProdSG in einem nicht abschließenden Katalog geregelt. Insbesondere sind die Marktüberwachungsbehörden zu folgenden Maßnahmen befugt:
– das Ausstellen eines Produkts zu untersagen
– Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass ein Produkt erst dann auf dem Markt bereitgestellt wird, wenn es die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 erfüllt
– anzuordnen, dass ein Produkt von einer notifizierten Stelle, einer GS-Stelle oder einer in gleicher Weise geeigneten Stelle überprüft wird
– die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt oder das Ausstellen eines Produkts für den Zeitraum zu verbieten, der für die Prüfung zwingend erforderlich ist
– anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht verständliche Hinweise zu Risiken, die mit dem Produkt verbunden sind, in deutscher Sprache angebracht werden
– zu verbieten, dass ein Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird
– die Rücknahme oder den Rückruf eines auf dem Markt bereitgestellten Produkts anzuordnen
– ein Produkt sicherzustellen, es zu vernichten, vernichten zu lassen oder auf andere Weise unbrauchbar zu machen
–