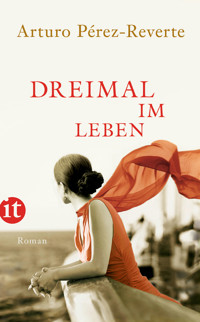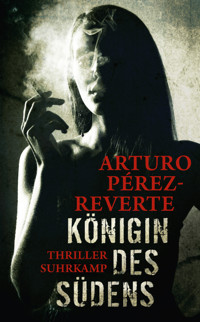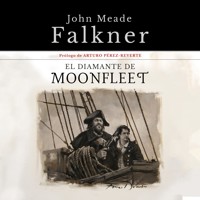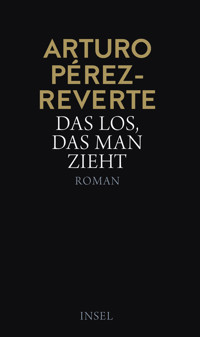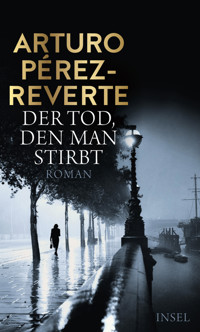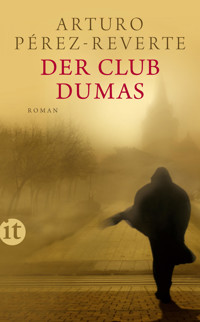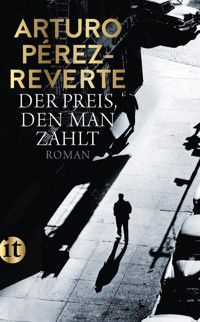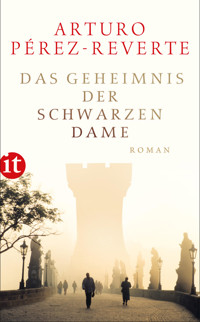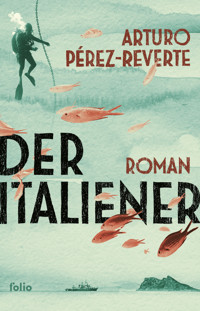
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Liebe und Sabotage in Zeiten des Krieges: Ein brillanter Spionageroman, basierend auf wahren Begebenheiten. Bucht von Gibraltar 1942: Nachts am Strand findet die Buchhändlerin Elena Arbués einen schwer verletzten Taucher und schleppt ihn in ihr Haus. Kurz darauf wird er von Unbekannten abgeholt. Wochen später begegnet sie ihm im Hafen von Algeciras wieder. Zwischen den beiden entflammt eine waghalsige Liebe und sie erfährt, wer er wirklich ist: Teseo, ein Kampfschwimmer der italienischen Marine-Spezialeinheit X MAS, sabotiert britische Schiffe. Als Spanierin hat Elena Zugang zur britischen Exklave und soll nun für die Italiener die Lage auskundschaften. Immer tiefer verstrickt sie sich in ein lebensgefährliches Netz aus Täuschung und Verrat. Erst Jahrzehnte später vertraut Elena dem Autor ihre unglaubliche Geschichte an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LIEBE UND SABOTAGE IN ZEITEN DES KRIEGES.
Bucht von Gibraltar 1942: Nachts am Strand …
… findet die Buchhändlerin Elena Arbués einen schwer verletzten Taucher und schleppt ihn in ihr Haus. Kurz darauf wird er von Unbekannten abgeholt. Wochen später begegnet sie ihm im Hafen von Algeciras wieder. Zwischen den beiden entflammt eine waghalsige Liebe und sie erfährt, wer er wirklich ist: Teseo, ein Kampftaucher der italienischen Marine-Spezial einheit Decima Flottiglia MAS, sabotiert britische Schiffe. Als Spanierin hat Elena Zugang zur britischen Exklave und soll nun für die Italiener die Lage auskundschaften. Immer tiefer verstrickt sie sich in ein lebensgefährliches Netz aus Täuschung und Verrat. Erst Jahrzehnte später vertraut Elena dem Autor ihre unglaubliche Geschichte an.
Ein brillanter Spionageroman, basierend auf wahren Begebenheiten.
»Arturo Pérez-Reverte taucht mit einer Liebesgeschichte in das große Abenteuer der italienischen Kampfschwimmer des Zweiten Weltkriegs ein.« El Pais
www.folioverlag.com
»Es war ein Mann. Während sie sich näherte, sah sie es. Der Hund rannte zwischen ihr und der reglosen Gestalt hin und her, als wollte er sie dazu einladen, den Fund mit ihm zu teilen. Einen in nasses, glänzend schwarzes Gummi gehüllten Mann. Er lag auf dem Bauch, Gesicht und Oberkörper im Sand, die Beine im Wasser, als wäre er bis hierher gekrochen oder als hätte die Flut ihn angespült. Er trug einen Gürtel mit einem Messer, am linken Handgelenk zwei seltsame große Uhren und am rechten eine dritte. Die Zeiger einer von ihnen standen auf 7.43 Uhr.«
DER AUTOR
ARTURO PÉREZ-REVERTE, 1951 im spanischen Cartagena geboren, bezeichnet sich selbst als »Leser, der Bucher schreibt«. Bevor seine Werke in über 40 Sprachen übersetzt wurden, arbeitete er 21 Jahre lang als Kriegsreporter, unter anderem im Libanon, in Eritrea, im Tschad und in Mosambik. Sein Weltbestseller Der Club Dumas wurde von Roman Polanski mit Johnny Depp in der Hauptrolle verfilmt. 2003 wurde er in die Real Academia Española aufgenommen. Wenn er nicht in seiner 32.000-Bücher-Bibliothek schreibt, dann ist er draußen auf dem Meer und segelt.
DER ÜBERSETZER
CARSTEN REGLING, 1970 in Göttingen geboren, studierte Lateinamerikanistik, Soziologie sowie Ethnologie in Berlin. Dort lebt er heute als freier Übersetzer und Lektor. Er übersetzte Romane und Erzählungen von unter anderem Ricardo Piglia, Álvaro Enrigue, Manuel Vázquez Montalbán, Rafael Chirbes und Juan Pablo Villalobos ins Deutsche.
Arturo Pérez-Reverte
Der Italiener
Zu dir komme ich, geflohen vor dem Meerund seinem Gott Poseidon.
Homer, Odyssee
Wer, wenn nicht Soldat oder Verliebter, trotzt der Kälte der Nacht?
Ovid, Amores
Für Carlota, deren Welt unter der Meeresoberfläche weitergeht
Inhalt
1. Ein venezianisches Rätsel
2. Die Männer des letzten Mondviertels
3. Die Buchhandlung in der Line Wall Road
4. Schatten in der Bucht
5. Herausforderungen und Rache
6. Zimmer 246
7. Die Züge des Dr. Zocas
8. Der Fang des Schwertfischs
9. Der Groll alter Götter
10. Eine schlichte Formalität
11. Heißes Eisen, nasse Haut
12. Der Kohlenkai
13. Schlussakt
14. Epilog
Anmerkungen
Während des Zweiten Weltkriegs, zwischen 1942 und 1943, versenkten oder beschädigten italienische Kampftaucher in Gibraltar und in der Bucht von Algeciras insgesamt vierzehn Schiffe der Alliierten. Dieser Roman basiert auf realen Ereignissen. Nur die Personen und einige Situationen sind erfunden.
Der Hund entdeckte sie zuerst. Er lief zum Ufer, schnüffelte, aufgeregt mit dem Schwanz wedelnd, herum und knurrte leise die dunkle Gestalt an, die reglos halb im Sand, halb im perlmuttfarbenen Wasser lag, in dem sich das erste Licht des Tages spiegelte. Die Sonne hatte noch nicht den Felsen überschritten, der einen dunklen Schatten auf die stille, spiegelglatte Bucht warf, in der die Schiffe ankerten mit dem Bug gen Süden. Der Himmel war blassblau, ohne eine einzige Wolke, nur gezeichnet von einer Rauchsäule, die nahe der Hafeneinfahrt aufstieg; dort, wo ein Schiff, das in der Nacht von einem U-Boot oder bei einem Luftangriff getroffen worden war, noch am frühen Morgen brannte.
„Argos …! Argos, bei Fuß!“
Es war ein Mann. Während sie sich näherte, sah sie es. Der Hund rannte zwischen ihr und der reglosen Gestalt hin und her, als wollte er sie dazu einladen, den Fund mit ihm zu teilen. Einen in nasses, glänzend schwarzes Gummi gehüllten Mann. Er lag auf dem Bauch, Gesicht und Oberkörper im Sand, die Beine im Wasser, als wäre er bis hierher gekrochen oder als hätte die Flut ihn angespült. Er trug einen Gürtel mit einem Messer, am linken Handgelenk zwei seltsame große Uhren und am rechten eine dritte. Die Zeiger einer von ihnen standen auf 7.43 Uhr.
Sie kniete sich neben ihn in den feuchten Sand und berührte seinen Kopf – der Mann hatte schwarzes, sehr kurz geschnittenes Haar. Unter seiner Brust ragten eine Gummimaske und ein seltsamer Apparat mit zwei Metallzylindern hervor. Er blutete aus Ohren und Nase und schien tot zu sein. Sie erinnerte sich an die nächtlichen Explosionen, die Scheinwerfer der Luftabwehr, die den Himmel und das brennende Schiff erleuchtet hatten, und einen Moment lang dachte sie, es könne sich um einen Matrosen handeln. Doch sie begriff sofort, dass dieser Mann nicht von einem der in der Bucht vor Anker liegenden Schiffe stammte, sondern aus dem Meer gekommen war. Oder vom Himmel. Es musste sich um einen Piloten oder Taucher handeln. Vielleicht um einen Deutschen oder Italiener, die seit zwei Jahren Gibraltar angriffen – die Grenze zwischen Spanien und der britischen Kolonie lag, folgte man dem Strand in Richtung Osten, nur drei Kilometer entfernt.
Sie wollte gerade aufstehen, um die Guardia Civil zu benachrichtigen – nicht weit entfernt, im Militärgebiet von Campamento, gab es eine Wache –, als sie den Mann plötzlich atmen zu hören glaubte. Sie beugte sich wieder über ihn, und als sie mit den Fingern seinen Mund und seinen Hals berührte, spürte sie ein leichtes Atmen und einen schwachen Pulsschlag. Sie schaute sich hilfesuchend um. Der Strand war menschenleer – auf der einen Seite die sandige Biegung, die bis nach La Línea und weiter bis zur Grenze reichte, auf der anderen die vereinzelten fernen Hütten der Fischer von Puente Mayorga, die um diese Uhrzeit ihrer Arbeit in der Bucht nachgingen. Niemand war zu sehen. Das nächste, ein paar hundert Meter vom Ufer entfernte Haus, war ihr eigenes: klein, einstöckig, von Palmen und Bougainvilleen umgeben.
Sie beschloss, den Mann dorthin zu bringen und ihm zu helfen, bevor sie die Behörden informierte. Und dieser Entschluss veränderte ihr Leben.
1. Ein venezianisches Rätsel
Die Buchhandlung hieß Olterra, was mich hätte warnen sollen. Doch im Winter 1981 wusste ich wie viele andere Menschen nichts von dem Geheimnis, das diesen Namen umgab.
Als ich zufällig durch die Calle Corfù, zwischen der Accademia und der Kirche Santa Maria della Salute, schlenderte, war ich vor dem Schaufenster der Buchhandlung stehen geblieben, da ein Buch meine Aufmerksamkeit weckte. Es war La gondola von Cargasacchi. Zwei Exemplare waren in der Auslage, eines davon geöffnet auf einer Seite mit einer detaillierten Zeichnung dieses Bootstyps. Weil ich mich schon immer für Schiffbau interessiert hatte, betrat ich den Laden. Er war klein, gemütlich, wurde von einem Gasofen beheizt und hatte im hinteren Teil ein Fenster, das auf einen Kanal mit bröckelnden Mauern und Toren ging, an denen das Wasser nagte. Die Buchhandlung wurde von einer älteren Frau mit hübschem Gesicht und weißem, im Nacken zusammengebundenem Haar geführt, die mit einem eleganten Tuch über den Schultern auf einem Stuhl saß und las. Zu ihren Füßen, auf dem Teppich, döste ein Labrador. Sie begrüßte mich, ich fragte nach dem Buch im Schaufenster, und sie brachte mir eines der ausgestellten Exemplare. Nachdem ich ein bisschen darin geblättert hatte, legte ich es zur Seite, um es später zu kaufen, und schaute mir die anderen Bücher an. Es gab viele über Nautik, sodass ich mich längere Zeit dort aufhielt. Irgendwann bemerkte ich die Fotos an der Wand.
Es waren zwei, hinter Glasrahmen. Schwarz-weiß. Das kleinere zeigte ein Paar mittleren Alters, das in die Kamera lächelte. Der Mann, in fortgeschrittenem Alter, aber gut aussehend, hatte seinen Arm um die Taille der Frau gelegt. Nachdem ich das Bild eine Weile betrachtet hatte, fiel mir auf, dass es sich bei der Frau um die Buchhändlerin handelte, vor zehn oder fünfzehn Jahren. Auf dem anderen Foto, das größer, aber von schlechterer Qualität und älter war, waren zwei Männer zu sehen: Der eine trug einen Overall und eine Matrosenmütze, der andere kurze Hosen und Hemd. Sie posierten neben einer Art Torpedo an Deck eines U-Boots. Beide lächelten, und der Mann mit der kurzen Hose hatte große Ähnlichkeit mit dem auf dem anderen Foto, auch wenn er auf diesem hier deutlich jünger aussah. Das attraktive, einnehmende Lächeln war leicht wiederzuerkennen, ebenso wie das kurze schwarze Haar, obwohl es auf dem zweiten Foto schon leicht ergraut und etwas spärlicher war.
Als ich mich von den Fotos abwandte, bemerkte ich, dass die Buchhändlerin mich ansah.
„Interessant“, sagte ich mehr aus Höflichkeit als aus irgendeinem anderen Grund.
„Sind Sie Spanier?“
„Ja.“
Sie sagte nicht, dass sie ebenfalls aus Spanien kam, zumindest in diesem Moment noch nicht. Ich hielt sie für eine waschechte Venezianerin; wir unterhielten uns auf Italienisch und wechselten erst später die Sprache.
„Was finden Sie daran interessant?“, fragte sie.
Ich deutete auf das Foto mit den beiden Männern neben dem Torpedo.
„Das maiale“, sagte ich.
Sie sah mich neugierig an, leicht überrascht.
„Sie wissen, was ein maiale ist?“
„Ich habe gerade eins im Schifffahrtsmuseum gesehen, beim Arsenale.“
Es war nicht nur das. Ich hatte auch das eine oder andere Buch darüber gelesen und Fotos gesehen: Zweiter Weltkrieg, bemannte Torpedos mit Sprengköpfen, Unterwasserangriffe in Alexandria und Gibraltar. Ein stiller, verborgener Krieg.
„Interessieren Sie sich für so was?“
„Ein bisschen.“
Sie betrachtete mich noch immer, nachdenklich, dann erhob sie sich, um etwas in einem der Regale zu suchen. Während sie damit beschäftigt war, stand auch der Hund – es war eine Hündin – auf, drehte eine Runde um mich und legte sich gleichgültig wieder an derselben Stelle hin wie zuvor. Schließlich brachte mir die Buchhändlerin zwei Bücher. Eines hieß All'ultimo quarto di luna (Im letzten Viertel des Mondes). Auch der andere Titel war nicht besonders aufschlussreich: Decima Flottiglia MAS. Die Einbände verrieten mehr. Der eine zeigte mehrere Taucher, die ein Netz zerschnitten. Der andere zwei Männer, die, halb unter Wasser, auf einem der bemannten Torpedos fuhren.
Ich legte die beiden Bücher zu dem über die Gondeln und betrachtete wieder die Fotos an der Wand.
„Ein gut aussehender Mann“, sagte ich.
Sie sah nicht die Fotos, sondern mich an, als versuchte sie einzuschätzen, inwieweit ich eine Verbindung zwischen ihr und dem Mann knüpfte. Dann bewegte sie leicht den Kopf.
„Ja, das war er“, sagte sie auf Spanisch.
Ihre perfekte Aussprache überraschte mich.
„Entschuldigung … Sind wir Landsleute?“
„Das waren wir.“
Die Vergangenheitsform machte mich neugierig.
„Leben Sie schon lange hier?“
„Fünfunddreißig Jahre.“
„Jetzt verstehe ich. Sie wirken wie eine Italienerin.“
„Das ist eine lange Geschichte.“
Ich betrachtete erneut die Fotos. Den Mann, der seinen Arm um ihre Taille gelegt hatte.
„Lebt er noch?“
„Nein.“
„Das tut mir leid.“
Sie schwieg. Mit einer überraschenden Geste, die mir fast wie Koketterie vorkam, hob sie langsam die Hand und fasste sich an den Haarknoten im Nacken. Schließlich wandte sie sich mit einem sanften Lächeln den Fotos zu, und dieses Lächeln schien die Falten in ihrem Gesicht zu glätten und es zu verjüngen.
„Er ist vor fünf Jahren gestorben“, sagte sie.
Ich tippte mit dem Finger auf das Cover eines der Bücher und deutete anschließend auf das Foto mit den zwei Männern und dem maiale.
„Einer von ihnen?“
Es klang nicht nach einer Frage, und es war auch keine. Die Frau nickte.
„Ja.“
Ihr Ton war sanft und entschieden zugleich. Und auch ein wenig Stolz lag darin, bemerkte ich. Sogar etwas Herausforderndes. Da erinnerte ich mich an den Namen der Buchhandlung.
„Was bedeutet Olterra?“
Sie lächelte und betrachtete weiter reglos die Fotos. Nach einer Weile zuckte sie mit den Schultern, als läge die Antwort auf der Hand.
„Es bedeutet so viel wie mutige Männer“, antwortete sie. „Im letzten Viertel des Mondes.“
Fünfzehn Minuten später verließ ich mit den drei Büchern in einer Tüte den Laden und ging langsam zum Canale della Giudecca. Es war einer dieser kalten venezianischen Wintertage mit wolkenlosem Himmel über der Lagune, sodass ich die Fondamenta delle Zattere entlangspazierte und die Sonne genoss. Als ich die Punta della Dogana erreichte, die zu jener Zeit ein noch wenig besuchter Ort war, setzte ich mich auf den Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt, und blätterte in den Büchern. Damals war ich noch kein Schriftsteller und wollte auch keiner werden. Ich war nur ein junger Journalist, ein Reporter, der ständig auf Reisen war und der Geschichten vom Meer und von Seemännern liebte. Und ich hatte Urlaub. Ich ahnte nicht, dass das, was ich damals las, der Beginn vieler anderer Bücher und langer Gespräche war. Der Beginn einer komplizierten Recherche über Personen und dramatische Ereignisse, das Lüften eines Geheimnisses und der Keim eines Romans, der erst vierzig Jahre später geschrieben werden sollte.
Es sind zwei Monate vergangen, doch Elena Arbués erkennt ihn sofort.
Er sitzt an einem Tisch an der Tür der Bar Europa in Algeciras und unterhält sich mit zwei anderen Männern – sonnengebräunt, getönte Brille, die Ärmel des weißen Hemds hochgekrempelt, blaue Hose mit Ledergürtel und Espadrilles. Er unterhält sich lebhaft und lächelt viel. Während ihrer kurzen und einzigen Begegnung hat sie ihn nicht lächeln sehen – ein weißer, sympathischer Strich, der das südländische, unverkennbar mediterrane Gesicht erhellt, ein Gesicht, von dem sie weiß, dass es italienisch ist, das aber ebenso gut spanisch, griechisch oder türkisch sein könnte. Ein typischer Mensch des Südens, geboren an irgendeiner Küste oder auf einer baum- und wasserlosen Insel: Olivenöl, Rotwein, rötliche Abenddämmerungen, warme Gewässer und weise, erschöpfte Götter. Sein Anblick ruft ihr all das in Erinnerung. Außerdem ist er attraktiv. Mehr als an jenem Tag, als er blutverschmiert und blass vor ihr lag. Er trägt das Haar genauso kurz wie beim ersten Mal, als sie ihn vom Strand zu sich nach Hause schleppte und auf dem Boden des kleinen Wohnzimmers mit Blick auf die Bucht ablegte, bewusstlos, voller Sand, mit Argos, der ihm Gesicht und Hände ableckte, die faltig und weiß waren aufgrund der langen Zeit im Wasser.
Sogar seinen Namen kennt sie, falls der Name in dem kleinen Seefahrtbuch echt ist, das sie in einer Hülle aus Wachstuch fand, als sie mit einer Schneiderschere den oberen Teil des Gummianzugs aufschnitt: Lombardo, Teseo. 2° Capo, Regia Marina N. 355.876. Unter dem Gummianzug trug er einen dünnen Overall aus blaugrauer Wolle mit einem Stern auf jeder Seite des Revers und drei Litzen in Form eines Winkels an den Ärmeln. Italienische Kriegsmarine, kein Zweifel. Da sie ihn am Strand fand, kam er bestimmt von einem U-Boot, das die im Hafen von Gibraltar und im Norden der Bucht ankernden Schiffe angegriffen hatte. Ein Froschmann. Ein Kampftaucher.
An jenem Morgen hatte sie nicht recht gewusst, was sie tun sollte. Nachdem sie ihm den Gummianzug abgestreift und den Overall geöffnet hatte, um zu sehen, ob er weitere Verletzungen hatte, rieb sie ihm Brust und Arme mit Alkohol ein, um ihn aufzuwärmen, und anschließend wischte sie das Blut aus seinen Ohren und seiner Nase. Es schien weniger von Verletzungen an den Sinnesorganen als einem Schlag auf den Kopf zu stammen, obwohl sie kein Hämatom erkennen konnte. Sie erinnerte sich an die nächtlichen Detonationen und das brennende Schiff und kam zu dem Schluss, dass es sich um innere Verletzungen handeln musste. Vielleicht durch eine vom Wasser übertragene Druckwelle. Vielleicht von einer seiner eigenen Bomben.
Jedenfalls erlangte der Mann das Bewusstsein wieder. Elena hatte gerade das Alkoholfläschchen zugeschraubt, als sie sich umdrehte und sah, dass er die Lider geöffnet hatte und sie mit trüben, blutunterlaufenen Augen ansah. Als sie sagte, sie gehe einen Arzt holen, starrte er sie weiter an, als hätte er ihre Worte oder deren Sinn nicht verstanden, und nach einer Weile bewegte er langsam den Kopf von einer Seite zur anderen. Sie musste sich zu seinen Lippen hinunterbeugen, um zu verstehen, was er sagte: ein paar Worte und eine Nummer, ausgehaucht mit einem schwachen Stöhnen. Telefon, bitte. Das sagte er. Bitte. Auf Spanisch, mit einem leichten Akzent. Telefon, wiederholte er, und eine Nummer, 3568. Dann verlor er wieder das Bewusstsein.
Jetzt, an der Ecke Callejón del Ritz und Plaza Alta, versteckt zwischen den vielen Menschen in der belebten Innenstadt, beobachtet sie ihn von Weitem, achtet auf jedes neue Detail. Sie erinnert sich an den fünfzehnminütigen Fußweg zur Telefonzentrale von Campamento, in der sich noch keine Soldaten befanden. An die glänzende Münze in ihrer Hand, das Geräusch, als sie das Geld in den Schlitz steckte; den Schatten von zwei Jahren Einsamkeit und Groll, die Zweifel, als ihr Zeigefinger einen Zentimeter von der Wählscheibe entfernt war, während sie durch die Glasscheibe das Schild mit der Aufschrift AllesfürdasVaterland über der Tür der Wache der Guardia Civil betrachtete. Eine noch frische, schmerzhafte Vergangenheit, die auf der ungewissen Gegenwart lastete. Der endgültige Entschluss: drei, fünf, sechs, acht. Eine Stimme am anderen Ende, männlich, spanisch, ohne jeden Akzent. Teseo Lombardo, sagte sie. Schweigen. Wer spricht da?, fragte die Stimme. Das spielt keine Rolle, antwortete sie. Dann nannte sie die Adresse, hängte ein und ging zurück nach Hause.
Sie steht weiter reglos an der Ecke, ohne den Blick von dem Mann zu wenden, der nichts von ihrer Gegenwart ahnt. Sie tut so, als betrachte sie das Schaufenster eines Schuhgeschäfts, dessen Glas ihr Spiegelbild zurückwirft, während sich im dunklen Hintergrund das helle Licht der Straße abzeichnet: das leichte, an der Taille eng anliegende Sommerkleid, die beiden Hände, die die Handtasche an den Schoß drücken, das kurze, modisch geschnittene, leicht wellige kastanienbraune Haar. Eine gut aussehende, noch junge Frau, schlank, fast ein wenig zu dünn, und mit ihren ein Meter sechsundsiebzig ohne hochhackige Schuhe vielleicht etwas zu groß für eine durchschnittliche Spanierin: Elena María Arbués Ortiz, siebenundzwanzig Jahre alt, seit zwei Jahren verwitwet. Inhaberin der Buchhandlung Circe in der Calle Real in La Línea de la Concepción.
Die drei Männer sind vom Tisch aufgestanden und gehen zwischen den Menschen auf dem Platz in Richtung Calle Cánovas del Castillo. Alle drei haben die Ärmel hochgekrempelt und sehen gesund und kräftig aus, was ihnen eine gewisse Ähnlichkeit verleiht. Entspannt miteinander plaudernd spazieren sie in Richtung Hafen. Elena ist kurz davor, sie zu vergessen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern – sie ist mit dem Bus in die Stadt gefahren, um ein paar Behördengänge zu erledigen –, doch im letzten Moment gibt sie einem inneren Impuls nach. Der Neugier, die sie seit jenem Morgen am Strand von Puente Mayorga verspürt. Dem Wunsch, mehr über diesen Unbekannten zu erfahren, der vor zwei Monaten für anderthalb Stunden in ihr Leben trat, von dem sie seitdem nichts mehr gehört hat und den sie nicht vergessen kann.
Als sie nach dem Anruf nach Hause zurückkehrte, war der Mann wach. Argos lag in seiner Nähe und beobachtete ihn aufmerksam. Als er sie hereinkommen sah, rannte der Hund ihr glücklich entgegen. Der Mann lag noch immer auf dem sandigen Teppich, gehüllt in zwei Decken und mit dem Kopf auf dem Kissen, das Elena ihm unter den Nacken geschoben hatte. Neben ihm lagen die Reste des Taucheranzugs und die seltsamen Uhren mit den fluoreszierenden Zifferblättern, die sie ihm abgenommen hatte, als sie ihn mit Alkohol einrieb. Doch das Messer, das sich bei den anderen Objekten befand, als sie telefonieren gegangen war, lag jetzt wieder neben ihm, in Reichweite seiner rechten Hand. Über dem schwarzen Holzgriff glänzte die nackte Klinge im Licht, das durch das geöffnete, nach Süden zur Bucht gehende Fenster fiel und das Profil des unerwarteten und seltsamen Gastes beleuchtete.
„Ich habe Bescheid gesagt“, bemerkte Elena, während sie den Hund streichelte.
Der nervöse Blick des Mannes schien sich zu entspannen. Er beobachtete sie genau, studierte jeden Gesichtsausdruck und jede Bewegung. Allmählich ließ sein Misstrauen nach.
„Keine Ahnung, wem“, fügte sie hinzu. „Aber ich habe es getan.“
Ohne sie aus den Augen zu lassen, nickte der Mann langsam.
„Danke“, sagte er schließlich mit heiserer, noch schwacher Stimme.
Unschlüssig stand sie vor ihm. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Es war eine absurde, seltsame Situation.
„Wer auch immer das ist“, erwiderte sie, „sie werden vermutlich schnell hier sein.“
Sie sah, wie er erneut nickte und auf eine Weise blinzelte, als müsse er sich zusammenreißen, um nicht vor Schmerz zu stöhnen. Es muss ihm sehr schlecht gehen, dachte sie. Er wirkte erschöpft, leidend und schwach, obwohl er ein kräftiger Mann mit einem athletischen Oberkörper war. Als sie ihm die Brust eingerieben hatte, hatte sie seine Muskeln, die eines Schwimmers, bemerkt. Seine Augen waren noch gerötet, doch er blutete nicht mehr aus Nase und Ohren. Sie dachte wieder an den brennenden Tanker und daran, was sie über Druckwellen gehört hatte. Erst vor ein paar Tagen hatte Samuel Zocas, Dr. Zocas, das Thema beim Stammtisch im Café Anglo-Hispano erwähnt, als sie über den Krieg, Bomben und Schiffe gesprochen hatten. Eine Explosion unter Wasser konnte bewirken, dass die inneren Organe eines Menschen platzten, auch wenn sie sich in einer gewissen Entfernung ereignete.
„Haben Sie sonst noch jemand Bescheid gesagt?“
Der Mann – ein Italiener, das stand jetzt zweifellos fest – sprach ein gutes Spanisch, wenn auch mit leichtem Akzent. Er klang misstrauisch, als machte ihm der Gedanke große Sorgen. Sie beruhigte ihn mit einem Kopfschütteln, verschränkte die Arme und blickte vorwurfsvoll auf das Messer.
„Noch nicht.“
Sie betonte das noch, und er blinzelte wieder, diesmal verlegen, wegen seiner Frage und der Antwort. Dann sah er den Hund an, streckte ungeschickt eine Hand aus und schob das Messer näher an sich heran, um es unter den Decken zu verstecken, als schämte er sich dafür, dass man es sehen konnte.
„Entschuldigung“, murmelte er.
Es klang aufrichtig. Trotz des Messers wirkte er hilflos. Elena deutete auf eine Flasche Malagawein, die auf dem Sims des erloschenen Kamins stand.
„Vielleicht tut Ihnen ein bisschen davon gut.“
Er nickte, und sie brachte ihm ein zu einem Drittel gefülltes Glas. Sie kniete sich neben ihn und hielt ihm das Glas an die Lippen. Er nahm drei kleine Schlucke. Beim dritten musste er husten. Elena betrachtete die Litzen auf den Ärmeln seines Overalls.
„Secondo capo, Regia Marina?“, fragte sie und deutete auf die Tasche, in die sie das Seefahrtbuch zurückgesteckt hatte.
„Sottufficiale.“
„Sie heißen Teseo? Teseo Lombardo?“
Sie sah ihn einen Moment zögern, erschrocken, seinen eigenen Namen zu hören. Dann schien er sich erleichtert zu erinnern und zu begreifen.
„Ja“, sagte er.
„Was haben Sie gemacht? … Woher kommen Sie?“
Er antwortete nicht. Die ganze Zeit wandte er die Augen nicht von ihren ab.
„Warum helfen Sie mir?“, fragte er seinerseits.
Elena zuckte mit den Schultern. Die Frage war nicht leicht zu beantworten.
„Sie sind verletzt“, sagte sie schließlich. „Sie brauchen Hilfe.“
Er starrte sie weiter fragend an, schien eine ausführlichere Antwort zu erwarten. Sie schüttelte den Kopf, stand auf und stellte das Glas auf der Anrichte ab.
„Ich weiß es nicht“, gestand sie, auch wenn es nicht ganz stimmte.
In diesem Moment hob Argos den Kopf und stieß ein leises Knurren aus. Kurz darauf erklang das Motorgeräusch eines Wagens, der vor dem Haus hielt. Es klopfte an der Tür, und der Italiener verschwand aus ihrem Leben.
Das war alles gewesen, vor vierundsechzig Tagen. Daran denkt Elena jetzt, erinnert sich daran, während sie aufgeregt, von Neugier getrieben – ihr Herz schlägt so schnell, dass sie ein paarmal stehen bleiben muss, um sich zu beruhigen – hinter den Männern hergeht und sich bemüht, nicht ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Vorsichtig hält sie Abstand; zu dieser Stunde wimmelt es in der Innenstadt von Menschen, sodass es nicht schwer ist, unbemerkt zu bleiben. Sie sieht, wie die Männer einen Tabakladen und eine Apotheke betreten, und danach ein Kolonialwarengeschäft, das sie eine Weile später mit in Packpapier gewickelten Paketen unter den Armen wieder verlassen. Wenn sie Lebensmittelkarten haben, denkt sie, werden sie sie aufgebraucht haben. Obwohl Ausländer vielleicht keine Bezugsscheine brauchen.
Sie folgt ihnen weiter. Sie kann nichts Geheimnisvolles oder Rätselhaftes an ihrem Verhalten erkennen – sie unterhalten sich angeregt, entspannt, und scheinen gut gelaunt zu sein. Zweimal sieht Elena den Mann lachen, den sie in Puente Mayorga gerettet hat. Auf diese Weise legen sie den restlichen Weg zum Hafen zurück, wo zwischen Schuppen und Kränen Schiffe mit verschiedenen Flaggen vertäut liegen. Bevor sie den Eingang erreichen, bleiben sie am kleinen Hafenbecken des Río de la Miel stehen und steigen an Bord eines Motorboots, während sie ihnen vom Kai aus mit dem Blick folgt. Sie beobachtet, wie sie zur äußeren Mole fahren, zu einem großen Schiff mit schwarzem Rumpf und hohem Schornstein, das wie ein Tanker aussieht und am Ende der Mole, etwas abseits von den anderen Schiffen, vertäut ist. Sieben Kilometer weiter, in gerader Linie auf der anderen Seite der Bucht, erhebt sich der graue, im Dunst unter der im Zenit stehenden Sonne leicht verschwommene Felsen von Gibraltar.
Von ihrem Standort aus kann Elena eine italienische, im Westwind flatternde Flagge erkennen. Sie kennt den Namen des Schiffes, denn als sie mit der Fähre, die zwischen La Línea und Gibraltar verkehrt, an dem Schiff vorbeigefahren ist, hat sie ihn gesehen, in weißen Buchstaben am Bug aufgemalt. Und davor lag das Schiff eine Zeit lang vor Puente Mayorga, von seiner Besatzung auf Strand gesetzt, damit es nicht in die Hände der Briten geriet. Es trägt den Namen Olterra.
Gegenüber dem Círculo Mercantil von La Línea gelegen, hat das Café Anglo-Hispano den Stil des neunzehnten Jahrhunderts bewahrt: Tische aus Holz und Marmor, Spiegel, Gaslampen, die niemand anzündet, und ein Stierkampfplakat mit den Namen von Marcial Lalanda, Domingo Ortega und Morenito de Talavera. Der Holzboden knarrt, und die Gardinen sind verstaubt, doch die großen lichtdurchfluteten Fenster zeigen das lebhafte Treiben auf der Calle Real. Ein paarmal die Woche kommt Elena Arbués hierher, um so etwas Ähnliches wie Kaffee zu trinken und sich mit ihren Freunden zu treffen: Dr. Zocas und Pepe Aljaraque, der Stadtarchivar. Manchmal gesellt sich Nazaret Castejón zu ihnen, die Gemeindebibliothekarin. Sie treffen sich seit anderthalb Jahren, seit der Zeit, als Elena ihre Buchhandlung eröffnete.
„Da bin ich anderer Meinung, Doktor.“
„Es würde mich wundern, wenn du das nicht wärst, verehrter Freund.“
Pepe Aljaraque klopft mit dem Zeigefinger auf die Seiten des aufgeschlagenen Gibraltar Chronicle und lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Er ist blond, fast ein Albino. Der schlaff herabhängende Schnurrbart betont sein skandinavisches Aussehen, das im Gegensatz zu seinem andalusischen Akzent steht.
„Die Todesstrafe hat nicht nur einen strafenden, sondern auch einen abschreckenden Aspekt“, erklärt er entschieden. „Erst recht in diesen Zeiten. Das sagt dir ein spanischer Patriot, der die Engländer verachtet.“
„Und Beamter“, erwidert Samuel Zocas lachend. „Ein Patriot und städtischer Beamter.“
„Na ja … Das sind Synonyme.“
Der Doktor schüttelt den Kopf, während er den Kaffeeersatz in seiner Tasse umrührt. Er ist gerade von der privaten Sprechstunde gekommen, die er drei Tage die Woche bei sich zu Hause abhält, im Wechsel mit seinen Diensten im Colonial Hospital in Gibraltar.
„In den letzten Jahren ist die Todesstrafe viel zu oft verhängt worden.“ Aus den Augenwinkeln betrachtet er den Kellner, der mit seiner Arbeit beschäftigt ist, und senkt ein wenig die Stimme. „Es gibt andere, weniger barbarische Methoden.“
Aljaraque hebt die Hände und macht eine hilflose Geste.
„Es sind harte Zeiten, wie wir alle wissen. Und solche Zeiten bedürfen solcher Methoden. Der Mensch lernt nicht aus seinen Erfahrungen.“
Der Arzt wirkt nicht überzeugt.
„Egal ob Krieg oder nicht, einen spanischen Hafenarbeiter und Familienvater hinzurichten, nur weil man ihn der Sabotage verdächtigt, geht zu weit.“
„Ich verteidige keinesfalls das perfide Albion, ja? Damit das feststeht. Aber dieser Mann, ein deutscher Agent, wollte eine Bombe im Arsenal zünden.“
Zocas macht eine zweifelnde Miene. Er ist klein, kahl, kurzsichtig. Der einzige Makel an seinem gepflegten Äußeren sind zwei vom Nikotin gelb verfärbte Finger an der linken Hand. Er sieht stets frisch rasiert aus und duftet nach Rasierwasser, als käme er direkt vom Herrenfriseur. Er trägt eine Nickelbrille und zwischen den makellosen Kragenspitzen seines Hemds wie immer eine gewagte Fliege.
„So heißt es“, bemerkt er skeptisch. „Wer weiß, ob das stimmt.“
„Jedenfalls halten sie es für erwiesen. Übrigens bestreite ich nicht den patriotischen Aspekt der Tat, die ich als Sympathisantdes Reichs sogar begrüßen könnte … Aber wer so etwas macht und dabei erwischt wird, muss dafür bezahlen. Das ist ganz normal. Da verstehen die Söhne des perfiden Albion keinen Spaß.“
„Selbst dann, Absichten sind keine Taten.“
Aljaraque wendet sich Elena zu, die zerstreut in einer Ausgabe des Blanco y Negro blättert.
„Was sagst du dazu? Du bist heute sehr still.“
„Ich hör euch zu“, antwortet sie. „Ich habe mir Gedanken über Sabotage gemacht.“
„Und hältst du die Todesstrafe auch für angemessen, wenn sie einen dabei erwischen?“
„Ich finde, ein Saboteur ist nicht das Gleiche wie ein Soldat.“
„Was meinst du damit?“
Sie zögert, denkt an die morgendliche Begegnung in Algeciras. An die drei Männer, denen sie bis zum Hafen folgte.
„Ich spreche von Deutschen und Italienern“, antwortet sie schließlich. „Englands wahren Feinden.“
„Ah, natürlich. Das ist etwas anderes. Das sind Soldaten, die in einem offiziellen Krieg für ihr Vaterland kämpfen. Denen ist nichts vorzuwerfen.“
„Aber Spione werden gehängt, oder?“
„Genau dazu dient die Uniform“, mischt Zocas sich ein, der eine Dose Panter-Zigarillos aus der Hosentasche gezogen hat. „Wer Uniform trägt, ist Soldat und durch die Genfer Konvention geschützt. Wer keine trägt, sich hinter einem feindlichen Abzeichen versteckt oder aus einem anderen, nicht Krieg führenden Land stammt, ist schuldig und endet am Galgen oder vor einem Exekutionskommando.“
„Es ist etwas anderes, deinem Land zu dienen, als das Vaterland zu verraten oder dich bei deinen Taten hinter einer Verkleidung zu verstecken“, bemerkt Aljaraque. „Kein zivilisiertes Land richtet einen Kriegsgefangenen hin.“
Der Arzt stößt eine Rauchwolke aus, während er Aljaraque mit einem leisen Vorwurf in den Augen ansieht.
„Gut, Pepe, in Spanien …“ Wieder betrachtet er verstohlen den Kellner, der dem Gespräch weiterhin keine Aufmerksamkeit schenkt, und senkt die Stimme noch mehr. „Hier wurden einige hingerichtet, stimmt's? Du verstehst, was ich meine.“
Der Archivar trinkt den Rest seines Kaffees aus und nimmt einen Schluck Wasser.
„Bürgerkriege sind etwas anderes. Sie sind absolut unmenschlich, die völlige Verrohung. Ohne jede Regel.“
„Mir brauchst du das nicht zu sagen, ich musste schließlich abhauen.“
Elena kennt Samuel Zocas' Geschichte. Nachdem er wegen seiner liberalen Ansichten nach Gibraltar fliehen musste – es heißt, er habe einer Freimaurerloge angehört, auch wenn er nie darüber gesprochen hat –, konnte er erst nach Spanien zurückkehren, ohne von den neuen Behörden belästigt zu werden, als einflussreiche, dem Franco-Regime wohlgesonnene Personen auf beiden Seiten der Grenze für ihn bürgten.
„Ihr werdet sehen, das mit diesem Pechvogel ist nicht der letzte Fall“, sagt Aljaraque. „Hier wimmelt es nur so von Spionen, Saboteuren, Agenten der einen wie der anderen Seite … Wir befinden uns im Auge des Orkans.“
„Und unsere Behörden schauen weg“, bemerkt Zocas traurig.
„Vorsicht, nicht immer. Spanien vollführt einen komplizierten Drahtseilakt. Es ist nicht mehr wie damals, als Deutschland jeden Krieg zu gewinnen schien. Jetzt ist alles verworren, und Franco, dieses Phänomen, muss Fingerspitzengefühl zeigen und die Form wahren. Es ist nicht das erste Mal, dass die Guardia Civil faschistische oder Nazi-Agenten verhaftet und sie ausweist.“
„Einmal habe ich einen Taucher gesehen“, sagt Zocas. „Vor ein paar Monaten, ich habe euch davon erzählt.“
„Der vom letzten Angriff auf Gibraltar?“
„Genau der … Ich war in der Klinik, als sie die Leiche gebracht haben.“
„Ein Italiener, stimmt's? Die Zeitungen haben darüber berichtet.“
„Offenbar hat ihn ein U-Boot in der Bucht abgesetzt. Wahrscheinlich waren es mehr als einer, aber sie haben nur den einen gefunden … Sie haben diesen Tanker versenkt, wie hieß er noch mal, Sligo oder so ähnlich. Weißt du noch, Elena? Es war nicht weit von deinem Haus entfernt.“
Die junge Frau, die weiterhin in der Zeitschrift geblättert hat, hält inne.
„Wie könnte ich das vergessen“, sagt sie so natürlich wie möglich. „Es liegen immer noch ein paar Teile herum. Von dem Schiff und von anderen.“
„Hätten sie ihn lebend erwischt, wäre er wegen Sabotage erschossen worden“, meint Aljaraque. „Da kennen die Engländer kein Pardon.“
„Das bezweifle ich“, widerspricht Zocas. „Schließlich war er ein Soldat … Sie sind hart, aber sie halten sich an Regeln.“
Plötzlich ernst geworden, wirft der Archivar Elena einen kurzen Blick zu.
„Ja, an die eigenen, und das auch nur, wenn es ihnen in den Kram passt“, sagt er.
Auch Zocas scheint es bemerkt zu haben und sieht die Frau schuldbewusst an.
„Entschuldigung, Elena. Ich wollte nicht …“
„Natürlich“, sagt sie lächelnd, froh über die Wendung, die das Gespräch genommen hat.
„Ich bin ein Trottel.“
„Mach dir keine Gedanken.“
Einen Augenblick lang schweigen alle beklommen. Aljaraque starrt auf den Gibraltar Chronicle, und der Arzt fasst sich nervös an den Knoten seiner Fliege. Vor etwas mehr als zwei Jahren haben die Engländer Elena zur Witwe gemacht, als sie in Mersel-Kébir die französische Mittelmeerflotte angriffen – Frankreich hatte sich gerade dem nationalsozialistischen Deutschland ergeben –, um zu verhindern, dass die Stadt in die Hände des Feindes geriet. Durch ein paar verirrte Kanonenschüsse kamen dabei auch acht spanische Seemänner ums Leben.
Um die Situation zu retten, ergreift Zocas wieder das Wort.
„Was diesen toten Italiener betrifft, kann man den Engländern nichts vorwerfen, oder? Es sind Soldaten, die einen wie die anderen, sie töten und sie sterben. Alle tun nur ihre Pflicht.“
„Mir sind die Achsenmächte lieber“, beharrt Aljaraque. „Ihr wisst ja, dass ich germano- und italophil bin.“
„So wie du das sagst, klingt es nach einer Geschlechtskrankheit, Pepe. Du solltest in den nächsten Tagen mal in meiner Sprechstunde vorbeischauen“, nimmt Zocas ihn auf den Arm.
Verärgert sieht der Archivar Elena aus den Augenwinkeln an.
„Das ist nicht lustig, Mann.“
Während sie so tut, als höre sie den beiden Männern zu, erinnert sie sich an ihre eigene Geschichte, oder besser gesagt, an die ihres verstorbenen Ehemannes. Er war an jenem 3. Juli 1940 Erster Offizier an Bord des spanischen Handelsschiffes Montearagón, eines neutralen Schiffes, das sich an einem Ort befand, an dem es nicht hätte sein sollen. Es folgte eine diplomatische Entschuldigung der Briten (a very serious and terrible mistake) und eine Entschädigung für die Familien. Kollateralschäden eines Krieges, der schon bald die ganze Welt heimsuchen sollte. Achthundert Pfund Sterling, die Elena ermöglichten, die Buchhandlung zu eröffnen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Trotz allem hatte sie noch Glück. In letzter Zeit sind mistakes, die der Briten oder die anderer, nichts Besonderes mehr. Niemand wird entschädigt.
„Das erfordert Mut, stimmt's?“, sagt sie plötzlich. „Mitten in der Nacht in diesen Gewässern unterwegs zu sein und sein Leben zu riskieren.“
„Für so was sind die Italiener nicht gerade berühmt“, bemerkt Aljaraque.
Zocas bläst einen Rauchring in die Luft und hebt den Zeigefinger.
„Es gibt überall mutige Menschen. Es ist nur eine Frage der Motivation.“
„Dann muss dieser Taucher, der ums Leben gekommen ist, sehr motiviert gewesen sein.“
„Kein Wunder … Eine Bucht wie diese, mit Dutzenden von Handelsschiffen und den Booten der Royal Navy im Hafen, ist ein Leckerbissen für mutige Männer.“
„Stimmt schon“, wendet Aljaraque ein, „aber die Engländer haben Netzsperren errichtet und die Überwachung mit Schiffspatrouillen, Scheinwerfern und allem Möglichen verstärkt … Es gibt Luftangriffe, aber vom Meer aus anzugreifen, wagt keiner mehr.“
Elena nickt nachdenklich.
„Ja“, sagt sie ruhig. „Das wagt keiner mehr.“
Curro, der Angestellte der Buchhandlung, klopft mit den Fingerknöcheln an die Fensterscheibe, um Elena die Schlüssel zu geben. Sie schaut auf die Uhr und stellt fest, dass es halb acht ist. Nachdem sie sich von ihren Freunden verabschiedet hat – heute ist Pepe Aljaraque mit Bezahlen dran –, geht sie hinaus. Curro ist ein hagerer junger Mann mit Brille aus La Línea, mit Abitur, der im Bürgerkrieg in der Schlacht von Peñarroya drei Finger an einer Hand verloren hat. Er ist dreiundzwanzig Jahre alt und absolut vertrauenswürdig. Zweimal die Woche erlaubt Elena ihm, eine halbe Stunde früher zu gehen, damit er die Abendschule besuchen und dort Englisch lernen kann.
„Ich habe den Karton mit den Neuerscheinungen von Espasa-Calpe geöffnet, Doña Elena … Und es sind drei Bücher von Fernández Flórez, fünf von Stefan Zweig und der neueste Band von Las aventuras de Guillermo gekommen.“
„Sehr gut.“
„Und ich habe das letzte Exemplar vom Zauberberg verkauft. Wir müssen welche nachbestellen.“
„Klar … Ich kümmere mich morgen drum.“
„Es gibt wieder Strom, deshalb brennt das Licht im Schaufenster.“
„Ist gut, ich mache es später aus. Bis morgen.“
„Bis morgen.“
Die Buchhandlung befindet sich ganz in der Nähe, neben dem Textilwarengeschäft La Escocesa. Mit einem Nicken grüßt Elena ein paar Passanten, die sie kennt, und Ladenbesitzer, die bereits die Rollläden herunterlassen. Vor der Apotheke plaudern zwei Nachbarinnen mit dem Apothekengehilfen und der Inhaber des Kolonialwarengeschäfts räumt die ausgestellten Waren in den Laden. Auf der Straße spielen Kinder und Frauen sitzen auf Holzstühlen und unterhalten sich, bis ihre Männer mit leerer Brotbüchse unter dem Arm und ein paar Peseten in der Tasche aus Gibraltar zurückkehren. Die wenigen Laternen sind ausgeschaltet, und vielleicht werden sie heute nicht angezündet. Der Tag zieht unaufgeregt dahin. Über den Dachterrassen verfärbt der Himmel sich dunkelviolett, und die Abendsonne lässt die Schatten länger werden.
„Guten Abend, Luis … Auf Wiedersehen, Doña Esperanza.“
„Guten Abend, Elenita, meine Liebe. Ich wünsch dir einen schönen Feierabend.“
Bevor sie ihren Laden betritt, betrachtet sie zufrieden das von zwei 20-Watt-Glühbirnen erleuchtete Schaufenster. Bescheiden wie das Geschäft selbst, sind dort etwa zwanzig Titel ausgestellt, die sie sorgfältig auswählt, wobei sie gut verkäufliche Bücher mit weniger nachgefragten kombiniert, sodass sich Baroja, Remarque oder Vicki Baum die Auslage mit Homer und Montaigne teilen. Der obere Teil des Schaufensters ist der Colección Austral gewidmet: Don Juan von Marañón, Cäsars Commentarii und Carlos de Europa von Wyndham Lewis; und darunter, gut sichtbar, Abenteuer- und Kriminalromane mit den bunt illustrierten Covern der Biblioteca Oro – Salgari, ZaneGrey, Phillips Oppenheim, Edgar Wallace – und, deutlich sichtbar, das neueste Buch von José María Pemán, El paraíso y la serpiente, sowie eine Neuausgabe von Agatha ChristiesDer blaue Express, die sich sehr gut verkauft. In der Buchhandlung selbst gibt es eine kleine Abteilung mit Büchern auf Englisch, die von Angestellten aus Gibraltar, hauptsächlich Soldaten, bei ihren Besuchen auf dieser Seite der Grenze frequentiert wird.
Im Laden nimmt Elena das Geld aus der Registrierkasse – siebenundfünfzig Peseten, kein schlechter Tag – und steckt es in die Tasche. Sie schaut sich um, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, der Boden gefegt, der Tisch mit den Neuerscheinungen aufgeräumt und die Bücher in ihren Regalen, und dabei bleibt ihr Blick an der Lithografie haften, die über dem kleinen Schreibtisch im hinteren Teil des Ladens hängt, neben der Tür zum Lager und von der Straße aus nicht sichtbar: ein halb nackter, schiffbrüchiger Odysseus, der aus dem Meer steigt, während Nausikaa und ihre Zofen ihn entsetzt betrachten. Unter dem Einfluss dieses Bildes, das sie täglich sieht, das ihr aber heute aus irgendeinem Grund besonders auffällt, löscht die Buchhändlerin das Licht, sperrt die Tür zu, schließt das Schloss des an die Tür gelehnten Fahrrads auf – ein Damenrad der Marke Rudge –, drückt den Dynamo gegen den Reifen, um das kleine Licht anzuschalten, und fährt zur Bucht hinunter.
Während sie die drei Kilometer zu ihrem Haus zurücklegt, gehen ihr zu ihrer eigenen Überraschung, die sich in einer ungewöhnlichen Unruhe ausdrückt, Nausikaa und Odysseus nicht aus dem Kopf. Auch die Nähe des Meeres trägt dazu bei – ab der Mole von San Felipe verläuft die Straße entlang der weiten Bucht, an dessen Ende sich deutlich die fernen Lichter von Algeciras abzeichnen. Im Kontrast dazu hebt sich auf der anderen Seite im letzten Abendlicht hinter den dunklen Umrissen der vor Anker liegenden Schiffe die gewaltige schwarze Masse des Felsens von Gibraltar ab – düster wie eine unbewohnte, tote Klippe. Obwohl die Kolonie mit Flugabwehrbatterien gespickt ist, trotz der zwanzigtausend britischen Soldaten, des Arsenals und des Hafens voller Kriegsschiffe erwartet sie wie jede Nacht argwöhnisch einen feindlichen Luftangriff. Auch die Bewohner von La Línea sehen dem Einbruch der Nacht in Gibraltar, trotz der bei vorhandenem Strom leichtsinnig angeschalteten Beleuchtung, mit Unruhe entgegen – während die Nachbarn die Nachrichten von Radio Nacional oder Musik auf Radio Tanger hören, horchen sie aufmerksam auf jedes Motorengeräusch am Himmel. Es wäre nicht das erste Mal, dass italienische Bomben auf dieser Seite der Grenze einschlagen und für Tote und Verletzte sorgen.
Plötzlich hält Elena an und betrachtet die dunkle Bucht. Es weht eine leichte Brise, die einen Geruch nach Algen, Salz und ausgelaufenem Öl herüberträgt. Das Meer ist ruhig, und nur das leise Rauschen der sanft rollenden Wellen ist zu vernehmen, dort, wo ein schwacher Lichtreflex den Verlauf des Ufers verrät. Noch mondlose Dunkelheit, ferne Lichter auf der spanischen Seite, eine friedliche Stimmung unter einem bereits schwarzen Himmel, an dem sich allmählich die Sterne behaupten.
Der Italiener.
Das ist es, was ihr wirklich durch den Kopf geht.
Teseo Lombardo, erinnert sie sich. Und aus irgendeinem seltsamen Grund überläuft sie ein Schauer, so stark, dass sie die Hände vom Lenker nimmt und die Arme verschränkt, als wäre ihr plötzlich kalt geworden.
Lombardo, Teseo, 2° Capo, Regia Marina.
Sie war ihm am Morgen in Algeciras begegnet, als sie bereits glaubte, ihn niemals wiederzusehen. Doch an wen sie sich lebhaft erinnert, ist der andere. Oder derselbe, als er ein anderer zu sein schien: der Unbekannte, der vor zwei Monaten auf ihrem sandigen Teppich lag, sie nervös anstarrte, das Messer in Reichweite. Der seltsame Odysseus aus dem Meer, in seinem schwarzen Gummianzug, aus Nase und Ohren blutend. Sein straffer, muskulöser Körper, das nasse Haar, das klassische, männliche Profil, zu dem ein antiker griechischer Bronzehelm gut passen würde. Auch an die grünlichen, ausdrucksvollen Augen, die sie erst argwöhnisch, dann dankbar ansahen, erinnert sie sich, und an den letzten Blick, den er ihr zuwarf, als zwei Männer, die sie nie zuvor gesehen hatte, in einem Auto angefahren kamen, ihm auf die Beine halfen und eine Decke über die Schultern legten. Und während einer von ihnen, mager, groß, ohne ausländischen Akzent, zu Elena sagte: Wir sind Ihnen etwas schuldig und vertrauen auf Ihre Besonnenheit und Ihr Schweigen, mit einer Geste, die zugleich freundlich und unmissverständlich war, sah sie der Mann aus dem Meer zum letzten Mal – intensiv und eindringlich – an. Seine Lippen, die wieder ein wenig Farbe angenommen hatten, entspannten sich zu einem dankbaren, strahlend weißen Lächeln und formten das Wort grazie.
Der Hund spürt zuerst etwas. Er stellt die Ohren auf, hebt den Kopf, der zwischen seinen Pfoten ruht, schaut zur Tür und knurrt leise, während Elena das Buch in ihren Händen zur Seite legt und lauscht.
„Leise, Argos. Sei ruhig.“
Es ist nichts zu hören, doch das Tier bleibt unruhig. Sie steht auf, macht die Schreibtischlampe aus, öffnet die Tür und tritt genau in dem Moment in die Dunkelheit des kleinen Gartens hinaus, als aus der nahen Sierra Carbonera ein Geräusch anschwillt. Kurz darauf erfüllt dröhnender Motorenlärm die Nacht, und mehrere flüchtige Schatten fliegen in geringer Höhe über das Haus in Richtung Gibraltar, das nur vom Mond erhellt ist.
Da sind sie wieder, denkt sie. Da sind sie wieder, am Himmel.
Das erste Mal seit zehn Tagen.
Unsicher weicht sie zurück und sucht an der Hauswand Schutz, zusammen mit dem Hund, der sich zitternd an ihre Beine drückt, während sie sieht, wie die schnellen schwarzen Silhouetten über der Bucht an Höhe gewinnen und zur selben Zeit in der britischen Kolonie ein Dutzend Scheinwerfer aufleuchten, deren lange, weiße Finger wie bei einem seltsamen Lichterfest am Himmel umherwandern und sich dabei immer wieder kreuzen. Einen Augenblick lang erfasst einer von ihnen die schwarze Gestalt eines Flugzeugs, dann die eines anderen, bevor er sie wieder verliert. Fast im selben Moment leuchten Blitze auf und sprenkeln den Himmel: Artillerieexplosionen, deren monotoner, trockener Klang erst Sekunden verspätet zu hören ist. Bum, bum, bum, bum, machen sie. Bum, bum, bum, bum, bum. Dazu kommen weiße und bläuliche Striche, die langsam aufsteigen und am Himmel verlöschen oder sich im Wasser spiegelnd herabstürzen und die Umrisse der ankernden Schiffe aufschimmern lassen. Einen Augenblick später leuchten in Gibraltar die Explosionen der einschlagenden Bomben orange schimmernd auf, mit einem dumpfen Dröhnen, das Elena an den Trommelfellen und in der Brust spürt.
Kaum eine Minute später ist alles vorbei. Plötzlich hören die Bombenexplosionen und die Schüsse der Flugabwehr auf, die Scheinwerfer suchen noch ein paar Sekunden den leeren Himmel ab, verlöschen einer nach dem anderen und geben der Nacht das Leuchten der Sterne und des Mondes zurück. Der riesige Felsen ist wieder eine dunkle Masse, dessen einziges Licht jetzt der rötliche – ferne, aber deutlich zu sehende – Punkt eines Feuers ist, das im Hafen von Gibraltar ausgebrochen zu sein scheint. Ansonsten ist wieder Ruhe in der Bucht eingekehrt.
Elena geht ins Haus zurück und knipst die Schreibtischlampe wieder an, um weiterzulesen, doch der Strom ist ausgefallen. Tastend, mit der Leichtigkeit der Gewohnheit, sucht sie nach der Streichholzschachtel, nimmt sie, hebt den Glaszylinder einer Petroleumlampe an, dreht am Rädchen des Brenners und zündet den Docht an. Ein gelboranges Licht erhellt das kleine Wohnzimmer, die Bücher in den Regalen, den Schrank voll Steingutgeschirr und Flaschen, den Schaukelstuhl, den Tisch und den Teppich, auf dem es sich Argos wieder bequem gemacht hat. Es beleuchtet auch ein altes Bild an der Wand über dem Sofa. Auf der rissigen Leinwand ist ein Segelschiff zu sehen, das sich zwischen hohen, stürmischen Wellen zum Hafen durchzukämpfen versucht. Und ein gerahmtes Foto über dem Schreibtisch: Elena, drei Jahre jünger, im Arm eines attraktiven dunkelhaarigen Mannes in der Uniform der Handelsmarine, der seine Schirmmütze unter dem Arm und an den Manschetten die Litzen eines Zweiten Offiziers trägt.
Sie hat keine Lust mehr zu lesen.
Nicht heute, nicht an diesem Abend.
Sie versucht es nicht einmal. Sie bleibt mitten im Raum stehen und betrachtet das Foto. Versunken in der noch frischen, wunden Erinnerung. Obwohl die Einsamkeit nach zwei Jahren nicht mehr so schlimm ist, wie sie zu Beginn, als der Schmerz noch lebendiger war, gedacht hatte. Oder befürchtet. Das ruhige Vergehen der Tage mildert die Einsamkeit, ebenso wie die Arbeit, die Bücher, das nahe Meer, die Gesellschaft des Hundes, die langen Spaziergänge, die nicht allzu weit entfernt lebenden Freunde. Die Freiheit des Geistes ohne große liebevolle Empfindungen, nicht einmal ihrem Vater gegenüber – manchmal ein Brief, ein kühler Anruf –, der nach den bewegten Kriegszeiten fast zweihundert Kilometer entfernt, in Málaga, alt wird. Das Fehlen von engen Bindungen, von intimen Beziehungen und den damit verbundenen Ängsten und Verwirrungen erleichtert sie sogar, gibt ihr Kraft. Man hat weniger Angst, wenn man kaum etwas erwartet, außer von sich selbst. Wenn das Leben zur Not in einen Koffer passt, mit dem man von jedem beliebigen Ort aus aufbrechen kann, ohne zurückblicken zu müssen.
Nur Argos ist da, denkt sie. Und bückt sich, um den Hund zu streicheln, der sich, als er ihre Hand spürt, auf den Rücken dreht, damit sie ihm den Bauch krault. Nur er und der metaphorische Koffer. Eine neutrale, bequeme Welt, ohne Überraschungen und Emotionen. Leicht zu transportieren und zu bewohnen, hier oder an jedem anderen Ort.
Und trotzdem, folgert sie. Trotzdem.
Nachdem sie einen Moment nachgedacht hat, geht sie zur Anrichte und zieht eine Schublade auf. Die drei seltsamen Uhren, die der Mann aus dem Meer trug, liegen seitdem dort. Sie nahm sie ihm ab, während sie sich um ihn kümmerte, und weder er noch die Männer, die ihn abholten, dachten daran, sie mitzunehmen. Sie nahmen das Messer mit, vergaßen aber die Uhren. Sie entdeckte sie auf dem Boden, als das Auto kaum noch zu hören war, und untersuchte sie eine Weile, bevor sie sie, unter ein paar gefalteten Servietten und Tischdecken, in der Schublade verstaute. Sie wartete darauf, dass jemand käme, um sie zu holen, doch es kam niemand, und jetzt, zwei Monate später, liegen sie noch immer dort.
Sie nimmt sie, betrachtet sie erneut. Es handelt sich um eine Uhr, einen Kompass und ein Gerät, dessen Funktion sie nicht kennt. Alle drei sind aus Stahl, mit Armbändern aus Plastik. Der Kompass besteht aus einer Halbkugel aus Plexiglas und einer Skala mit den Himmelsrichtungen. Das schwarze Zifferblatt der Uhr trägt die Inschrift Radiomir Panerai, und seine Markierungen und Zahlen sind wie bei den anderen Geräten fluoreszierend und leuchten im Dunkeln. Das dritte Gerät hat eine Skala mit Ziffern, die möglicherweise Druck oder Tiefe anzeigen.
Sie setzt sich mit den drei Geräten im Schoß. Der Mann vom Strand und der, den sie am Morgen in Algeciras wiedererkannt hat, vermischen sich in ihrem Kopf, verwirren sie, als näherte sie sich mit unsicherem Schritt einer Klippe oder einer Grube, die sie gleichzeitig verunsichert und anzieht – ein Geheimnis, das es zu lüften gilt, der lose Faden eines Rätsels. Da draußen tobt ein Krieg, ein weiterer, oder vielleicht ist es immer derselbe; und die drei Uhren in ihren Händen, der in der Nähe des Hafens wiederaufgetauchte Italiener, sein Geheimnis – zweifellos gibt es eines – sind Teil dieses Krieges. Sie spürt, dass auch sie, wenn sie die Uhren nicht zurück in die Schublade legt und den vergisst, der sie trug, wenn sie weiter an der Idee festhält, die nach und nach ihre Absichten bestimmt, Teil dieses düsteren Geflechts werden wird. Der trügerisch weit entfernten Bomben und Scheinwerfer, die Gibraltar vor einem Augenblick erhellt haben.
Letzten Endes, sagt sie sich, war nicht sie es, die das Treffen gewollt hat. Der Krieg war bereits zu ihr gekommen, ohne dass sie ihn gesucht hätte. Vor mehr als zwei Jahren in Mers-el-Kébir, vor zwei Monaten frühmorgens am Strand, vor zwei Stunden in Algeciras. Kuriose Geometrie des Lebens. Es gibt Dinge, die von allein geschehen, folgert sie. Vielleicht weil irgendeine geheime Regel besagt, dass sie geschehen müssen. Und dreimal ist zu viel, um es als nebensächlich abzutun.
Sie lächelt in sich hinein, beinahe erstaunt. Während sie im Licht der Petroleumlampe sitzt, der Hund zu ihren Füßen und die drei Uhren im Schoß, hat Elena Arbués entschieden, dass der Krieg, der für sie weit weg gewesen war, wieder Teil ihres Lebens ist.
Jetzt muss sie es wissen, und sie hat vor, es zu tun.
2. Die Männer des letzten Mondviertels
Der sottocapoGennaro Squarcialupo bemerkt die Frau als Erster – sie ist dünn und größer als die durchschnittliche Spanierin, in einem hellen, leichten Kleid, das Beine und Hüften betont. Er hat sie kurz zuvor zwischen den Gästen auf der Terrasse des Restaurants Miramar nahe am Hafen entdeckt, im Schatten einer aus Segeln gefertigten Markise. Er hat sie von Weitem gesehen, wie sie dagesessen und etwas getrunken hat, mit einem Hut auf dem Kopf, der einen Teil ihres Gesichts verdeckte. Squarcialupo hat ihr einen prüfenden Blick zugeworfen – er ist Neapolitaner und mag die Andalusierinnen, da sie den Frauen seiner Heimat ähneln – und ist dann schnell seinen kurz zuvor an der Galera-Mole an Land gegangenen Gefährten gefolgt: dem Unterleutnant Paolo Arena und dem Unteroffizier Teseo Lombardo.
Als er sich nun zufällig umdreht, sieht er sie wieder. Es scheint die Frau von der Terrasse zu sein. Sie geht etwa zwanzig Meter hinter ihnen. Squarcialupo hält es für einen Zufall und misst der Sache keine weitere Bedeutung bei. Er betrachtet die Frau einen Moment lang, folgt dann den anderen. Im Stadtzentrum herrscht reges Treiben, was Squarcialupos Heimweh nach seiner Geburtsstadt ein wenig lindert. Außerdem tut es ihm gut, sich ein bisschen zu bewegen und die Beine zu vertreten, denn er hat zwei Tage ununterbrochen in einem stickigen, schmutzigen Maschinenraum verbracht, wo er zuerst das Ventil eines Kompressors, der Probleme bereitete, und dann den Drehzahlregler eines Elektromotors repariert hat. Eigentlich ist der Mechaniker dafür zuständig, ein Sarde namens Roccardi, doch der liegt seit einer Woche mit einer Blinddarmentzündung in Cádiz im Krankenhaus, und bisher haben sie noch keinen Ersatz gefunden.
Doch Squarcialupo beklagt sich nicht. Er ist von kleiner, athletischer Statur, mit dichtem, lockigem Haar, das er zu zähmen versucht, indem er es mit Pomade nach hinten kämmt. Ein Südländer mit heiterem Charakter und viel Humor, der das Leben genießt. Er geht langsam, zufrieden, eine Zigarette zwischen den Lippen und die Hände in den Hosentaschen, und erfreut sich an dem Spaziergang und dem dank der leichten Brise aus Südost angenehmen, sonnigen Tag. Genau wie seine beiden Gefährten hat er die Ärmel seines Hemds hochgekrempelt und trägt Espadrilles. Er besitzt einen Ausweis auf den Namen Fabio Collana, der für das Genfer Schiffsreparaturunternehmen Stella arbeitet. Was ihn zu einem Angestellten einer zivilen Firma in einem neutralen Hafen macht – eine makellose Tarnung, sogar in einem Spanien, das, obwohl es sich bisher aus dem Krieg heraushält, mit Italien sympathisiert. Sie sehen aus wie Matrosen, die auf ihrem Landgang Bars und, falls Zahltag ist, für eine halbe Stunde irgendeine Hafennixe besuchen. In Algeciras wird man überall beobachtet; es empfiehlt sich, vorsichtig zu sein.
„Da vorne ist eine Eisenwarenhandlung“, sagt Unterleutnant Arena und deutet auf ein Geschäft.
Arena ist dünn, hat einen stark hervortretenden Adamsapfel, einen kleinen Schnurrbart und sieht aus wie ein trauriger Windhund. Er und Lombardo betreten den Laden, während Squarcialupo vor der Tür wartet und die Straße im Auge behält. Die Frau ist verschwunden, also war es Zufall. Doch die Tatsache, sie zweimal innerhalb einer halben Stunde gesehen zu haben, macht ihn leicht nervös. Die Stadt ist kein Feindesland, doch als man sie herschickte, riet man ihnen zu ein paar wesentlichen Vorsichtsmaßnahmen. Immerhin sind Algeciras und die Umgebung von Gibraltar Jagdrevier verschiedener Geheimdienste – in den Landhäusern, Gasthöfen und Hotels wie dem Reina Cristina in Algeciras oder dem Príncipe Alfonso in La Línea wimmelt es nur so von englischen, deutschen, italienischen und spanischen Spionen, die kommen und gehen und auf eigene Faust handeln. Nichts davon betrifft auf direkte Weise die Mannschaft, der Squarcialupo angehört, doch es kann nicht schaden, hin und wieder einen Blick über die Schulter zu werfen, man kann ja nie wissen. Und wie ein alter italienischer, auch in Spanien gebräuchlicher Seemannsspruch sagt: Die Garnele, die schläft, wird von der Strömung mitgerissen.
Nach der Eisenwarenhandlung, wo sie mechanische und elektrische Komponenten kaufen, die sie für verschiedene Reparaturen benötigen, gehen die drei Männer zum Mercado Torroja. Unter dem modernen, kreisförmigen Oberlicht des Gebäudes ertönen die Stimmen der Verkäufer. Es wirkt mehr wie ein arabischer Basar denn wie eine spanische Markthalle: Die Gerüche der Stände mit Kolonialwaren und Gewürzen vermischen sich mit denen von Obst und Gemüse, Stockfisch und Fässern mit in Salzlake eingelegten Sardinen. Squarcialupo fühlt sich fast wie zu Hause, als befände er sich in dem Viertel von Neapel, in dem er vor fünfundzwanzig Jahren geboren wurde. Wenn es darum geht, sich an den mediterranen Trubel anzupassen – auch Afrika ist nur zweiundzwanzig Kilometer entfernt –, hat der sottocapo der italienischen Marine seinen Gefährten einiges voraus. Auch sie haben die Tauchschule der Decima Flottiglia MAS hinter sich, sind durch intensives Training abgehärtet und haben im Krieg gekämpft, doch für manche Dinge sind sie einfach zu hochmütig. Sie stammen aus dem Norden, wo man angesichts derartiger mediterraner Ausdünstungen gerne einmal die Nase rümpft: Paolo Arena kommt aus Savona in Ligurien und Teseo Lombardo aus Venedig.
In diesem Moment sieht Squarcialupo sie wieder. Er kauft gerade Obst – er liebt es, mit den Verkäufern über den Preis zu verhandeln –, und als er aufschaut, entdeckt er ein paar Stände weiter die Frau. Sie betrachtet die Auslage eines Fischstands. Zweifellos, es ist die Frau, die er erst auf der Terrasse des Restaurants und danach auf der Straße gesehen hat. Es ist das dritte Mal, was ein seltsames Unbehagen in ihm auslöst, eine Verunsicherung, die ihn misstrauisch macht und zugleich warnt. Vielleicht ist sie nicht allein, überlegt er. Vielleicht werden sie noch von anderen beschattet, und sie ist nur der sichtbare Teil einer viel ernsteren und gefährlicheren Bedrohung.
„Da ist eine Frau am Fischstand“, wendet er sich an seine Gefährten. „Nicht hinschauen, aber ich glaube, sie folgt uns.“
Überrascht dreht sich Unterleutnant Arena unauffällig in Richtung der Frau.
„Die im hellen Kleid?“, fragt er leise.
„Ja.“
Arena sieht erneut aus den Augenwinkeln zu ihr hinüber.
„Und du glaubst, dass sie uns folgt?“
„Schon seit einer Weile … Sie war im Hafen, als wir angekommen sind.“
„Bist du sicher?“
„So sicher wie ich an den Duce glaube.“
„Ich mein's ernst, Gennà.“
„Ich auch. Ich bin mir ziemlich sicher.“
„Und das kann kein Zufall sein?“
„Doch, natürlich. Aber ich habe sie dreimal innerhalb kurzer Zeit gesehen.“
Arena wendet sich dem anderen Mitglied der Gruppe zu.
„Was meinst du?“
Teseo Lombardo scheint ihn nicht zu hören. Er steht reglos da, mit ernster Miene, und starrt unverhohlen zu der Frau hinüber. Und obwohl sein Gesicht ebenso von der Sonne gebräunt ist wie das seiner Gefährten, ist er plötzlich blass geworden.
„Starr nicht so hin, Mann“, weist ihn der Unterleutnant zurecht. „Sonst merkt sie es noch.“
„Das ist sie“, sagt Lombardo schließlich.
Arena sieht ihn verblüfft an.
„Wer?“
„Die Frau aus Puente Mayorga. Die vom Strand.“
„Red keinen Unsinn. Die dich …“
„Ja.“
Arena und Squarcialupo blicken sich an. Plötzlich wendet Lombardo sich von ihnen ab.
„Teseo, denk nicht mal dran“, warnt Arena ihn erschrocken.
Doch Lombardo hört nicht auf ihn. Er geht zu der Frau und bleibt neben ihr stehen. Sie hebt den Kopf, und beide sehen sich reglos an.
„Das gefällt mir nicht, Gennà“, sagt Arena zu seinem Kameraden.
Squarcialupo nickt. Er ist genauso besorgt wie der Unterleutnant.
„Mir auch nicht.“
In den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts war die Via Pignasecca – und ist es jetzt, da ich diese Geschichte schreibe, noch immer – einer der lebhaftesten und quirligsten Orte Neapels. Der gesamte Puls der Stadt pochte dort zwischen den Straßenständen, dem Geruch von Fleisch, Gemüse, Fisch und heißer Pizza. Durch diese Straße zu gehen, hieß, in eine Menschenmasse einzutauchen, die kaufte, stritt und lachte: beleibte Matronen mit Einkaufskörben, Männer, die vor der Tür einer Bar rauchten und Bier tranken, Typen mit furchterregenden Visagen, denen man besser nicht in einer dunklen Gasse begegnete, Frauen von herber Schönheit. Alles gehüllt in das ohrenbetäubende Summen eines Bienenstocks, vermischt mit dem Hupen von Autos und Motorrädern, in einem mediterranen Licht, das zwischen heruntergekommene Stadtvillen fiel, wo in den zu bescheidenen Wohnungen umgewandelten Salons Menschen mit aristokratischen Nachnamen Seite an Seite mit dem einfachen Volk lebten, als wäre die gesamte Stadt eine Dauerschleife. Ein endloser Film von Vittorio De Sica.
Se potessi avere
mille lire al mese,
senza esagerare,
sarei certo di trovar
tutta la felicità …
Dieses alte Lied trällerte Gennaro Squarcialupo, während er beobachtete, wie ich mein Tonbandgerät anschloss. Die Trattoria Il Palombaro lag an der Ecke Via Pignasecca und Via Porta Scura. Am ersten Tag – die Buchhändlerin aus Venedig hatte mir die Adresse gegeben – hatte das Zeichen neben dem Namen des Lokals über der Tür meine Aufmerksamkeit geweckt: ein Totenkopf mit einer Blume zwischen den Zähnen. Il Palombaro