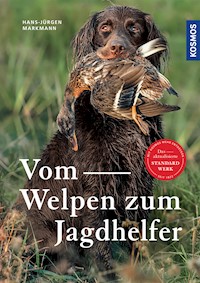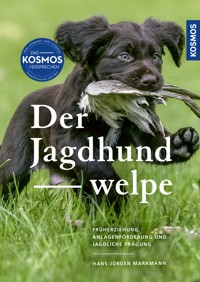
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Standardwerk über die Prägung des Jagdhundwelpen in den ersten Lebenswochen zählt seit Jahren zu den bewährtesten Ratgebern der Jagdhundeliteratur. Neugestaltet und aktualisiert bietet die Neuausgabe des Klassikers eine wertvolle Hilfestellung bei der Früherziehung des Jagdhundes und garantiert die richtige Weichenstellung von Anfang an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Der Jagdhundwelpe
Hans-Jürgen Markmann
KOSMOS
Impressum
Mit 176 Farbfotos
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Verlag und Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien und Methoden entstehen könnten. Dabei müssen geltende rechtliche Bestimmungen und Vorschriften berücksichtigt und eingehalten werden.
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Wir behalten uns die Nutzung von uns veröffentlichter Werke für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de.
Über Neuigkeiten informieren Sie regelmäßig unsere Newsletter kosmos.de/newsletter.
Umschlaggestaltung von Büro Jorge Schmidt, München, unter Verwendung einer Fotografie von Jenniffer Figge (Griffograph)
© 2025, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
kosmos.de/servicecenter
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-51217-3
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Welpenerziehung heute
Vom Wolf zum heutigen Jagdgefährten
Isegrims Domestikation
Die Parforce-Dressur
Moderne Früherziehung
Welpenauswahl und -haltung
Die Qual der Wahl
Verhaltensgerechte Unterbringung
Ernährung und Fütterung
Entwicklungsphasen und Früherziehung
Die ersten 16 Lebenswochen
Allgemeines zur Früherziehung
Lehrgänge und Ausbildungshilfen
7. bis 9. Woche
Welpenübernahme und -eingewöhnung
Erste Erziehungsmaßnahmen
Anlagenförderung
9. und 10. Woche
Der Kleine Gehorsam
Welpenspiel- und Welpenlerntage
Bringen – erste Übungen
Der Welpe und das Wasser
11. bis 16. Woche
Führigkeit und Schuss
Spur und Schleppe
SCHWEISSFÄHRTEN UND WIEDERHOLUNG
Herzensthemen
Ein Wort zur „Schärfe“
Unsere Jugendprüfungen – zur Diskussion gestellt
Welpenerziehung heute
In manchen älteren jagdkynologischen Veröffentlichungen ist zu lesen: „Die Ausbildung des Junghundes beginnt schon im Alter von fünf bis sechs Monaten. Schon im Alter von vier bis fünf Monaten gewöhnt man den Junghund an Halsung und Leine …“
Diese Aussage ist nach neueren Erkenntnissen unverantwortlich. Wer noch heute danach verfährt, lässt die entscheidenden Wochen der Lernbereitschaft des Welpen ungenutzt – und vergeudet dessen Jugendzeit! Denn wie für den Menschen gilt auch für den Hund: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“
FRÜH ÜBT SICH
Sehen wir uns doch einfach einmal in der Natur um – bei den Caniden, den hundeartigen Prädatoren. Deren Nachwuchs muss mit sechs bis neun Monaten schon eine derartige Selbstständigkeit erlangt haben, dass ihnen das Leben, das Überleben in der Natur möglich ist.
© Jenniffer Figge (Griffograph)
Caniden sind früh selbstständig: Diese Füchslein werden mit etwa vier Monaten gelernt haben, was es zum Überleben ohne Elterntiere braucht.
Sozialisierungsphase – das Lernen beginnt
Lehrmeisterin ist zunächst die Mutterhündin. Zu Beginn der Sozialisierungsphase, also ab der 8. Lebenswoche, tritt das Vatertier, der Rüde, hinzu und übernimmt einen Großteil der Erziehung. Er spielt ausgiebig mit den Welpen, animiert sie zur Verfolgung und lässt sich nach einiger Zeit stets fangen. Lernen durch Erfolg heißt die Devise! Diese Art Meute-/Beutespiele sind ideale Vorübungen für das spätere gemeinsame Jagen.
Der Rüde setzt aber auch Grenzen, die die Welpen einzuhalten haben und die regelmäßig konsequent durchgesetzt werden. Wer diese Tabus verletzt, wird zum Beispiel durch Ignorieren, Knurren oder den „Über-den-Fang-Biss“ gestraft. Gleichwohl erproben die Welpen die Konsequenz des Rüden mehrmals, bis sie schließlich feststellen müssen, dass dies keinen Sinn hat. Anschließend folgen Anhänglichkeitsbezeugungen gegenüber dem Vatertier. Aus eben diesen Meute-/Beutespielen mit Grenzen, die von den Welpen nicht übertreten werden dürfen, entwickeln sich notwendige soziale Verhaltensweisen – vor allem aber entsteht auch eine Partnerschaft, eine Vertrauensbasis zu den Elterntieren.
Weichenstellung zur rechten Zeit!
Bei unseren Hunden ist diese Sozialisierungsphase auch der Zeitpunkt, an dem wir Menschen den Platz der Elterntiere einnehmen müssen. Von nun an sind wir die Lehrmeister! Dabei ist es unsere Aufgabe, das Lernen aus dem Spiel mit dem Welpen heraus zu entwickeln und es vor allem – soweit möglich – lustbetont zu gestalten. Auch wir müssen Grenzen und Tabus setzen. Diese Grenzen kann der Welpe nicht nachvollziehen, er muss sie einfach akzeptieren lernen wie in der Hundefamilie auch. Und wir müssen stets konsequent bleiben: Konsequenz ist überhaupt die wichtigste Grundlage jeder Hundeausbildung!
© AdobeStock/Studio Porto Sabbia
Ab der achten Lebenswoche übernimmt der Vaterrüde Aufgaben. Er spielt mit den Welpen, erzieht sie aber auch.
Es ist ganz entscheidend, die Lernbereitschaft, ja die „Lernbegierigkeit“ unseres Welpen bis zur 16. Lebenswoche richtig zu nutzen, seine Anlagen zu fördern, ihn vor allem an seine späteren jagdlichen Aufgaben heranzuführen, jagdlich zu prägen also. Nur wenn wir das tun und danach, also ab dem 5. Monat, eine konsequente Grundausbildung anschließen (vgl. Markmann: Vom Welpen zum Jagdhelfer. 2023, KOSMOS), werden wir einen künftigen Jagdhelfer erhalten, der durchaus in der Lage sein kann, schon mit neun Monaten seine jagdliche Brauchbarkeit nach den jeweiligen Landesregelungen unter Beweis zu stellen.
Sinn und Zweck dieses Buches soll es sein, Ihnen eine Anleitung an die Hand zu geben, wie Sie die wichtigsten acht Wochen im Leben Ihres Welpen richtig nutzen können – den Zeitraum von etwa der 8. bis zum Ende der 16. Lebenswoche also. Dabei sind die Anregungen und Tipps dieses Buches nur beispielhaft, gleichwohl aber wesentlich. Ihnen muss auch klar sein, dass Sie viel, viel Zeit, Geduld, Ausdauer und vor allem Einfühlungsvermögen beim Umgang mit Ihrem Hund brauchen werden. Es wird Höhen und Tiefen geben. Aber die Freude an Ihrem Welpen wird überwiegen. Und Sie werden staunen, was Ihr Welpe, Ihr künftiger Jagdhelfer, am Ende der 16. Lebenswoche schon alles kann – auch wenn das Meiste natürlich noch nicht richtig „sitzt“.
Ich wünsche Ihnen mit Ihrem Welpen viel Freude und bei der Früherziehung, Anlagenförderung und jagdlichen Prägung viel Erfolg.
ZEHN BITTEN EINES HUNDES AN DEN MENSCHEN
Bei den Arbeiten zu diesem Buch fiel mir jüngst eine Ausgabe von „UH – Unsere Hunde“, dem Verbandsorgan des Österreichischen Kynologenverbandes, wieder in die Hände. In dieser schon etwas älteren Ausgabe fand ich die im Kasten wiedergegebenen „Zehn Bitten eines Hundes an den Menschen“.
Zehn Bitten eines Hundes an den Menschen
Mein Leben dauert etwa 10 bis 15 Jahre. Jede Trennung von dir bedeutet für mich Leiden. Bedenke dies, bevor du mich anschaffst.Gib mir Zeit zu verstehen, was du von mir verlangst.Setzte Vertrauen in mich – ich lebe davon.Zürne mir nie lange und sperre mich zur Strafe nicht ein! Du hast deine Arbeit, dein Vergnügen und deine Freunde – ich aber habe nur dich.Sprich viel mit mir. Wenn ich auch deine Worte nicht verstehe, so doch deine Stimme, die sich an mich wendet.Wisse, wie immer an mir gehandelt wird – ich vergesse es nie.Bedenke, wenn du mich gar schlagen willst, dass meine Kiefer mit Leichtigkeit die Knöchelchen deiner Hand zerquetschen könnten, dass ich aber keinen Gebrauch von ihnen mache.Ehe du mich bei der Arbeit unwillig schiltst, bockig oder faul, bedenke: Vielleicht plagt mich ungeeignetes Futter, vielleicht war ich der Sonne zu lange ausgesetzt oder vielleicht habe ich ein verbrauchtes Herz.Kümmere dich um mich, wenn ich alt werde – auch du wirst einmal alt sein.Geh jeden schweren Gang mit mir. Sage nie: „Ich kann so etwas nicht sehen“ oder „Es soll in meiner Abwesenheit geschehen“. Alles ist leichter für mich mit dir, auch mein letzter Gang.Ich halte diese Bitten im Verhältnis zwischen Hund und Mensch für so wegweisend, dass ich sie in diesem Buch voranstellen möchte. Diese Bitten, deren eine oder andere ich geringfügig ergänzt habe, sprechen für sich.
© Hans-Jürgen Markmann
Der Umgang mit Welpen erfordert Feingefühl – sie haben nur uns Menschen!
Sind diese Bitten vielleicht zu viel verlangt? Ich meine nein! Wir sind es unseren treuesten Gefährten schuldig, sie zu erfüllen.
Hans-Jürgen Markmann
© Hans-Jürgen Markmann
VOM WOLF ZUM HEUTIGEN JAGDGEFÄHRTEN
Isegrims Domestikation
Bisher ging man davon aus, dass Urvater aller Hunde der Wolf ist. Dessen Domestikation, die Zähmung vom Wildtier zum Haustier Hund, begann gegen Ende der Steinzeit – vor mindestens 15 000 bis 10 000 Jahren.
WANN UND WIE – DIE THEORIEN
Nach dem Wolfsforscher Erik Zimen sollen die Frauen der Steinzeitmenschen die Domestikation eingeleitet haben, indem sie junge Wölfe in der Kinderpflege einsetzten, beispielsweise als Bewacher, insbesondere aber zum Kotfressen und Sauberlecken ihrer Babys. Anders sieht es Konrad Lorenz: Er meint, dass es die Steinzeitjäger waren, die zuerst mit Wölfen bei der Jagd zum Nutzen aller gemeinsame Sache machten.
In jüngster Zeit aber sind Wolfsforscher insbesondere durch Genstudien teils zu anderen Erkenntnissen gelangt. Danach ist und bleibt Urvater all unserer Hunde zwar der Wolf (Canis lupus) – darüber sind sich alle Wolfsforscher einig. Ob aber der Mensch jemals den Wolf aktiv domestiziert oder der Wolf dies „selbst“ getan hat, indem er sich zum Beispiel dem Menschen „anschloss“, ist unklar. „Ebenso unklar sind die Zeit und der genaue Ablauf“, schreibt der Wolfsforscher Erik Axelsson.
„Verbündete“
Die Entdeckung von sterblichen Überresten von Wölfen in den von Menschen bewohnten Gebieten Europas datiert etwa 40 000 Jahre zurück, meinen einige Wolfsforscher. In dieser Zeit war der Mensch noch nicht sesshaft, ernährte sich von der Jagd und folgte den Wildtieren auf deren Wanderungen. Unter anderem führten klimatische Veränderungen zum Aussterben großer Wildarten wie Mammut und Bison. Der Rückgang des Wildangebots veranlasste den Menschen, neue Waffen zu erfinden, seine Jagdtechniken anzupassen und zu verbessern.
© AdobeStock/Jim Cumming
Urahn Wolf: Sein Erbe blieb vor allem in unseren Jagdhundrassen erhalten.
Er stand dabei im Wettbewerb mit den Wölfen, die sich von derselben Jagdbeute ernährten. Der Mensch musste so den Wolf zu seinem Verbündeten bei der Jagd machen, indem er zum ersten Mal versuchte, ein Tier zu zähmen, lange bevor er selbst sesshaft wurde, Vieh züchtete und Getreide anbaute. Der primitive Hund war also in erster Linie ein Jagdhund, mit Sicherheit aber auch ein Abfallbeseitiger.
Die Ahnen des Hundes passen sich an
Als sich Wölfe zu Haustieren im engeren Sinn entwickelten, gewöhnten sich die frühen Hunde an eine neue Ernährungsweise. Von jetzt an stand vermehrt Stärke auf dem Speiseplan. Damit passten sich die Hunde den Menschen an. Diese aßen – in Form von Getreideprodukten – ebenfalls viel Stärke, nachdem sie sesshaft geworden waren und mit der Landwirtschaft begonnen hatten.
Statt ständig Beutetiere zu jagen, konnten die Hunde nun von Essensresten leben, die Menschen in der Nähe ihrer Lager und Behausungen liegen ließen. Diese Bequemlichkeit könnte sogar ein Grund dafür gewesen sein, dass sich Mensch und Wolf überhaupt annäherten. „Die Fähigkeit, mit einer stärkereicheren Kost zurechtzukommen, stellte einen bedeutenden Schritt in der frühen Domestikation des Hundes dar“, schreiben Forscher um Erik Axelsson von der schwedischen Universität Uppsala.
© Hans-Jürgen Markmann
Das ausgeprägte Sozialverhalten des Wolfes ist auch für unsere Jagdhunde kennzeichnend. An die Stelle des Wolfsrudels tritt bei ihnen die Mensch-Hund-Meute.
Der Beginn ist unklar
Die Auswertung einer neueren Genstudie aus dem Jahre 2002 ergibt ein mutmaßliches Alter des Haushundes von rund 15 000 Jahren. Für dieses Alter sprechen ebenfalls die Datierungen bisheriger archäologischer Funde, die sich in ein Zeitfenster von rund 13 000 bis 17 000 Jahren einordnen lassen. Im Jahre 1914 legten zum Beispiel Arbeiter im heutigen Bonner Ortsteil Oberkassel ein Grab in Oberkassel frei, in dem ein Mann, eine Frau und ein Hund zusammen bestattet worden waren. Das Grab geht auf das Paläolithikum zurück, ist also rund 14 000 Jahre alt. Funde im Nahen Osten, die auf Hunde hinweisen, wurden auf ein Alter von 10 000 bis 23 000 Jahre datiert. Weit vorher, bereits vor 100 000 Jahren, sollen erste genetische Unterschiede zwischen Wolf und Hund entsprechenden Untersuchungen zufolge bestanden haben.
Wann nun begann also die Entwicklung des Wolfs zum Hund? Bereits vor 100 000 Jahren oder „erst“ vor 10 000 Jahren? Nun – so genau weiß das bis heute niemand! Es gibt mehrere Theorien, die alle mehr oder weniger schlüssig klingen, und jede für sich beansprucht, mehr Beweise bieten zu können als die andere.
In historischer Zeit war der Wolf von Irland und Spanien über ganz Europa und Sibirien bis nach Japan verbreitet. Im Süden Eurasiens drang er bis nach Vorderindien vor, auch in Nord- und Mittelamerika war er vertreten. Die Domestikation kann also überall dort, wo der Mensch mit dem Wolf zusammentraf, zeitlich neben- und hintereinander stattgefunden haben. Ihr Beginn in Europa dürfte in die Zeit um 10 000 bis 8 000 vor unserer Zeitrechnung einzuordnen sein – für unsere heutigen Hunde hat diese Frage aber wohl keine Bedeutung.
© AdobeStock/Gerasimov_foto_174
Höhlenmalereien belegen, dass Mensch und Wolf beziehungsweise erste Hunde schon in Gemeinschaft jagten.
Die ersten Hundetypen
Um 4 000 bis 2 000 vor unserer Zeit hatten sich in Europa jedenfalls bereits fünf grundsätzliche Hundetypen herausgebildet (s. Infobox).
Aus diesen Grundtypen entwickelten sich im Laufe der Jahrtausende nach und nach verschiedene Rassen. Manche davon starben wieder aus, mit den „Nachfahren“ der verbliebenen leben wir heute.
Hundegrundtypen Europas
(vor 4 000 bis 6 000 Jahren)
SpitzhundtypDoggentypWindhundtypJagdhundtypSchäferhundtypVOM „WAFFENERSATZ“ ZUM SPEZIALISTEN
Der Hund war anfänglich mehr Haustier im eigentlichen Sinne. Er diente zum Beispiel als Bewacher, war aber auch eine wichtige Nahrungsquelle! Später wurde er auf jagdlichem Gebiet mehr und mehr zu einem unentbehrlichen Gehilfen.
Die Entwicklung der jagdlichen Methoden war in allen geschichtlichen Epochen eng mit der Entwicklung des Jagdhundewesens verbunden und von dieser abhängig. Die unterschiedlichen Jagdtechniken richtete man stark nach der Verwendbarkeit der Hunde aus. Wenn auch sehr früh eine Vielzahl von Hundetypen bekannt war, die nach Beschreibungen und bildlichen Darstellungen gewisse Vergleiche mit heutigen Jagdhunderassen zulassen, sah ihre Abrichtung und Verwendung schon im Grundsatz völlig anders aus als in unserer Zeit. Denn die Schnelligkeit, Stärke und der Mut jener Hunde mussten die Mängel der primitiven Jagdwaffen früherer Zeiten ersetzen.
Frühe Differenzierung
So entwickelten sich auch bei den einzelnen Völkern sehr verschiedene Jagdmethoden. Die alten Ägypter führten zum Beispiel schon Hetz- und Treibjagden mit Hunden durch, wobei auch schon Netze und Jagdlappen Verwendung fanden. Die Hunde mussten also auf die unterschiedlichsten Jagdarten auch durch differenzierte Dressur spezialisiert werden.
War anfangs die Jagd mit Hunden über Tausende von Jahren Erwerbsform und Teil der Lebensgrundlage des Menschen, wurde sie bei uns insbesondere zu Zeiten Karls des Großen – Kaiserkrönung im Jahre 800 unserer Zeit – zum Selbstzweck: Aus der Jagd entstand nach und nach das Waidwerk. Dieser Prozess war über Jahrhunderte zweifelsohne auch von zum Teil grausamen, oft sadistischen Jagdmethoden geprägt, die insbesondere bei den Hofjagden Perfektion erlangten. Durch die Weiterentwicklung der Jagd erfuhr auch das Jagdhundewesen einen erheblichen Aufschwung. So ist zum Beispiel überliefert, dass Herzog Julius von Braunschweig im Jahre 1592 mit 600 Rüden zur Sauhatz an der Oberweser ausrückte.
© AdobeStock/acrogame
Darstellung eines eingestellten Jagens mit Speeren und Hunden.
Uraltes Thema – der Ausbildungsbeginn
Hier weiter das Hundewesen nach dem Jahre 800 bis zum 20. Jahrhundert darzustellen und auf die Entstehung der Rassen, mit denen wir heute jagen, einzugehen, würde den Rahmen dieser Anleitung zur Früherziehung sprengen.
Interessant ist aber – und das möchte ich hier herausstellen –, dass sich einige Hundeleute schon Mitte des 18. Jahrhunderts darüber Gedanken machten, in welchem Alter man die Hunde für die Aufgaben der Jagd ausbilden sollte. So fordert VON HEPPE (1751) in seinem kynologischen Werk über die Ausbildung des „Leithundes“, des Vorläufers des Hannoverschen Schweißhundes, dass man den Welpen „stets freundlich zuspräche“ und sie „fleißig mit aller Geduld lieben“ sollte. Auch vertrat er ferner die Auffassung, dass man den Welpen den Gebrauch der Nase schon im Alter von fünf bis sechs (!) Wochen lehren sollte, und zwar über eine Art Futterschleppe, wie wir sie heute auch kennen. Insoweit ist also die Früherziehung, wie wir sie heute verstehen, nicht nur eine Erfindung des 20. Jahrhunderts.
© Archiv
Schon 1751 forderte Carl von Heppe in seiner Abhandlung einen liebevollen Umgang mit dem Jagdhund und dessen frühzeitige Schulung.
© AdobeStock/motivjaegerin1
MANIPULATION DURCH DEN MENSCHEN
Domestikation bedeutet die Übernahme eines Wildtiers in den menschlichen Hausstand; sie stellt eine Manipulation des natürlichen Selektionsprozesses dar. Der Mensch verändert dabei die Umwelt des Wildtiers derart, dass für die natürliche Selektion wesentliche Eigenschaften an Bedeutung verlieren. Das Wildtier selbst wird durch züchterische Maßnahmen in gezielter Weise zum Nutzen des Menschen verändert, was insbesondere Modifikationen des Körperbaus und des Verhaltens bewirkt. So sind die sozialen Verhaltensweisen des Hundes durch seine starke Prägung auf den Menschen bestimmt: Der Hund braucht heute den Menschen – ja, er hängt unmittelbar von ihm ab.
Jagen „auf Kommando“
Aber auch Jagdinstinkt und -verhalten des domestizierten Jagdhundes unterscheiden sich deutlich von denen des wilden Ahnen. Wölfe jagen bis hin zum starken Elch alle Tiere, die sie überwältigen können. Gejagt wird immer nur bei Hunger und nur zur Ernährung. Satt und nur „aus Lust“ zu jagen, verbietet sich dem Wolf, denn Jagd bedeutet zunächst einmal Anstrengung und Energieverlust. Der steuernde Jagdtrieb des Wolfes sichert also sein Überleben.
Diesen angewölften Jagdtrieb haben wir Menschen beim Hund jedoch über Jahrtausende durch Zucht gefördert, erweitert und verfeinert. So jagen unsere Jagdhunde heute auf Kommando. Hunger ist grundsätzlich nicht mehr Voraussetzung zur Auslösung der Jagdpassion. Allerdings steigert er auch bei unseren Hunden zum Beispiel den Findewillen. Dies nutzen wir etwa bei der Arbeit auf der künstlichen Wundfährte, bei der wir immer mit nüchternem Hund antreten.
Wie für die Wölfe bedeutet Beute machen jedoch auch heute noch für unseren Hund, vom Urinstinkt Jagdtrieb gesteuert, das Rudel zu versorgen und zur Arterhaltung beizutragen. Sein Rudel ist inzwischen aber aufgrund jahrtausendelanger Prägung, die den Jäger zum Artgenossen machte, die „Mensch-Hund-Meute“. Für sie „arbeitet“ er – eine echte soziale Verhaltensweise.
Die Parforce-Dressur
Die Parforce-Dressur versucht, „par force“, mit Gewalt also – heute sagen wir „Zwang“ –, den Hund zu einem vielseitig brauchbaren Jagdhelfer zu erziehen. Als Vertreter dieser in vielen Ausbildungsabschnitten rüden Methode gelten Carl Emil Diezel und „Oberländer“.
Unter dem Pseudonym „Oberländer“ publizierte der Fabrikant Carl Rehfus (1857–1927) das Buch „Die Dressur und Führung des Gebrauchshundes“ erstmals 1894; es erschien zuletzt 1926 in der 10. Auflage. In diesem Werk stellt Oberländer eine schon erheblich abgemilderte Art der Parforce-Dressur vor, die wohl überwiegend auf den Forstbeamten und Jagdschriftsteller Carl Emil Diezel (1779–1860) und dessen Kapitel „Die Abrichtung des deutschen Vorstehhundes“ in dem Buch „Erfahrungen auf dem Gebiet der Nieder-Jagd“ von 1849 zurückgeht.
© Hans-Jürgen Markmann
Symbolbild: Für den Jagdhund begann die Parforce-Dressur mit einem Jahr „Zwingerhaft“.
OBERLÄNDER
Die Parforce-Dressur rechtfertigte Oberländer mit seiner Liebe zum Wild, dessen Qualen er, wenn es krank war, durch die harte Ausbildung des Hundes verringern wollte. Der Jagdhund musste schon immer in der Lage sein, in kürzester Zeit krankgeschossenes Wild zu stellen, abzuwürgen oder zu beuteln. Von diesem Standpunkt aus glaubte Oberländer, auch dem Hund und vierbeinigen Jagdhelfer im Interesse des kranken Tieres einiges an Härte zumuten zu können und zu müssen. Für ihn hatte schon damals die Arbeit nach dem Schuss Priorität. Gleichzeitig rückte aber bereits Oberländer von den noch härteren Abrichtmethoden Diezels ab. Bei wichtigen Ausbildungsabschnitten verzichtete er sogar ganz auf Zwang und nutzte vielmehr die natürlichen Triebkräfte des Hundes, zum Beispiel bei der Wasserarbeit.
© Ekkehard Ophoven
Oberländer-Denkmal in Kehl am Rhein. Als „Oberländer“ wurde Carl Rehfus (1857–1927) zu einem der bekanntesten Vertreter der zweifelhaften Parforce-Dressur des Jagdhundes.
CARL EMIL DIEZEL
So „fortschrittlich“ wie Oberländer war Carl Emil Diezel nicht: Er zog den Hund, der aus dem Wasser apportieren sollte, über zwei Leinen in das Gewässer hinein, dirigierte ihn über die Leinen an den Apportiergegenstand und hielt ihn dort so lange „schwimmend“ an der Stelle, bis der Hund das Apportl gegriffen hatte!
Apport brutal
Aber Diezel propagierte auch noch härtere Methoden: Wollte der Hund das Apportierholz nicht freiwillig vom Boden aufnehmen, wurde er mit einer Kette so kurz angehängt, dass er sich nicht hinlegen konnte.
Der Hund wurde für einige Stunden allein gelassen. Dann fährt Diezel wörtlich fort:
„Man macht dann den Versuch, ob er sich jetzt williger zeigt, indem man das diesen Tieren eigene, sehr gute Gedächtnis voraussetzend, ihm den Apportierbock ohne weitere Ansprache vorhält.