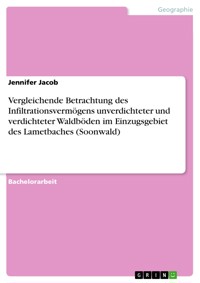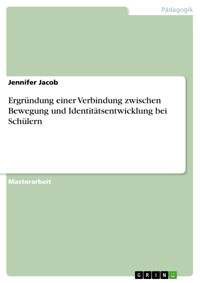Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der weltweite Medizintechnikmarkt befindet sich im Wachstum. Japan, die USA und Deutschland sind auf diesem Markt führend. Neben einigen berühmten Global Playern liegt die Stärke der deutschen Medizintechnik in spezialisierten Klein- und Mittelbetrieben. Obwohl jedoch Japan trotz seiner eigenen starken Medizintechnikbranche die Hälfte seines, nicht zuletzt wegen der demographischen Alterung der Bevölkerung, wachsenden Bedarfs importiert, liegt der Anteil deutscher Produkte am japanischen Import nur bei rund bei 6 Prozent, während der Anteil der USA bei über 50 Prozent liegt. Dieses Buch geht der Frage nach, welche Barrieren deutsche Medizintechnikunternehmen davon abhalten, den japanischen Markt zu erschließen und wie diese Marktzugangsbarrieren überwunden werden können. Sie wurde an der Osaka-City-University begonnen und von der Universität Hamburg als Masterarbeit angenommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Forschungsstand
1.3 Definitionen
1.3.1 Medizintechnikbegriff
1.3.2 Klein- und Mittelunternehmen
Theorie
2.1 Der Internationalisierungsbegriff
2.2 Erklärungsansätze zur Entstehung des Internationalisierungsphänomens
2.2.1 Nachfragestrukturhypothese von Linder
2.2.2 Theorie der technologischen Lücke – Neotechnologieansatz von Posner
2.3 Ansätze zur Entstehung unterschiedlicher Internationalisierungsformen
2.3.1 Die Uppsala-Schule – die skandinavischen Internationalisierungsmodelle
2.3.2 Verhaltensorientierte Theorie von Aharoni
Methode
3.1 Experteninterviews
Weltweiter Medizintechnikmarkt Überblick
4.1 Gesundheit als Wirtschaftsgut
4.2 Determinanten der Nachfrage nach Medizintechnik
Deutsche Medizintechnik
5.1 Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung Deutschland
5.2 Branchenstruktur
5.3 Bisheriges Engagement in Japan
Allgemeine Situation von Handel und Wirtschaft in Japan
6.1 Japans Wirtschaft in der Folge der Tsunami-Katastrophe vom 11.03.2011
6.2 Handelsabkommen und andere Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels
6.2.1 Verhandlungen über Trans-Pazifischen-Freihandelszone
6.2.2 Verhandlungen über einen Handelspakt mit der EU
6.2.3 Währungspakt mit China
6.3 Der Stellenwert Deutschlands als Handelspartner
Aktuelle Marktstruktur des japanischen Medizintechnikmarktes
7.1 Bedarf
7.1.1 Demographische Entwicklung
7.1.2 Häufige Krankheiten und Todesursachen
7.2 Die Finanzierungsseite
7.2.1 Das japanische Gesundheitssystem
7.2.2 Kranken- und Pflegeversicherung im Sozialversicherungssystem
7.2.3 Private Krankenversicherungen und der private Sektor
7.3 Die Ausgabenseite
7.3.1 Ärztedichte
7.3.2 Krankenhauszahlen und Krankenhausstrukturen
7.3.3 Pflegeeinrichtungen
7.4 Japans Eigenproduktion
7.4.1 Branchenstruktur
7.6 Marktpotential des japanischen Medizintechnikmarktes
7.6.1 Importanteil
7.6.2 Marktaussichten und künftige Entwicklungen
Marktzugangsbarrieren und die Überwindungsmöglichkeiten
8.1 Die Angst vor dem japanischen Markt
8.1.1 „ausländische Unternehmen haben es schwer auf dem japanischen Markt“
8.1.2 „Die Mitarbeiterrekrutierung ist für westliche Unternehmen in Japan schwer“
8.1.3 „Die China ist wichtiger“ – Die China-Euphorie
8.1.4 „Der japanische Markt erfordert einen langen Atem“
8.1.5 „Die Kultur in Japan ist zu fremd“ – Kulturelle Barrieren
8.1.6 „Englisch spricht man überall“ – die Sprachbarriere
8.2 allgemeine, nicht-tarifäre Handelshemmnisse
8.2.1 Steuerbelastung für ausländische Unternehmen in Japan
8.2.2 Japanische Vertriebswege
8.2.3 Transport
8.2.4 Qualitätsverständnis japanischer Kunden
8.2.5 Produktanpassung
8.3 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse des japanischen Medizintechnikmarktes
8.3.1 Wareneinfuhrbestimmungen
8.3.2 Produkt-Zulassung
8.3.3 Kostenerstattung durch das japanische Gesundheitssystem
8.4 Zwischenfazit
Wege auf den japanischen Medizintechnikmarkt
9.1 Gründe den japanischen Markt zu erschließen
9.2 allgemeine Hilfestellung der deutschen Regierung
9.2.1 Länder- und Marktinformation
9.2.2 Umsetzung von Marketing Maßnahmen im Technologiefeld Medizintechnik
9.3 Unterstützung durch deutsche öffentlich rechtliche und private Institutionen
9.3.1 IHK-Firmenpool Life-Science Japan
9.3.2 DEKRA
9.3.3 SPECTARIS
9.4 Wirtschaftsstrategien und Deregulierungen der japanischen Regierung
9.4.1 Innovation
9.4.2 Vision
9.4.3 Angleichung der Standards zwischen der EU und Japan
9.5 Bilaterale Förderung von Wissenschaft und Technologie
9.5.1 Abkommen zur Zusammenarbeit auf wissenschaftlich-technischem Gebiet
9.5.2 Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit nach 3-11
9.5.3 Deutschlandjahr in Japan 2005/
9.5.4 „150 Jahre Freundschaft – Deutschland und Japan“
9.6 Direkter Export als Strategie
9.6.1 Exportunterstützung von deutscher Seite
9.6.2 Einschätzung der Eignung von direktem Export
9.7 Zwischenbetriebliche Kooperation als Strategie
9.7.1 Horizontale zwischenbetriebliche Kooperationen
9.7.2 Vertikale zwischenbetriebliche Kooperationen / Indirekter Export
9.7.3 Kooperationsförderung der deutschen Regierung
9.7.4 Förderung durch die Europäische Union
9.7.5 Förderung durch die Japan External Trade Organization
9.7.6 Messebesuche
9.7.7 Einschätzung zur Eignung zwischenbetrieblicher Kooperationen
9.7.8 Erfahrungswerte der Interviewpartner
9.8 Direktinvestitionen als Strategie
9.8.1 Joint Venture
9.8.2 Akquisition von Unternehmen
9.8.3 Gründung einer eigenen Niederlassung in Japan / Firmengründung
9.8.4 Direktinvestition in Forschung und Entwicklung
9.8.5 japanische Förderung ausländischer Direktinvestitionen
9.8.6 Investitionsunterstützung am Beispiel des Kobe Life-Science-Clusters
9.8.7 Einschätzung zur Eignung von Direktinvestitionen
9.8.8 Erfahrungswerte der Interviewpartner
9.9 Eignungseinschätzung der unterschiedlichen Marktzugangsstrategien
9.9.1 Internationalisierung durch internes versus externes Wachstum
9.9.2 Die Vor- und Nachteilen ausgewählter Markteintrittsstrategien
Fazit
Literatur
11. Anhang
11.1 Tiefeninterview-Gesprächsleitfaden
11.2 Experteninterviews
11.2.1 Interview mit DMB-Consult
11.2.2 Interview mit Christoph Miethke GmbH & Co.KG
11.2.3 Interview mit Greggersen Gastechnik GmbH
11.2.4 Interview mit einem Medizintechnikhersteller von Ultraschallreinigern
11.2.5 Interview mit Alpha Plan GmbH
11.2.6 Interview mit eZono AG
1. Einleitung
Der weltweite Medizintechnikmarkt befindet sich im Wachstum. Insbesondere für die wohlhabenden Industrienationen wird, aufgrund von demographischer Alterung der Gesellschaft und technischem Fortschritt, ein erhöhter Bedarf an Medizintechnologie-Produkten für die nächsten Jahre erwartet. Japan, Deutschland und die USA sind auf dem Medizintechnikmarkt sowohl in Importzahlen als auch in Exportzahlen führend. Deutschlands Medizintechnikbranche erwirtschaftet über sechzig Prozent ihres Umsatzes durch den Export. Neben einigen berühmten Global Playern liegt die Stärke der deutschen Medizintechnik in spezialisierten Klein- und Mittelbetrieben. Die Medizintechnikbranche gilt als Zukunftsbranche und die deutsche Regierung fördert sie als Wachstumsmotor der Wirtschaft und Garant von Arbeitsplätzen. Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe erfahren immer mehr Unterstützung durch die Bundesregierung. Japan wird unter Anderem aufgrund der extremen demographischen Alterung der Gesellschaft ein weiterer Anstieg im Bedarf an Medizintechnik vorausgesagt. Trotz wirtschaftlicher Stagnation Japans, ist die Kaufkraft in Japan immer noch hoch und die Ausgaben für Medizintechnik werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Die nun in Rente gehende Babyboomer-Generation hat gute Rücklagen gebildet und rückt als Konsumentengruppe unter dem Stichwort „Silbermarkt“ schon seit einigen Jahren immer mehr in den Fokus. Ein Teil des Silbermarktes ist auch der Gesundheitswirtschaft zuzurechnen.
Japan importiert, trotz eigener starker Medizintechnikbranche ungefähr die Hälfte seines Bedarfs an Medizintechnik. Der Anteil deutscher Produkte am Import lag 2010 bei 6,3 Prozent. Damit stehen deutsche Importe an dritter Stelle nach den USA und Irland. Dazu muss jedoch betont werden, dass der Anteil der Importe aus den USA in Japan bei fast sechsundfünfzig Prozent lag, der von Irland bei 10,8 Prozent. Nur 4,3 Prozent der deutschen Exporte gehen nach Japan. Deutsche Medizintechnik ist also, relativ zu seiner Position auf dem Weltmarkt gesehen, unterrepräsentiert. Bisher sind auf dem Japanischen Markt überwiegend die „Global Player“, wie z.B. Siemens, vertreten, die international konkurrieren. Die Klein- und Mittelbetriebe, welche in Deutschland einen, im Vergleich mit anderen Branchen, überdurchschnittliche großen Anteil haben, sind bislang nur vereinzelt auf dem japanischen Markt zu finden. Es stellt sich also die Frage welche Marktzugangsbarrieren deutsche Medizintechnikunternehmen davon abhalten den japanischen Markt zu erschließen und wie diese Marktzugangsbarrieren überwunden werden können.
1.1 Fragestellung
Welche Marktzugangsbarrieren bestehen für den Marktzutritt deutscher klein- und mittelgroßer Medizintechnikunternehmen in den japanischen Medizintechnikmarkt?
Was für Strategien sind zur Überwindung dieser Marktzugangsbarrieren für deutsche Klein- und Mittelunternehmen geeignet?
1.2 Forschungsstand
Japanologische Literatur zur japanischen Wirtschaft und zur allgemeinen Marktbeschreibung existiert zahlreich. Jedoch stammt der Großteil dieser Literatur aus den 1980er und 1990er Jahren und beschäftigt sich meist mit japanischen Managementmethoden. Über den japanischen Markt wurde in jüngerer Zeit, abgesehen von Analysen des wirtschaftlichen Abstieges Japans, wenig veröffentlicht. Literatur, die sich mit einem Markteintritt nach Japan beschäftigt zielt zu großen Teilen auf Großunternehmen und hierbei wiederrum auf das Management ab. Da die meisten großen Unternehmen schon viel früher mit einer Internationalisierung begonnen haben, werden Klein- und Mittelunternehmen innerhalb der meisten Internationalisierungstheorien und wissenschaftlichen Arbeiten zu Marktzugangsstrategien wenig oder erst in jüngerer Zeit beachtet. In der Japanforschung werden Klein- und Mittelunternehmen fast vollkommen ignoriert. Als eine der wenigen Autoren hat sich in jüngerer Zeit Parissa Haghirian mit dem Eintritt von Klein- und Mittelunternehmen in den japanischen Markt beschäftigt. Weiterhin bringt die Deutsche Industrie und Handelskammer Tōkyō in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Außenwirtschaft (seit 2009 Germany Trade und Invest) kleinere Broschüren mit einigen konkreten Informationen und Tipps zum Markt und Markteintritt heraus.
Der japanische Medizintechnikmarkt ist in westlicher Literatur nahezu unerforscht. Einige wenige Aufsätze in Sammelbänden sind zu finden. Hier ist erwähnenswert der Aufsatz über die japanische Medizintechnik von Tim Goydke (2007). Germany Trade & Invest gibt regelmäßig kurze Zusammenfassungen zu einzelnen Branchen nach Ländern heraus. Diese Informationen umfassen jedoch kaum mehr als eine Seite. Weiter Erwähnung findet der japanische Medizintechnikmarkt nur als Teil des Silbermarktes oder des Biotechnologiemarktes. Informationen zu diesen Märkten sind jedoch nicht immer auf die sehr spezielle Medizintechnikbranche übertragbar. Japanischsprachige Literatur beschränkt sich meist auf die eigene Branche und den globalen Medizintechnikmarkt und behandelt nur in Ausnahmen die Situation fremdländischer Unternehmen auf dem eigenen Markt. Insgesamt weisen die Daten zum globalen, sowie auch zu den einzelnen Ländermärkten oft Differenzen auf, da zur Erhebung unterschiedliche Maßstäbe und Definitionen zugrunde gelegt werden.
Diese Arbeit soll einen Überblick über den japanischen Medizintechnikmarkt bieten und über die Eintrittsstrategien und Chancen deutscher Klein- und Mittelunternehmen auf den japanischen Markt.
1.3 Definitionen
1.3.1 Medizintechnikbegriff
Die vorliegende Arbeit behandelt den Medizintechnikmarkt. Die mit dem Begriff „Medizintechnik“ beschriebenen Produkte unterliegen jedoch keiner einheitlichen Definition. Es liegen Zahlreiche Definitionen vor. Das deutsche Gesetz über Medizinprodukte definiert in § 3:
Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke
a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten,
b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen,
c) der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder
d) der Empfängnisregelung
zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann. (Bundesministerium der Justiz 2011)
Laut Bundesministerium für Gesundheit sind Medizinprodukte:
„[…] Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände mit medizinischer Zweckbestimmung, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen bestimmt sind. Anders als bei Arzneimitteln, die pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch wirken, wird die bestimmungsgemäße Hauptwirkung bei Medizinprodukten primär auf physikalischem Weg erreicht. Medizinprodukte sind zum Beispiel Verbandstoffe, Infusionsgeräte, Katheter, Herzschrittmacher, Sehhilfen, Röntgengeräte, Kondome, ärztliche Instrumente und Labordiagnostika.“
(Bundesministerium für Gesundheit 2010)
Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den oben aufgeführten Definitionen. Es muss jedoch an dieser Stelle betont werden, dass in der herangezogenen Literatur, in den einzelnen Ländern und in den befragten Unternehmen Medizintechnik geringfügig abweichend definiert werden kann.
1.3.2 Klein- und Mittelunternehmen
Für Klein- und Mittelunternehmen liegt keine einheitliche, wissenschaftliche Definition vor. Es gibt verschiedene quantitative und qualitative Kriterien zur Einordnung: Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz, interne Unternehmensstruktur etc. Auch ist es teilweise schwierig diese Unternehmensinternen Daten zu erheben, da kleinere Firmen nicht zur Publikation verpflichtet sind. Da in dieser Arbeit die Fördermaßnahmen Seitens der deutschen Regierung und der Europäischen Gemeinschaft eine Rolle spielen bietet es sich an deren Definition für Klein- und Mittelunternehmen zu folgen. Auch die Förderdatenbank des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie folgt dieser Definition.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden definiert als Unternehmen, die „weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro aufweisen“ (Europaische Gemeinschaften 2006: 11 – 25).
2. Theorie
Eine Marktanalyse, wie sie in der vorliegenden Arbeit geleistet werden soll, beinhaltet Teilaspekte aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Gebieten. VWL, BWL, Psychologie, Kulturwissenschaften, Soziologie und andere Disziplinen spielen eine Rolle. Klassische Marktanalysen stammen größtenteils aus der Betriebswirtschaftslehre. Diese analysieren den Markt in Bezug auf die Interessen einzelner Unternehmen. Eine Marktanalyse, wie sie hier gedacht ist, soll jedoch einen umfassenderen Blick auf den gesamten Markt und die Analyse der Marktchancen für unterschiedliche Unternehmen leisten. Im Zentrum der Arbeit stehen Marktzugangsbarrieren und Marktzugangsstrategien für deutsche Klein- und Mittelunternehmen, die auf den japanischen Markt wollen. Daher bieten Internationalisierungstheorien aus der Internationalen-Managementlehre der Betriebswirtschaftslehre, die geeignetsten Problemlösungsansätze. Viele unterschiedliche Aspekte des japanischen Marktes, der Zugangsbarrieren und Zugangsstrategien sollen beleuchtet werden. Die hierfür zu untersuchenden Faktoren reichen in verschiedene Themengebiete hinein. Aufgrund der Komplexität der Fragestellung kann eine einzige Internationalisierungstheorie nur unzureichend alle Aspekte des Medizintechnikmarktes Japans und des Marktzuganges abdecken. Daher werden an dieser Stelle verschieden Strömungen und Theorien der Internationalisierung vorgestellt.
2.1 Der Internationalisierungsbegriff
Es existieren verschiedene Definitionen für den Begriff der Internationalisierung. Für die vorliegende Arbeit wird „Internationalisierung“ definiert als die Aufnahme erstmaliger oder zusätzlicher Landesgrenzen überschreitender Aktivitäten seitens der Unternehmung.
Beispiele für solche Aktivitäten sind alle im Ausland erzielte Umsätze, internationale Kooperationen, die Produktion oder ein Geschäftssitz im Ausland. Mit dem Phänomen der Internationalisierung von Unternehmen beschäftigen sich viele verschiedene Theorien, Konzepte und Strategien. Der Begriff der Internationalisierung kann sich auf alle betrieblichen Teilbereiche beziehen. Internationalisierungsentscheidungen werden also immer nur für bestimmte Funktionsbereiche getroffen (Helm 1997: 13).
2.2 Erklärungsansätze zur Entstehung des Internationalisierungsphänomens
Allgemein gibt es viele Motive für eine Internationalisierung. Beispiele hierfür sind die Erwartung höherer Gewinne, die Risikodiversifikation und Risikoreduktion, die Erschließung neuer Absatzmärkte, die Erhöhung von Kapazitäten, die Nachfrage ausländischer Konsumenten nach inländischen Gütern und Dienstleistungen, das Ausnutzung von Erfahrungen aus dem Inland für das Ausland, Lernerfahrungen auf Auslandsmärkten zu sammeln durch Beispielsweise anspruchsvolle Konsumentenwünsche im Ausland, die Befürchtung, gegenüber exportierenden Konkurrenten bei einem Verzicht auf Ausfuhr zurückzufallen und die Förderung des Exports durch staatliche Stellen (Kutschker und Schmid 2008: 39).
Bevor auf das Phänomen der Internationalisierung von Deutschland nach Japan eingegangen werden kann, muss zunächst die grundlegende Frage beantwortet werden, wie es zwischen zwei Hochtechnologienationen wie Deutschland und Japan, die beide über hervorragende Medizintechnologie und über eine ähnliche Kapitalausstattung verfügen, überhaupt zu einem Importbedarf kommen kann.
2.2.1 Nachfragestrukturhypothese von Linder
Im Gegensatz zu den klassischen Außenhandelstheorien, die sich bei der Erklärung der Entstehung von Exporten auf die Angebotsbedingungen konzentrieren, betrachtet Staffan Linder1 die Nachfragebedingungen. Die Kernfrage ist, ob ein Produkt auch ein potentielles Exportgut darstellt. Dies sei nur der Fall, wenn das Absatzpotential im Inland gut ist, da bei einem entsprechenden inländischen Absatzmarkt Skaleneffekte bei der Produktion erzielt werden können. Ein Produkt erreicht das größte Absatzpotential wenn es der repräsentativen Nachfrage im Inland entspricht, also den Wünschen des Durchschnittskonsumenten, festgemacht an Durchschnittseinkommen und präferiertem Qualitätsniveau. In der Konsequenz ist auch das Absatzpotential im Ausland entsprechend. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das Produkt immer zuerst auf dem Inlandsmarkt und später auf dem Auslandsmarkt abgesetzt wird. Für die vorliegende Arbeit ist Linders Hypothese relevant, da er sich bei seiner Betrachtung auf einen Zwei-Länder-Fall konzentriert. Linder stellt auch die Hypothese auf, dass sich die Nachfragestruktur der zwei Länder überlappen muss damit es zum Export kommt. Also ist in der Konsequenz, der Handel zwischen Ländern mit ähnlicher Nachfragestruktur und ähnlicher Kapitalausstattung am größten. Hier wiederspricht Linder den meisten, vor allem klassischen, Außenhandelstheorien, die davon ausgehen, dass Kapitalunterschiede zu vermehrtem Export und Import führen.
Es stellt sich die Frage, warum Länder mit ähnlicher Nachfragestruktur und Kapitallage nicht auch ähnliche Produkte produzieren. Wie kann es also trotzdem zu einem Importbedarf kommen? Bei Ländern mit überlappender und ähnlicher Nachfragestruktur und Kapitallage gilt das Prinzip der internationalen Arbeitsteilung. Die Erklärung hierzu liegt also in der Spezialisierung und Produktdifferenzierung. Es werden unterschiedliche Varianten der gleichen Produktkategorien produziert (Kutschker und Schmid 2008: 399 – 401).
Dies ist typisch für den Handel zwischen zwei Industrieländern wie Deutschland und Japan bei denen es hauptsächlich zu substitutivem Handel kommt, also die Warenströme zwischen den Ländern vergleichbar sind. Der intra-sektorale Handel von Medizintechnikprodukten zwischen Deutschland und Japan wird also in erster Linie von Produktdifferenzierung getragen.
2.2.2 Theorie der technologischen Lücke – Neotechnologieansatz von Posner
Die Theorie der technologischen Lücke davon aus, dass komparative Erlösvorteile durch technologische Entwicklung die Entstehung von Außenhandel erklären. Bekanntester Vertreter der Theorie ist Michael Posner2, der den Neotechnologieansatz entwickelt hat. Wie auch Linder, so geht auch Posner davon aus, dass ein Produkt zunächst im Inland und später im Ausland vermarktet wird. Wie schon oben erwähnt, spielt die Produktdifferenzierung bei dem Handel von Medizintechnikprodukten zwischen Deutschland und Japan eine wichtige Rolle.
Nach Posner entstehen komparative Vorteile einzelner Länder durch technologische Innovationen. Diese Vorteile gehen jedoch meistens wieder verloren, sobald andere Länder das Produkt imitieren. Anders als in der berühmten Theorien der komparativen Kostenvorteile von Ricardo, betrachtet Posner jedoch nicht zwei Güter aus zwei Ländern, sondern ein (innovatives) Gut aus zwei Ländern. Wird in einem Land A ein innovatives Produkt X auf den Markt gebracht, entsteht eine Zeitspanne, bis auch Kunden in anderen Ländern von dem Produkt X erfahren. Das ist die sogenannte Nachfragelücke, in der aus dem Ausland noch keine Nachfrage kommen kann. Ab dem Zeitpunkt der Nachfrage, kann das Unternehmen mit dem Export beginnen und somit die Nachfrage im Ausland bedienen. Da ein vergleichbares, technologisch aber weniger innovatives Produkt somit auf dem Exportmarkt verdrängt wird, wird die Konkurrenz im Ausland B versuchen ein ähnlich innovatives Produkt Y anzubieten. Der Zeitraum, den das Ausländische Unternehmen B zur Entwicklung eines gleichwertigen oder eventuell besseren Produktes Y benötigt bis dieses auf den Markt gebracht wird, ist die sogenannte Lernperiode. Die Nachfragelücke ergibt zusammen mit der Lernperiode, die Imitationslücke. Nach der Imitationslücke kommt der Export des Innovativen Produktes X aus Land A zwar nicht sofort zum erliegen, wird aber immer mehr zurückgehen. Gründe, warum die Konsumenten in Land B auf das heimische Produkt umsteigen, können Transportkosten-, Service- und Liefervorteile sein sowie der Country-of-Origin-Effekt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt können die Handelsströme sogar von Land B nach A wechseln wenn das Imitat dem original überlegen ist oder zum Beispiel durch Lohnunterschiede Kostenvorteile greifen. Der Zeitraum ab der Lernperiode bis zur Umkehr der Handelsströme wird als technologischer Lückenhandel bezeichnet. Technologische Lücken sind nicht auf Länderebene anwendbar. Man kann also nicht immer von einem Hochtechnologieland versus Niedrigtechnologieland sprechen. Einige Länder bzw. Unternehmen aus einzelnen Ländern sind in bestimmten Technologien führend in anderen aber nicht. So kann es auch zwischen zwei technologisch starken Industrienationen wie Japan und Deutschland zu technologischen Lücken kommen (Kutschker und Schmid 2008: 395 – 399).
2.3 Ansätze zur Entstehung unterschiedlicher Internationalisierungsformen
Nach der theoretischen Erklärung des Importbedarfs soll in dem folgenden Abschnitt der Frage nachgegangen werden wie der Internationalisierungsprozess von Unternehmen in Hinblick auf bestimmte Märkte abläuft und welche Faktoren diesen Prozess beeinflussen.
2.3.1 Die Uppsala-Schule – die skandinavischen Internationalisierungsmodelle
Einige der frühen Internationalisierungstheorien verfolgen einen phasenorientierten Ansatz. Hierbei wird die Internationalisierung von Unternehmen als Prozess aufgrund von erlernten Erfahrungen verstanden.
Eine der bekanntesten phasenorientierten Theorien liefert die Uppsala-Schule. Anstatt Innovation und externe, ökonomische Größen als ausschlaggebende Faktoren für Internationalisierungsschritte zu sehen entwickelten Jan Johanson und Jan-Erik Vahlne3