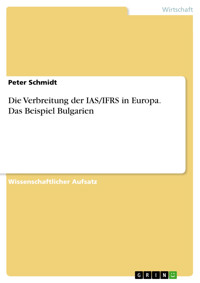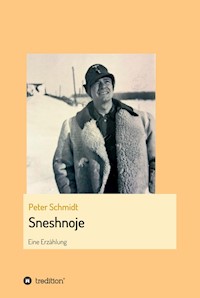Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter ist ein seltsamer Junge. Wenn er sich freut, flattert er mit den Armen, wie ein Vogel. In der Schule beißt er die Mitschüler, weil er sich mehr durchbeißen soll. Und Zuhause studiert er stundenlang Lichtflecken an den Wänden, weil das so herrlich juchzt. Peter Schmidts Aufzeichnungen über seine Kindheit mit Asperger-Syndrom sind einzigartig. Denn er kann sich nicht nur an die ersten Jahre seines Lebens, sondern sogar an die Stunden seiner Geburt erinnern! Für diese ungewöhnlichen Wahrnehmungen entwirft er eine eigene Sprachwelt, die faszinierend und verblüffend plausibel ist. Ein Lesevergnügen mit Aha-Effekt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Bildteil
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Peter Schmidt
Der Junge vom Saturn
Wie ein autistisches Kind die Welt sieht
Patmos Verlag
Für alle Menschen, die in mir das Gute sahen, sehen und sehen werden.
Besonders für die Papamamas, meine Eltern,
die diese Geschichte teilweise miterlebt haben,
wenngleich auch aus anderer Perspektive,
für meine Mutter, die mich gerne »Goldfasan« nannte,
meinen Vater und andere, die in mir den »Beerenbengel« gesehen haben,
und für die Spitzdosentante, für die ich der »kleine Prinz« sein durfte.
Und natürlich für mein Gnubbelchen, die Mau, meine Frau,
sowie für meine Kinder, die RaRas,
die dann irgendwann sagten: Der Papa ist aber komisch.
Manche Menschen müssen Außergewöhnliches leisten, um gewöhnlich zu sein.
Wenn sie ihren Sehnsüchten folgen, wachsen sie über sich hinaus.
Dr. Peter Schmidt
Inhalt
Begrüßung
Im Bann einer geheimnisvollen Insel
Der kleine Tomai
Jenseits des Sprachhorizonts
Wörterndes Gezwatscher
Der Klorohrbaum im Kohlenkeller
Schweigendes Sprechen
Löcheln, Licht und Länder jenseits der Morgenröte
Grenzen gibt’s, die gibt’s gar nicht
Der rot-weiße, klengschrankende Drohglocken-Bahnübergang
Der Spitzdosenjunge und seine Picknick-Plätzchen
Allein in der Roten Gruppe
Wandernde Taler und ein angebissener Abreißkalender
Der Arm, der einfach nicht brechen wollte
Straßenschluchten im Supermarkt
Im Zeichen des »Rast ich, so rost ich«
Tischender Turm am ersten Tornistertag
Fahrt ans oogige Ende der Welt
Löcher in verborgene Welten
Blutende Spielregeln
Betonfußball, bis die Fantabunten kommen
»Wenn du nicht bald mal spurst, kommst du ins Heim!«
Laut Tachogesetz vollzufahren bis 9999,9 km
Das erstarrte Fein
Im Skat gibt’s ja doch eine Herz-4!
Die bizarre Zahl und der unheimliche Berg
Meine lehrerrot blutende Seele
Eiternde Sterne, Lichtjahre und langnullige Zahlen
Gießkannenflüsse in Toffelland
Das verlorene Autochen
Pfennige, Pilze und Perihel
Die weihnachtliche Passstraße zum Licht
Der Komet und die Kakteen
Tubukuai geht nun vorbei
Mein Leben rund ums Mondmosaik
In den Straßen des Gymnasiums
»Auf dassss Tor doch nicht, du Depp!«
Der Baumschubser
Im Tunnel der Polypen
Die tollen Tabellenbücher
»Dann spring doch!«
Gesichterlose, kachelreiche Kunstwerke
Urlaub im Alltag
Belächeltes Verblüffen
Sehnsüchte sind der einzige Wegweiser!
Kirchgang ohne Gottesdienst
Der Tag, an dem Adam und Eva sterben
Gruppenallein zwischen Fjord und Fjell
»Du musst dich da mehr durchbeißen!«
Bibliotheksasyl
Der Pinselstrich
Die Hitformel aus 3:04 min Da diddley qa qa
Straßenwelten
Die »States of Japetus on Earth«
Aufbruch nach Amerika
Der Botschafter vom Saturn
Der durch null dividiert
Wo die Reise hingeht
Als die QE2 auf dem »Highway to Hell« zerschellt
JAPEL, das Grundgesetz des Lebens
Sprachliche Matrjoschkas und Fleischerhakenformeln
Nullstein reloaded und die Relativität von Koyaanisqatsi
Am Tor zur Welt
Inseln der Stille
Im skandinavischen Lärchenpanoramazimmer
Auf Wiederlesen
Autismus verstehen
Danksagung
Bildtafel
Begrüßung
Liebe Leserinnen und Leser!
Indem Sie dies lesen, spricht der Junge vom Saturn schweigend zu Ihnen.
Auf seinem Weg von irgendwoher nach irgendwohin fühlt sich der kleine Junge irgendwarum anders als andere. Sein Leben ist geprägt von scheinbaren Widersprüchen. Er will die Welt entdecken, aber alles soll so gewohnt funktionieren wie zu Hause. Er sucht fruchtbares Land in einer Wüste und gerade Straßen mit vielen Kurven. Konkurrierende Sehnsüchte bestimmen sein Leben. Wie beim Regenbogen wird sein Leben erst dann bunt, wenn Sonnenschein und Regen sich vereinen.
Einerseits fasziniert der Junge seine Mitmenschen wie ein exotisches Zootier. Andererseits kommt er mit den Gefühlen seiner Mitmenschen nicht klar und sie nicht mit seinen. Man bewundert ihn wie den Mount Fuji in Japan. Bizarr und perfekt geformt, die allermeiste Zeit still und erhaben. Aber dieser Berg ist so, wie er ist, weil er auch hin und wieder ausbricht. Unbeherrschbar für die Mitmenschen. Schmerzhaft für den Jungen. Niemand weiß, dass der Junge ein Autist ist.
Autisten sind wie Inseln, wenn Gesellschaften die zusammenhängenden Kontinente darstellen. Inseln haben verschiedene Ausprägungen. Es gibt flache Koralleninseln und gebirgige Vulkaninseln, warme und kalte, große und kleine, feuchte und trockene, bizarr geformte, festlandnahe und festlandferne. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist ihre Eigenschaft als Insel, das Sein als ein Stück Land, das vollständig von Wasser umgeben ist.
Im Bann einer geheimnisvollen Insel
Frühlingshaftes, liebliches Vogelgezwitscher kündigt einen neuen Tag an. Und immer wieder gockelt es draußen. Das krächzende, kraftvolle Krähen ortsansässiger Dorfhähne umrahmt die Stille. Noch liege ich im Bett. In einem weißen, einfach eingerichteten Raum. Ich genieße dieses Konzert der Natur. Ich bin an einem ganz besonderen Ort. Einem Ort, der alles hat, was ich wirklich brauche. Und der alles nicht hat, was ich nicht nur nicht brauche, sondern was mich auch stören würde: brummender Lärm, menschliches Gezwatscher, grelles Gewusel und großes, gewaltiges Gedöns aller Art.
Ich entbette und klamotte mich in rotblau, meinen Farben. Rotes T-Shirt mit weißen, strukturgebenden Schulterstreifen, blaue, eingetragene Jeans, hinten mit abgerundeten, aufgesetzten Taschen und einfacher Naht. Dann gehe ich aus dem Drinnen ins Draußen. Herrlich. Es himmelt azurblau. Die Sonne gleißt den Horizont. Was für morgenfrische, blütenbunte, intensive Farben, akzentuiert durch lange Schatten. Sie erinnern mich an eine Zeit, die längst vergangen ist. Wie ich als kleiner Junge gen Osten aus dem Küchenfenster schaute und wissen wollte, wie das Ende der Welt und das Land jenseits der Morgenröte aussehen. Damals gockelte es zu Hause genauso wie hier. Und die kahlen Bäume warfen bei Sonnenaufgang ihre langen Schatten auf das winterstarre, blassgrüne Land.
Vor einem halben Jahr habe ich begonnen, Geophysik zu studieren. Doch an der Uni wurden die neuguten Zeiten schnell zu altguten. Neugut deshalb, weil ich eine zweite Chance hatte, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Altgut deshalb, weil ich zwar die fachlichen Anforderungen des Studiums erfülle und es mir grundsätzlich gut geht, mir aber der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen auch hier nicht gelingen will. Wieder stoße ich schnell an eine mysteriöse, gläserne Mauer. Ich hatte gehofft, beim Studium Menschen kennen zu lernen, die so sind wie ich. Doch stattdessen spüre ich nach wie vor eine große Distanz zwischen mir und den anderen.
Nun blicke ich auf kleine Häuschen, weißgestrichene, flache Casas, die inmitten spitzgratiger, pechschwarzer Lava stehen. Und irrgartenhafte Fußwege, begrenzt von Lavahecken. Dort, wo keine Lava liegt, dehnen sich schwarzerdige Felder voller Kakteen aus. Niedrige Buschwälder aus ordnungsvoll gepflanzten Opuntien. Im Osten liegt das blaue Meer, im Westen das Vulkangebirge. Da, wo ich gerade bin, wollte ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin aber froh, diesen Ort gefunden zu haben. Die erste warme Oase der Ruhe nach meinem Abitur. Mala auf Lanzarote.
Von hier breche ich auf, um zu verstehen, um mein inselhaftes Sein ebenso wie die ganze Insel Lanzarote kennen zu lernen. Besonders die Montañas del Fuego will ich sehen. Die Feuerberge. Als ich die Mondlandschaft am anderen Ende der Insel erreiche, erlebe ich ein gewaltiges Déjà-vu. Ich habe alle diese Berge in diesem Leben schon einmal gesehen, obwohl ich noch nie in meinem Leben hier war. Da bin ich mir ganz sicher. Da sind einfach viel zu viele Details, die ich wiedererkenne. Das hier, das ist kein normales Déjà-vu, nein, es ist strenger.
Diese Vulkanberge kenne ich! Dieser stahlblaue Himmel. Diese bizarren Formen und Farben. Ich spule mein Leben ab, begebe mich in meine interne Zeitmaschine, bis ich in meiner Kindheit geistig innehalte. Es ist Januar. Im Jahr 1975. Ja, jaaaa, jaaaaaaa. Das … das … das sind genau die spannenden Berge, auf denen damals so komische, kugelige Antennen standen. Die mit schillerndem Lärm grelle Blitze auf alle Menschen schossen, die sich ihnen näherten. Die oft auch aus Löchern im Boden ausgefahren kamen, um Forscher und Abenteurer am Besteigen des Vulkans zu hindern.
Ich erstarre. Denn ein Kindheitstraum geht in diesem Moment völlig unvorbereitet in Erfüllung. Damals mit neun Jahren wollte ich unbedingt dahin. Diese Berge selber besteigen. Ich kaufte Bücher, um mehr über solche geheimnisvollen Berge, Vulkane genannt, zu erfahren. Es war die Geburt einer Sehnsucht.
Und nun stehe ich tatsächlich inmitten der tollen, prägenden Vulkanlandschaft aus dem mehrteiligen Film Die geheimnisvolle Insel nach einem Roman von Jules Verne. Er erzählt die Geschichte von Abenteurern, die im zentralen Vulkan der Insel die »Nautilus« mit ihrem »Herrscher einer versunkenen Welt« entdeckten. Ich konnte damals kaum abwarten, bis der nächste Teil endlich kam.
Die Handlung des Films: weitestgehend vergessen. Die menschlichen Charaktere: ganz vergessen. Aber diese Vulkanlandschaft! Jedes Detail ist noch da. Damals, im Januar 1975, erreichte mich die Sehnsucht nach Vulkanen, nach bizarren, übersichtlichen, weiten Landschaften. Nur deswegen habe ich diesen Mehrteiler damals gekuckt. Die Sache mit dem U-Boot im Vulkan: Schwachsinn. Aber diese Landschaften! Ich hätte damals nie gedacht, dass ich genau diese außerirdisch anmutende Vulkangegend einmal selbst zu sehen bekomme.
Wieder zurück in Mala verarbeite ich das Erlebte. Die Geschehnisse der letzten Jahre haben die Erinnerungen an ganz frühe Jahre zusedimentiert. Nun reißen die neuen Sedimente auf, es bahnen sich ganz frühe Kindheitserinnerungen ihren Weg an die Oberfläche, so als würde Magma die Sedimente der Vergessenheit durchstoßen. Ich stehe an einem Aussichtspunkt auf mein eigenes Leben. Dem ersten, nachdem ich meine Heimat, das Elternhaus, das Haus der Papamamas, verlassen hatte. Nachdem ich ausgezogen war, um die große, weite Welt zu entdecken.
Wie damals, am 3. Januar 1966, einem azurblauen Montag, als ich zu einer violettblaugrünen Uhrzeit, um 9:35 Uhr, direkt dem Licht der Welt ausgesetzt wurde, als ich meine körperliche Unabhängigkeit erreichte.
Der kleine Tomai
Jenseits des Sprachhorizonts
Ganz am Anfang findet eine Art Umstülpselung statt. Da wird das Außen zum Innen und das Innen wird zum Außen. Als ich so in einer Zeit körpere, nehme ich wahr, dass ich da bin. Nach dieser körperlichen Ichung bin ich auch immer mal wieder weg und dann wieder da. Wie leicht und schwer. In den Momenten, wo ich so da bin, fühle ich mich als gefangen in mir selbst und schwer. Ich erlebe mich als ganz großes Gnubbel. Als ein Körper mit Gnubbeln. Denn irgendwann finde ich, dass da irgendwelche Gnubbel an mir baumeln. Was es ist, finde ich nicht heraus. Ich bin wieder weg und leicht und wieder da und schwer. Ich versuche, diese Gnubbel abzuschütteln. Es gelingt mir nicht. Sie gehören offenbar irgendwie zu mir. Ich bin wieder weg und ich bin leicht und ich bin wieder da und ich bin schwer. Und irgendwann stelle ich fest, dass ich diese komischen Gnubbel unter Kontrolle bringen kann. Und dann merke ich, dass irgendwas mich einhäutet. Ich bin eingepellt. Ich ertaste diese Umpellung mit meinen Gnubbeln. Sie überallt um mich herum. Irgendwie. Ich benutze meine Gnubbel, um dagegenzustoßen. Um zu flattern, um zu zappeln.
Ich nehme ein grisseliges Schlierenspiel wahr. Und es sind so komische Vibrationen da. Wie fernes Gegrummel von Musik. Manchmal ganz regelmäßig, manchmal irgendwie durcheinander. Derweil wandern die Schlieren an mir vorüber. Sie verändern dabei ihre Form und Größe. Sie kommen heran und entfernen sich wieder. Körnige Schatten im Schlierenspiel ziehen durch. Die Schatten werden mehr und mehr, immer wenn ich da und schwer bin. Aber ich werde auch wieder leicht, bin wieder weg. Alles bewegt sich über-, in- und durcheinander. Und wenn ich da bin, spüre ich, dass die Umpellung immer dichter an mich ranrückt. Und die Vibrationen kommen auch immer mal wieder, immer zweiig von oben hinten, ein anderes Schwer. Wie von außen. Ich bin weg und wieder da. Es schliert mich.
Die Vibrationen werden zunehmend dröhnend unangenehm. Es schliert mich weiter. Irgendwie bin ich immer enger eingepellt, und ich will irgendwie weg. Aber ich bin da. Gefangen in Materie. Und finde, dass es immer schwieriger wird, mit den Gnubbeln zu stoßen, zu zappeln, zu flattern. Die Umpellung spüre ich nun immer und überall. Und die Umpellung drückt mich, besonders zweiig von oben hinten. Von dort spüre ich nun auch ganz deutlich die Vibrationen. Immer zweiig, genau von oben hinten, das angstet. Und es schliert mich weiter. Ich bin weg und wieder da. Und wieder weg. Und wieder da. Die grisseligen Schlieren tanzen in mir weiter ihre Figuren. Das ist schön, sehr schön. Aber die Vibrationen angsten immer mehr.
Irgendwann unterscheide ich bewusst mehrere Arten von Vibrationen:
Die, die sich in sich selbst verstärken, das sind die fern bedrohlich Obenhintenen.
Die, die sich anregend anfühlen und irgendwie von fern kommen.
Die, die ganz nahe bei mir entstehen.
Und die, die ganz regelmäßig im Hintergrund ticken, immer.
Die anregend von fern kommenden und die ganz nahen steuern das Schlierenspiel. Und die fern bedrohlich obenhintenen sich in sich selbst verstärkenden Vibrationen beginnen zu dutummen, wummernd immer zweiig. Urplötzlich ist wie immer, wenn diese Vibrationen kommen, alles vorbei. Dann juchzt mich das verlässlich vorhandene beruhigende Schlierenspiel. Aber irgendwann beginnt es, auch von unten vorn dröhnend zu dutummen:
Du -------------------------------- tumm
Du ----------------- tumm – Du --------------------------- tumm
Du ------- tumm – Du ----------------- tumm – Du ---------- tumm
Du – tumm – Du – tumm – Du – tumm – Du – tumm – Du – tuhhhhmm – Du – tuhhhhhhmm – Du – tuhhhhhhhhmm –
Du – tuhhhhhhmmmm
Es dutummt immer öfter und angstet immer mehr. Die Umpellung erdrückt mich fast. Ich gnubbele immer wieder dagegen, aber es wird schlimmer. Was ist das bloß?
Dann geschieht noch mehr angstendes Neues, als ich einmal ganz kräftig gnubbele. Die Vibrationen, die sich in sich selbst verstärken, kommen ganz unmerklich tief dröhnend auf einmal ganz schnell näher und näher, ganz bedrohlich spürbar. Zweiig. Von oben hinten. Wie zwei große Halbkugeln nehmen sie mich dröhnend in die Zange. Es gibt kein Entrinnen. Ich bin da. Ich bin nicht mehr weg. Ich kann nicht mehr weg sein, obwohl ich weg will. Was passiert da? Ich bin voll da!
Das wummernde Dutummen der Vibrationen ist nun regelmäßig erst verstärkt, dann wieder schwächer. Es angstet mich sehr. Ich beginne zu kämpfen, um da zu sein.
Die Vibrationen hören nicht mehr auf. Ich gnubbele stoßend dagegen, es soll aufhören, endlich. Doch die Vibrationen steigern sich in sich selbst ins Unermessliche. Auf einmal drückt mich die Umpellung zusammen. Ich kann meine Gnubbel gar nicht mehr zappeln. Es ewigt, eigentlich kann ich nicht mehr da sein, aber ich bin da. So ergebe ich mich dem, was offenbar geschieht, ohne dass ich es beeinflussen kann.
Dann zerhackt sich das bisher stets fließende Schlierenspiel selbst in schneidend blitzige Zuckungen, die mich wahnsinnen. Schlagartig fahren dann die dicken Halbkugeln zurück. Schlagartig ist der schier unermessliche Druck weg. Zu meiner Überraschung ist auch die Umpellung weg. Stattdessen feinnadelt es. Von allen Seiten fühle ich mich geprickelt und gepiesackt. Und alle Schlierenspiele sind wie weggeblitzt. Für Momente ist stattdessen alles unermesslich grellkörnig schemig.
Ich bin da und habe noch immer panische Erstickungsängste, bis ich merke, dass alle Gnubbel frei bewegbar sind, so gut wie noch nie. Und dass ich vor allem ein Gnubbel habe, womit ich die vom Dutummen kommende Erstickung eigenmächtig beenden kann. Das gab es vorher nicht. Ich spucke und wäähe los, was das Gnubbel hergibt.
Es gibt jetzt zwei verschiedene Schlierenspiele. Das eine, das ich gewohnt war, als auch diese Vibrationen da waren. Es ist jetzt heller, schemig durchgekörnt. Aber da gibt es auch ganz neue Schlieren. Sie sind voller starrer Strukturen. Manchmal bewegen sich sogar Schlierenteile starr vor dem Hintergrund anderer. Und es erscheinen plötzlich neue Strukturen, obwohl sie eben noch nicht da waren. Das alte Schlierenspiel war stets beruhigend, während die neuen Schlieren sehr aufregen und angsten.
Ich habe aber zum Glück ein Gnubbel, mit dem kann ich zwischen alten und neuen Schlieren wechseln, das ging vorher nicht, da wusste ich gar nicht, dass ich so ein Gnubbel auch habe. So stelle ich fest, dass ich Gnubbel habe, die ich entweder sehen kann oder auch nicht. Die sichtbaren sind am weitesten von mir weg, man kann mit ihnen flattern, zappeln, strampeln und stoßen. Die unsichtbaren sind ganz nah bei mir. Die bin irgendwie ich. Was genau geschehen ist und warum auf einmal alles anders ist, bleibt rätselhaft. Und ich bin dauerschwer. Auch wenn ich immer mal wieder weg bin.
Ringsherum an mir ist alles weißweich. Das fühlt sich genauso an wie die Umpellung. Und es ist auch wie eine Umpellung. Aber man kann sie weggnubbeln, ohne dass sie immer gleich wieder zurückkommt. Die neue Umpellung drückt mich längst nicht so zusammen wie die alte. Und sie hat Stellen, wo sie nicht da ist.
Je öfter ich das neue Schlierenspiel sehe, desto mehr starre, feste, harte Schlieren entdecke ich. Manche sind grellhell. Meist aber sind sie richtig grellweiß. Immer mehr ganz gerade starre Schlieren kann ich erkennen. Sie bewegen sich gar nicht. Und die sind immer erschreckend unvermittelt ergnubbelbar. Damit sind sie groß und nah. Das angstet erst besonders. Deshalb wäähe ich immer wieder, um der Drohung etwas entgegenzusetzen. Um auszugleichen.
Immer wieder regelmäßig kommt es vor, dass das Sehgnubbel anscheinend nicht richtig funktioniert. Ich sehe, aber ich sehe doch nichts. Dann angsten mich starre, ganz grelle, gelbe, gerade Linien, die schwertstechend das Dunkel des Raums durchbrechen. Und wenn mein Sehgnubbel wieder funktioniert, dann sehe ich starre, weiße, dicke Linien, die von der weißweichen Umpellung ins Untenoben gehen – oder umgekehrt. Davon sind viele da. Alle nebeneinander ergnubbelbar. Und überall. Die angsten auch.
Dahinter dichtdrücken oft weiße wedelnde Wesen. Manchmal kommen diese weißen Wesen auch von oben angstend rüber. Aber immer nur dann, wenn es hell ist. Und überall feinnadelt es immer mal wieder, ich zittere, wenn die Umpellung weg ist. Dann höhle ich mich in mein Wattewischelwuselweichweiß, um bald weg zu sein.
Alles, was mich anfassen will und an das Dutummen erinnert, angstet. Ich fühle mich den mich umgebenden riesigen Weißkittelwesen hilflos ausgeliefert. Die kommen aus einem fernen kleinen Schatten, sind erst verschwommen, wachsen immer schneller, bis sie ganz riesig vor mir sind. Dann sind sie sogar mit den baumelnden Gnubbeln ergnubbelbar. Ich wäähe mit meinem unsichtbaren Gnubbel.
Als das, was ich mich finde, und dort, wo ich mich finde, will ich nicht wirklich sein. Aber es gibt kein Entrinnen, ich fühle mich schwer und nicht mehr so leicht wie vorher, und ich fühle mich mitgerissen. Mitgerissen von einem unerbittlich dahinfließenden Strom, dem Strom der Zeit im Raum. Durch die in einer Zeitdimension gefangene Körperung wird meine Existenz, die Welt, nun erlebbar.
Immer wieder wäähe ich mit meinem Gnubbel, das dicht an mir ist. Und versuche, die alten Schlieren einzuschalten, um wieder in mir ruhen zu können. Aber meine Umgebung drängt sich stetig auf. Es weißt überall. Manchmal sehe ich auch ein rundes Schlierenmuster, das ganz komisch buntet und erstarrt scheint. Es bewegt sich nicht weich und sich selbst erzeugend, sondern abrupt oder gar nicht. Mal sehe ich es, mal nicht. Ich weiß nicht, was ich da sehe.
Manches ist ergnubbelbar, manches nicht. Es gibt in diesen starren, beunruhigenden Schlieren ein Nah und ein Fern. Und aus fern kann nah werden. Immer dann wird aus klein und leise auch laut und groß. Und aus nah kann fern werden. Dann wird aus groß und laut wieder beruhigend klein und leise. Schlieren kommen her und gehen weg.
Irgendwann begreife ich die starren grellen Schlieren als meine Außenwelt. Viel mehr noch, sie geben eine neue Struktur, eine neue Heimat. Aber die geraden Linien, die von der nahen untenen Umpellung bis ins ferne Oben gehen, die angsten noch immer. Man kann sie ergnubbeln, sie kommen von oben und gehen an mir vorbei nach unten. Sie markieren das Ende des Weichs, in dem ich bin. Ich sehe nicht nur ein Bild von meiner Welt, ich bin Teil des Bildes und das Bild ist um mich herum. Und es weißgrellt überall. Ja, meine neue Welt ist weiß, dann unsichtbar oder auch gilbweiß. So eine Weißung ist immer in derselben Reihenfolge:
Unsichtbar – gilbweiß – weiß – gilbweiß – unsichtbar.
Wenn es hell ist, dann weißt es. Die Unterpellung, die Umrandung, die Überpellung, die Wesen. Alles. So erlebe ich, dass es immer abwechselnd hell und dunkel ist. Wenn es dunkel ist, kann es auch plötzlich grellhell werden. Das kommt dann immer von dort, wo die gelben, ins Dunkel stechenden Linien sind.
Immer mal wieder dröhnen auch die Vibrationen. Irgendwie erinnernd in mir. Sie sind aber jedes Mal urplötzlich weg, wenn ich das Weichweiß erblicke. Und oben an der beruhigend weit entfernten Decke des Raumes flattert es drohend oder fleckt grauringplakatig.
Ich ergrabbele alles, was ich ergrabbeln kann. Direkt über mir flattert das blassgelbe Oben. In langen, faltigen Schatten. Die starren Schlieren werden dinglich. Ich entdecke bunte Sachen um mich, die neugierig machen. Dann spaßt das Ergrabbeln. Während das Weichwuschelweiß weich ist, ist das Ergrabbelbare meistens hart. Und immer mal wieder zwatschert ein Weißkittelwesen. Das ist mal ganz nah, mal ganz weit weg. Dann höre ich es nur leise zwatschern oder immer lauter und dichter regelmäßig klackern.
Plötzlich kommt ein Tag, da verbuntet auf einmal alles. Ich finde mich zwischen buntplümeranten Umrandungen und Wesen wieder. Ich wäähe, was ich kann. Denn ich fühle mich erneut verloren. Wieder und weiter voll mitgerissen, mitgerissen von dem unerbittlich dahinfließenden Strom, dem Strom der Zeit im Raum.
Wo ist das Weißeweltweiß? Warum ist die weiße Welt nicht mehr da? Wo ist mein Wattewischelwuselweichweiß? Wo sind all die weißen Wesen, an die ich mich endlich gewöhnt hatte? Keine weißen knisterknirschenden Knitterkittel mehr! Kein Weißeweltgeruch mehr! Alles, aber auch alles anderst zunächst bedrohlich angstend.
Erst das Schlierenspiel, das erstarrte, und nun verbuntet die weiße Welt. Statt Weißkittel nun Grellbuntplümerante und viel rauschiges, anscheinend nie endendes Gezwatscher der Wesen.
»Wäääääääh! – Wäh – wäh.« Nach vielem Gewäääh gibt es irgendwann endlich wieder ein Weißkittelwesen. Es entfernt die Untengnubbelumpellung. Und es gibt mir ein gefülltes Saugrohr mit weißem dicken Fettgnubbelwasser drin.
Das Verrutschen der Untengnubbelumpellung führt manchmal zu einem eigenartigen, erregten Kribbelgefühl, das in einem Würgen des umwindelten Gnubbels seinen abrupten Abschluss findet und das in sich selbst wunderschön angenehm ist. Aber oftmals kommt es vor, dass dieses Gnubbel in der Windel verknotet wird, ich deswegen wäähe, dann immer gleich so eine duftige Milchpulle nibbeln soll, was ich aber überhaupt nicht will. Dieses weiße Kittelwesen versteht mich genauso nicht, wie ich es nicht verstehe. Aber manchmal vielleicht doch.
Irgendwann nimmt mich das Weißkittelwesen und packt mich in ein anderes Weichwuschelweiß. Das geht ganz weit hoch vor mir. Und darüber sehe ich dann vorne nur eine blaue Fläche. Ich werde hoch unter dieser sich bewegenden Fläche woanders hingefahren. Wo in der blauen Fläche grüne Flecken an braunastigen Stangen im Wind wedeln. Und es gibt umsummende schwarze Kitzelpunkte. Und auf dem Weichwuschelweiß tanzen Schatten. Licht und Schatten flattern und wedeln über das Weichwuschelweiß. Und auf das flatternde, steile Dach über mir. Überall. Ich bin irgendwo, wo es dieses Flattern gibt, wo es diesen Dschungel aus raschelgrünen Flecken gibt, aus dem es Licht und Schatten schauert. Derweil bin ich ganz ruhig. Und es ist still. Stille, die nur unterbrochen wird von den summenden Kitzelpunkten und einem anschleichenden Rascheln, das von dort kommt, wo das Licht durch den grünfleckigen Dschungel schauert. Das Stoffweiß türmt sich vor mir auf, und hinter mir ist ein Stückchen gilbweiß. Und direkt vor mir Buntplümerantes. Und es wabbert, wenn ich mit den Gnubbeln zappele. Das Kittelwesen kommt aus dem Strahleblau über das Stoffweiß und zwatschert. Ich gulpe, gluckse, nutschere oder wäähe, je nachdem, was ich bin oder will. Aber das Kittelwesen zwatschert nur.
Wörterndes Gezwatscher
Irgendwann erkenne ich bewusst, dass da ja nicht nur ein Weißkittelwesen ist, sondern auch ein Buntkittelwesen wedelt. Und dass es sogar verschiedene Buntkittelwesen gibt, manche davon zwatschern gleichartig, manche sind anderszwatschig. Irgendwann kommt ein Tag, da gibt es besonders viel Gezwatscher. Da gastieren bei uns viele andere bunte Wesen. Und solche Tage kommen auf einmal immer öfter vor. Da erreichen mich bewusst zwei Arten von Gezwatscher. Hohe, helle Stimmen. Und tiefe, dunkle Stimmen. Es gibt also zwei Arten von zwatschernden zweibeinigen und zweiarmigen Wesen. Es sind viele, sie sind überall und zwatschern und zwatschern. Und knaspern und knaspern. Am Ende des Tages zwatschern die bunten Wesen auf den Weichsitzen rund um einen Hartbrauntisch.
Irgendwann erreichen mich nicht nur das Gezwatscher, sondern Lautungen, die sich aus dem Gezwatscher durch Öfterung besonders markant machen, ohne dass ich bereits weiß, was sie bedeuten sollen. Weil sie hintereinandern: »Mma-mma, Mma-mma« und »Paa-paa« sowie »Pe-ter« und »Nein – nein – nein«. Diese Mehrfachgleichlautung kommt besonders oft, wenn ich grabbele, wobei das letzte »Nein« immer am lautesten und am schnellsten ist. Wenn ich mit dem Grabbeln aufhöre, kommt kein Nein-Gezwatscher mehr. Was einerseits beruhigend ist. Aber andererseits: Warum kommt das, wenn ich doch einfach nur grabbeln will? Das Weißkittelwesen wird so komisch, dass das Grabbeln dann nicht mehr spaßt. Wenn diese Nein-Lautung kommt, halte ich immer inne, damit dieses laute und schrille Neinen endlich aufhört. Wenn es aus dem Weißkittelwesen neint, dann muss ich immer aufhören. Wenn es neint, dann endet das, was vorher spaßte, weil es enden muss. Damit bedeutet dieses Neinen offenbar, mit dem Gegrabbel zu enden. Wenn es neint, dann soll etwas nicht sein. Wenn ich Spaß kriege beim Grabbeln, kriege ich Nein-Stress. Und wenn es gar nicht erst neint, spaßt es oft vorher nicht. Das Sein ist komisch.
Ich empfange nicht nur diese störende Nein-Lautung, sondern immer mehr Gezwatscher wird zu anderen Lautungen. Es lautet, wenn ich aus der Umpellung genommen werde, es lautet anders, wenn es Fettgnubbelwasser gibt. Wenn das Gezwatscher zerlegt und strukturiert werden kann, wird es zu wiedererkennbaren und wiederholbaren Lautungen. Dann muss mich das Weißkittelwesen ja auch verstehen, wenn ich das auch lauten könnte! Vielleicht kann ich ja mein eigenes Gezwatscher beim Weißkittelwesen in Lautungen verwandeln? Ich übe verschiedene Lautungen mit meinem Gnubbel, weil das mir dann ermöglichen kann, auch zu neinen, damit das Weißkittelwesen mit dem aufhört, was mich stresst. Aber es will einfach nicht so neinen. Noch nicht. Immer wieder »mm – nn – nn – na – mma – paa«. Mehr nicht. Erst mal nicht. Schade.
So werden einige Hellungen und Dunkelungen später dann doch das Mmammanen, das Paapaanen und das Neinen meine ersten Lautungen, die das Weißkittelwesen versteht. Aber noch nicht ganz! Vor allem das Mma und das Pa sind noch nicht klar. Aber das Nein scheint das zu bedeuten, was ich brauche! Endlich kann ich auch was lauten!
Die andere Lautung, die ich immer wieder höre, ist so etwas wie »Haschalle«. »Na, was hat denn mein kleines Hascherle?«, zwatschert das Weißkittelwesen, ohne dass mich das inhaltlich wirklich erreichen kann. Es kommt daher wie hartes, zerhacktes Gezische. Kittelwesenzwitschern. So wird meine zweite Lautung, die das Weißkittelwesen zu verstehen scheint, irgendwann »Hasss-ha!«, was sich kurze Zeit später vervollkommnet zu »Hassa!« und irgendwie irgendwann sich auch weiter zu »Hascha« evolutioniert. Aber was diese Lautung ganz genau bedeuten soll, bleibt unklar.
Ganz allmählich kommen so immer weitere Lautungen hinzu. Es kommt oft vor, dass das Weißkittelwesen irgendwas macht, was ich nicht will. Ich verbinde daher aufgrund der Erfahrungen mit dem Neinen meine ersten beiden Lautungen zu »Hascha nein!«. Hascha will das nicht! Hascha soll das nicht. Hascha – das ist immer da, wenn ich da bin und das Weißkittelwesen da ist. Hascha ist die Art der Verbindung zwischen dem Weißkittelwesen und mir. Immer wenn das Weißkittelwesen etwas nicht will oder ich etwas nicht will, dann »Hascha-nein-t« es.
Nach einigen weiteren Hellungen ist irgendwann die Draußenzeit vorbei, da pudert es hinter dem gefrorenen Nichts, das die warmen Wände vom kalten Außen trennt. Es weißt alles in Stille. Und wenn ich draußen unter dem hohen Stoffweiß ausgefahren werde, feinnadelt es oft wieder: Es ist kalt. Dann wäähe ich wieder los. Es ist auf einmal oft kalt. Das war schon mal so, es angstet vor dem Kalt. Die schneeige Stille ist vor allem draußen so groß, dass ich in mir etwas höre und spüre, das mich irgendwie an das Dutummen erinnert. Mein eigener Puls. Es ist so still, ich höre mich selbst, ich spüre es im Ohr, in der Nase, überall.
Das Weißkittelwesen verbuntet sich immer öfter, und ein festes Buntkittelwesen gehört offenbar auch zum Haus. Beide erkenne ich vor allem an der ganz eigenen Art ihres Gezwatschers. Von Tag zu Tag wird mir klarer, dass das eine Weißkittelwesen, das immer bei mir ist, offenbar mit der Lautung »Mama« erreicht werden kann, das Buntkittelwesen mit der Lautung »Papa«. Da es die beiden einzigen Wesen sind, die immer wieder zu sehen sind, werden sie für mich zu den Papamamas.
Über die Zeit hin verdichtet sich die Vermutung, dass die gezwatscherte Lautung »Peter« irgendwie ich sein soll. Ich, Peter!
Mit der Zeit wird es möglich, alleine loszukrabbeln. Dabei entdecke ich auf dem harten Boden überall viele Linien. Besonders im weichkuscheligen Umwandeten, wo es raumt. In den meisten, aber nicht allen Räumen, bohnert es warme glanzkackbraune Bretter mit dunkleren Ringeleiern darin und vielen geraden Ritzen dazwischen. Und es raumt überall mit »Bohnerwachs«, so lautet das Mamawesen die Sache mit dem glänzenden, harten Boden. Deswegen bohnert es für mich überall.
Und dann gibt es zwei enge Raumungen mit Linien, die gleich weit voneinander entfernt hin- und her- und vor- und zurücklaufen. Dazwischen gibt es graue und schwarze kleinste kalte Klackerplatten. All das erkrabbele ich. Immer den Linien folgend lerne ich so das Klo und das Bad kennen.
Irgendwann feststelle ich, dass viele Dinge nur da oben sind. Um das Obene zu ergrabbeln, muss ich mit den Händen an den Wänden hochgehen. So geht es immer an der Wand lang durch die umwandeten Raumungen. Irgendwann entdecke ich, dass ich auch ohne Hände an den Wänden stehen kann. Dazu drücke ich mich von der Wand ab und lasse mich wieder daranfallen.
Dieses Ohnehändekrabbeln hat klare Vorteile: Ich kann viel weiter kucken, ich kann viel höhere Sachen anfassen, wie zum Beispiel den Rand des braunen Tisches im Sofaraum, der »die große Stube« heißt. Aber dennoch knie ich gerne, das ist stabiler, sicherer und zunächst auch viel schneller. So entdecke ich nach und nach die verschiedenen Raumungen im Haus.
Da gibt es welche mit grünen, gelben, roten und weißen, sich immer wiederholenden, mehr oder weniger huckeligen Papierbildern an der Wand. Und da gibt es welche, die haben ganz glatte, kalte, weiße, pissgelbe oder blassblaue Flächen an der Wand, die von Rillen umgeben sind, die sowohl von oben nach unten als auch von der einen Seite zur anderen gehen.
Und es gibt kalten, schwarzlinigen Plattenbohner, warmen, gelbbraunen Bretterbohner, Kurzhaarebohner und Langhaarebohner, die eigentlich kein Bohner sind, sondern sich weichkomisch anfassen. Bohner ist immer hartglatt. Und es gibt Kleinkariertbohner. In allen Räumen, in denen Kleinkariertbohner ist, dem Bad und dem Klo, rohrt es Wasser. Bei der großen Tür, die in eine feinnadelige, kalte Welt ohne Umrandungen, dem Draußen, führt, gibt es schwarze Linien, die von vorne nach hinten gehen und quer von Wand zu Wand. So blitzen sie über den glatten, gilbweißen, feinnadeligen, flächengroßen Flurplattenbohner. Und dort, wo es nuckelig nach Essen und Trinken riecht, bohnert es ein graues, erstarrtes, körniges Schlierenspiel. Dieser Bohner ist Teppich aus Plastik.
Irgendwann kommt ein Tag, da steht auf einmal in unserem Wohnzimmer so ein stacheliger Tannenbaum, wie es davon draußen viele gibt. Drinnen aber ist er mit Lichtern. Die Papamamas lauten das Tannenbaumen im Raum »Weihnachten«. Und es knistert verbuntetes Papier, hinter dem Sachen versteckt sind. Und es gibt schwingende Lautung aus einem Bandabspielgerät mit dicken Knöpfen.
Einige Hellungen weiter sind auf einmal drehende, bunte papierene Stangen im Raum, die von ganz weit oben unter der weißen Rubbeldecke sich aufringelnd herunterkommen. Es lustet mich, die langen, sich drehenden, dünnen Papierstangen zu jagen. Sie sind weich und buntig, sie wedeln hin und her. Es spaßt, die zu drehen und zu drehen und zu drehen, um zu sehen, wie sie sich andersherum von selber drehen, drehen und drehen.
Und noch mal einige Hellungen weiter sitzen am Tisch im Anrichtenzimmer die Papamamas und faltige Ommaliesen. Die eine ist Omma Liese und die andere Omma Liesbett. Heute soll der Tag sein, an dem ich »auf die Welt kam«, so die noch nicht voll verstandenen Lautungen.
Alle kommen im Anrichtenraum, der auch »die kleine Stube« heißt, zusammen. Doch mich interessieren mehr die Kaischiffe und das Wasser im Rahmen an der Wand. Nebenan gibt es einen Hochtischraum mit Hartkugelkissen, einem Schrägsofa und einer buntweichen Wand. Und im Sessel- und Sofaraum ist viel Bohner, aber hier wachst es oft und nur selten darf ich da rein. Da schrankt ein Nussbaum mit vielen aufklappbaren, blätterbaren Büchern.
Irgendwann begreife ich, dass das Umwandete im Draußen unser Haus ist, das in einem großen Obst- mit angrenzendem Gemüsegarten steht. Mittlerweile habe ich alle Raumungen des Hauses erforscht und in ihren Funktionen begriffen: Kinderzimmer, Bad, Küche, Klo, kleine Stube, große Stube, Schlafzimmer, wo es riesiges Wattewischelwuselweichweiß gibt.
Irgendwann darf ich auch die Welt ohne Umrandungen, das Draußen, erforschen. Das sah ich auch bereits aus meinem Weichwuschelweiß, als ich im Draußen umhergefahren und abgestellt wurde. Dort wo das Oben vor dem Strahleblau wedelgrün ist. Da bin ich nun, um mehr zu sehen. Von außerhalb des hohen Weichwuschelweiß.
Die wedelnden Blätter und flatternden Schatten sind auf dem Teppich, der hier ganz lange grüne Haare hat. Und die Blätter sind an dicken Linien mit dem Boden verbunden. Sie sind immer krumm und verzweigt. Geradezu wohlwollend geordnet dagegen sind die Teppichausklopfstange und die von ihr verbundenen Wäscheleinenpfeiler. Daneben steht eine Bank am großen, backsteinrot gemusterten Haus. Da sitzen oft omafaltige Wesen, die uns besuchen, gerockt und hellstimmig. Manchmal gibt es da auch gehoste, dunkelstimmige Wesen.
Ich begreife, dass die hoch- und hellstimmig zwatschernden Kittelwesen Tanten und die tief- und dunkelstimmig zwatschernden Onkel heißen. Onkel und Tante, Tanten und Onkel. Damit wird das Weißkittelwesen zu einer besonderen Tante, die Tante »Mama«. Und das Buntkittelwesen wird der Onkel »Papa«.
Seit langem sitze ich, Peter, drinnen so hoch, dass ich den Tisch endlich nicht nur von unten, sondern auch von oben sehen kann. Mein Hochsitz besteht aus bohnergelben Holzstangen mit einer blutroten lederriechigen Pfüitt-Stoff-Sitzfläche. Die hat eine Rundscheibe genau unter mir, wenn ich da drinnen sitze. Und die kippt manchmal weg, so dass mich diese schief berührt oder ich sogar mit meinem Hintenunten darüber in der Luft sitze. Manchmal wird diese Rundfläche von der Mamatante weggenommen, dann kann ich da gleich reinmachen, vorne und hintenunten.
Ich habe auch ein bleichrosanes Töpfchen, in das ich jetzt immer reinmachen soll. Deswegen bekomme ich jetzt keine Untengnubbelumpellung mehr. Einerseits fühle ich mich jetzt ungewohnt nackthosig, andererseits ist endlich der störende Stoff weg und ich entdecke schnell, dass ich mich nun viel besser bewegen kann. Die anfängliche Skepsis weicht der windelbefreiten Begeisterung.
Wann immer mich nur Gezwatscher erreicht und entweder die Mamatante oder der Papaonkel etwas von mir will, sage ich: »Nein!« Da ich auf alle Fragen neine, zwatschert irgendwann die Tante Mama zum Onkel Papa: »Der kann kein Jott! Der hat nen Sprachfehler!« Aber auch das erreicht mich nicht wirklich. Jott angstet. »Sag mal J-J-J-j-j-j-aaaa!«, echoen die Papamamas. Doch es dauert noch, habe ich doch bisher selten etwas nachgemacht, sondern immer meine eigene Weise gefunden, über diese Welt zu lernen. Und Nein war gut. Jedenfalls bisher. Was passieren würde, wenn ich Ja sage, ist unbeherrschbar. Also bleibt es beim Nein, bis mich schließlich die Einsicht erreicht, dass ich mit Ja vielleicht auch schöne Dinge bekommen kann, die ich haben will oder die mir angeboten werden.
So übe ich das Jaen, heimlich eingezimmert. Als mich dann die Mama einmal fragt: »Willst du noch was trinken?«, antworte ich mit »Ja!«. »Sag das noch mal!«, antwortet die Mama. So bekomme ich nach einem neuen Ja tatsächlich die Pülli mit dem milchigen Glibbersaft darin in den Mund geschoben, und ich kann wieder am Weichplastikknauf saugen, der so süßmilchig schmeckt und riecht.
Der Raum, in dem ich meistens meine Glutschepülli mit Sauglutschnapf bekomme, ist die Küche. Da gibt es vor dem glasklaren Nichts, das die Küche vom Draußen abtrennt, eine breite Umrandung, auf die ich immer raufklettern kann, wenn ich mir vorher eine kleine Stuhltreppe gebaut habe. Auf dieser breiten Umrandung steht ein gelber Kasten, aus dem schwingende Laute kommen, wenn man ihn knopft, das Küchenradio. Die Umrandung ist mein Spielland. Von hier kann ich immer das Draußen krabbelnd sehen.
Wenn es draußen dunkelt, dann passiert allerdings etwas ganz Merkwürdiges. Dann ist die Küche hinter der Glasscheibe des Fensters noch einmal vorhanden. Und da sind immer die gleichen Dinge und Wesen wie in der Küche. Als ich das erstmalig so sehe, angstet mich das. Weil da Dinge sind, die nicht da sind, aber doch hinter einem gefrorenen Nichts, dem Küchenfenster, da sind.
»Du sollst doch nicht immer so viele Finger an die Scheibe machen!«, lautet die Mama wiederholt. Aber ich bin wie immer neugierig, will das verstehen. Allein. Ohne die Mama, denn die versteht vieles nicht, was mich fasziniert. So bewege ich meinen Arm vor und zurück. Dabei stelle ich fest, dass das andere Wesen alles, was ich mache, auch immer macht.
Ich komme zu dem Schluss, dass es mich, Peter, dort auch gibt, es gibt mich mehrmals. Denn ich steuere dieses Wesen hinter dem Nichts genauso wie Peter selbst. Schließlich betrachte ich meine Finger ganz genau, jede Furche und Falte. Und stelle fest, dass das Wesen hinter dem Glas ganz genau die gleichen Finger, Furchen und Falten hat. Damit erlebe ich dieses Glas als ein Fenster zu mir. Ich erlebe, wie mein Wesen aussieht, aber nur wenn es draußen dunkel ist. Peter entdeckt, wie er sehen kann, wie er von der anderen, hinteren Seite aussieht. Interessant. Spannend. So sehe ich also von außen aus.
Wenn es hell ist, also tagsüber, ist hinter dem Fenster da draußen der Hofplatz mit der Teppichausklopfstange. An der Teppichausklopfstange hängt eine klackende Babyschaukel mit eingeseilten Holzrohren. Die Holzstabschaukel ist doppelgut: Zum einen klacken die Holzstäbe beim Reinsetzen. Peter schiebt diese Stäbchen hin und her: klack – klack – klack. Zum anderen schaukelt die Schaukel hin und her: nach vornobenhoch – rückschnellvorbeiunten – nach hintenobenhoch – vorschnellvorbeiunten. Schon bald ist das Oben immer weniger und das Schnellunten immer langsamer. »Anschwung geben – Anschwung geben – Anschwung geben!«, dafür ist diesmal das Braunstoffkittelwesen verantwortlich, der Onkel Papa.
Je höher ich komme, desto mehr spaßt es. Manchmal kann ich sogar hinter die Mauer kucken. Die Welt ist so groß. Welt, das ist das, wo ich, Peter, bin. Ich beginne, in dem Peterwesen, dem Peterkörper, die draußene Welt zu entdecken.
Der Klorohrbaum im Kohlenkeller
Langsam begreife ich bewusst die Zusammenhänge zwischen den wandgetrennten Räumen im Haus. Durch den Flur komme ich zum Bad. Über mir sind die Waschbecken, und neben mir wachsen metallglänzende Äste aus der Wand, die Rohre. Und da gibt es dicke verknotete Rohre und dünne Rohrungen mit Schaltern. Solche Rohrungen wachsen auch in den Wänden und im Fußboden. Da gluckert das Wasser in die Wand oder unter den Fußboden. Weg ist es. Große und kleine Becken mit Rohren darunter. Hinter einer der Türen entdecke ich einen Kletterweg ins Dunkel, eine grausteinerne Treppe. Der treppige Weg führt ins Unten in eine riesige, raumreiche, unheimliche Höhle unter dem Haus, in den kalten, kahlen Keller. Mit einem schwarzen Schalter lasse ich es dort lichten. Nun erforsche ich erstmals diese noch unbekannten, geheimnisvollen Raumungen unterhalb des Bohners.
Händend und füßend krabbele ich kletternd die kalte, glanzbetonige Kellertreppe hinab. Hinter einer Tür finde ich in einer staubigen Raumung, die vorne zugebrettert ist, einen riesigen Haufen dreckiger, schwarzer Steine. Unser Kohlehaufen. Und an der kalkweißen Wand entdecke ich einen steinernen, kahlen, dickwandigen Rohrbaum mit Rohrringen. Dessen rohrende Äste verschwinden im Oben der Höhle, der Kellerdecke. Die Rohrbäume wurzeln im kaltfeuchten Kellerfußboden. Und manchmal gluckurgelt es darin, und es macht pütschatt-schatt-schatt.
Der größte Rohrbaum an der weißsteinigen Wand ist ein Klorohrbaum. So sieht er aus:
Das Pütschatt-schatt-schatt kommt immer dann, wenn treppoben im Klo der Drücker der Spülung gedrückt wird. Das finde ich schnell heraus. Denn das Klo ist genau hier über der kellernen Höhle.
Aber da sind noch weitere, kleinere Rohrbäume in diesem Teil der Höhle. Sie wachsen ebenfalls aus dem Kellerfußboden. Und sie verschwinden oben genau an der Grenze zwischen Bad und Küche. Die Rohrbäume sind sehr interessant. Die Kurven, die Verdickungen, die Abzweigungen. In der Kellerhöhle entdecke ich weitere Rohrungen in der Waschküche. Äußerst interessant. Stundenlang kann ich mir die ankucken. Überall laufe und krabbele ich hin, um mir noch unbekannte, verborgene Rohrungen zu entdecken. Das spaßt mehr, als draußen zu sein, denn dort zeigt sich die Welt jetzt wieder stangenastig, dunkel, kahl und kalt.
Alles wiederholt sich anscheinend. Erneut lichtet ein buntes Geschenkefest, es weihnachtet. Und Peter hat wieder Geburtstag. Geburtstage sind Tage, an denen Onkel und Tanten kommen. Und viel Gezwatscher herrscht. Derweil tortet der Tisch, und unterm Tisch ist Peters Höhle. Herrlich dunkel gemütlich.
Draußen ist währenddessen das stille Weiß höher als ich selbst. Das ist herrlich juchzig, weil ich da von Papa, dem Buntkittelwesen, immer reingeworfen werde. Und ich kann mich darin höhlig verstecken. In dieser Zeit heizt im Haus immer ein rostroter, blecherner, runder Ofen. Oft schaue ich mir dann die bunten Wände voller Tapetenlinienstrukturen und Tapetenmuster, die sich immer wiederholen, an. An ihnen fährt mein Blick auf und nieder, wenn der Ofen aus feinnadeligem Kalt ein deckenkuscheliges Warm im Raum macht.
Seit längerem baue ich mit bunten Holzbauklötzen und mit Biegnadelsteinen. Die befinden sich in einem Dash-Eimer, der breite, bunte, farbwichtige krumme Linien hat. Die Mama kippt ihn in der Küche auf dem Bohner aus. Das Sortieren, Aufschlangen und Stapeln ist juchzig. Stundenlang spiele ich »Wie hoch geht der Turm, bis er umkippt«, reibe die glatten Holzbauklötze aneinander, weil das so schön geschmeidig ist, stecke die Biegnadelsteine ineinander und versuche, deren Nadeln am Finger zu biegen, auch in der Hand und vor allem streichend am Arm. Oft bin ich allein im Haus, denn die Mama ist derweil draußen im Garten, der Papa »auf der Hütte«, einem Ort, wo die Leute blaue Jacken anhaben sollen und wo es viel dreckt. Die Hütte kann man von zu Hause sehen, da sind ganz hohe runde Türme, aus denen es wolkt, mal heiter wattig hell, mal dreckig dunkel. Und manchmal kann ich die Hütte auch riechen. Dann sticht sie nah in der Nase, obwohl sie weit weg ist.
Der rote, lederriechige Hochsitz hat immer mehr ausgedient. Mittlerweile sitze ich auf der ebenso rotledrigen Sitzfläche meines dünnbeinigen Küchenstuhls. Dieser Stuhl hat mehrere Stangen hinter meinem Rücken, in denen sich durch mein Hin- und Herbewegen immer mal wieder meine Hosenträger verfangen.
Zu dieser Zeit erkenntnisse ich, dass neuerdings auch noch ein papageienbuntes Wesen zum Haus gehört. Dieses Wesen krabbelt so wie ich früher in den Umwandungen der Räume herum und erkrabbelt vor allem die Bäume unseres Obstgartens. Das machte ich bisher nie.