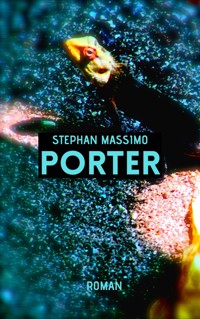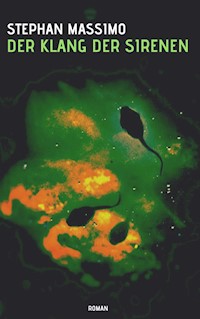
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Mitte ihres Lebens ist Helen plötzlich alleine. Ihr Mann hat sie verlassen, ihr Sohn lebt auf einem anderen Kontinent und befindet sich auf einer Everest Expedition. Als eines Morgens ihre Katze erschossen wird und kurz darauf ihre Mutter stirbt, befindet Helen sich endgültig im Niemandsland zwischen dem Ende ihres alten Lebens und einem unbekannten Anfang. Die Menschen, die ihr auf ihrer Reise in eine fremde, unvertraute Freiheit begegnen, werden von ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten angezogen, wie vom Klang der Sirenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
STEPHAN MASSIMO
DER KLANG DER SIRENEN
© 2023
Die beste Weise, alle unsere Wünsche zu befriedigen, besteht darin,
all unsere Pläne zu Ende zu führen, das heißt, sie fallen zu lassen.
(Dilgo Khyentse Rinpoche)
PROLOG
COLIN
Der Vollmond im nahtlos dunklen Himmel wirkt so nah, als sei es möglich, ihn mit den Händen zu berühren. Seit zwei Nächten schwebt er über dem Gipfel des Mount Everest wie eine gleißende Passage in die sinnlose Schönheit ferner Galaxien, die durch den Uterus der Unendlichkeit treiben. Die Gebetsfahne der Sherpas und bunte Wimpel flattern im Wind. An Zeltschnüren befestigte Lampen und Glöckchen schaukeln im gleichen Rhythmus. Der Atem eines Yaks verströmt sich in die eisige Luft. Colin steht ein Stück abseits des Zeltlagers, verspürt den Drang das Tier aufzuschneiden und in den warmen, blutigen Leib zu kriechen. Er atmet aus, und als alle Luft aus seinen Lungen gewichen ist, verliert sich jede Begründung an diesem Ort zu sein, in der Erbarmungslosigkeit der Natur. Es war sein großer Wunsch diese Tour zu gehen, aber jetzt versteht er ihn nicht mehr. Der Yak zuckt und beginnt zu pissen. Colin hält seine Hände unter den warmen Strahl, lässt sich von der Wärme Mut machen, säubert sich dann mit Schnee, der wie Feuer auf seiner Haut brennt. Den Blick auf den mondhellen Gipfel des Everest gerichtet, stapft er zurück zum seinem Zelt. Jeder Schritt dorthin fällt ihm schwer. Er kriecht in das Zelt, schließt es, verstaut seine bleischweren Glieder im Schlafsack. Sein gesamtes Dasein besteht nur noch aus simplen Impulsen – hechelndem Atem, dröhnendem Kopfschmerz und schnellen, fiebrigen Herzschlägen. Mit klammen Fingern zieht er das Asthmaspray aus seinem Rucksack und führt es an seinen Mund, aber selbst der Gedanke, er könnte der erste Asthmatiker auf dem Gipfel des Everest sein, hat weder die Kraft, ihn zu trösten, noch ihn zu motivieren. Ist es das wirklich wert, Colin? hört er Miranda sagen. Er richtet sich auf. Obwohl er weiß, dass Miranda in Melbourne ist, suchen seine Augen das Zelt nach ihr ab, nach ihrem Körper, in dem die Wärme des australischen Sommers gespeichert ist, den er gegen den Everest eingetauscht hat.
Der Schlaf nähert sich Colin wie ein scheues Reh. Seine Augen fallen zu, öffnen sich sofort wieder, bewachen sein Leben. Der Vorgang wiederholt sich, wird zu einem Muster, einem Rhythmus. Ein tibetanisches Mädchen betritt das Zelt. Sie kann nicht mehr als ein Traum sein. Schon einmal, vor langer Zeit, ist Colin das Mädchen erschienen, aber im Gegensatz zu ihm hat es sich nicht verändert. Es berührt seine Augenlider, schließt sie, wie man die Augen eines Toten schließt.
»Schlaf, Colin«, flüstert das Mädchen. »Menschen, die nicht schlafen, träumen nicht. Und wer nicht träumt, ist schon vergangen.«
TRÄUME
PEDRO
Pedro Gonzales erhebt sich von der Gymnastikmatte, auf der er seit geraumer Zeit versucht, sich auf seine Übungen zu konzentrieren. Jenseits der Fenster seines Apartments blutet die Sonne aus. Jedem Morgenrot folgt ein schlechter Tag, sagt man da, wo er herkommt. Wenn der Lärm auch nur noch eine einzige Minute anhält, befürchtet Pedro sich darin zu verirren wie in einem Spiegelkabinett. Um fünf Uhr morgens hat ihn der tropfende Wasserhahn in der Küche geweckt. Inzwischen hat sich der Krach vermehrt wie Karnickel. Seit einer Stunde hämmern stampfende Bässe und die orgiastischen Wogen eines nicht enden wollenden Beischlafs aus der angrenzenden Wohnung gegen die Wände seines Wohnzimmers. Im Reihenhaus schräg gegenüber will das Schreien eines Babys nicht aufhören und hat sich mit den Klagelauten einer Katze vermischt, die durch den Garten der angrenzenden Villa streunt. Pedro rammt einen Besenstiel gegen die Wand. »Hört endlich auf! Wie viele seid ihr da drüben eigentlich?« schreit er und hämmert wieder und wieder gegen das Mauerwerk, aber wie seine Ohren, so gehorcht auch seine Wut dem Rhythmus der obszönen Schreie, die wie ein kreischender Zug einem Prellbock entgegenrasen, einem Abgrund. Sie entspringen der Kehle von Ella Grushin, bei der Pedro sich mehr als einmal beschwert hat. Auch sie ist in dieses Land gekommen, um ihr Glück zu machen, aber während er noch immer danach sucht, hat sie es längst mit all den Soldaten annektiert, die sie im Schützengraben zwischen ihren Schenkeln kämpfen und schießen lässt. Aus ihr brüllt der Tumor der Lust, der sich nach Vollständigkeit sehnt, nach einem eigenen Leben. Ella Grushin ist einer der Dämonen, die Pedro verfolgen, die seinen müden Penis belächeln, der sich nicht mehr an seinem Leben beteiligt, seit der Lärm der Welt ihn zur Geisel genommen hat. Das jämmerliche Arsenal seiner Gegenwehr besteht aus seinen geballten Fäusten, die gegen die Wand schlagen. Er prügelt darauf ein, bis der unbekannte Soldat jenseits der Wand Ella Grushin endlich zum Sieg verhilft.
Pedro sinkt an der Wand herab, leckt sich die aufgeplatzten, blutigen Hände, schließt die Augen und kehrt zurück an die moosbewachsenen Felsen unterhalb des Wasserfalls von Sào Pedro da Cadeira. Als Kind lag er dort oft unter dem blauen Himmel der Algarve, versunken in die Musik des Wassers, die sogar den Lärm des Presslufthammers tilgen würde, der ihm seit zwei Jahren zusetzt. Er nimmt einen Schluck Wasser, fährt sich durch die Haare, die schon grau werden, obwohl er vor zwei Wochen gerade einmal dreißig geworden ist. Manchmal zittern seine Hände abends noch lange im Rhythmus des Presslufthammers weiter und es fällt ihm schwer, ein Glas oder das Besteck festzuhalten. Seit vier Monaten ist er clean, trinkt keinen Kaffee mehr, keinen Alkohol. Sogar Simone, die seinen Fernseher mehr zu lieben schien als ihn, hat er zusammen mit dem Apparat aus seinem Leben verbannt.
Er atmet ein wie die Yoga-Lehrerin es ihm beigebracht hat, kommt mit jedem Atemzug mehr zur Ruhe, aber dann jagt plötzlich ein Hubschrauber über das Haus und macht alle Bemühungen zunichte. Sofort vermehrt sich der Lärm wieder, addiert sich zu einer bösen Abrechnung mit seinen Nerven. Der Besen kippt von der Wand, touchiert die grüne Vase mit den verwelkten Amaryllen, aus der sich Blumenwasser über das helle Laminat ergießt. Das Baby beginnt wieder zu schreien und die Katze antwortet völlig sinnlos darauf. Als hätten sich alle gegen Pedro verschworen, rammt auch der unbekannte Soldat sein Bajonett nochmals in Ella Grushin. Sofort feuert sie ihn wieder an, ihre nimmersatte Fotze zu beackern, stachelt damit auch Pedro an, die Dämonen nicht einfach nur zu bekämpfen, sondern sie ein für alle Mal zu besiegen.
Das Gewehr seines Vaters steht noch immer im Dielenschrank. Simone hatte ihn mehrmals gebeten, es aus dem Haus zu schaffen. Sie glaubt, dass jede Waffe eines Tages benützt wird. Mit zittriger Hand drückt Pedro die Patronen in den Lauf. Er atmet vier, fünf Mal ins Zwerchfell, tritt dann ans Fenster, spürt den Widerstand des Abzugs an seinem Zeigefinger. Durch das Zielfernrohr wirkt das Gesicht des Babys so nah, als könne er es berühren. Eine junge Frau betritt das Zimmer, nimmt das Baby auf den Arm, wiegt es sanft, küsst es. Wenn er jetzt den Zeigefinger bewegte, wäre es nicht mehr, als würde er einen Schalter betätigen und das Licht löschen. Aber zu seinem Erstaunen folgt der Berührung des Kindes wundersame Stille. Babys, die in den ersten Stunden und Tagen nach ihrer Geburt nicht berührt werden, sterben, hat seine Großmutter ihm einmal erzählt.
Pedro denkt an die ausladenden Brüste und die warmen Schenkel von Simone, die er seit einem halben Jahr mehr vermisst als Simone. Einen Augenblick wünscht er, sie hätte ihren Körper zurückgelassen, dann könnte er sich damit zudecken, ihre Brüste nachts als Schalldämpfer benützen. Das Baby lächelt, zumindest hat es den Anschein. Pedro stellt sich vor, wie es zwischen der jungen Mutter und ihm liegt, wie er es mit seinen schwieligen Händen so sanft wie möglich streichelt. Die Frau öffnet ihr Nachthemd, hebt eine ihrer Brüste an, nach denen Pedro sich nicht weniger sehnt, als das Baby. Sie beginnt zu singen, wiegt ihr Kind in ihren Armen, stillt es. Pedro kann ihren Gesang nicht hören, glaubt jedoch, ihn wie eine Vibration zu spüren, die sich von ihrem warmen Körper ausbreitet und sie alle drei miteinander vereint. Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann jenen, diesen Moment zur Ewigkeit zu verpflichten. Aber als wolle das Schicksal beweisen wie unwichtig Pedro Gonzales ist, betritt ein Mann das Zimmer. Er nimmt das Baby an sich und sofort beginnt es wieder zu schreien. Die elende Katze stimmt ein und zusammen mit Ella Grushin entfachen sie einen schuldhaften Lärm, für den jetzt jemand bezahlen muss.
Nur mit Mühe kann Pedro das Gewehr und seine Gedanken ruhig halten. Den Mann zu erschießen, scheint ihm gerecht. Die Frau, das Baby und dann sich selbst zu töten hingegen wie eine Verheißung. Aber zuerst wird er Ella Grushin und ihren Soldaten zum Schweigen bringen, dann den Mann. Danach wird alles gut sein. Es wird nur noch Stille geben, die Frau, das Baby und ihn.
Pedro setzt einen langen Schritt über den Abgrund. Einen Augenblick lang wird ihm schwindlig, aber dann ertastet seine linke Hand das Geländer des Balkons vor dem Schlafzimmer von Ella Grushin. Im Garten der Villa, die sich mit hohen Hecken von den Mietshäusern absondert, als markierten sie die Grenze zu einem besseren Land, maunzt die elende Katze. Eine rostbefallene Kinderschaukel quietscht im stärker werdenden Wind einen monotonen Abgesang auf eine verwelkte Kindheit. Das Laub vom letzten Herbst bedeckt den Grund des wasserlosen Swimmingpools. Pedro hat die Besitzerin des Hauses noch nie darin schwimmen sehen. Ausgerechnet jetzt, da er zwischen Himmel und Erde schwebt, erinnert er sich wieder an ihren Namen, an den Augenblick, als er an ihre Tür klingelte, um sich über den Lärm ihres Laubbläsers zu beschweren. Ihr Name klingt, als sei er von einer Schauspieleragentur erfunden worden.
Helen Demeraux.
Sie öffnete die Haustüre. Ihr melancholischer Blick nahm ihm den Wind aus den Segeln. Er hatte Überheblichkeit erwartet, aber anstatt wütend zu sein, verspürte er das Bedürfnis, diese Frau zu umarmen und sie zu trösten. Die Türschwelle wirkte wie eine Grenze, die den Sommer vom Herbst trennte und Helen Demeraux vor dem ihr bevorstehenden Alter. Bevor Korallenriffe absterben, flammen sie in wunderschönen, fluoreszierenden Farben ein letztes Mal auf. Pedro sah sie nur an, erinnerte sich an den Grund seines Kommens, fand jedoch keine passenden Worte, flehte stattdessen mit den Augen um Gnade wie ein verwundetes Tier. Bitte keinen Lärm mehr. Der Lärm wird mich töten. Sie bat ihn zu warten, schloss die Tür, erschien kurz darauf wieder, drückte ihm zwanzig Euro in die Hand, verwechselte ihn vielleicht mit einem Bettler. Am Ende erfüllte sie doch noch seine Erwartung einer Frau, die in einer Welt lebt, zu der er niemals Zutritt haben wird.
Pedro versucht sein rechtes Bein auf das Geländer des Balkons von Ella Grushin zu stellen, aber seine Füße sind drei Schuhgrößen zu kurz, um sicheren Halt zu finden. Unten drohen ihm Pflastersteine und Fahrradständer. Im Garten von Helen Demeraux landet eine Amsel im knöchelhohen Gras und sofort schlägt die Katze nach dem Vogel. Hau bloß ab – denkt Pedro, aber da beißt die Katze der Amsel schon ins Genick. Es blitzt, ein Donner zerreißt die Luft, ein Schuss löst sich aus dem Gewehr seines Vaters. Pedros Hand gleitet vom nassen Geländer. Er fällt und die Menschen, bei denen er sich über den Lärm der Welt beschwert hat, werden sagen – das hat er jetzt davon.
Plötzlich ist es ganz still. Nur der Wasserfall von Sào Pedro da Cadeira rauscht in Pedros Ohren.
HELEN
Colin steht auf dem Turm der Bungee-Anlage. Unter ihm der Abgrund. Helen will nicht, dass er springt, aber Luc ignoriert ihre Ängste, findet sie lächerlich. Da muss er durch, wenn er Astronaut werden will, sagt Luc, obwohl er weiß, dass sie dagegen ist. Überall stehen Schaulustige, die feindselig wirken, die zu Luc halten, die ihr Colin nicht zurückgeben werden und ihr hilfloses Flehen ignorieren. Er ist doch erst zehn. Aus dem Nichts tauchen Kinder auf, die in Rollstühlen sitzen, deren Gesichter unkontrolliert zucken, deren Arme sinnlose Tänze aufführen und deren gellendes Gelächter ihr Angst macht. Sie deuten auf den Turm, beginnen hämisch zu johlen, als Colin sich über die Kante der Plattform fallen lässt, um die Träume seines Vaters zu erfüllen, der ein Versager ist, wenn es darum geht, sich etwas zu versagen. Bravo, Colin! Bravo! ruft Luc in das Fallen seines Sohnes, das nicht aufhören will und erst ein Ende findet, als er auf den Steinen aufschlägt, die eben noch ausgesehen haben wie Wasser. Helens Augen sind plötzlich verschlossen, lassen sich nicht mehr öffnen. Sie ist in beklemmender Dunkelheit gefangen. Colins Stimme erklingt, aber etwas stimmt nicht, ist grauenvoll falsch. Mit aller Macht öffnet sie ihre Augen. Vor ihr steht ein fast erwachsener Mann, der Colins Kinderstimme gestohlen hat: Hast du das gesehen, Mama? Ich bin geflogen, ruft er mit naiver Begeisterung und fährt dann plötzlich – als gäbe es eine Tonstörung – mit der dunklen Stimme fort, die Luc bis jetzt allein gehört hat. Schau nur Mama, ich bin frei. Frei wie ein Vogel. Warum hat niemand sie gewarnt, dass die Zeit ein Dieb ist? Colin? Was ist mit dir passiert? Sie fährt ihm durch die Haare, aber die langen blonden Kinderlocken, die sie so sehr an ihm liebt, lösen sich von seinem Kopf und taumeln wie Daunen zu Boden. Momo schnuppert daran, ist aus dem Nichts gekommen, wie alles in diesen Träumen. Wie der amerikanische Straßenkreuzer mit dem offenen Verdeck, in dem Luc und Ava lachend in die Zukunft reisen. Wie Avas Kopftuch, das der Wind aus dieser Zukunft zurück in die Vergangenheit treibt, in der Helen für immer leben muss. Das Tuch, das nach Luc und Ava riecht, nach Betrug und Verletzung, spinnt Helen ein wie eine Mumie. Sie erstickt, glaubt zu sterben, aber plötzlich reißt eine unsichtbare Hand ihr das Tuch vom Gesicht, als zaubere er sie darunter hervor. Tusch. Helen steht an der äußersten Kante des Sprungturms, wie auch immer sie dorthin geraten ist. Weiter hinten, wo es ein Geländer gibt, steht Ava und hält Momo so vertraut in ihren Armen, als gehöre sie ihr. Wut überschwemmt Helens innere Stadt, Hass, der sie noch mehr schwächt, Zorn auf Luc und sein Männergeschwätz. Er ist nicht wie du, Helen. Du kannst ihn nicht behalten. Er muss seinen Weg machen, so wie alles es tun.
Dem Hass folgt ein Schmerz, reißend wie ein wilder Strom. Colin! hört Helen sich schreien, aber da wirft Ava ihr Momo zu und sie verliert das Gleichgewicht, verliert Momo, verliert sich selbst, taumelt, stürzt und fällt. Sie ruft nach Colin, der fortgegangen ist, der für immer für sie verloren ist. Ihre Rufe vermischen sich mit dem Schreien eines Babys, einem Donnerschlag und dem Miauen von Momo, bis ein scharfer Knall die Luft zerreißt.
In Helens Kopf verebbt das Echo des Schusses, der die Membran zwischen Traum und Realität durchbrochen hat. Unter der Bettdecke schwitzt sie den schlechten Traum aus. Seit Luc und Colin nicht mehr im Haus sind, hat sie regelmäßig Albträume. In der Ferne grollt ein Donner. Regentropfen schlagen gegen die Fenster. Helen wirft die Decke zur Seite, reibt mit den Händen über ihre Arme, scheuert fast daran. Der schlechte Traum haftet an ihr wie eine zweite, beklemmende Haut.
Sie lässt die Spiegeltür des Kleiderschranks zwischen Nacht und Tag rollen, scheucht damit die bösen Geister in ihrer Seele auf. Wie eine Schar schwarzer Raben entweichen sie durch ein imaginäres Loch in ihrem Nacken und hinterlassen Gänsehaut. Ihr Bademantel gleitet vom Bügel, kollidiert mit den verlassenen Bügeln, an denen früher die Sachen von Luc hingen. Hemden, Anzüge, Sakkos, Mäntel. Klack, klack, klack. Noch immer steht ein abgetragenes Paar Budapester im untersten Regal, daneben ein Karton mit Kleidung, die Luc zurückgelassen hat. Eine löchrige Jeans, verblichene T-Shirts. Es ist idiotisch, die Sachen aufzubewahren. Im Grunde braucht sie die ganze rechte Seite des Schrankes nicht mehr. Wieder denkt Helen daran, jemanden zu beauftragen, diesen Teil zu entfernen und die obsoleten Module aus ihrem Leben zu schaffen. Ein dunkler Rand würde die Lücke markieren. Die Amputation wäre endlich sichtbar, die Wunde, die Luc und das Leben ihr zugefügt haben.
Neonlicht erhellt das Badezimmer. Blink, blink, blink. Wieder eines dieser Geräusche, die Helen erst auffallen, seit sie allein im Bungalow lebt. Seltsame Stimmen, die immer schon da gewesen sein müssen, überdeckt von der beständigen Brandung einer Familie, übertönt vom Refrain der Illusion, die besten Jahre des Lebens könnten ewig dauern. Letzten Sommer hat sie zum ersten Mal das Gurgeln der Pumpe des Pools wahrgenommen, in dem Colin ganze Tage zugebracht hat. Sie hat das Wasser abgelassen, die Pumpe abgestellt, aber nichts hat sich dadurch verbessert. Die Stille ist noch stiller geworden, wirkt wie ein angehaltener Atem, durchbrochen von seltsamen, knackenden Geräuschen oder dem Rascheln des Laubs, wenn der Wind es im Herbst um das Haus scheucht. All das gibt Helen das Gefühl, sich jenseits einer unsichtbaren Linie zu befinden, hinter der nie mehr etwas besser wird und die einzige Konstante schleichende Verschlechterung ist.
Schlaf Kindlein, schlaf. Sie hat die Spieluhr von Colin Nacht für Nacht aufgezogen, um sich von ihr in den Schlaf klingeln zu lassen, aber die Batterien sind längst leer und eine weitere Wahrheit liegt nutzlos im still gewordenen Land ihrer Träume. Weder Colin noch ein anderes Kind werden je wieder den Trost dieser Spieluhr benötigen, zu ihrer Melodie einschlafen oder träumen. Früher waren Helen die Zimmer wie Schutzräume vorgekommen, aber jetzt zeigt sich, dass sie nicht weniger sterblich und vergänglich sind als alles anderes auf der Welt. Nur die Hälfte des Schlafzimmers, das Bad, die Toilette und die Küche, die sich am heftigsten gegen die Stille wehrt, halten sich noch am Leben. Mit der springenden Feder des Toasters, dem Keuchen der Kaffeemaschine, dem Wummern des Geschirrspülers, der quietschenden Antwort des Mülleimers auf jeden Tritt, dem Surren des Kühlschranks, dem sanften Schleifen der Schubladen und all den anderen Klängen, die Helen unheimlich sind, seit Luc und Colin nicht mehr da sind; Geräusche, die sich mit den bereits toten Dingen vermischen, die herumliegen wie die Knochen und Eingeweide eines verendeten Tieres. Die zweite Bettdecke. Das überflüssige Geschirr. Die unbesetzten Stühle. Das Indianerzelt ohne Indianer. Das erstarrte Skateboard. Die abgetaute Kühltruhe. Die Uhr von Luc, die zeitlos auf der Ablage über dem zweiten Waschbecken liegt, im halblebendigen Badezimmer, in dem das Wasser vor Helens Augen in den Ablauf strudelt wie flüssig gewordene Zeit.
Ein dunkles Haar klebt auf dem Spiegel, trennt ihr Gesicht in zwei Hälften. Es tut nicht weh, Haare zu verlieren, aber es schmerzt, dass immer mehr von ihnen desertieren und nicht wiederkehren. Ein ganzes Heer von Hormonen lässt sie im Stich, hat sich mit der Schönheit zur Flucht verabredet. Nie findet Helen runzlige Haut im Bett, nirgendwo liegt ein grauer Star halbblind im Garten, und dennoch geschieht es, heimlich, vielleicht nachts. Sie kommt sich vor wie eine Leinwand, auf der die Zeit wie Farbe versickert. Die Schwerkraft ist ein heimtückisches Wesen. Vor einem Jahr hat Helen sie noch nicht gespürt, aber dann hat sie sich über Nacht an sie geklammert. Seitdem versucht die Gravitation sie in den Abgrund zu ziehen. Der Herbst lauert wie ein verborgener Magnet in der Erde, ist dabei keinen Deut weniger kaltblütig als der Spiegel, der ihr beim Altwerden zusieht. Helen fährt mit dem Finger über das Haar auf dem Spiegel, um es wegzuwischen, verspürt sogleich einen Schmerz. Blut tropft auf das weiße Porzellan. Das, was ihr Gesicht in zwei Teile spaltet, ist kein Haar, sondern ein feiner Riss im Glas des Spiegels. Gestern war er noch nicht da. Sonst wäre es ihr aufgefallen. Seit Luc und Colin nicht mehr da sind, hat sie einen untrüglichen Blick für Risse und Brüche.
»Momo! Momo?«
Unerwiderte Liebe keimt in Organen, mutiert dort zu Tumoren, zu Karikaturen von Embryonen und verkrüppelten Anfängen. Der verletzte Finger macht das Ankleiden umständlich. Er pocht wie ein rasendes Herz, aber er muss wehtun. Schmerz ist der Anfang der Heilung. Diese Gewissheit macht es für Helen einen Moment lang besser, obwohl jede künftige Besserung es nie mehr mit dem vergangenen Guten aufnehmen kann. Beschädigte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Ihre Freundinnen verstehen sie nicht mehr, sind ihr fremd geworden. Sie erteilen ihr oberflächliche Ratschläge, die tausend Mal in tausend Frauenzeitschriften standen, degradieren damit die schwerste Krise ihres Lebens zu einer Petitesse. Helen weiß nicht, was sie mehr verletzt – die Verluste oder die Nichtanerkennung der Schmerzen, die sie verursachen.
Im mannshohen Kühlschrank verlieren sich einige Packungen Katzenfutter, ein paar Scheiben Schinken, ein Tetra-Pack Milch, Eier und zwei Becher Joghurt. Ausklänge nach dem Refrain. An der Kühlschranktür hängen seit Jahren die gleichen Fotos, scheinen wie alles Vergangene magnetisch geworden zu sein. Colin auf der Babywaage, im Clownskostüm, mit seinem ersten Mofa, mit dem verdammten Raumanzug, Arm in Arm mit Luc am Abend seiner Abiturfeier, wie zwei Saufkumpane. Wenn Colin lebendig vom Everest kommt, wird sie vor Glück weinen. Sie hat ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Er ist nach Melbourne gezogen, 16.000 Kilometer weit weg von ihr, in die Heimatstadt seines Vaters, was auch immer es zu bedeuten hat. Er ist erwachsen, kann tun und lassen was er will. Colin kann sie aus der Entfernung verletzten, ohne die Auswirkungen ertragen zu müssen. Er kann sie mit einem Anruf in Hochstimmung versetzen, sie fallen lassen, wenn er wieder auflegt.
»Momo? Momo? Komm, komm.«
Den Flur hat Luc als gebogenen Weg zum Licht konzipiert. Links die Tür zum Kinderzimmer ohne Kind, danach vier Schritte bis zum zweiten Bad mit dem unbenützten Whirlpool. Rechts ein Gästezimmer ohne Gäste, dahinter Lucs Arbeitszimmer ohne Luc und ohne Arbeit. Am Ende dann, wie eine Lichtung, der Living Room, ihr Lebensraum ohne Leben, weitläufig wie ein Ballsaal, dem es an Tänzer mangelt, an Musik, Gesprächen und Ausgelassenheit. In der rechten Ecke der verstummte Steinway-Flügel von Colin oder besser gesagt, der Flügel, den Helen in der Hoffnung gekauft hat, einen virtuosen Pianisten aus ihm machen zu können. Links das Wandbild, auf dem sie als Siebzehnjährige im Bikini zu sehen ist, lasziv, an einem vom Meer umspülten Felsen gelehnt, umwerfend faltenlos, unbeschädigt. Sie liebt dieses Bild, liebt dieses Mädchen, liebt dieses Meer, nur dieses, kein anderes. Sie fleht darum, dorthin zurückkehren zu dürfen. Sie möchte schreien vor Wehmut, aber man hat ihr beigebracht, Emotionen dieser Art zu unterdrücken. Ihre Mutter verachtet jede Form von Sentimentalität und ihr Vater hat sich sogar beim Sterben jede Gefühlsduselei verbeten. Luc spielt in ihrer Klasse. Er bekämpft alles was ihn schwächen könnte mit gnadenloser Sachlichkeit. Vielleicht sollte sie das Bild entfernen, die siebzehnjährige Schönheit, die zur unstillbaren Sehnsucht geworden ist, zu einem weiteren Grund, in tausend Teile zu zerbrechen, die sich nie mehr zu einem Ganzen fügen.
Kleine Hagelkörner schlagen gegen die Fenster. Der Garten wirkt wie ein unbewohnter Planet mit einem bläulichen Krater. Die Sirene eines Krankenwagens heult, Blaulicht zuckt in Ellipsen durch den verwaisten Ballsaal und über den nassen Planeten.
»Momo? Momo? Komm, komm.«
Helen zieht die Kapuze ihres Regenmantels über den Kopf, stürzt sich ins Unwetter, sucht Momo an ihren Lieblingsplätzen, aber dort ist sie nicht. Sie findet sie im hinteren Teil des Gartens vor der Chinaschilf-Hecke. Leblos. Regungslos. Helen versucht sich einzureden, Momo wolle nur mit ihr spielen, sich tot stellen, bis sie ihr den Bauch krault, aber sie scheut Wasser, würde niemals freiwillig auf diese Weise im strömenden Regen liegen, eingerollt und friedlich. Neben Momo, im feuchten Gras, versucht eine verwundete Amsel mit einem Flügel den Tod zu verjagen. Luc würde eine Schaufel aus dem Schuppen holen und es beenden. Es wäre ein Akt der Gnade, aber Helen ist nicht wie Luc. Es ist ihr so unmöglich, die Amsel zu erschlagen, wie es ihr unmöglich ist, die Maschinen abstellen zu lassen, an denen ihre Mutter hängt oder besser gesagt das, was von ihr übrig ist. Ein fast resonanzloses Herz, Haut, so dünn und faltig wie das Laken, das sie bedeckt, und das schwache Licht im Gehirn. Die kleine Flamme auf dem Docht des Lebens, die nicht verlöschen will, die nach Sauerstoff giert und sinnlos einen Kreislauf in Gang hält, der nichts kennt, außer das Leben. Reste eines autarken Willens, der in dem zerbrechlichen, ausgetrockneten Körper ihrer Mutter nur noch um sich selbst besorgt ist.
Die Amsel schlägt wieder mit den Flügeln, erhebt sich plötzlich und entschwindet im matten Grau des Himmels. Wieder läuft Helen ein Schauer über den Rücken. Sie ist glücklich, nicht wie Luc zu sein, der das Tier erschlagen hätte, weil er es kann. Auf dem Rasen vermischen sich Regen und Erde mit dem Blut, das aus Momos Leib sickert. Jenseits der Hecke liegt ein nackter Mann auf den Pflastersteinen, und nicht weit von ihm entfernt, ein Gewehr. Ein Krankenwagen nähert sich. Im dritten Stock des Hauses steht ein Fenster offen. Vielleicht ist der Mann von dort gesprungen. Vielleicht hat er sich erschossen. Vielleicht hat die Kugel seinen Körper durchschlagen und ist in Momo eingedrungen. Vielleicht. Vielleicht.
Ein Donner kracht und erschüttert das Erdreich.
WINTER
Durch das kleine Fenster in der Eingangstür seines Hauses sieht Arno Winter dichten Regen auf den kiesbedeckten Vorplatz prasseln. Vor einer halben Stunde hat es angefangen. Der bleierne Himmel lässt erahnen, dass es nicht so schnell wieder aufhören wird. Der schrille Gesang einer Polizeisirene kommt schnell näher. Blaue Blitze streifen die Hecken, die das Grundstück begrenzen. Für einen Moment treibt Winter die Sorge um, die Polizei könnte auf dem Vorplatz erscheinen und ihn für einen Mord verhaften, den er nicht begangen hat, an den er jedoch schon oft gedacht hat. Der Wagen entfernt sich, aber der Klang der Sirene zirkuliert in seinen Ohren weiter.
Seit einigen Monaten wacht Winter jeden Morgen gegen vier Uhr auf und findet nicht mehr in den Schlaf. Sein Sekretär schiebt es auf den Wahlkampfstress, sein Arzt auf das Alter, aber sie liegen beide falsch. Es ist nicht der erste Wahlkampf, den er durchsteht wie einen Feldzug. Trotzt seiner einundsechzig Jahre befindet er sich in besserer Verfassung, als mancher Dreißigjährige. Hie und da meldet sich nach dem Aufstehen ein unzufriedener Knochen, aber Winter weigert sich, diesen Zipperlein Gehör zu schenken. Früher hat er um diese Zeit mit Lore das Frühstück eingenommen, aber die Sache mit Malte hat den Rhythmus ihres Lebens zerstört. Deshalb steht er seit einer halben Stunde an der Haustür wie an einer Bushaltestelle und wartet darauf, von Dammann erlöst zu werden. Die Diele ist der letzte Ort des Hauses, an dem Winter sich noch wohl fühlt. Im Plan des Architekten sind die zwölf Quadratmeter als Entree verzeichnet, aber für Winter ist es seit geraumer Zeit der Ausgangsbereich, die Schleuse, durch die er entfliehen kann.
Sein schwarzer Dienstwagen rollt durch die Pfützen, bleibt keine drei Meter von der Haustür entfernt stehen. Dammann, der seit vielen Jahren sein Chauffeur ist, steigt aus dem Wagen und spannt einen Regenschirm auf, wie er es immer bei solchen Wetterlagen tut. Winter tritt vom Fenster zur Seite, möchte von Dammann nicht beim Warten ertappt werden. Es klingelt. Er schlägt den Kragen seines Mantels hoch, zählt bis zwanzig und öffnet dann die Tür. Dammann begrüßt ihn, hält den Schirm schützend über ihn, bis er im Wagen sitzt.
Durch die dicken Fäden des Regens sieht Winter seine Frau am Fenster ihres Schlafzimmers stehen, das er seit der Renovierung nur ein einziges Mal betreten hat. Es ist das ehemalige Zimmer von Malte. Winter fragt sich, wie Lore es schafft, ein Auge darin zuzubekommen, aber vielleicht gelingt es ihr ja nie. Jeden Morgen kippt sie eine Hand voll Tabletten in ihren Mund, legt den Kopf in den Nacken und würgt sie durch ihre Kehle. Als Winter sie kennenlernte, war sie elf Jahre jünger als er, aber jetzt kommt es ihm vor, als hätte sie ihn überholt.
»Zur JVA?«
»Korrekt«, erwidert Winter, und sofort steigt sein Zorn auf Malte in seiner Kehle auf wie Sodbrennen. Er hat einen missratenen Menschen in die Welt gesetzt. Das wird ihn bis an sein Ende verfolgen. Die Limousine setzt sich in Bewegung und wie jeden Morgen hofft Winter, nie mehr an diesen Ort zurückkehren zu müssen.
MARIA
Eben war da noch der Lärm der Motorsäge, aber er verliert sich mehr und mehr im Summen der Insekten und dem Rascheln der Blätter. Das Zimmer ist erfüllt mit dem Geruch von gemähtem Gras, frischer Kuhmilch und allen Erinnerungen und Gefühlen, die von diesen Gerüchen zum Leben erweckt werden. Die weißgetünchte Decke über Maria verwandelt sich in eine Leinwand. Fünf Jahre alt ist sie da oben.
Sie holt Schwung, damit die Schaukel am Ast der hohen Linde sie so hochfliegen lässt, wie es nur geht. Sie will endlich das Meer zu sehen bekommen. Kannst du es sehen, ruft ihr Vater von unten. Nein. Ich glaube, du schummelst. Hast du es wirklich schon einmal gesehen? ruft sie zurück. Aber ja, du musst nur höher schaukeln, hört sie ihn in der Entfernung rufen. Immer wenn die Schaukel sie nach vorne trägt, sieht Maria ihren Vater für Augenblicke mit einem Schlauch den Garten wässern. Bei jedem Schwung versucht sie höher hinaus zu fliegen, aber dann geben die Seile der Schaukel doch immer wieder nach. Mama hat gesagt, man kann es von hier aus gar nicht sehen. Am Stamm der Linde steht ein Teller mit den Resten des Karottenkuchens, den ihre Mutter gebacken hat. Wespen stochern darin herum. Das sagt sie nur, weil sie nicht will, dass du eine Träumerin wirst. Maria weiß nicht, ob sie eine Träumerin sein möchte, aber ganz sicher möchte sie nicht wie ihre Mutter werden. Sie will nicht jeden Tag das Haus aufräumen, Wäsche waschen, Essen kochen, Kühe melken, Gläser mit Honig und Marmelade füllen und in den kleinen Ökoladen bringen. Maria versteht nicht, warum ihre Mutter all diese Dinge tut, denn sie machen eine griesgrämige Frau aus ihr. Warum will sie das nicht? ruft sie ihrem Vater zu, als sie ihm wieder entgegenfliegt. So ist sie eben. Jeder ist das, was er ist. Einen Moment lang, während die Schaukel sie wieder von ihm wegzieht, ist Maria traurig darüber, dass ihre Mutter für immer diese griesgrämige Frau bleiben muss. Man kann also nie mehr jemand anderes sein? ruft sie in der Hoffnung, ihr Vater könnte einen Trick kennen, der es doch möglich macht. Wie meinst du … ruft er ihr zu. Plötzlich richtet sich der Gartenschlauch auf wie eine Mamba, die sich schlängelnd über den Rasen bewegt. Maria fliegt durch einen glitzernden Wasservorhang, kreischt vor Wonne. Unten spielt Papa ihr wieder mal einen Streich, liegt mit dem Kopf nach unten im Gras. Wie lustig er immer ist, ganz das Gegenteil von Mama, ganz das Gegenteil. Jenseits des Gartenzauns bewegt sich eine Gruppe Menschen in langsamen Schritten auf das Grundstück zu. Maria erkennt das Gesicht des Dorfpfarrers. Vier kräftige Burschen tragen einen Sarg auf ihren Schultern. Die Wahrheit ist so ein Ding im Bauch, das keine Lügen gestattet. Papa wird nicht mehr aufstehen. Er ist nicht mehr da. Ihr Leben wird nie mehr lustig sein.
Der Lärm der Motorsäge dringt in Marias Zimmer. Draußen poltert die Stimme ihre Mutter wie ein Stück Blech, auf das man mit Fäusten schlägt. Die Männerstimmen sind weicher, gehorsam, von der Vorsicht gedrosselt, dem Blech und den Fäusten nicht zu nahe zu kommen. Ganz ohne Vorwarnung knackt es laut und ehe Maria sich vom Bett erheben kann, wird ihr Zimmer vom Sonnenlicht überflutet. Die Helligkeit, die sich siebzehn Jahre lang hinter der mächtigen Linde versteckt hat, kommt endlich herein und erleuchtet ihr Zimmer. Im Bann dieses unwirklichen Zaubers sieht Maria aus dem Fenster. Ich kann es sehen, flüstert sie. Es ist wirklich da, du hast nicht gelogen. Auch wenn es in Wirklichkeit der blaue Himmel mit seinen weißen Wolken ist, so fällt es ihr doch ganz leicht, ihn wie ein Meer mit Buchten, Inseln, Stränden und Gischt zu betrachten. Da ist endlich das Meer, das ihr Vater als kleiner Junge von hier aus entdeckt hat. Das neue Licht macht den alten Staub sichtbar, verwandelt alle Sekunden von Marias bisherigem Leben in winzige, schwebende Partikel. Der ganze Raum ist nur mehr flirrende Vergangenheit, selbst die Stimme ihrer Mutter kommt nicht mehr aus dem Garten, sondern aus einer alten Welt, zu der Maria nicht mehr gehört, seit die Linde gefallen ist und sie das Meer gesehen hat. Sie nimmt den Clearblue-Test vom Nachtisch, der anzeigt, dass ein Kind in ihrem Bauch wächst und hält ihn der Sonne entgegen wie ein Kreuz, das sie mit allen Himmelsrichtungen des Glücks verbinden soll.
Auf der Straße vor dem Haus liegt die Linde, in Stücke zerteilt wie ein erlegtes Mammut. Die halbverrotteten Seile der Schaukel, mit der Maria sich einmal zum Himmel aufgeschwungen hat, sind mit der Borke verwachsen, Teil des Baums geworden. Der Geist ihres Vaters weicht aus den Wurzeln, das erleichtert ihr den Abschied. Seit sie von dem Kind in ihrem Bauch weiß, hat der Bahnhof einen Magneten. Die Stadt hat schon seit Jahren einen, aber jetzt ist dieser Sog mehr als die dümmliche Sehnsucht einer Provinzlerin. Es ist ein Zeichen, eine Wegbeschreibung.
Maria geht durch die Straßen des Dorfes, in dem sie jeden Stein, jeden Grashalm und jeden Menschen kennt. Sie wird gegrüßt, grüßt zurück, gibt nichts preis, was sie verraten könnte. Geheimnisse machen das Leben aufregend, aber die Menschen im Dorf hassen Aufregungen. Für sie ist die Langeweile ein Paradies und das Alltägliche ihr Opium.
»Maria! Warte!«, hört sie die Stimme von Friedo hinter sich. Er holt sie mit seinem Fahrrad ein, fährt neben ihr her, dreht die Pedale im Freilauf rückwärts, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.
»Warst du krank?«, fragt Friedo, dabei müsste er doch ganz genau wissen, warum sie sich nicht gemeldet hat. Sie ist kurz davor, ihm die Wahrheit zu sagen, weil er sie sonst vielleicht nie erfährt. Vor einem Monat haben sie sich beide unten am Wallerbach, ohne einen Plan wie es danach weitergehen sollte, nackt ausgezogen. Inzwischen glaubt Maria, es ist nur geschehen, damit Friedo seine Wegbeschreibung bekommt. Die Sommersprossen lassen sein Gesicht wirken, als sei er ganz wild nach Mädchen, aber das stimmt nicht nur hinten und vorne, sondern auch oben und unten nicht. Keinen Zentimeter hat sich sein Ding am Wallerbach erhoben. Maria denkt an das Konzert, an Finn, an seinen harten Schwanz und das Baby, das er ihr damit gemacht hat.
»Ich musste im Laden helfen«, erwidert sie. Die Lüge schwebt wie eine Wolke zu Friedo und weil er alles, was sie sagt, für die Wahrheit hält, weicht das Vorwurfsvolle aus seinem Gesicht.
»Wollen wir zum Bach fahren? Das Wetter ist so schön«, sagt Friedo. Vielleicht funktioniert sein Bauch ja nicht richtig. Maria streicht sich die Haare aus dem Gesicht, sieht ihn an, hofft, dass er es endlich kapiert. Er wird es schwer genug haben. Die Menschen tun nur immer so offen und liberal, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Sie mögen es nicht, wenn jemand anders ist. Meistens lügen sie einem scheinheilig ins Gesicht, aber sobald man ihnen den Rücken zukehrt, lästern sie und wünschen einem die Pest an den Hals. Jeden Sonntag gehen sie in die Kirche, lassen sich von Heuchlern segnen und von Kinderschändern die Sünden erlassen.
»Du gehst weg, oder?«
»Ich bin nicht die, die ich hier sein muss. Ich bin jemand anderes.«
Friedo steigt vom Fahrrad, lässt es achtlos zu Boden fallen.
»Und was ist mit mir?«
»Ach Friedo, das weißt du doch.«
Der Stationsleiter schreitet die Waggons ab, wirft Türen zu, lässt seine Pfeife schrillen, als lebten sie noch im 19. Jahrhundert. Draußen vor dem Fenster, neben dem Werbeplakat auf dem Wir machen den Weg frei steht, winkt Friedo ihr zu. Früher, das weiß sie von ihrer Oma, ließen sich die Fenster der Züge noch öffnen und diejenigen, die fortgingen, konnten denen, die zurückblieben, etwas Tröstliches sagen. Aber damit ist es vorbei. Jetzt ist der Abschied eine Pantomime. Nimm mich mit, schreit es aus Friedos Augen und seine Arme und Hände versuchen es zu übersetzen. Er hat Angst vor seinem Vater und davor, dieser Friedo zu sein und kein anderer. Der Zug setzt sich in Bewegung, überlässt ihn dieser Wahrheit, lässt das Leben zurück, in dem Maria für immer das Kind ihrer Eltern und der Umstände bleiben würde. Sie fährt der Stadt entgegen, löst sich endlich aus dem Schatten, strömt wie ein wilder Fluss dem Meer entgegen.
HELEN
Niemand öffnet die Wohnung im dritten Stock bei Pedro Gonzales. Ist das der Name des Mannes, der Momo getö