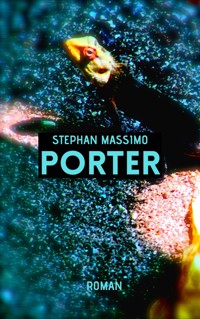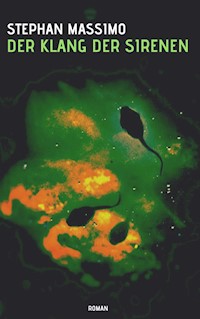6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München 1972. Während dem hochbegabten Luis alle Türen offen stehen, versucht der aus kleinen Verhältnissen Niko wenigstens ein kleines Stück vom Glück zu ergattern. Grundrisse erzählt die Geschichte einer ungleichen Freundschaft, der architektonischen Verschandlung Münchens und von Träumen und Luftschlössern, die den Schwächen der Menschen und der bockigen Wirklichkeit zum Opfer fallen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
STEPHAN MASSIMO
GRUNDRISSE
©2024
Zwischen dem Wunsch und den Dingen
liegt die Welt auf der Lauer
(Cormack McCarthy)
TEIL I
FUNDAMENTE
DA war wieder dieses unbeschreibliche Flimmern, wie vor drei Jahren, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet waren. Mitten in der Nacht hatte Luis mit Jonah im Garten gelegen und versucht die beiden mit seinem Teleskop im Mare Tranquillitatis zu erkennen. Wochenlang träumten sie davon, Astronauten bei der NASA zu werden und in weniger als einer Woche 384.400 Kilometer weit zu fliegen, nur um ein paar Minuten auf dem Mond herumzuspazieren. Auf der Erde kam man mit dem Auto in derselben Zeit gerade mal von München bis nach Istanbul und wieder zurück, und manchmal – obwohl diese Erkenntnis jeder mathematischen Regel widersprach –, konnte es sogar sechs Jahre dauern, um ein Ziel zu erreichen, das nur zehntausend Meter von dem Ort entfernt lag, an dem man lebte. Er verstand genau, was Albert Einstein herausgefunden hatte. Die Zeit war relativ.
Luis trennte den 239. Tag des Jahres, den 26. August 1972, vom Kalenderblock neben seinem Bett so behutsam ab, als handle es sich um Blattgold. Eines Tages würde er das kleine Stück Papier zusammen mit seiner Eintrittskarte für die Eröffnungsfeier als Beweis vorzeigen können, dabei gewesen zu sein. Er verstaute das Kalenderblatt in der blechernen Sarotti-Dose mit dem kleinen, fahnenschwingenden Mohren, in der er all seine wertvollen Dinge verwahrte. Einen kompletten Satz goldener Shell-Münzen mit den Portraits der Spieler der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die im Juni Europameister geworden waren, handsignierte Autogrammkarten von Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dem Rennfahrer Jochen Rindt und Muhammad Ali, das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, das sein Großvater ihm vermacht hatte, fünfzehn gebrauchte Zehnmarkscheine, acht nagelneue Fünfdollar- und sechs Zehndollar Noten, eine Apollo 11 Gedenkmünze, eine NASA Anstecknadel, ein rotes Schweizermesser, die Eintrittskarte für den Boxkampf von Ali gegen Frazier im Madison Square Garden in New York, das goldene Christusamulett, das er zur Kommunion bekommen hatte und an die zwanzig Postkarten von Tante Anne aus den Vereinigten Staaten von Amerika, auf denen die Wolkenkratzer von New York und Chicago abgebildet waren. In so einem Haus, hoch über der Welt, wollte er eines Tages auch wohnen.
Draußen auf der Lamontstraße erklang die Hupe der Goldmedaillenkutsche, wie sie den goldenen Mercedes 450SE nannten, den sein Vater seit zwei Wochen fuhr. Luis sprang auf, als habe er im April 1966 eine Feder verschluckt, die sich jetzt plötzlich ausdehnte. Sechs Jahre lang hatte er auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt war es endlich so weit. Die Olympischen Spiele begannen.
In den sechsundsiebzig Monaten seit der Vergabe der Spiele an München waren Stadien, Sporthallen, der Olympiaturm, der Olympiapark, das Olympiadorf und S-Bahn-Trassen aus mehr als sechzig Baustellen gewachsen. Unter der Erde fuhr jetzt die U-Bahn, wie in einer richtigen Großstadt. Zwischen dem Stachus und dem Marienplatz flanierten die Menschen neuerdings durch eine Fußgängerzone, ohne von Autos oder Straßenbahnen bedrängt zu werden. Alles war überpünktlich fertiggeworden, so wie die Deutschen es am liebsten hatten. München räkelte sich in der Augustsonne. Alles sah herausgeputzt aus. Fahnen mit dem Olympischen Ringen flatterten an Masten im Wind. Aus allen Himmelsrichtungen strömten Menschen dem Olympiapark und den Heiteren Spielen entgegen, mit denen man der Welt zeigen wollte, dass Deutschland nicht mehr die Heimat grimmig dreinblickender Nazis war. Der Mittlere Ring, eine vierspurige Kardinale, führte seit einigen Monaten einmal um die ganze Stadt herum. Wenn man lange genug darauf fuhr, brachte sie einen immer wieder zu den Zeltbauten des Olympiaparks, die Luis immer wieder aufs Neue bewunderte. Sein Vater arbeitete für die Bayerischen Regierung und hatte maßgeblich daran mitgewirkt, die Spiele nach München zu holen. Aus diesem Grund fuhren sie nicht ständig im Kreis um das Wunder herum, sondern steuerten direkt darauf zu. Der Ordner an der Nordseite des Olympiastadions winkte sie durch die geöffnete Schranke.
»Habe die Ehre, Herr Staatssekretär. Gnädige Frau«, sagte der Mann und tippte mit dem Zeigefinger gegen den Schirm seiner Dienstmütze. Angesichts der Menschenmassen – dem Fußvolk, wie sein Vater es nannte –, die auf der Hans-Braun Brücke den Georg-Brauchle Ring kreuzten und sich vor den Toren des Stadions stauten, fühlte Luis sich wie der Kaiser von China. Seine Mutter sah ungläubig über den Rand ihrer Sonnenbrille. Gnädige Frau. Die plötzliche Freundlichkeit der Bayern schien ihr nicht geheuer. Vielleicht verwechselte der Ordner sie ja mit Doris Day. Das war schon öfter vorgekommen, obwohl ihr Mädchennamen weder zu einem Filmstar passte, noch nach München, wo alle Sorten von Preußen unerwünscht waren. Gabi Bühler, geboren 1932 in Detmold, Nordrhein-Westfalen als Gabriele Galaske, sprach glasklares Hochdeutsch, jene in Bayern so verhasste Fremdsprache, die Einheimische verächtlich als geschwollen bezeichneten. Luis wusste genau, was sie durchmachte. Obwohl er in München zur Welt gekommen war, sprach er wie seine Mutter und musste sich bei jeder Gelegenheit als Saupreuße beschimpfen lassen. Warum Kinder immer nur die Muttersprache lernten, und nie die Vatersprache, blieb ihm ein Rätsel, aber insgeheim war er sogar froh darüber. Der bayerische Dialekt bestand aus einer breiigen Melange von Vokalen und halbverschluckten Konsonanten, die übellaunig und hinterwäldlerisch klang. Worte wie Oachkatzlschwoaf (Eichhörnchenschweif), wattschinsen (wahrscheinlich), Hiasl (Depp), Lätschnbene, (Langweiler) oder Glupperl (Wäscheklammer oder auch Finger) würden für seine Mutter auf ewig unaussprechlich und unverständlich bleiben. Ganz zu schweigen von einem Wort wie gehweida, das je nach Lage der Dinge ach, Blödsinn - unglaublich - lass mir meine Ruhe - glaub ich nicht - jetzt komm schon oder bitte hilf mir mal heißen konnte. Seit den bayerisch-französischen Bündnissen und den Kriegen der Napoleonischen Zeit hatte sich eine Ansammlung französischer Worte in die bayerische Sprache geschlichen und eine bajuwarische Färbung angenommen. Einheimische nannten einen Regenschirm Parapluie, die Zimmerdecke Plaffont, den Bürgersteig Trottoir, eine Bettdecke Plumeau, einen Polizist Gendarm, einen Fahrer Chauffeur, und anstatt danke sagten sie merci. Man ärgerte jemanden nicht, sondern schikanierte ihn (chicaner), man blamierte sich (blamer), und foppte man jemanden, tratzte man ihn (tracasser). In der Straßenbahn, die in München Tram hieß, kaufte man keinen Fahrschein, sondern ein Billett und ein gängiger Fluch lautete Sakradi (Sacre dieu). Wer all das nicht beherrschte, blieb – ganz gleich wie lange er schon hier lebte –, ein Fremder. Da waren die Bayern unnachgiebig. Umso mehr grenzte es an ein Wunder, dass es den Ungehobelten, wie seine Mutter die Bayern nannte,gelungen war, die Olympischen Spiele nach München zu holen.
»Da schaust, Gabilein«, sagte sein Vater, und griff nach seiner fabrikneuen, faltbaren Polaroid SX 70, um das überraschte Gesicht von Doris Day für die Ewigkeit festzuhalten. Jedes Mal, wenn sie sich über die Ruppigkeit der Bayern beschwerte, versicherte sein Vater ihr, sie seien im Grunde ein freundliches Volk. Eines Tages würde sie es schon noch merken. Jetzt, da dieses von ihr angezweifelte Feingefühl plötzlich zu Tage trat, kam es Luis vor, als habe es schon immer existiert. Seine Mutter musste sich nur noch an das neue München gewöhnen, an die Weltstadt mit Herz, dieplötzlich zur großen weiten Welt gehörte. Nur sture Alteingesessenen beharrten noch immer darauf, der Rest der Welt sei ein Vorort von Minga (München), und zu denen wollte sie bestimmt nicht gehören. Sein Vater wedelte mit dem Polaroid, und als es ihm trocken genug schien, schrieb er mit dem Edding Stift, ohne den er das Haus genauso wenig verließ, wie ohne die Kamera, auf den weißen Rand:
Gabilein kann’s nicht glauben - 26.08.72
In den Straßen der Stadt hörte man seit Tagen ein Sammelsurium unterschiedlicher Sprachen, und die sonst so bockigen Münchner gaben sich alle Mühe, jeden Fremden zu verstehen – sogar die Preußen. Mehr als einmal hatten die Lehrer in der Schule Luis und seinen Mitschülern eingetrichtert, während der Spiele höflich und hilfsbereit zu allen Besuchern zu sein. Das kam davon, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, der sechzehn Jahre vor seiner Geburt zu Ende gegangen war, so viel Mist gebaut hatten. Die meistens Filme und Fotografien aus dieser Zeit waren so grau und düster, als hätte es damals auf der Welt noch keine Farben gegeben. Jetzt, im Angesicht der bunten Menschenmenge im Stadion und des blauen Münchner Himmels, wurde Luis fast schwindelig beim Gedanken, was für ein Glück es bedeutete, in die erleuchtete, farbige Welt geboren worden zu sein. Seinem Vater schien es genauso zu gehen. Er sah stolz und zufrieden aus. Man sah ihm nicht an, wie ungemütlich er werden konnte, wenn Luis in seinem Zimmer zu laut Musik hörte oder abends nicht ins Bett wollte. Zweimal hatte es sogar Ohrfeigen gesetzt. Einmal, als er mit dem Ball das Ladenfenster der Bäckerei Tuttlinger zerschossen hatte und das zweite Mal, als er nach dem Fußballspielen an die Mauer der Dreieinigkeitskirche in der Lamontstraße gepinkelt, und der Pfarrer ihn dabei erwischt hatte. Aber das war schon ein paar Jahre her. Meistens lief es gut zwischen ihnen. Sie unternahmen viel zusammen, segelten bei gutem Wind mit ihrem Kajütboot über den Wörthsee oder fuhren mit den neuesten Sportwägen herum, die befreundete Autohändler ihnen für ihre Spritztouren überließen. Manchmal verbrachten sie ein Männerwochenende am Gardasee oder fuhren zu einem der Auswärtsspiele des FC Bayern München. Gegen den Willen seiner Mutter waren sie in einem Heißluftballon über das Berchtesgadener Land, in einem Zeppelin über das Oktoberfest und in einem Hubschrauber zum Hockenheimring geflogen, wo sie sich ein Autorennen angesehen und ein Autogramm des Siegers Jochen Rindt ergattert hatten. Hin und wieder fuhren sie zum Pferderennen nach Daglfing, wo sie um echtes Geld wetteten. Letztes Jahr hatte sein Vater ihn sogar mit nach New York genommen. Die Eintrittskarten für den Weltmeisterschaftskampf zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier im Madison Square Garden hatte ihnen der Architekt Ezard von Blom zukommen lassen. Wofür, daran konnte sich Luis beim besten Willen nicht mehr erinnern. Sein Vater organisierte andauernd etwas für sie, ohne dafür bezahlen zu müssen. Darin war er Weltmeister.
NIKOhätte vor lauter Wut am liebsten in ein Kissen gebissen. Noch lieber wäre es ihm gewesen, erst gar nicht bei seinen Eltern auf die Welt gekommen zu sein, sondern bei anderen, irgendwo im Lehel, Grünwald oder Bogenhausen, wo Leute wohnten, die sich Eintrittskarten für die Olympischen Spiele leisten konnten. Bei einem Vater, der Fabrikdirektor oder Bankier war, anstatt Dreher bei Schrauben Winkler. Bei einer Mutter, die nicht halbtags im Salon Susi in der Sudetendeutschen Straße alten Damen die Haare champagnerfarben oder rosa färbte und den Rest des Tages die Wohnung putzte, als würde jeden Augenblick jemand vom Ordnungsamt an der Tür klingeln.
Es war sein elfter Geburtstag, der beschissenste, den er je gefeiert hatte. Da half weder der selbst gebackene Gugelhupf seiner Mutter, noch das dunkelblaue 1860 Trikot, das sein Vater ihm geschenkt hatte. Im Gegenteil. Wegen des Trikots war der Streit ja erst losgegangen, weil das Wichtigste daran fehlte – das Wappen. Ohne das Löwenwappen des TSV 1860 München und die Rückennummer von Hansi Rebele war das Trikot nur ein ganz normales, blaues Sporthemd. Saublödes blaues Hemd hatte Niko bestimmt zwanzigmal hintereinander gebrüllt, bis sein Kopf rot angelaufen war. Deswegen musste er jetzt zwei Tage lang in seinem Zimmer bleiben. Es war total ungerecht. Seine Mutter hatte ihm das Wappen und die Rückennummer hoch und heilig versprochen.
Seit dem 28. Mai 1966, als die Sechziger die Meisterschaft der 1. Bundesliga errungen hatte, war Niko glühender Anhänger der Löwen, wie jeder, der in München etwas mit Fußball am Hut hatte, den TSV 1860 München nannte. An diesem historischen Tag durfte er zum ersten Mal in seinem Leben auf der Gegentribüne des Grünwalder Stadions in der Reihe 12 auf Platz 12 sitzen. Onkel Willy, der ältere Bruder seiner Mutter, besaß eine Dauerkarte und hatte ihn mitgenommen. Fritz Stifter, dem der Platz neben Onkel Willy gehörte, lag an diesem Tag mit einem Darmverschluss im Rotkreuz Krankenhaus. Obwohl es nicht richtig war, hoffte Niko, dem Stifter würde noch öfter etwas passieren. »So, jetzt bist du ein Sechziger. Einmal Löwe, immer Löwe«, hatte Onkel Willy auf dem Heimweg zu ihm gesagt. Obwohl er ihn nie mehr mit ins Stadion genommen hatte, fühlte Niko sich seit diesem Tag dem TSV 1860, dem Meer aus weißblauen Fahnen, den Gesängen der Anhänger, der Farbe Blau im Allgemeinen und den Löwenspielern mehr verbunden, als seinen Verwandten. Im Gegensatz zu ihnen ging jeder Löwe nämlich für seine Kameraden durchs Feuer, so wie sein Großvater es im Krieg erlebt hatte. Inzwischen waren die Sechziger aus der Bundesliga abgestiegen, aber das änderte rein gar nichts. Wenn mal erst einmal ein Löwe war –da hatte Onkel Willy völlig recht –, blieb man es für immer. Dann war man gewissermaßen in guten wie in schlechten Tagen mit dem Verein verheiratet, bis der Tod einen von ihm schied, aber das würden seine Eltern im Leben nicht verstehen. Nie kauften sie ihm eine Karte für ein Löwenspiel, nie ließen sie ihn mit der Tram nach Giesing fahren, damit er seinen Lieblingsspielern wenigstens beim Training zuschauen konnte. Nie würden sie ihm ein echtes Sechziger Trikot besorgen. Nie, nie, nie. Niko trat gegen die verschlossene Tür.
»Ihr seid so gemein! Ich hasse euch!«
Wenn sie sein Zimmer wieder aufsperrten, würde er das saublöde Trikot einfach durch den Abort spülen, ganz egal, ob sie ihn dann zur Strafe vier Wochen lang in sein Zimmer sperrten oder ihm das Taschengeld strichen. Dann konnte er wenigsten behaupten, der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der nichts von der Olympiade mitbekommen hatte, noch nicht mal einen Bericht im Fernseher, weil sie nämlich keinen besaßen und auch nie einen besitzen würden. Falls ihn dann jemand fragte, ob er nicht wenigsten im Radio etwas davon gehört hätte, könnte er ohne zu lügen antworten, seine hundsgemeinen Eltern hörten unentwegt Volksmusik, anstatt Uriah Heap, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin oder Rory Gallagher. Vielleicht wäre es auch eine gute Gelegenheit zu behaupten, sie könnten nicht lesen und die Zeitung läge nur zum Schein jeden Morgen vor der Tür. Ganz nebenbei würde er dann noch erwähnen, dass sie ihm so gut wie nie etwas zu essen gaben und sein Vater ihn jeden Tag prügelte wie einen Hund, was gelogen wäre, denn es geschah nur ein oder zwei Mal im Monat. Vielleicht käme er dann endlich zu Leuten, die sich Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 leisten konnten. Noch zwei Jahre würde er es hier jedenfalls nicht mehr aushalten.
Es war zehn vor vier. In einer halben Stunde kam die Fackel im Olympiastadion an, aber davon würde er rein gar nichts mitbekommen. Unten im Hof stand das gelbe Bonanza-Rad, das Edgar gehörte. Noch so ein Ding, das Niko zeigte, dass der bescheuerte liebe Gott, den seine Mutter öfter anrief als ihre beste Freundin, ihn dauernd anschmierte. Edgar hatte es viel besser erwischt. Sein Vater arbeitete seit einem halben Jahr drüben in den modernen Zylindertürmen bei BMW. Wenn es stimmte was Edgar sagte, zogen sie schon nächsten Monat in eine Wohnung an der Münchner Freiheit, nach Schwabing, an den Nabel der Welt, raus aus dem Milb, diesem Drecksloch Milbertshofen, wo es nur schäbige Häuser gab und man den Leuten ansah, dass sie auf ewig in der Kreisliga spielten.
LUISschritt durch das Tor Z in das weite Rund des Olympiastadions. Beim Richtfest war er an genau dieser Stelle gestanden. Da war das Stadion noch eine schlammige Grube mit rohen Tribünenskeletten gewesen. Jetzt kam er aus dem Staunen gar nicht mehr raus.Auf seinen Armen war so soviel Gänsehaut wie an Heilig Abend, wenn sich die Tür zum Wohnzimmer öffnete und er ins Glitzern und das Leuchten des Christbaums trat, aber auf dem Polaroid, das sein Vater machte, war sie natürlich nicht zu erkennen.
Luis Sprachlos 26-08-1972
Block Z befand sich auf der überdachten Haupttribüne gleich neben dem Bereich für die Ehrengäste. Hüpfend sprang Luis die hohen Stufen bis weit hinauf bis zur Reihe 66, wo schon einige Geschäftsfreunde seines Vaters saßen. Eberhard Schmidl, der ihnen alle zwei Jahre das neueste Mercedes Modell für den halben Preis besorgte und ihnen vor zwei Wochen höchstpersönlich die Goldmedaillenkutsche in die Lamontstraße gebracht hatte. Erhardt Freigerber, der Eiskrem Fabrikant, der ihnen jeden Monat gratis zwei Kartons mit Vanille- und Erdbeereis schickte. Kurt Scheller, den sie alle „Friseur“ nannten, obwohl er Steuerberater war. Der Feinkosthändler Albert Spinner, der ihnen zu Weihnachten und Ostern riesige Fresskörbe mit Delikatessen zukommen ließ und Peter von Stein, der Rechtsanwalt seines Vaters. Jakob Binder vom Baureferat war auch da. Jedes Mal, wenn sie ihm begegneten, erwähnte seine Mutter, der Binder sei vom anderen Ufer. Luis hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte, aber die mitleidige Art seiner Mutter verhieß nichts Gutes. Wahrscheinlich war der Binder schwer krank, und keiner traute sich etwas zu sagen.
»Da schau her, die ganze Bagage ist schon da!« rief sein Vater, als er endlich die Reihe 66 erreichte. Eine schiere Ewigkeit hatte er Leute begrüßt und Hände geschüttelt. Hans Woltinger schwang sich mit seiner kolossalen Bierwampe aus einem der gelben Schalensitze und schlug ihm mit einer seiner klobigen Pranken auf die Schulter. Mit der anderen Hand zeigte Woltinger auf das Stadion und prahlte in seinem verbeulten Allgäuer Dialekt, wie großartig sie das alles hinbekommen hatten. Luis stellte sich vor, dass im Kopf seiner Mutter deutsche Untertitel mitliefen, wie bei manchen Kinofilmen. Sein Vater bezeichnete Hans Woltinger als die korrupteste Sau im Rathaus, aber im Leben der Erwachsenen schien es keine Rolle zu spielen, ob man sich mochte oder nicht. Zu Hause schimpfte sein Vater über so ziemlich alle, die jetzt mit ihm in der Reihe 66 saßen. Dennoch traf er sich jeden zweiten Freitag im Augustiner zum Stammtisch mit ihnen, wo sie bei Bier und Schweinebraten die neuesten Gerüchte herumgehen ließen oder andächtig zuhörten, wenn der „Friseur« ihnen erklärte, wie sie eine Menge Steuern sparen konnten, indem sie mehr Geld ausgaben, als sie verdienten. Manchmal, wenn seine Mutter zu einem Tupperware-Abend bei Elli Bamberger eingeladen war oder sich bei Cora Grimmel die neuesten Kosmetikartikel von Avon vorführen ließ, durfte Luis seinen Vater zum Stammtisch begleiten. Da die eine Hälfte der Anwesenden aus Anhängern des TSV 1860 München bestand und die andere zum FC Bayern München hielt, wurde meistens zuerst über Fußball gestritten. Anschließend redeten sie über das Geschäft, wie sie es nannten, also über Politik und Autos. Und wenn das alles erledigt war, sprachen sie über Weiber, Furien, Schlampen, Zicken, Tussis, Jungfrauen und Ladies, womit, wie Luis schnell herausgefunden hatte, immer Frauen gemeint waren. Wenn einem aus der Runde etwas kaputt ging oder jemand etwas Unliebsames loswerden wollte, meldete einer der anderen den Schaden seiner Versicherung und nahm das Malheur auf seine Kappe. Auf diese Weise kamen sie alle günstig an neue Möbelstücke, Kameras, Anzüge oder Uhren und irgendwie schien es in Ordnung zu sein. Schließlich zahlten sie alle viel Geld in die Versicherungen ein. »Die schwimmen im Geld. Und zwar in eurem«, sagte der Friseur bei solchen Gelegenheiten, und darauf stießen sie dann alle an. Hin und wieder fragten sie Luis nach seiner Meinung zu der einen oder anderen Sache, als sei er schon erwachsen. Nur für ihre derben Scherze hielten sie ihn noch zu jung. »So jetzt hört der Junior einmal weg«, sagten sie dann, aber natürlich bekam er immer alles mit. Im Gegensatz zu seinen Schulfreunden wusste er längst was nageln bedeutete, nämlich das gleiche wie bumsen, pimpern, vögeln, flachlegen, ficken, pudern, besteigen, einlochen oder drüberlassen. Er hatte auch herausgefunden, dass das Wort Fotze mindestens zwei Bedeutungen hatte.Halt die Fotz’n, bedeutete in Bayern halt den Mund. Eine Fotze flachlegen oder den Willy in eine Fotze stecken hingegen etwas ganz anders. Aber davon erzählte er seiner Mutter, wenn sie ihn fragte, wie es beim Stammtisch war, kein Sterbenswort. »Das bleibt alles unter uns. Wir Männer müssen zusammenhalten«, ermahnte ihn sein Vater jedes Mal auf dem Heimweg vom Stammtisch.
Wieder und wieder ließ Luis seinen Blick über das Stadion schweifen. Eisverkäufer schleppten Bauchläden durch die Reihen, rot gekleidete Männer mit hochroten Köpfen und roten Tanks auf ihren Rücken riefen »Coca- Cola! Eisgekühlte Coca-Cola!« Afrikaner, Araber, Asiaten, Südländer und Einheimische saßen friedlich nebeneinander. Kinder schwenkten weiße Fähnchen auf denen die fünf olympischen Ringe abgebildet waren. Frauen trugen Hotpants, Miniröcke, Kimonos, Schleiergewänder, Bikinis, manche sogar Anzüge wie Männer. Orientalen in wallenden Kaftanen quälten sich die steilen Treppen herauf. Mexikaner schwenkten Sombreros oder spielten auf Trompeten kurze, eingängige Melodien. München hatte sich tatsächlich in eine Weltstadt verwandelt.
Hoch oben, an der äußersten Kante der gläsernen Waben des Zeltdachs, verlief das längste Stahlkabel der Welt, ohne das die gesamte Dachkonstruktion in sich zusammenfallen würde wie ein Kartenhaus. Wochenlang hatte Luis alles Wissenswerte über das Olympiagelände zusammengetragen. Die exakten Abmessungen der Spielfelder, die Höhe der Flutlichtmasten, die genaue Menge des abgetragenen Erdreichs, das Fassungsvermögen der Stadien und das verwendete Material. Dank seines Vaters wusste er sogar über streng vertrauliche Dinge Bescheid. Der ursprüngliche Plan des Architekten Günter Behnisch sah vor, alle Stadien des Olympiageländes aus Holz zu bauen und sie mit Zeltdächern aus Stoff zu überspannen. Nach den Spielen sollte die Natur das ganze Areal wieder überwuchern, damit die ganze Welt sah, dass die Deutschen keine Herrenmenschen mehr waren, die Monumente für ein tausendjähriges Reich bauten. Dieses Geheimnis durfte Luis in seinem Aufsatz über den Bau des Olympiastadions nicht verraten, aber für eine Eins mit Stern hatte es trotzdem gereicht. Nur warum die Stahlpfeiler des Stadions, die schräg aus der Erde ragten, nicht einfach umfielen, verstand er immer noch nicht. Sein Vater behauptete, es sei alles eine Frage der Statik.
In den Stadionkurven verwandelten sich Lichtpunkte auf den modernsten Anzeigetafeln der Welt wie von Geisterhand gesteuert in Worte und Grafiken. An den Seiten der Gegentribüne ragten die langen Hälse der Fluchtlichtmasten in den Himmel. Einen Moment lang wünschte Luis, es wäre schon dunkel, damit er endlich eine Vorstellung davon bekam, wie hell 1500 Lux waren. Hinter der Südkurve, wo der Olympiaberg aufragte, unter dem der Schutt des Zweiten Weltkriegs lag, hatten sich so viele Menschen versammelt, dass man das Gras nicht mehr sehen konnte, das inzwischen darüber gewachsen war. Dicht an dicht standen sich die Leute seit Stunden die Beine in den Bauch, um etwas von der Atmosphäre im Stadion mitzubekommen.
Als Sepp Hadlinger schwer schnaufend auf die letzten Stufen vor der Reihe 66 stampfte, geriet der Beton unter ihm in Schwingung. Selbst wenn nicht jeder der 25.000 Zuschauer auf der Haupttribüne Hundertzwanzig Kilo wog, musste die Konstruktion ein für Luis unvorstellbares Gewicht tragen. Sein Vater und der Kiesschieber, wie er Hadlinger immer nannte, begrüßten sich überschwänglich, klopften sich gegenseitig auf die Schultern und scherzten. Vor vier Jahren hatte der Kiesschieberihnen als Dank für einen Großauftrag das Schwimmbad im Garten in der Lamontstraße ganz umsonst gebaut. Unvermittelt kniff Hadlinger Luis in die Backen und prahlte in derbstem Bayerisch mit seinen guten Verbindungen zum Präsidenten des TSV 1860 München. Er müsse nur etwas sagen, wenn er in der Schülermannschaft der Sechziger spielen wollte. Seit es Diridari, also Geld dafür gab, wolle ja jeder gesunde Bursche Profi-Fußballer werden. Aber das wollte Luis gar nicht, und wenn, dann bestimmt nicht beim TSV 1860 München, sondern beim FC Bayern, weil der viel besser war.
»Nö. Ich werde Rechtsanwalt oder Libero beim FC Bayern«, erwiderte Luis, und dieses nö genügte dem Hadlinger, ihn anzublaffen, er solle gefälligst Bayerisch lernen, sonst könne er in München gar nichts werden, nicht mal Balljunge bei dem Saujuden-Verein. Es hatte sich also doch noch nicht alles geändert.
»Hat er dich beleidigt?« erkundigte sich seine Mutter, die ihn in solchen Momenten um seine Mehrsprachigkeit beneidete. Sie fühlte sich ausgeschlossen und unsicher, wenn etwas auf bayerisch oder in einer anderen Fremdsprache gesagt wurde. Im Gegensatz zu ihr konnte Luis wenigstens schon ein bisschen Englisch sprechen. Good morning. Where do you come from? May I help you? Munich is a beautiful town with peaceful inhabitants. Welcome in the city with heart.
»Er ist ein dummes, fettes Arschloch.«
»So etwas sagt man nicht.«
»Ihr sagt doch immer, ich soll nicht lügen.«
»Das musst du auch nicht. Wenn du Wahrheit für dich behältst, ist sie ja immer noch wahr. Nur hast du es dann leichter im Leben
FERNER Jubel und Fetzen von Musik segelten aus
dem nahen Olympiastadion durch das offene Zimmerfenster. Ganz München war da drüben, nur Nikolaus Sedlmayer aus dem verschissenen Milb nicht. Von der Hanselmannstraße bis zur Welt waren es keine zweihundert Meter, aber für ihn fühlte sie sich so weit weg an, wie der Mond. Er kletterte auf das Fenstersims und schloss die Augen. Seine Beine zitterten. Dann zwängte sich sein Magen in seinen Hals.
Unten, vom Hof aus, wirkte das Fenster seines Zimmers ungefähr so weit entfernt wie das Dreierbrett im Dantebad vom Beckenrand. Den Sprung auf das harte Pflaster des Hofs hatte er überlebt, also würde es mit dem Wasser nicht anders sein. Beim nächsten Mal würde er todesmutig vom Zehner springen. Dann würden die anderen ihn nie mehr als feigen Hund bezeichnen.
Seine Fußsohlen brannten. Aus einer Wunde an seinem rechten Knie lief Blut durch ein klaffendes Loch in der Jeans, die seine Mutter ihm erst zum Ferienanfang gekauft hatte, obwohl sein Zeugnis so schlecht ausgefallen war. Es war seine allererste Jeans. Zwei Jahre lang hatte er darum gebettelt, die speckige Lederbundhose nicht mehr tragen zu müssen. Im Gymnasium lief kein Mensch mehr mit so etwas herum. Da trugen alle Bluejeans, Parka, Adidas Rom Turnschuhe und lange Haare. Das war quasi die Uniform der Hippies. Im Englischen Garten, der inzwischen so etwas wie der Garten Eden war, hatten viele sogar überhaupt nichts an, nicht mal die Mädchen. Während man in einer Lederbundhose ein Gefangener von Neandertal blieb, lief man mit einer Bluejeans geradewegs in die Freiheit. Seit er die Levis trug, hatte er das Gefühl, zu den Befreiten zu gehören, aber jetzt nahm seine Mutter sie ihm bestimmt wieder weg. Mit dem Loch würde sie ihn jedenfalls aus lauter Sorge, was die anderen Leute von ihnen denken könnten, nicht auf die Straße lassen, aber was später kam, war jetzt unwichtig. Er musste so schnell wie möglich zur Olympiade, sonst war er wieder einmal der allerletzte Depp.
Edgars Bonanza Rad war abgeschlossen. Oben am Fenster und sogar im Fallen hatte er davon geträumt, es damit noch rechtzeitig zum Schuttberg zu schaffen und das Olympische Feuer zu sehen. Dabei sein ist alles – das sagten jedenfalls alle, wenn es um die Olympiade ging, aber wenn dabei sein alles war, dann war das jetzt gar nichts. Wieder rüttelte er am Schloss, aber es sprang nicht auf. Wütend trat er gegen die verbeulte Konservenbüchse, mit der Edgar und er im Hof immer so lange Bayern gegen Sechzig spielten, bis sich jemand aus dem Haus beschwerte. »Tor!«, rief er aus Versehen, als die Büchse in den Kellerabgang flog. Erschrocken schlug er eine Hand vor den Mund. Er sah nach oben zum Fenster und hielt die Luft an, bis er sicher sein konnte, dass seine Eltern nichts bemerkt hatten.
Die Büchse lag neben dem Werkzeugkasten, der Hausmeister Weber gehörte. Niko zog die Henkel auseinander und fand zwischen rostigen Nägeln, einem Hammer, einer Säge, rostigen Schraubenschlüsseln und Zangen, einen Schraubenzieher. Edgar würde bestimmt nicht sauer sein. Der saß irgendwo im Block J des Olympiastadions, weil sein Vater Eintrittskarten von BMW geschenkt bekommen hatte.
Niko bohrte den Schraubenzieher in das Fahrradschloss. Er würde Edgar vom nächsten Taschengeld einfach ein neues kaufen. Außerdem hatte er ihm vor zwei Wochen die neueste Deep Purple LP geliehen und bis jetzt nicht wiederbekommen, obwohl sie nur eine Woche ausgemacht hatten. Eine Hand wäscht die andere, hatte sein Opa immer gesagt.
»Was machst’n da?« rief Edgars kleine Schwester Franziska, die auf dem Fenstersims im Erdgeschoss saß und mit den Beinen wippte. Niko hatte sie bis jetzt gar nicht bemerkt.
»Fall bloß nicht runter, Franzi. Wer passt denn auf dich auf? Deine Oma?«
»Ja, die Oma.«
Er zwängte den Schraubenzieher wieder in das Schlüsselloch des Fahrradschlosses und bog daran herum, bis es schließlich aufsprang. Franziska pflaumte ihn an, er solle gefälligst die Finger vom Rad ihres Bruders lassen, also versuchte er – obwohl sie es garantiert nicht verstand –, ihr zu erklären, dass Ausleihen eine astreine Sache war, vorausgesetzt, man brachte dem Besitzer das, was man sich lieh, in einwandfreiem Zustand wieder zurück. Anstatt zu nicken und es gut sein zu lassen, wollte sie wissen, warum er so geschwollen daherredete.
»Nur Steinzeitmenschen sprechen Neandertalerdeutsch. Wenn du kein Hochdeutsch lernst, musst du für immer bei den Ha-i im Milb bleiben«, erwiderte Niko.
»Was sind Ha-i?«
»Halbidioten.«
Edgars Oma erschien mit einem misstrauischen Gesicht am Fenster. Obwohl sie immer so schaute, wurden seine Handflächen diesmal schlagartig warm und begannen zu schwitzen. Wenn er mitbekommen wollte, wie das Olympische Feuer entzündet wurde, musste er schleunigst los, aber jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als der schwerhörigen Frau fünfmal hintereinander zu versichern, dass er das Rad vom Edgar nicht klaute, sondern nur borgte, weil er dringend zur Olympiade musste.
»Das geht schon in Ordnung, Frau Thum. Der Edgar weiß Bescheid. Der hat dafür meine Deep Purple. Eine Hand wäscht die andere.«
DIE Olympia-Fanfare erklang. Eine Nation nach der anderen zog durch das Marathon-Tor über die ziegelrote Tartanbahn mit ihren akkuraten, weißen Markierungen ins Stadion ein. Applaus brandete auf, verebbte kurz und schwoll sofort wieder an. Drüben auf der Gegentribüne, die kein Dach besaß, saßen die Zuschauer in der prallen Sonne. Sein Vater deutete mit seinem Kinn zur Ehrentribüne.
»Da schau, der Mann neben Michael Schulmeister. Das ist der Günter Behnisch. Der ist jetzt bestimmt froh, dass alles auf ewig stehen bleibt. Manche Menschen muss man zu ihrem Glück zwingen. Merk dir das.«
Luis betrachtete den Architekten des Olympiageländes und versuchte sich vorzustellen, wie es sich anfühlen musste, all das erschaffen zu haben, was sich vor seinen Augen ausbreitete. Da würde man sich vermutlich vorkommen wie Gott. Er ließ seinen Blick über das sonnenbestrahlte Wunder wandern, das Behnisch aus dem Oberwiesenfeld gezaubert hatte und fasste einen Entschluss. Er würde nicht Zahnarzt werden, wie seine Mutter es sich wünschte und auch nicht Libero beim FC Bayern, auch wenn es seinem Vater in der Seele weh täte. Etwas wagen. Immer der eigenen Nase lang. Handeln oder behandelt werden, betete Luis stumm die drei obersten Gebote seines Vaters herunter. Er sah neben sich und für einen Augenblick lief das Leben ab wie in Zeitlupe. Die Hände seines Vaters schlugen rhythmisch zusammen, seine Augen glänzten, sein schütteres Haar wehte. Ihm war es zu verdanken, dass die Stadien nun doch aus Stahl, Beton und Glas waren. Seinetwegen würde der Olympiapark bis in alle Ewigkeit in München stehen wie ein Weltwunder. Wie das Taj Mahal oder die Pyramiden von Gizeh.
AM Ende der Hanselmannstraße teilte der Mittlere Ring die Welt in zwei Teile. Hinter Niko, im Norden, lagen die Stadtteile Milbertshofen, Am Hart, Haselbergl, Kieferngarten und dahinter Großlappen, wo es wegen der Kläranlage fast immer nach Fäkalien stank. Vor ihm, nur vier Fahrspuren entfernt, begann die bessere Welt. Im Süden Schwabing, im Westen Neuhausen und dahinter Nymphenburg, wo die feinen Leute wohnten, und die weniger feinen in ihren Sonntagskleidern durch den Schlosspark spazierten und sich im Palmencafé bedienen ließen, als gehörten sie zur Hautevolee. Niko passierte die imaginäre Grenze und bog in der Lerchenauerstraße an der Stelle in den Olympiapark, wo er noch vor vier Jahren Sportflugzeugen beim Starten und Landen zugesehen hatte. Da war das ganze Gelände bis hinüber an die Schwere Reiter Straße ein einziges Stoppelfeld gewesen, auf dem sie eigentlich nicht spielen durften, weil es der Luftwaffe gehörte. Weiter drüben im Westen standen immer noch Kasernen und die Gebäude ehemaliger Bombenfabriken. Die Straßen dort hießen Lazarett-, Artillerie-, Funker-, oder Infanteriestraße. Das hatte alles mit früher zu tun. Wo jetzt die Stadien standen und sich der Olympiaberg erhob, wollten die Nazis zuerst den größten Güterbahnhof der Welt und später den größten Schlachthof der Welt bauen. Die hatten immer ganz groß gedacht, an ein Weltreich. Das wusste Niko von seinem Opa, und der musste es ja wissen, weil er in der Partei gewesen war. Jedenfalls war es gut, dass sie keinen Schlachthof gebaut hatten, zumindest nicht an dieser Stelle. Sonst würde es im Milb außer nach der Scheiße aus Großlappen auch noch nach Blut und toten Tieren stinken.
Entlang des Olympiasees bewegten sich unglaublich viele Menschen. Alte und junge Menschen, Muselmänner, Fakire, Juden, Neger, Araber, Schlitzaugen, Hippies und Trachtler liefen einträchtig nebeneinander. Sogar Hirnis und Spastis wurden in Rollstühlen zum Stadion geschoben. Die ganze Welt spazierte im Olympiapark umher, also war das Gelände doch noch so eine Art Weltreich geworden. Das hätte seinem Opa sicherlich gefallen, aber der sah sich jetzt schon seit zwei Jahren am Nordfriedhof die Radieschen von unten an. Gegenüber der Schwimmhalle, die auf der anderen Seite des Olympiasees lag, ging es nicht mehr weiter. So einen Menschenauflauf hatte Niko noch nie erlebt, nicht mal im Sechziger Stadion. Auf dem ehemaligen Schuttberg war kaum mehr ein Flecken Grün zu sehen. Neben dem Seeufer standen einige Fahrräder um einen Baum herum und da stellte er Edgars Rad einfach dazu. Eine Fanfare, die der Wind aus dem Stadion herüber wehte, trug ihn den Hügel hinauf. Plötzlich riefen die Leute »Da, ... da kommt er! Da ist die Fackel!«
Als er die Kuppe des Schuttbergs erreichte, kamen ihm fast die Tränen. Er hatte es tatsächlich noch geschafft. Es war fast so, als hätte der Fackelläufer auf ihn gewartet. Erst sah er nur den ausgestreckten Arm mit der Fackel an der obersten Kante der Gegentribüne, dann den Läufer. Plötzlich wurde es ganz still. Auf der ganzen ehemaligen Nazi-Brache schwiegen die Leute wie bei einer Andacht. Aus den Lautsprechern im Stadion ertönte eine feierliche Stimme. Dann berührte die Fackel den großen silbernen Kelch, aus dem kurz darauf Flammen schlugen. Jubel brach aus, wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Niko spürte, wie er von oben bis unten Gänsehaut bekam. Er hatte es wirklich noch geschafft. Dabei sein war wirklich alles, und deshalb war es doch noch der schönste Geburtstag, den er je erlebt hatte.
»Ich habe heute Geburtstag!« rief er zwei Frauen zu.
»Gehweida! Was du für ein Glück hast, Bub! So viel Glück hat nicht jeder!«
Soviel Glück hatte bestimmt niemand auf der Welt, da war Niko sich ganz sicher.
LUIS war noch ganz aufgekratzt von der Eröffnungsfeier, und jetzt schüttelte er auch noch die Hände von Wirtschafts- und Finanzminister Franz-Josef Strauß, dem Münchner Oberbürgermeister Jochen Vogel, den er mochte, obwohl er der SPD angehörte, die ein rotes Tuch für seinen Vater war. Der Präsidenten des NOK Willi Daume, Innen- und Sportminister Genscher und Günter Behnisch waren auch da. Es habe sechsunddreißig Jahre gedauert die Spiele wieder nach Deutschland zu holen, sagte jemand, und es würde vermutlich mindestens so lange dauern, bis es wieder einmal geschehe. Luis rechnete nach. Wenn es stimmte, kam also erst im nächsten Jahrtausend wieder eine Olympiade nach Deutschland. Bis dahin würde er älter sein, als sein Vater es jetzt war. Vielleicht hätte er bis dahin auch eine Stirnglatze, eine Brille und einen goldenen Mercedes 450SE, aber ganz bestimmt würde er dann der Architekt sein, der die Stadien für die Olympischen Spiele baute, ganz gleich, wo sie stattfanden.
Als sie am Stadion abfuhren, durchsuchte Luis die Tragetasche mit dem offiziellen Olympia 72 Schriftzug, die ihm eine der Hostessen in die Hand gedrückt hatte. Als erstes zog er ein schweres Stück Glas in der Form einer Nougatstange hervor.
»Was ist das?«
»Ein Briefbeschwerer. Damit dir die vielen Liebesbriefe nicht davonfliegen, die du von den Mädchen bekommen wirst«, sagte sein Vater.
»Haha. Sehr lustig.«
»Papa hat recht. Du bist klug, und hübsch bist du auch noch. Das gibt es nicht sehr oft.«
Luis zog einen hölzernen Dackel aus der Tasche – Waldi. Der bunte Hund war das offizielle Maskottchen der Olympiade. Überhaupt schienen alle Dinge automatisch offiziell zu werden, sobald die Olympischen Ringe darauf abgebildet waren.
»Was heißt offiziell?«
»Das bedeutet im amtlichen Auftrag, von allerhöchster Stelle genehmigt und bestätigt, also zum Beispiel von mir. Wenn einer versucht, den Waldi nachzumachen und zu verkaufen, geht er ins Gefängnis«, sagte sein Vater, der über viele Dinge Bescheid wusste. Luis setzte den Dackel auf die Heckablage zwischen den Trachtenhut seines Vaters und die gehäkelte Mütze, unter der sich eine Rolle Klopapier für einen Notfall verbarg, der bisher noch nie eingetreten war. Dann förderte er ein gebundenes Buch aus der Tasche zu Tage, in dessen Einband der offizielle Schriftzug der Olympiade geprägt war. Er blätterte es durch, aber es befanden sich nur leere Seiten darin.
»Das ist ein Notizbuch. Du kannst hineinschreiben, was du möchtest. Telefonnummern, Adressen. Vielleicht schreibst du ein Tagebuch oder malst etwas Schönes. Du kannst doch so gut zeichnen. Da ist ein Stift in der Schlaufe, schau«, sagte seine Mutter.
Am Ackermannbogen öffnete ihnen ein Ordner die Schranke. Die Passanten auf dem Bürgersteig blieben stehen und versuchten zu erkennen, wer im Wagen saß. Seine Mutter winkte ihnen zu, als sei sie die Königin von England. Luis drehte sich um und sah durch die Rückscheibe noch einmal zum Olympiastadion. Es war wie im Traum. Karawanserei, Tausendundeinenacht, mitten in München, weit weg von Arabien.
Auf der Brücke am Leonrodplatz quälte sich der Verkehr von einer zur anderen Seite der Dachauerstraße. Luis erkundigte sich bei seinem Vater nach dem Namen der Brücke, aber sie besaß keinen, war nichts weiter als eine Behelfsbrücke, die während der Bauarbeiten für die U-Bahn noch am Oskar-von-Miller-Ring gestanden hatte.
»Können wir die nicht einfach abreißen und eine schönere bauen?«
»Freilich, das machen wir, gell, Gabilein«, sagte sein Vater und tätschelte das Knie von Doris Day. Luis zog den Stift aus der ledernen Schlaufe des Notizbuchs und schrieb auf die allererste Seite:
Luis Bühler - Architekt
Er blätterte um, zog mit dem Daumen einen akkuraten Falz und begann zu schreiben:
Notwenige Abrisse:
1.) Behelfsbrücke, Leonrodplatz.
2.) Neckermann-Gebäude, Kaufingerstraße
3.) Peterhof, Marienplatz
4.) Kaufhof am Marienplatz
Dann begann er mit der Zeichnung einer neuen Brücke für den Leonrodplatz, die so viel Schwung haben sollte wie die olympischen Zeltdächer. Und während er zeichnete, kamen ihm immer mehr Gebäude in München in den Sinn, die bis zum Fundament abgerissen und neu entworfen werden mussten. Ab jetzt würde er das Notizbuch überall mit hinnehmen. Bis zum Abitur würde es voller Skizzen und Ideen sein. Wenn er sie dann einem Professor der Universität zeigte, würde er vielleicht gar nicht mehr studieren müssen. Dann könnte er vielleicht sofort damit anfangen, aus München eine Metropole zu machen, die es mit New York, Paris oder London aufnehmen konnte.
»Zeig mal«, sagte seine Mutter. »Unglaublich. Und das hast du jetzt so auf die Schnelle gezeichnet?«
Sein Vater lenkte die Goldmedaillenkutsche die steil ansteigende Kurve zum Friedensengel so schnell hinauf wie üblich. Meistens imitierte er dabei einen Schausteller, der beim Calypso auf dem Oktoberfest in sein Mikrofon brummte »und wieder eine tolle Fahrt«, aber diesmal sah er schweigend und gebannt auf die Skizze, bis sie oben auf der Prinzregentenstraße wieder aus der Zentrifuge kamen
»Gabilein, ich glaube, wir haben einen zweiten Leonardo da Vinci in die Welt gesetzt.«
WENN es kommt, kommt es richtig. Bestimmt hundertmal hatte Niko sich die Lebensgeschichte seines Großvaters angehört. Als Soldat war er an einem saukalten Novembertag in den zweiten Weltkrieg gezogen und im eiskalten Stalingrad fast erfroren, bevor die Russen ihn für einige Jahre in die Gefangenschaft nach Sibirien schickten, wo angeblich sogar die Seelen der Gefangenen vor lauter Kälte zu Eis erstarrten. Nach seiner Rückkehr hatte er zu Hause mit seiner Frau dann auch noch den schlimmsten aller Kriege mitgemacht – den Ehekrieg. Deshalb sagte sein Opa am Ende seiner Geschichte immer, im Grunde sei sein ganzes Leben eine einzige bitterkalte Pechsträhne gewesen. Niko hatte nicht geglaubt, dass ihn auch mal eine erwischen könnte.
Edgars Bonanza-Rad stand nicht mehr an dem Baum, an dem er es abgestellt hatte. Es war auch bestimmt nicht die falsche Stelle. Trotzdem suchte er drei Mal an allen Bäumen entlang des Olympiasees danach und fragte jede Menge Leute, ob sie das Rad gesehen hätten. In seinem Bauch wütete ein Feuer. Er verspürte Hunger und gleichzeitig fühlte sich sein Hals so eng an wie letztes Jahr auf dem Oktoberfest, als er nach zwei Fahrten mit der Wilden 8 eine Portion Zuckerwatte und ein halbverdautes halbes Hähnchen hinter das Hacker-Pschorr Zelt gekotzt hatte. Mittlerweile war es fast dunkel, aber ohne das Fahrrad brauchte er nie mehr in der Hanselmannstraße aufzukreuzen.
Auf der Böschung neben dem Theatron lagen zwei Hippies im Gras und rauchten Haschisch. Das konnte Niko schon aus zwanzig Meter Entfernung riechen. Johannes Immermaier, der in die Zehnte ging, rauchte solches Zeug manchmal in der hintersten Ecke des Schulhofs. Danach machte er immer so ein verschlafenes Gesicht wie die beiden auf der Böschung, nur hatte er dabei nicht eine Hand vorne in der Jeans eines Mädchens.
»Habt ihr ein gelbes Bonanza Rad mit einem roten Bananensattel gesehen?«
»Nö, Little Joe. Ist keins hier vorbeigeritten.«
Das Mädchen rügte ihren langhaarigen Freund, er solle nicht so gemein sein, und prompt machte er mit seinen Fingern ein Peace-Zeichen. Vermutlich war es überall auf der Welt so, dass die Frauen das letzte Wort hatten. Das Mädchen kam auf die Knie und strich Niko über die Haare. Sie trug keinen Büstenhalter. Durch den Ausschnitt ihres dünnen weißen Hemdchens konnte er ihre Birnen wackeln sehen. Es war verboten Frauen auf den Balkon oder den Allerwertesten starren, aber es nützte Niko rein nichts, es zu wissen. Er war von dem Gezappel so hypnotisiert, dass er seine Pechsträhne vergaß. Ihr Name war Mona. Als sie ihn fragte, ob er sich verlaufen habe, erzählte er ihr die Geschichte von Edgars Bonanza Rad, ohne das er nie mehr zu Hause aufzukreuzen brauchte.
»Schlagen sich dich vielleicht, die alten Faschos, oder was?« nuschelte Björn.
»Die haben mich aus dem Fenster geworfen«, erwiderte Niko und deutete auf sein aufgeschlagenes Knie.
»Zeit, die Biege zu machen, Kleiner.«
»Heißt das, ich kann mit euch kommen?«
Die beiden warfen sich einen Blick zu, der bedeute, dass sie ihn nicht am Hals haben wollten. So schauten die älteren Jungs auf dem Bolzplatz am Hart auch immer, wenn Niko sie fragte, ob er mitspielen durfte. Oben schossen zwei Fahrradfahrer über den Coubertin Platz. Er sah ihnen hinterher, bis sie am Schwimmstadion verschwanden. Wenn Mona seine große Schwester wäre, könnte er sie jetzt bei der Hand nehmen und mit ihr nach Hause gehen. Dann würde es bestimmt nicht so schlimm werden.
»Nicht weinen. Morgen scheint wieder die Sonne. So ist es immer«, sagte Mona, und wischte ihm die Tränen aus den Augen. Niko legte seine Arme um ihre Hüften und drückte seinen Kopf an ihre Birnen. Sie roch nach Haschisch und Patschuli und das erinnerte ihn an das dunkelhaarige Mädchen, dem er auf dem Weg zur Schule jeden Morgen im Bus begegnete. Immer wenn sie einstieg und ihr süßer Duft in seine Nase stieg, träumte er davon, mit ihr durch Schwabing zu spazieren und dabei ihre Hand zu halten. Er kannte ihren Namen nicht, aber auch wenn er ihn eines Tages in Erfahrung brächte, würde er es nicht wagen, sie anzusprechen. Sie war ungefähr so alt wie Mona. Männer mit jüngeren Frauen hatte er schon oft gesehen, aber umgekehrt war es einfach undenkbar. Seine Chancen, das Patschuli-Mädchen kennenzulernen waren etwa so groß, wie die der Löwen, Europapokalsieger der Landesmeister zu werden. Sie war unerreichbar, und wenn sie nach drei Stationen wieder aus dem Bus stieg, war er sich manchmal nicht sicher, ob sie nicht nur ein Traum war. Oft hielt sich ihr Duft bis zur Schule oder sogar bis zur ersten Pause in seiner Nase, und das machte diese Tage dann viel besser, als sie es zumeist waren. Die Hippies, die unter der Woche am Monopterus im Englischen Garten faul herumlagen, verkauften an den Wochenenden entlang der Leopoldstraße Räucherstäbchen, Peace Zeichen, Haschischpfeifen, Pali-Tücher, Silberringe, Henna, Batikshirts und Duftfläschchen mit Sandelholz, Jasmin, Amber oder Patschuli. Manchmal stromerte Niko dort herum und hoffte, das Traummädchen würde dort auftauchen, aber bis jetzt hatte sie sich noch nie dort blicken lassen. Wegen seiner schlechten Schulnoten bekam er seit zwei Wochen kein Taschengeld mehr, aber nächste Woche, wenn er die Strafe abgesessen hatte und wieder Zaster bekam, würde er sich Patschuli kaufen. Dann konnte er wenigstens von dem dunkelhaarigen Mädchen träumen, wann immer er wollte.
»Ich glaube, da hinten kommen die Bullen. Lass uns abhauen«, sagte Björn, obwohl weit und breit keine Polizisten zu sehen waren.
Da war niemand mehr. Das Weltreich war plötzlich menschenleer. Hinter der Südkurve des Stadions kamen Niko noch zwei Läufer entgegen, aber als sie außer Sichtweite waren, schien er der allerletzte Mensch im Olympiapark zu sein. Auf Höhe der Werner-von-Linde Halle rochen seine Hände immer noch Mona. Nur von Edgars Rad gab es keine einzige Spur. Bei jedem Geräusch spitze Niko die Ohren und hoffte das Schleifgeräusch des hinteren Schutzblechs zu hören.
Auf der Hanns-Braun-Brücke schwang er sich auf das Geländer und ließ die Beine hoch über dem Mittleren Ring baumeln. Wenn er sich jetzt fallen ließe, würden seine Eltern die Sache mit dem Rad und dem Zeugnis bestimmt nicht so wichtig nehmen. Vor einem halben Jahr hatte er an dem Tag, als seine Oma gestorben war, eine Sechs in Mathe kassiert, aber vor lauter Tod und Traurigkeit waren ihm die Ohrfeigen und die übliche Predigt erspart geblieben.
Niko spuckte hinunter und versuchte abzuschätzen, wie weit es bis zur Straße war. Wenn ein Lastwagen vorbeikäme, konnte er vielleicht auf den Anhänger springen, die lange Rampe hoch zur Landshuter Allee mitfahren und dann immer weiter bis nach Italien. Angeblich schmeckte das Meerwasser nach Salz. Die Italiener fuhren den ganzen Tag Wasserski, schleckten Gelati, aßen Spaghetti und Pizza und glotzten wildfremden Frauen ungeniert auf den Balkon und den Allerwertesten. So war es in Italia. Niemand musste zur Schule oder zur Arbeit gehen. Alle lagen immer nur am Strand und sonnten sich. Dolce Vita nannte man das – süßes Leben –, hatte Edgar erzählt, und der musste es ja wissen, denn er fuhr jedes Jahr in den Sommerferien mit seinen Eltern nach Rimini oder Jesolo. Weil er an Edgar dachte, kam ihm das verdammte Fahrrad wieder in den Sinn.
Am Kohlemainenweg wurde es unter den Bäumen so finster, dass Niko sich bei jedem Rascheln fürchtete. Wenn jetzt plötzlich einer mit dem Bonanza-Rad um die Ecke käme, würden sie wahrscheinlich beide vor Schreck tot umfallen. Er verließ den befestigten Weg, lief querfeldein den Lichtern des Olympiadorfs entgegen. Bis zum Baubeginn hatte er da noch mit Benni, Michi und Edgar Cowboy und Indianer gespielt. Jetzt ragten dort, wo die blauen Schilder der neuen U-Bahnstation helles Licht verströmten, die Wohnblöcke des Olympiadorfs in den Nachthimmel. Wenn er das Rad nicht in den Parkdecks der Conolly- oder Nadistraße fand, war es vorbei. Dann konnte es irgendwo in München sein und wer immer es gestohlen hatte, konnte einfach ein neues Schloss anbringen und behaupten, das Rad gehöre ihm.
Unten im Parkdeck der Conollystraße traf Niko endlich wieder auf Menschen. Einer von ihnen, ein großer schwarzer Kerl, schüttelte ihm sogar die Hand. »Nice to meet you, young man«. Ein muskelbepackter Mann kreuzte die Straße, zwei Frauen auf Rollschuhen fuhren vorüber. Irgendwo spielte Musik. In der Nadistraße standen einige Fahrräder herum, aber leider nicht das Rad von Edgar. Niko setzte sich auf den Randstein und gähnte drei Mal hintereinander. Immer musste er dreimal gähnen oder niesen, nie zwei Mal und schon gar nicht vier Mal. Eine junge Frau in einem weißen Trainingsanzug kam aus einem der Treppenhäuser. Ihre Füße steckten in goldenen Turnschuhen, die Niko noch nie in der Auslage von Sport Münzinger gesehen hatte. Jedes Frühjahr probierte er dort die neuesten Fußballschuhe von Adidas und Puma an, obwohl er wusste, dass seine Eltern sie ihm niemals kaufen würden.
»Was ist mit dir? Hast du dich verlaufen?«
»Ich suche das Rad vom Edgar.«
»Und warum sucht der Edgar sein Fahrrad nicht selbst?«
Sie setzte sich neben ihn, stopfte ihre langen blonden Haare durch ein Haarband und zog sie stramm. Ihr Name war Martina. Niko vertraute ihr die ganze Misere mit dem Bonanza-Rad an und fühlte sich danach besser, als nach einer Beichte bei Pfarrer Aschinger, von dessen ernster Art er sich immer eingeschüchtert fühlte. Obwohl er nie etwas Schlimmes zu gestehen hatte, ließ jeder Besuch im Beichtstuhl die Besorgnis in ihm zurück, er könne ein schlechter Mensch sein.
»Soll ich dich begleiten?« sagte Marina, aber bevor Niko antworten konnte, nahm sie ihn bei der Hand und sie machten sie auf den Weg.
In der Hanselmannstraße war um diese Zeit kein Mensch mehr unterwegs. Nur in wenigen Häusern brannte noch Licht. Das war ein Segen. Es waren nur noch hundertfünfzig Meter bis nach Hause. Mit der langen Leiter vom Hausmeister Weber würde es bestimmt klappen, die reichte bis zum Dach des Müllhäuschens. Von dort aus konnte er sich an der Dachrinne bis zum Fenster seines Zimmers hangeln. Dann würde morgen wirklich die Sonne wieder scheinen und er konnte einfach behaupten, er habe das Rad vom Edgar nicht genommen. Niemand würde Franziska glauben. Zumindest hatte ihm nie jemand etwas geglaubt, als er in ihrem Alter gewesen war, und daran hatte sich bis heute nicht viel geändert. Edgars Oma war fast so blind, wie sie fast taub war, und vergesslich war sie bestimmt auch, wie alle alten Leute. Morgen früh würde er selber nicht mehr glauben, aus dem Fenster in den Hof gesprungen zu sein, und diejenigen, die ihn im Dantebad immer auslachten, weil er sich nicht mal vom Dreier traute, würden es schon gar nicht glauben. Die konnte er quasi als Zeugen aufrufen.
Auf Höhe der Metzgerei Schillert blieb Niko stehen und tat so, als wohne er dort. Martina bot ihm an mit hineinzukommen, aber die Vorstellung, sein Vater könne ihm vor ihren Augen den blanken Hintern grün und blau schlagen, brachte seine Wangen zum Glühen. Er sah Martina und ihren goldenen Schuhen nach, bis sie nur noch ein kleiner heller Fleck in der Dunkelheit war. Die letzten fünfzig Meter bis nach Hause setzte er so bedächtig einen Fuß vor den nächsten, als balanciere über ein Hochseil. Aber dann kam er unweigerlich dort an, erkannte das wutentbrannte Gesicht seines Vaters und die abschätzigen Blicke von Alfred Thum, die am Hofeingang schon auf ihn warteten.
»Ah da schau her! Traut er sich also doch noch her, der Herr Fahrraddieb. Du bist ja wirklich der Allerletzte! Der Allerletzte!«, brüllte sein Vater. Niko versuchte den verächtlichen Blicken von Edgars Vater auszuweichen, aber Herr Thum packte ihn am Kinn wie einen unartigen Hund, der mitten ins Wohnzimmer geschissen hatte.
»Kannst von Glück reden, dass du nicht mein Sohn bist.«
Nikos Ohren und Backen brannten lichterloh. Wie Raketen aus einer Stalinorgel prasselten die Hände seines Vaters auf sein Gesicht, und es würde so schnell nicht wieder aufhören. Zu allem Überfluss hatten seine Eltern auch noch den blauen Brief von Direktor Zellner unter seiner Matratze gefunden, den er vor einer Woche aus dem Briefkasten gefischt hatte. Er verfluchte den Putzfimmel seiner Mutter, verfluchte das beschissene Bonanza Rad, verfluchte die Schule und die Ungerechtigkeit, die ihm an ihm hing, als sei sie sein siamesischer Zwilling.
»Ich habe es nur wegen dem Löwentrikot gemacht! Das hättet ihr mir doch sonst nie gekauft!« wimmerte Niko in den Kugelhagel. Und dann fiel ihm wieder ein, dass seine Mutter das Wappen gar nicht besorgt hatte. »Ihr seid auch Lügner. Das Wappen habt ihr mir versprochen!«
»Halt dein freches Maul, du Lump, du! Ein Verbrecher bist du! Man kann sich mit dir nimmer auf der Straße sehen lassen! Hundskrüppel, verreckter!« schrie sein Vater auf Neandertalerdeutsch – Hundskrippi, faräckta. »Da arbeitet man sich den ganzen Tag den Buckel krumm und dann hat man so eine Missgeburt am Hals!«
Niko sah flehend zu seiner Mutter, die mit dem blauen Brief in der Hand im Türrahmen stand. Sie schüttelte den Kopf wie sein Opa früher, aber der hatte es wegen den Bomben und Granaten getan, die unentwegt in seinem Kopf explodierten. Jetzt ahnte Niko, wie es sich angefühlt haben musste. Mona hatte gelogen. Morgen früh würde die Sonne nicht wieder scheinen. Es würde auf ewig dunkel bleiben und die schwieligen Hände seines Vaters würden für alle Zeiten auf seinen Kopf einschlagen.
»Wenigstens das hättest du schaffen können!« sagte seine Mutter und wedelte mit dem blauen Brief. »Wenigstens das!«
Niko sah zum Jesus am Kreuz über seinem Bett. Von da oben würde bestimmt keine Hilfe kommen. Der arme Hund war ja selber ans Kreuz genagelt und blutete wie eine Sau.
Als der Bombenhagel endlich versiegte, befahl seine Mutter ihm, sich auszuziehen.
»Ich zieh die Jeans nie mehr aus! Eher sterbe ich.«
»Dann stirbst eben!«
Sie packte ihn, riss ihm das Hemd über den Kopf, zerrte ihm erst die Jeans und die Unterhose auf die Knöchel.
»Lass mich! Geh raus! Das ist mein Zimmer!« schrie Niko sie an, aber da fasste sie ihn nur noch fester am Arm und schubste ihn zu seinem Bett.
»Du schämst dich jetzt nackt, allein und demütig vor dem Herrn Jesus Christus und betest zehn Vater Unser! Laut! Sonst hört er dich nämlich nicht! Und wenn du auch nur einmal mit der Wimper zuckst, kommt dein Vater noch mal! Und das willst du nicht erleben!«
Widerstandskämpfer waren immer die ersten, die erschossen wurden, hatte sein Opa gesagt.
DER5. September war der Geburtstag von Paul Breitner, Luis’ Lieblingsspieler beim FC Bayern München. Er mochte Breitners Art zu spielen, seine mitreißenden Läufe, seine Arroganz, seinen unbedingten Siegeswillen und seinen Hang zur Rebellion. Seit die Olympischen Spiegel begonnen hatten, musste sich der Rote Paul den obersten Platz auf Luis’ Rangliste jedoch mit dem Schwimmer Mark Spitz, dem Sprinter Valerie Borshov und dem Langstreckenläufer Lasse Virèn teilen. Zudem hatte die Weitspringerin und Hürdenläuferin Heidi Schüller sein Herz erobert. Seit zwei Tagen hing ein Poster von ihr in seinem Zimmer, auf dem sie mit ausgestreckten Armen und Beinen über einer Weitsprunggrube schwebte, als springe sie direkt zu ihm ins Bett. Seit sie an der Wand hing, sehnte er sich danach, erwachsen zu sein.
Im Aufzug, der seine Mutter, ihn und neunundzwanzig andere Menschen durch den Fuß des Olympiaturms katapultierte, war es eng und die Luft unangenehm stickig, aber seine Vorfreude wurde damit fertig. Er fühlte sich wie vor seiner ersten Fahrt mit der Achterbahn, seinem ersten Sprung vom 10er oder wie an dem Tag, als er fünf Minuten lang das Sportflugzeug von Andreas Deyler steuern durfte, einem Freund seines Vaters, der ein hohes Tier bei der Lufthansa war. Luis konnte es kaum erwarten, endlich in das Restaurant zu gelangen, das sich in 181 Metern Höhe über München im Kreis drehte.
Oben im Lokal standen fein gedeckte Tische. Kellnerinnen sausten mit voll beladenen Tabletts umher. Luis war nicht ganz klar wie sie den Überblick behielten, wenn sich der Turm ständig weiterdrehte, aber als er sich hinsetze und draußen vor den getönten Scheiben ein Punkt fixierte, bewegte sich rein gar nichts.
»Es dreht sich ja gar nicht«, sagte er zu der Kellnerin, die an ihren Tisch kam.
»Der Olympiaturm ist kein Karussell. Sonst würde den Leuten beim Essen ja ganz schlecht, verstehst?«
Ganze dreiundfünfzig Minuten, länger also, als eine Schulstunde, dauerte es, bis das Restaurant sich einmal im Kreis gedreht hatte. Luis stand auf und drückte seine Nase gegen die Fensterscheiben.
»Hab‘ ich gesagt, dass du aufstehen darfst«, raunzte sein Vater ihn an.
»Mir ist langweilig. Ich will raus auf die Aussichts-Plattform.«
»Kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich«, sagte seine Mutter.
»Ach geh’, Gabilein. Du immer mit deiner Angst. Da ist gar nix gefährlich.«
Die Plattform befand sich in 189 Meter Höhe. Der Blick über die Stadt war fantastisch. Wind fing sich im Kopftuch seiner Mutter. Sie klammerte sich an das Geländer, als fegte ein Orkan durch München.
»Ist dir schwindlig?«
»Nein, wieso?«
»Kannst ruhig wieder runtergehen. Mir passiert schon nichts.«
»Bei dir piept es wohl.«
Luis machte ein paar Schritte, bis er das Athletendorf zu sehen bekam, dessen terrassenförmige Häuser aus den grünen Böschungen des Olympiaparks ragten, als seien sie aus der Erde gewachsen. Unten im Olympiastadion sahen die Menschen aus wie winzige Spielfiguren. Fußballspieler liefen hin und her. Jubel schwoll in der Ferne an wie ein Rascheln und verklang wieder. Das geschwungene gläserne Dach des Stadions schwappte wie eine Welle über neun Pfeiler Richtung Südkurve, ergoss sich dann in den Coubertin Platz, erhob sich an dessen Rändern wieder, um sich in die Dächer des Schwimmstadions und der großen Olympiahalle zu verwandeln, ehe sie abwärts Richtung Eisstadion floss. Da war so viel Schwung in der Architektur und der Landschaft, fast wie in den Bergen und zugleich am Meer. Aus allen Richtungen führten Wege auf Brücken und die Straßen der Stadt. Menschen sammelten sich im Kessel zwischen den Stadien, zerstoben dort und liefen ihren Zielen entgegen wie eifrige Ameisen. Hinter der Grenze des Olympiaparks sprenkelten Häuser und Straßen den Blick bis an den nahen Horizont, wo sich München vor den dunstigen Gebilden der Alpen verlor. Im Osten zeigte das Arabella Hotel wie ein Finger in den blauen Himmel. Im Vergleich zum Olympiagelände wirkte die Stadt eckig, ihre Häuser wie Legosteine und ihre Straßen wie dicke dunkle Fäden und Trichter. Luis kniff die Augen zusammen und zog mit dem Daumen eine Linie, bis er glaubte das Haus seiner Eltern in der Lamontstraße zu berühren. Obwohl es ein stattliches Haus mit Garten und einem Swimmingpool war, verdeckte seine Fingerkuppe das gesamte Grundstück mitsamt dem Prinzregenten Theater, dem Eislauf-Stadion, dem Feinkost Käfer und einem Teil des Klinikums Rechts der Isar. Sein Fingernagel kratze sogar noch am Friedensengel, so winzig war das alles von hier oben. Er hatte sich München viel größer vorgestellt, so groß wie die Städte auf den Postkarten, die Tante Anne aus Amerika schickte, auf denen sich die Wolkenkratzer von Chicago und New York stolz und mutig der Sonne entgegen reckten. In München schienen sie sich zu ducken, auf die Knie zu sinken, wie Menschen bei der Andacht. Die Amis hatten mehr Mumm, mehr Fantasie und mehr Freiheitsdrang, behauptete Tante Anne, die seit zwanzig Jahren in Brooklyn lebte. Im Krieg war sie aus Deutschland geflohen. Wann immer Luis sie nach dem Grund dafür fragte, wich sie aus. Jedes Jahr zu Weihnachten kam sie zu Besuch und blieb zwei Wochen in ihrer Heimatstadt, die sie als Kuhdorf bezeichnete. Jetzt verstand er, was sie damit meinte.
»Wie lange muss ich noch zur Schule gehen?«
»Noch eine ganze Weile. Sei froh. Das Leben vergeht sowieso viel zu schnell.«
»Wie lange dauert ein Architekturstudium?«
»Wieso? Du wirst doch Zahnarzt. Zahnweh haben die Menschen immer.«
»Jetzt sag schon.«
»Fünf oder sechs Jahre, glaube ich.«
Er würde also so alt wie Onkel Berni sein, bis er damit anfangen konnte, aus München so etwas wie Chicago oder New York zu machen. Es fiel Luis schwer, so weit in die Zukunft zu denken. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Stadt mit ihrer Verwandlung von einem Kuhdorf in eine Metropole auf ihn wartete, und niemand ihm zuvorkam. Er drehte sich mit ausgebreiteten Armen um seine Achse. Der Himmel, die Turmspitze, die Stadt. Der Himmel, die Turmspitze, die Stadt. Alles drehte sich.
»Warte! Warte auf mich!«, rief er der Stadt zu.
»Nein, jetzt komm endlich! Wir gehen wieder runter!«
JETZT verstand Niko, was sein Großvater durchgemacht hatte. Im Kartoffelkeller des Schwaiger Hofs war es bestimmt nicht so eisig wie in Sibirien, aber kalt genug, um ganz traurig davon zu werden. Seit drei Tagen schälte er jetzt schon Kartoffeln, um das Geld für ein nagelneues Rad zusammenzubekommen. Es war eine bodenlose Gemeinheit. Das Bonanza-Rad war gar nicht neu gewesen. Edgars Vater hatte es einem Kollegen für fünfunddreißig Mark abgekauft, aber jetzt verlangten sie als Entschädigung ein hundertzwanzig Mark teures 10-Gang Rennrad der Marke Montbecàne. Deshalb musste er jetzt nicht nur so lange Kartoffeln putzen, bis ihm die Finger bluteten, sondern es würden auch noch die fünfundvierzig Mark von seinem Sparkassenbuch verschwinden, die er schon für eine Endspielkarte der Fußballweltmeisterschaft 1974 gespart hatte. Bestimmt würde Deutschland dann Weltmeister und er wäre nicht dabei. »Aus Niederlagen lernt man das meiste«, hatte sein Opa gesagt, und der musste es ja wissen, denn er hatte zwei Weltkriege und einen Ehekrieg verloren
Es war der elfte Tag der Olympischen Spiele. Außer der Fackel und den Birnen von Mona hatte Niko nichts davon mitbekommen. Was einen nicht umbringt, macht einen nur noch stärker, redete er sich ein, wann immer er den Tränen nahe war. Der Hausarrest an seinem Geburtstag, die kaputte Jeans, das Bonanza Rad, der blaue Brief von Direktor Zellner, die Nachricht, dass sein Lieblingsspieler Hansi Rebele die Löwen verließ und zu Wacker Innsbruck wechselte und jetzt auch noch der Kartoffelkeller. Es stimmte. Wenn es kam, kam es richtig. Sein Leben hatte sich in eine bitterkalte Pechsträhne verwandelt. Bestimmt hatte sein Opa sie ihm vererbt.