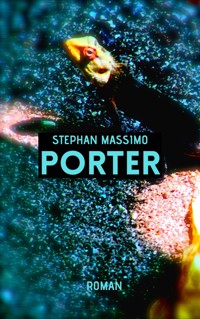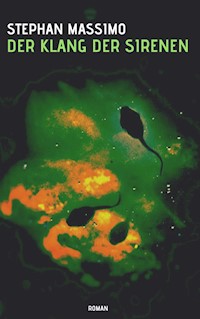4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählungen in Die Erfindung der Liebe fügen sich zu einem Kaleidoskop von Augenblicken, in denen Sehnsucht, Leidenschaft, Erinnerung und Zukunft zu einer Einbildung verschmelzen, deren unscharfe Magie dazu verführt, zu glauben, es handle sich um die Wahrheit. Zerteilte Kugelmenschen auf der Suche nach ihrer anderen Hälfte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
STEPHAN MASSIMO
DIE ERFINDUNG DER LIEBE
LILLY
Es ist acht Uhr, als es an der Tür klingelt. Jasper erwartet niemanden. Vor fünf Minuten hat er das Geschirr vom Abendessen in die Spülmaschine geräumt und es sich in seinem Sessel im Wohnzimmer gemütlich gemacht, um sich die sechste Folge von Gaslit anzusehen. Wenn er irgendetwas so gut beherrschen würde wie Julia Roberts ihre Rolle, wüsste die Welt davon.
Als er die Tür öffnet, vergeht ein Moment bis ihm klar wird, wer vor ihm steht. Vielleicht weil er mit allem gerechnet hat, nur nicht damit. Es ist Lilly.
»Hey«, sagt sie, als sei es nach zehn Jahren das beste Wort. »Kann ich reinkommen?«
Im Wohnzimmer lässt sie sich in seinen Sessel fallen. Jasper setzt sich auf die Couch, die er vor vier Jahren in einem Designer-Outlet gekauft hat, fühlt dort sich wie ein Gast in seiner eigenen Wohnung. Aus diesem Blickwinkel sieht das Zimmer ganz anders aus. Klein und vollgestopft.
Er füllt zwei Gläser mit dem Rosé, den er in den Sommermonaten immer bei Malinowski kauft. Lilly trinkt, ohne mit ihm anzustoßen. Es gibt ja auch keinen Anlass.
»Ich habe mich von Kolja getrennt«, sagt sie.
Jasper erinnert sich an die Mittagspause, in der er Lilly und Kolja im Leopoldpark gesehen hat. Sie küssten sich, sahen sich verliebt an, hätten ihn vermutlich nicht mal bemerkt, wenn er direkt an ihnen vorbeigegangen wäre. Es war Zufall. Sonst geht er nie in der Mittagspause raus, aber es wäre auch zu Ende gewesen, wenn er die beiden nicht erwischt hätte. Vorbei ist vorbei. Es ist lange her, aber er weiß noch genau, wie schlecht er sich damals gefühlt hat.
»Er ist ein totaler Egoist«, sagt Lilly.
Ohne Punkt und Komma breitet sie ihr Leben mit Kolja vor ihm aus. Den fantastischen Anfang, die zähe Mitte und das quälend lange Ende, das sich über drei Jahre hingezogen hat, weil sie einander nicht loslassen konnten. Weil sie eigentlich zueinander gehören.
Als Jasper ihr nachschenkt, fragt Lilly, ob sie rauchen darf.
»Natürlich«, antwortet er, obwohl er sonst nie jemandem gestattet, in seiner Wohnung zu rauchen.
»Im Augenblick ist es hart«, sagt Lilly.
Sie muss sich einen Job suchen, die Kinder alleine bei Laune halten, die ihren Vater nur noch sporadisch sehen werden. Kolja hat keine Neue, will nur seine Freiheit wiederhaben. Er hat genug von Familie, Hausaufgaben, Elternabenden und Ferienressorts, von der Verantwortung und davon, ein Vorbild sein zu müssen; genug von durchorganisierten Ausflügen, dem Geschwätz von Profi-Eltern und ihrem verdammten Glücksterror. Kolja will seine alte Band zusammentrommeln und nachholen, was auch immer er verpasst hat.
»Irgendwie kann ich ihn verstehen«, sagt Lilly. Sie hat es sich auch ganz anders vorgestellt, eine Familie zu haben. Erfüllender, leichter. Sam ist acht, hat ADHS und jede Menge Probleme in der Schule. Mira wird im Juni vier und leidet am Down Syndrom.
»Leiden ist eigentlich der falsche Ausdruck«, sagt Lilly. »Sie ist nur anders, aber das ist eben manchmal sehr anstrengend. »Ich liebe sie über alles. Nur, damit du mich nicht falsch verstehst«.
Vor zehn Jahren hätte Lilly als Fondsmanagerin bei einer Bank Karriere machen können, aber jetzt läuft es auf einen lausig bezahlten Halbtagsjob in einem Büro hinaus, in dem sie den Status einer Aushilfe nicht mehr loswerden wird. Wichtige Inhalte wird man an ihr vorbeischleusen, nur das snobistische Mitleid der Kinderlosen nicht.
»Für manche Träume ist es schon zu spät. Wer hätte das gedacht.«
Sie fühlt sich von der Zeit betrogen, von Freunden abgehängt, die keine Verpflichtungen haben; die ihr Fotos von den Seychellen, aus einem Wellness-Hotel oder einem langen Wochenende in Paris schicken und ihren Neid mit damit gießen wie eine Topfpflanze. Schlimmer sind für Lilly nur noch Eltern, deren Kinder perfekt in allem sind. In der Schule, am Klavier, in Fremdsprachen, auf dem Pferd, dem Skateboard oder beim Tennis. Optimierter Nachwuchs gibt Lilly das Gefühl, eine Versagerin zu sein. Sie würde gerne ein Sabbatjahr einlegen, zwölf Monate für sich allein haben, sich von der Realität erholen, aber es ist nicht möglich. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, will sie sich noch einmal verlieben, noch einmal jung sein, aber sie weiß nicht, ob Mira jemals das Haus verlassen wird.
»Das kann doch noch nicht alles gewesen sein.«
Sie wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel, aber vielleicht ist es auch nur eine abgebrochene Wimper. Sie ist älter geworden. Vorhin an der Tür ist es Jasper nicht aufgefallen. Die Last ihrer Träume, ihr Traummann und die Wunschkinder haben Gravuren in ihrem Gesicht hinterlassen. In seinem Kopf ist Lilly zehn Jahre jünger und wird es dort vermutlich für immer bleiben. Wenn ihr Körper empfänglich war, musste er ein Kondom benützen. Sie wollte Karriere machen, ehe sie Kinder in die Welt setzt. Er findet ihre schönen Hände und ihre heisere Stimme immer noch anziehend.
»Ich war zu naiv, zu verliebt, zu verträumt.«
Als sie Kolja kennenlernte, hatte er gerade ein vielversprechendes Start-up Unternehmen gegründet, träumte vom Börsengang, von Millionen, die ein Global Player für die Übernahme bezahlen würde. Seit drei Jahren arbeitet er bei der Firma, die eine ähnliche Idee hatte – ein halbes Jahr früher als er.
»Es war nicht seine Schuld. Nur Pech.«
Ihre Mutter hat Krebs. Obwohl sie erst Ende Fünfzig ist, gibt es keine Chance mehr für sie. Die Ärzte haben sie abgeschrieben. Ihr Leben ist so gut wie zu Ende.
»Vielleicht habe ich auch nur noch ein paar Jahre. Wer weiß«, sagt Lilly. Die Vorstellung die Welt zu verlassen, ohne auf ihre Kosten gekommen zu sein, löst Panik in ihr aus. Sie hat jetzt mehr Träume und Wünsche als mit zwanzig, als sie noch nicht wusste, was sie nicht wollte. Die Tage ihres Lebens fliegen nur so dahin. Auf dieses Tempo war sie nicht vorbereitet. Jasper will ihr nachschenken, aber sie hält ihre Hand über das Glas.
»Das fehlt noch, dass ich zur Alkoholikerin werde.«
Sie trinkt jeden Abend ein Glas, manchmal auch zwei, aber niemals mehr. Nicht mehr als andere um sie herum auch trinken. Das Rauchen hat sie eigentlich aufgegeben. Es ist nur wegen der Trennung von Kolja. Wenn sie sich davon erholt hat, wir sie es wieder sein lassen. Warum Gifte vielen Menschen in Krisen hilfreich erscheinen, ist Jasper ein Rätsel.
»Wie spät ist es?«
»Zehn nach neun«, sagt Jasper.
»Siehst du? Genau das meine ich. Ich muss los. Immer muss ich los. Du hast es gut. Du bist frei, kannst ausgehen und unterwegs sein, so lange du willst.«
Sie steht auf, geht hinaus in den Flur. Jasper folgt ihr, die Hände in den hinteren Taschen seiner Jeans vergraben. Lilly streicht über seinen Oberarm wie über das Fell eines Haustiers.
»Mach’s gut. Danke für den Wein«, sagt sie, bevor sie die Tür hinter sich zu zuzieht.
Jasper kehrt ins Wohnzimmer zurück, setzt sich in die Wärme, die Lilly im Sessel zurückgelassen hat. Er mag sie immer noch, aber jetzt weiß er, dass es nicht an ihr liegt.
MARY ANN
Es ist gerade einmal drei Tage her, dass er Mary Ann kennengelernt hat, aber Fynn ist sicher, der Frau seines Lebens begegnet zu sein. Ausgerechnet hier. Darauf wäre er wirklich nie gekommen. Von Kopenhagen aus hat er sich einen Platz auf dem Campingplatz am Hahei Beach reserviert. Es ist Hochsaison. Die erste Reihe vor dem Ozean ist heiß begehrt. Er ist nicht nach Neuseeland gekommen, um die Wohnmobile anderer Leute vor der Nase zu haben, Wäscheleinen voller Alltäglichkeiten, banale Gespräche, schlappe Witze, die nach Gemeinsamkeit gieren. Er hat sich für den Camping Trip durch Neuseeland entschieden, um für einige Tage die Komfortzone zu verlassen, aber alles hat eine Grenze. Seine Freunde und Kollegen in Kopenhagen haben Wetten darauf abgeschlossen, dass er es keine zwei Nächte aushält. Wenn er nächste Woche im Conrad Nui auf Bora Bora eincheckt, wird er es vermutlich selbst nicht mehr glauben.
Er hat den Toyota Hiace, den er in Auckland gemietet hat, so geparkt, dass er vom Bett aus den Ozean sehen kann. Keine zehn Meter entfernt steht der orangefarbene Chevrolet Express von Mary Ann, ein ausrangierter, sechs Meter langer Schulbus. Seit vier Jahren reist sie allein durch die Welt. Mary Ann mag keine Wiederholungen. Wenn sie genug von einem Ort hat, zieht sie weiter. Außer einem Rucksack voller Klamotten, einem Skimboard und einem museumsreifen Nokia besitzt sie nichts. Fynn hat das Flugzeug in Kopenhagen mit dem größten Koffer bestiegen, den Airlines akzeptieren. Er hat einen ganzen Elektronikladen dabei. Laptop, i-Pad, Boom Box, Smartphone, GoPro und mehrere externe Akkus, damit ihm der Saft nie ausgeht.
Mary Ann ist ganz anders als die Frauen, die er in Kopenhagen kennt. Ida, Gry, Mille, Mette, Inga und Brit haben alle die gleichen Vorlieben, den gleichen Geschmack, die gleichen Lieblingsmarken und die gleichen rasierten Muschis. Mary Ann ist ein Wildpferd und das trifft genau seinen Nerv. Freiheit ist das Kerosin der Draufgänger. In den zwei Wochen auf Bora Bora wird er vierzehntausend Euro verbrennen, Cocktails schlürfen, tauchen, Wasserski fahren und sich ausgiebig massieren lassen, aber jetzt gefällt es ihm, selbstgefangene Fische zu grillen, Hafermilch zu trinken und den Tag mit einem Sonnengruß zu beginnen. Fynn steht vor den schlichten Sanitäranlagen des Campingplatzes, betrachtet den Sternenhimmel über dem Hahei Beach, während Mary Ann über einem schmuddeligen Toilettensitz schwebend pinkelt.
Mary Ann. Mary Ann.
Sie stammt aus Galveston, Texas. Ihr Vater war Surfer. Ihre Mutter lebt in Amsterdam, unterrichtet Tantra und veranstaltet Yoga-Retreats. Mary Ann hat sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.
»Die beiden haben nicht zusammengepasst. Aber was passt schon zusammen?«, sagt Mary Ann.
Fynns Eltern sind seit dreißig Jahren verheiratet. Sein Vater arbeitet in der Stadtverwaltung, seine Mutter bei der Post. Sie sind Anfang fünfzig. Viel Aufregendes wird in ihrem Leben nicht mehr passieren. Das Schlimmste am Älterwerden scheint Fynn die Zufriedenheit mit allem, was man nicht erreicht hat.
Mary Ann rollt ihren Neopren Anzug zusammen und stopft ihn in ihren Rucksack. Sie hat jede Menge Muskeln an den Armen und Beinen. Ihr Bauch ist flach und hart wie eine Tischplatte, ihr Hintern fest wie ein Basketball. Sie ernährt sich vegan, macht jeden Morgen Yoga und hat zwei Achttausender bestiegen. In Kopenhagen geht Fynn zweimal die Woche joggen, aber die Touren mit Mary Ann gehören zu einer anderen Kategorie, sind anstrengend und herausfordernd. Sie lässt keine Sekunde nach, zeigt nie Schwäche. Gestern Abend hat die Health App seines Smartphones 44.272 Schritte angezeigt, zwei Drittel davon in unebenem Gelände. Sobald der Muskelkater in seinen Beinen nachlässt, will er Mary Ann von seinen anderen physischen Fähigkeiten überzeugen. Wenn ihre Ausdauer im Bett genau so groß ist wie auf ihren Exkursionen, wartet eine berauschende Erfahrung auf ihn, ein saftiger Muskelkater im Schwanz.
»Lass das lieber alles hier. Um diese Uhrzeit sind die Wellen in der Cove unberechenbar«, sagt Mary Ann. Sie macht niemals Fotos, filmt keine Sekunde ihres Lebens. Ihre Augen und die Festplatte in ihrem Kopf genügen ihr. Sie will nichts posten, braucht keine Follower, kein Netz, keine Verbindung. Fynn findet die Idee, vierundzwanzig Stunden lang keine Fotos an seine Community zu schicken, ziemlich abgefahren. Vermutlich würden sie glauben, es sei ihm etwas zugestoßen und mit Hubschraubern nach ihm suchen lassen.
Er macht ein Selfie von Mary Ann und sich und lässt sein Smartphone grinsend in die Seitentasche seiner Shorts gleiten. Auf andere zu hören, ist einfach nicht sein Ding, und damit ist bisher gut gefahren. Für seinen Freigeist bezahlen sie ihm 160.000 im Jahr, plus Boni. Wenn Mary Ann für etwas keine Verwendung hat, dann für Luschen ohne eigene Meinung. Darauf würde er wetten.
Es ist vier Uhr morgens. So früh ist er noch nie in seinem Leben aufgestanden. Er hat den Tidenkalender abfotografiert, der im Empfangsbereich des Campingplatzes aushängt, obwohl Mary Ann ihn auswendig kennt. Sie will vor dem ersten Touristenstrom in der Cathedral Cove ankommen. Gedränge an Hotspots ist für sie ein absolutes no-go. Ihr wäre es lieber, die Menschen blieben zu Hause. Als ihr Vater mit dem Surfen begann, galt es unter den Cracks als Todsünde, die Buchten mit den besten Wellen publik zu machen, aber die Zeit der Geheimnisse ist längst vorbei. Mary Ann befestigt das Skimboard an ihrem Rucksack, will die letzten Ausläufer der Flut in der Cove für einige Rides nützen.
Als sie das Ende der steilen Grange Road erreichen, wo der Cathedral Cove Walk beginnt, geht gerade die Sonne auf. Die meisten Touristen lassen sich vom Shuttlebus bis zu dieser Stelle bringen, aber Mary Ann hält nichts von Bequemlichkeit. Sie sind den ganzen steilen Weg gelaufen. Der Blick über die Gemstone Bay entschädigt ihn für die Anstrengung. Es war eine gute Idee, die Videokonferenz zu ignorieren, die sie ihm aufhalsen wollten, obwohl sie versprochen hatten, ihn vier Wochen lang in Ruhe zu lassen. Sobald ein kleines Problem auftaucht, verlieren sie die Nerven und wollen ihren Müll bei jemand anderem abladen. Am liebsten am Freitagabend, kurz vor Büroschluss. Das Business ist voller digitaler Feiglinge. Schon seit geraumer Zeit geht Fynn das viele sinnlose Gequatsche auf die Nerven, die Unmengen an Mails und Videokonferenzen, in denen viel geredet, aber wenig entschieden wird. All die wichtige Scheiße, die im Grunde völlig unwichtig ist, nichts weiter als Show-off und blinder Aktionismus.
Er lässt seinen Blick über den Südpazifik schweifen, verspürt große Lust, sein altes Leben für immer hinter sich zu lassen, mit Mary Ann durch die Welt zu ziehen und anschließend zum Mars zu fliegen, falls sie es möchte.
»Wahnsinn«, flüstert er ihr ins Ohr und küsst ihre Schläfe, die nach Mandelöl riecht.
Der Weg zur Cathedral Cove führt durch den Memorial Forest Wao Whakamaumaharatanga. Wenn der Plan von Mary Ann aufgeht, werden sie kurz vor dem Ende der Flut unten ankommen und etwa zwei Stunden ihre Ruhe haben, ehe die Touristen die Bucht kapern. Sie geht davon aus, dass niemand dort aufkreuzt, so lange auch nur das geringste Risiko besteht. Seit eine Warnung auf Kaffeebechern stehen muss, dass der Inhalt heiß sein kann, halten viele Menschen sogar die Benützung von Messer und Gabel für lebensgefährlich. Es ist das Zeitalter der Hysterie, gegen die nur gesunder Menschenverstand hilft.
Unten in der Cove wogt der Ozean wie der Rücken eines riesigen Tieres, windet sich schnaubend, ausgelaugt von der Flut. Vereinzelt donnern schwere Brecher gegen die Felsen und das Ufer, aber die Ebbe kündigt sich schon an. Ein schmaler Streifen Strand zieht sich entlang der felsigen Küstenlinie, wird mit jeder Minute breiter. In einer halben Stunde können sie durch die Cathedral bis zum TE Hoho Rock laufen.
Fynn entledigt sich seiner Shorts, unter der die Goldfinger Badehose zum Vorschein kommt, für die er fast dreihundert Euro bezahlt hat. Er schlüpft in seine Badeschuhe, aber Mary Ann macht keine Anstalten ihren Poncho auszuziehen, den sie über dem gelben Shirt mit dem verwaschenen Schriftzug Lawa’i Beach – Kauai und ihrer Shorts trägt.
»Wir sollten noch warten. Die Strömung ist brutal«, ruft sie ihm zu.
»Ich finde, es sieht schon ganz gut aus!«
»Genau das ist das Problem!«
Er schaltet die GoPro ein, geht zu ihr und umkreist sie.
»I’m you fan, Mary Ann. Let me be your man, Mary Ann.«
Sie wirft den langen Schoß ihres Ponchos über die Schulter, vergräbt ihr Gesicht darin wie eine Theaterschauspielerin, vollführt einige sparsame Tanzbewegung, die eine Ausbildung andeuten. Das kann sie also auch. Er will sie küssen, sie lieben, jetzt, hier in der Cove, so lange sie noch allein sind. Es ist viel besser zu finden, als zu suchen. Er wird nicht mehr nach Kopenhagen zurückkehren. Es ist der richtige Moment, ein neues Leben zu beginnen. Er fährt mit seinen Händen unter ihren Poncho, berührt ihren Körper, der sich drahtig anfühlt, kantig wie Basalt. Er streicht über ihre Schlüsselbeine und ihre kleinen Brüste, lässt eine Hand über ihren Tischplattenbauch in ihre giftgrüne Shorts gleiten.
»Echt jetzt?«, sagt Mary Ann
Er kniet sich in den Sand, schlüpft unter ihren Poncho, zieht ihr die Hose auf die Knöchel, drückt seine Lippen an ihre Vulva, die ganz anders ist, als die der Frauen, mit denen er bisher etwas hatte. Haarig, wild, ungezähmt. Er leckt den Schweiß von ihrer Haut, der nach Salz schmeckt, windet sich um ihre schmalen Glieder, bis er endlich in ihr ist und seine drängenden Stöße den Atem aus ihren Lungen pressen. Ihr Becken ist voller Widerstand, fordert seine Kraft heraus. So gut war es noch nie. Es ist tief, tiefer, als er es jemals erlebt hat. Mary Ann stößt zurück, zwingt ihm einen anderen Rhythmus auf, der schneller ist, härter, mutiger, so ernst wie ihr Gesicht und ihre Gedanken. Das Leben muss ihr weh tun, wird für sie nur auf diese Weise wirklich. Für Mary Ann ist es niemals ein Spiel. Sie kämpft, will für das Glück bezahlen, um dem Schicksal nichts schuldig zu sein. Sie beißt ihn auf die Lippen, verlangt von ihm, seinen Anteil zu begleichen. Und dann kommen sie, kommen länger, als er es je erlebt hat. Er schreit den Ozean an, den Himmel über der Cove, der keine Grenzen hat. Er atmet, als sei es das erste Mal in seinem Leben. Mary Ann ist plötzlich eine andere Frau, flüssig, warm und gnädig. Fynn taucht einen Finger in sie, fährt damit über ihre Lippen, küsst sie. Nie war es schöner zu küssen.
Mary Ann schnappt sich die GoPro und filmt, wie sie seinen Körper mit dem kühlen Sand der Cove balsamiert. Der Ozean hat die Bucht freigegeben, den Strand und die Passage zum TE Hoho. Fynn steht auf und sprintet über den breiter gewordenen Strand.
»Komm! Komm schon! Worauf wartest du?«, ruft er Mary Ann zu, als er in den Schatten der Cathedral taucht. Er läuft weiter, ohne auf sie zu warten, der Sonne entgegen, dem Glitzern des Wassers, stürzt sich in die Fluten, schwimmt den Wellen entgegen, springt über sie hinweg, taucht durch sie hindurch. Eine mächtige Woge hebt ihn hoch und trägt ihn zu dem vorgelagerten Felsen am Fuß des TE Hoho. Es gelingt ihm, den Felsen zu erklimmen, ohne sich zu verletzen, er findet festen Stand, den blauen Champagner des Universums vor den Augen und das Fenster in die Ewigkeit.
»Pass auf«, ruft Mary Ann ihm von Strand aus zu. Es gefällt ihm, dass sie die Rollen getauscht haben. Sie scannt den Ozean, jede Welle, jeden Sog, versucht den Mut aufzubringen, zu ihm zu kommen. Er breitet die Arme aus, high von Mary Ann und der krassen Show der Natur. Eine mächtige Woge erhebt sich aus einem Tal, türmt sich keine zwanzig Meter von ihm entfernt auf wie ein Gebirge. Es ist unbeschreiblich, übersinnlich, eine Gotteserfahrung.
Plötzlich ist sein Mund voller Salzwasser. Tonnenschweres Gewicht zwingt ihn in die Tiefe und die wütende Pranke einer höheren Macht reißt ihn durch die Dunkelheit. Er verliert die Orientierung, weiß nicht mehr wo oben oder unten ist, rotiert im Karussell des Ozeans, sucht mit den Füßen panisch nach festem Grund. Sein Rücken schrammt über Sand, bis seine Schulter hart gegen einen Felsen prallt. Wieder wird er hochgehoben, leicht wie ein Plüschtier. Sein Kopf ragt aus dem Wasser. Er giert nach Luft, ruft nach Mary Ann, aber schon wird er zurück in den tiefblauen Schlund gezogen. Seine Glieder fliegen umher, gehören nicht mehr ihm. Der Rückstrom der Brandung fetzt ihm die Badehose von den Hüften, die nächste Welle schnappt sich seine Schuhe. Er ist nackt, er kämpft, ist noch immer am Leben, aber seine Kraft ist nichts wert, verschwendet sich im Sekundentakt, wird schon bald versiegen, zu Ende gehen.
»Trink«, hört er Mary Ann sagen. Etwas Glattes berührt seine Lippen. Warme Flüssigkeit, salzig wie Meerwasser, füllt seinen Mund. Ihre Hand legt sich auf seine Lippen, versiegelt sie, sorgt dafür, dass er die Suppe schluckt. Er küsst die Finger von Mary Ann, gerührt vor Erschöpfung. Dann fallen seine Augen zu.
Als er sie wieder öffnet, ist er ohne jedes Zeitgefühl. In der Entfernung sieht er die Wasserlinie des Hahei Beach. Mary Ann setzt sich auf den Rand der Matratze. Sie lächelt nicht. Der Ernst liebt ihr Gesicht, das voller Bedeutung ist, voller Bewusstsein über das Leben und den Tod.
»Welcher Tag ist heute«?
»Dienstag. Du hast drei Tage und Nächte geschlafen«, sagt Mary Ann.
Sie hat ihn mit Hilfe ihres Skimboards aus dem Pazifik gezogen, ihn wiederbelebt, den Transport aus der Cove organisiert, ihn ins Hospital und zurück auf den Campingplatz gebracht, als klar war, dass er nur einige Tage Ruhe braucht
»Was für eine Show«, flüstert Fynn.
»Du hast unfassliches Glück gehabt, sonst nichts«, erwidert Mary Ann.
Ihr Vater ist vor fünf Jahren vor Kauai ertrunken, obwohl er den Ozean besser kannte, als irgendeinen Menschen auf dieser Welt.
»Du kannst bis Freitag bleiben, dann brauchen sie den Platz«, sagt Mary Ann.
Er hat wirklich Glück gehabt, aber das weiß er schon, seit er Mary Ann zum ersten Mal gesehen hat.
»Ich werde mit dir kommen.«
»Wohin?«
»Wohin du willst.«
Fynn öffnet die Augen, hört entfernte Stimmen und Motorengeräusche. Er sieht auf sein Smartphone, das Mary Ann neben sein Kopfkissen gelegt haben muss. Es ist Donnerstag. An den Mittwoch kann er sich nicht erinnern. Im Toyota ist es unerträglich heiß. Auf dem Herd steht ein Topf mit kalter Suppe, daneben, auf der Anrichte, eine Packung Salzstangen, zwei Bananen, Traubenzucker, Wasserflaschen, Verbandszeug und Wundsalbe. Fliegen schwirren umher. Er kann sich besser bewegen, als er befürchtet hat, schafft es sogar, ein Foto von seinem Rücken zu machen, der aussieht, als hätte ein Pferd ihn stundenlang über schroffes Gelände geschleift. Mit einer schmerzhaften Bewegung wischt er die Vorhänge zur Seite und schiebt eines der Fenster auf, um frische Luft in den Wagen zu lassen. Er sieht hinaus, braucht einen Moment, bis er es begreift. Der Chevy von Mary Ann ist nicht mehr da.
AYANNA
Ben ist mal wieder zu spät, trifft als letzter im El Mirador ein, einem peruanischen Restaurant, das Nina ausgesucht hat. Sie hat die drei, vier Lokale satt, die sie immer wieder besuchen, weil sie bequem von ihrer Wohnung aus zu erreichen sind. Er beugt sich über sie, küsst ihr Haar, umarmt dann Claire und Gregor, gerät dabei in die gleiche Wolke aus Parfum und Aftershave, die die beiden seit zwanzig Jahren umgibt. Früher haben sie sich jede Woche getroffen, aber inzwischen sehen sie sich nur noch zwei oder drei Mal im Jahr. So ist mit den meisten Freunden. Niemand hat Schuld daran. Man kennt sich, bildet es sich zumindest ein, aber innerhalb dieser Kenntnis ist kein Platz mehr für Veränderungen und was sich nicht verändert, verbraucht sich. Für einen Quantensprung muss ein Quant sämtliche zuvor bestehenden Verbindungen auflösen.
»Entschuldigt. Die Probe hat länger gedauert, als geplant«,
sagt Ben.
»Wen spielst du gerade?«, fragt Claire, die als Kind Flöte ge-
spielt hat.
»Sylvestrov. Ein Ukrainischer Komponist«, erwidert Ben.
»Beim letzten Mal als wir uns gesehen haben, warst du unzu-
frieden mit dem Orchester«, sagt Gregor.
»Wann war das?«, fragt Ben.
»Letzten Dezember«, sagt Nina, die ein unerbittliches Ge-
dächtnis hat.
Es ist wahr. Im Dezember hat er über das Orchester geschimpft, wie die gesamten zwei Jahre zuvor, seit er es übernommen hat. Inzwischen weiß er, dass es nicht an den Musikern lag. Letztes Jahr im September ist er fünfzig geworden, dem Gefühl ausgeliefert, sich in und auswendig zu kennen und innerhalb der Kenntnis seiner selbst keinen Raum mehr für Veränderung zu finden. Er glaubte alles schon einmal gesehen, gehört und dirigiert zu haben, bis er die Stimme von Ayanna entdeckt hat. Seitdem gibt es keine Stunde mehr, in der er sie nicht hört, keinen Traum mehr, in dem Ayanna ihm nicht begegnet.
»Es läuft ausgezeichnet. Könnte nicht besser sein«, sagt Ben.
Seit Ayanna zum Orchester gestoßen ist, steht er morgens wieder gerne auf, geht laufen und schwimmen, strotzt vor Tatendrang. Der matte Klang des Orchesters ist einem Leuchten gewichen. Die Obertöne glitzern, die Bässe sind erdig und voll und die Chorstimmen erheben sich, menschlich und göttlich zugleich, kostbar und verletzlich wie das Leben. Ayanna hat seine Art zu dirigieren verändert, aber er hat nicht das Bedürfnis, diese Veränderung einzuordnen oder zu analysieren, will nicht wissen, wohin sie führt, wie lange sie andauert oder wann das damit verbundene Hochgefühl endet. Die Unwissenheit ist ein Geschenk, eine Brücke zurück in den Garten Eden, in dem er als Kind gelebt hat. Glück lässt sich nicht verdienen. Es kommt und geht, wie es ihm passt. Er hätte in Ruanda zur Welt kommen, zum Mörder oder Opfer werden können, vom Glück verschmäht, so oder so. Als der Genozid dort begann, war er zweiundzwanzig, ging in Wien auf das Konservatorium, dachte Tag und Nacht nur an seine Karriere und an sich. Er ist in den Wohlstand hineingeboren, hat sich keine Gedanken darüber gemacht, das andere den Preis dafür bezahlen müssen.
»Freut mich sehr für dich. Ich dachte schon, du steckst in einer Midlife-Crisis. Oder ist das etwa schon Altersmilde?«, sagt Gregor, der seit fünf Jahren mit seiner Vergesslichkeit kokettiert, mit zu erwartender Inkontinenz und nachlassender Libido. Er flirtet mit dem Alter, als handle es sich um eine willkommene Gelegenheit, endlich träge und langweilig sein zu dürfen. Gregor streicht über seine Stirnglatze, versetzt seinen Wohlstandsbauch einen Klaps, will partout beweisen, dass er mit seiner Vergänglichkeit im Reinen ist.
Ayanna ist achtundzwanzig. Sie kam zwei Tage vor Beginn des Völkermordes in Ruanda zur Welt. Als das hunderttägige Schlachten vorüber war, hatte sie keine Familie mehr, keine Verwandten. Es gibt es nur noch sie und diese Schuld, die nur Überlebende kennen. Vielleicht ist ihre Stimme deshalb so wie sie ist. Ernst, voller Tiefe und Achtsamkeit. Ayanna ist die einzige Schwarze im sonst weißen Chor, aber Ben würde sie auch mit verbundenen Augen erkennen. Da ist eine Art Überschlag in ihrer Stimme, ein zusätzlicher Atem, die Gravur einer unstillbaren Trauer, die sie einzigartig macht. Singen können viele, ein Feuer damit entfachen nur wenige.
Früher mochte er Chorgesang nicht, hat sich aus freien Stücken dem Dogma unterworfen, das viele Künstler sich nach dem zweiten Weltkrieg verordnet haben. Kein Pathos, keine Gefühlsduselei, kein Kitsch. Das Feuilleton feiert die unsentimentale Kunst, beklatscht jeden Sieg des Intellekts über das Herz – auch seine –, aber seit er Ayanna zum ersten Mal gehört hat, ist Nüchternheit keine Lösung mehr für ihn. Sie ist ihm zu kalt, zu sehr damit beschäftigt, sich selbst zu beschützen und jeder Verletzung vorzubeugen; zu mächtig und zu widerstandsfähig, um bereit für Veränderungen zu sein. Die moderne Abgeklärtheit ist unfähig die Stimme von Ayanna wahrzunehmen, die über den Schlachtfeldern und Leichenbergen schwebt, um die Lebenden vor sich selbst zu warnen.
All die Jahre hat er sein Orchester beherrscht, organisiert, erzogen und gedrillt. Jetzt versucht er es zu einen, schenkt ihm Freiheit, ohne Schaden damit anzurichten. Er lässt es lodern, lässt es weinen und gegen die Angst antreten, die alles Fremde und Schwache mit Grausamkeit besiegen will. Das Leben ist dramatisch, gravierend und zerbrechlich, und die Musik, die er für sein Orchester auswählt, macht keinen Hehl daraus. Es spielt gegen die Vergänglichkeit an, gegen die Vergeblichkeit, erschafft einen Raum voller Licht und Nächstenliebe, in dem alle Verstummten wieder eine Stimme haben.
Nina bestellt Jalea Mixta für ihn und für sich Anticuchos. Wie immer sucht sie zielsicher den passenden Wein dazu aus. Ben vertraut ihrem Geschmack blind. Nina übersetzt Spanische und Französische Literatur ins Deutsche, hat Shenna und Juliette zu selbstständigen, offenen Wesen erzogen, als wäre es ein Kinderspiel und jeden Umzug mitgemacht, den seine Karriere gefordert hat. Sie sind seit fünfundzwanzig Jahren zusammen, sein halbes Leben. Shenna ist zweiundzwanzig, studiert in London an der Royal Academy of Music, folgt seinen Spuren. Juliette ist letzte Woche neunzehn geworden. Seit sie ihren Abschluss gemacht hat, wird Ben das Gefühl nicht mehr los, als sei dieses Leben, das für immer gedacht war, fertiggestellt. Nina kommt damit klar, wie mit allem. Sie kann so viel. Viel mehr als er. Er hat nur seinen Taktstock, um in den tosenden Wellen des Lebens nicht unterzugehen.
»Entschuldigt mich einen Augenblick«, sagt Claire. Sie fächelt sich mit einer Serviette Luft zu, steht auf und geht hinaus auf die Straße.
»Fehlt ihr was«? sagt Ben.
»Aber ja doch. Ihre Jugend. Die fliegende Hitze kommt jetzt jeden Tag auf einen Sprung bei ihr vorbei. Wie ein feuriger Liebhaber«, sagt Gregor und zwinkert mit den Augen. Die beiden haben keine Kinder, aber das macht sie auch nicht jünger.
Es dauert keine fünf Minuten bis Claire zurück ist.
»Entschuldigt«, sagt sie, »hier ist so wenig Sauerstoff, findet ihr nicht auch«?
»Ja, das stimmt«, pflichtet Nina ist bei.» Sie sind im gleichen Alter, spüren bestimmt die gleichen Veränderungen. Auch sie ist mit den Jahren etwas fülliger geworden. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Beim Dessert haben Claire und Gregor früher nein gesagt, aber jetzt besitzen sie keinen Ehrgeiz mehr, Kalorien zu zählen. Sie bestellen zwei Portionen Suspiro Limeño de Mango.
»Ich muss niemandem mehr gefallen. Ich habe ja schon alles«, sagt Gregor, und wirft Claire einen Blick zu, den sie bestimmt auswendig kennt.
Nina bezahlt mit ihrer Karte. Beim nächsten Mal sind die anderen wieder dran. Das gibt allen das Gefühl, großzügig zu sein. Die Rechnung ist so unbarmherzig, wie der Kapitalismus es ermöglicht. Für Ben ist es das Prelude einer bevorstehenden Periode des Mangels. Im Taxi zeigt Nina sich sehr zufrieden mit dem Abend.
»Mal was anderes. Passend zu dir.«
»Was meinst du?«
»Du wirkst glücklich, wie lange nicht mehr. Sogar die drei mausetoten Bougainvillea im Garten hast du wieder zum Leben erweckt. Kannst du plötzlich zaubern oder bist du verzaubert worden?«
Er könnte antworten, dass es an der Arbeit liegt, aber Lügen haben noch nie zu ihnen gepasst. Er fühlt nicht mehr das gleiche für sie wie vor fünfundzwanzig Jahren, aber dieses veränderte Gefühl ist nicht schwächer, nur anders. So wie er selbst.
»Wollen wir im August nach Biarritz fahren? Das Haus ist noch frei«, sagt Nina.
»Das wäre wundervoll«, erwidert Ben.
Es ist ein schönes Haus mit Blick auf den Atlantik. Voller Frieden, kühlendem Schatten und kontemplativer Weisheit. Es wird das zehnte Mal sein, dass sie dorthin fahren. Das erste Mal ohne Shenna und Juliette, aber das erste Mal mit Ayanna.
MARISA
Wellen rollen heran, unter Unterlass, als gäbe es irgendwo da draußen eine Wellenfabrik. Sie umspülen seine Füße, färben den Sand dunkel, machen unverwechselbare Geräusche, die aus seiner Kindheit kommen und ihn mit dem Erwachsensein versöhnen. Gustav sieht hoch zur Klippe, wo die wenigen Häuser von Odeceixe stehen. Die Bucht ist lang gestreckt und tief, wie geschaffen für einen Film über den D-Day oder einen sehnsüchtigen Sommerroman. In der flimmernden Hitze liegt eine Frau auf einem grünen Handtuch im Sand, den Kopf auf den Händen abgestützt, den Blick auf ein Buch gerichtet. Ihre Beine stehen abgewinkelt in der Luft, wippen ungeduldig auf und ab. Sie blättert die Seiten in schnellem Tempo um, scheint im Gegensatz zu ihm die Kunst des Querlesens zu beherrschen. Die Gläser ihrer Sonnenbrille haben die Farbe ihrer Haare. Ihr Bikini ist senfgrün, ihre Haut so gleichmäßig gebräunt, wie seine es zuletzt als Kind am Ende eines guten Sommers war. Gustav nähert sich der Frau, vernimmt das Flattern der Buchseiten, getrieben vom atlantischen Wind, der hier nie eine Pause macht. Er lässt sich in ihrer Nähe in den Sand fallen, als geschähe es zufällig und versucht den Titel des Buches zu erkennen. Verdammte Eitelkeit. Als sein erstes Buch herauskam, hat er in jeder Buchhandlung danach gesucht, und wenn es nicht im Schaufenster stand, fühlte er sich gekränkt. Inzwischen sind die Auslagen jedes Jahr einmal voll damit.
Die Frau wirft ihre Lektüre achtlos in den Sand, läuft zum Ozean, wird von ihm aufgefressen und wieder ausgespuckt, schaukelt darin wie ein lebloser Gegenstand. Gustav steht auf, klopft den Sand von seinen Beinen, nähert sich ihrem Handtuch und dem dicken Schmöker. Balder Nilsson. Brainsnatcher. Ein roter Aufkleber mit weißer Schrift. BESTSELLER. Er hat dieses Buch vor fünf Jahren in nur drei Monaten geschrieben. 725 Seiten, dreihundert zu viel, weil die Leser etwas für ihr Geld haben wollen und glauben, dass viel auch viel kann. Der Gehirnräuber. In alle gängigen Sprachen übersetzt, wie alle zwölf Romane von Balder Nilsson, den er erfunden hat, weil sich skandinavische Thriller besser verkaufen als deutsche. Manchmal fragt er sich, ob er als Gustav Zimmermann genauso erfolgreich geworden wäre. Wenn er einen Roman beendet hat, liest er ihn nicht noch einmal durch. Das macht Fritz für ihn, der nichts infrage stellt, weil er nichts erfindet. Fritz sucht nach Fehlern, bessert sie aus, markiert geeignete Passagen für Lesungen, kümmert sich um den ganzen formalen Kram, bleibt klaglos auf der dunklen Seite des Mondes.
Die Frau kommt aus dem Wasser zurück zu ihrem Handtuch. Ihre Haare und ihre gebräunte Haut glänzen. Sie ist zierlich, sehnig, etwas jünger als er, aber vielleicht denkt er das nur, weil sie gesünder aussieht als er. Ihre Augen sind fast schwarz, ihr Lippen weder schmal, noch künstlich vergrößert, wie bei so viele anderen.
»Wie gefällt es Ihnen?«, fragt Gustav.
»Hier?«
»Nein. Das Buch.«
»Es ist grauenvoll. Absoluter Schund. Voller Klischees. Dutzendware.«
»Warum haben Sie es dann gekauft?«
»Das habe ich nicht. Es lag da drüben neben dem Mülleimer. Manchmal ist es eine Wohltat, zu sehen, wie schlecht andere schreiben. Es klingt gemein, aber es gibt mir Kraft.«
Ihr Englisch ist so gut wie seines. Gemeinsame Sprache als spätes Geschenk der Kolonialzeit. Wenigsten etwas. Ihr Name ist Marisa. Sie lebt in Lissabon. Abends arbeitet sie im Bairro Alto in einer Bar, tagsüber schreibt sie. Für den August hat sie ein kleines Appartement in Odeceixe gemietet, um einige Wochen lang nicht müde aufzuwachen, nicht übermüdet zu schreiben und nicht müde zur Arbeit gehen zu müssen, die sie noch müder macht.
»Dann sind Sie also Schriftstellerin?«
»Mehr als dieser Balder Nilsson zumindest, falls er überhaupt existiert. Wahrscheinlich stecken vier professionelle Plagiateure dahinter, die sich darüber kaputtlachen, dass Millionen Menschen ihren Mist kaufen«, sagt Marisa.
»Warum vier?«
»Von mir auch aus zwei oder fünf. Erfolg ist nichts wert, wenn das, womit man Erfolg hat, keinen Wert besitzt.«
Marisa schreibt an ihrem zweiten Roman. Für den ersten hat sie keinen Verlag gefunden. Gustav erinnert sich an seinen Anfang, an die Zeit bevor er Balder Nilsson wurde. Auf der nach oben offenen Vernichtungsskala rangiert das Desinteresse von Agenten und Verlagen weit vor schlechten Kritiken. Er war kurz davor aufzugeben.
»Und du? Was machst du? Lass mich raten. Hautarzt?« sagt Marisa. Sie lacht, drückt ihren Zeigefinger gegen seinen sonnenverbrannten Oberarm, hinterlässt eine weiße Druckstelle, die sich nur zögerlich wieder rot färbt. Er ist neugierig, worüber Marisa schreibt. Über die Liebe vermutlich, ohne sie beim Namen zu nennen. Sie schiebt ihre Sonnenbrille in ihre lockigen Haare und greift nach dem Sonnenschutzspray, das neben ihrer Strandtasche liegt, streift die Träger ihres Bikinis über ihre Schultern und cremt sich ein. Gustav würde ihr gerne behilflich sein, aber die Zeiten, in denen er später behaupten könnte, er habe dabei keine Hintergedanken gehabt, sind vorbei. Bestseller Autor begrapscht Frau an einem Strand in Portugal.
Er hat seit sieben Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, nur geschrieben, geschlafen, geschrieben, zu viel getrunken, unzäh-lige Lesereisen und Autogrammstunden absolviert. Nichts langweilt ihn mehr, als aus seinen Büchern vorzulesen, die nicht mehr als Gelddruckmaschinen sind. Fritz studiert für ihn die erfolgreichsten Thriller auf dem Markt, analysiert sie, legt ihre Eingeweide frei, ist der Anatom seines Erfolges. Balder Nilsson macht nichts Neues, sondern setzt Bewährtes geschickt auf andere Weise zusammen. Das Genre ist längst ausgelutscht, aber die Leser scheint das nicht zu stören.
Eine fünfköpfige Familie zieht ein Schlauchboot über den Strand. Die Frau und der Mann Anfang dreißig, die zwei Mädchen im Vorschulalter, Zwillinge dem Anschein nach. Das Baby liegt im Bauch des Bootes, schreit gegen den Wind und die Brandung an, aber niemand nimmt es wahr.
Marisa nimmt das Spray, sprüht seinen Rücken ein, lässt ihre Handflächen und ihre schmalen Finger darüber gleiten. Sie muss sich keine Sorgen um ihren Ruf machen, braucht keine Angst vor einer Anzeige wegen sexueller Belästigung zu haben
»Du musst besser auf dich aufpassen. Sonst verbrennst du«, sagt Marisa.
Die meisten seiner Begegnungen mit Frauen dauern eine Nacht, die Nacht nach einer Lesung, manchmal auch ein Frühstück länger, bevor er weiterreist. Burn after reading. All die Jahre hat er nie das Bedürfnis verspürt, irgendwo anzukommen, aber in letzter Zeit machen ihn Bahnhöfe und Häfen aller Art melancholisch.
»Darf ich etwas von dir lesen?«
»Du kannst Portugiesisch?«
Sein Laptop kann alle Sprachen, ist dank Fritz mit einem Übersetzungsprogramm ausgerüstet, das Geheimdienste verwenden. Der Turm von Babel ist befreit. Marisa könnte auf Suaheli schreiben, auf Russisch oder Kalaallisut. Es würde ihn nicht hindern, ihren ersten Roman zu lesen.
Marisa greift nach seiner Hand, zieht ihn hoch, weg von seinen Gedanken, die im heißen Sand zurückbleiben und läuft mit ihm den Wellen entgegen. Er hat Geschichten über die tückische Strömung gehört, aber bestimmt weiß sie, an welchen Stellen es ungefährlich ist. Vertrauen entsteht von einer Sekunde auf die andere, und genauso schnell kann es wieder verschwinden. Es dauert nicht lang, bis Marisa den Boden unter den Füßen verliert. Sie legt einen Arm um seinen Hals, hält sich an ihm fest. Die ankommenden Wellen schieben ihre Körper aneinander und trennen sie wieder. Es ist wie ein Tanz, ein langsamer Fado, der Beginn einer Geschichte, deren Ausgang ungewiss ist.