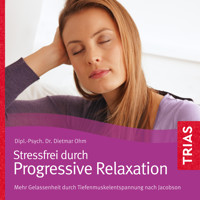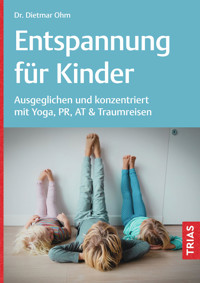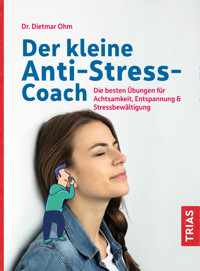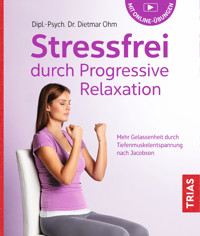18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Der kleine Coach
- Sprache: Deutsch
Ihr Weg aus der Angst
Haben Sie Flugangst, Angst vor Spinnen oder dem Zahnarzt? Kämpfen Sie mit Höhenangst, Klaustrophobie, Panikattacken, sozialer Phobie oder einer generalisierten Angststörung? Dann sind Sie nicht allein, denn viele Menschen leiden unter Ängsten. Die gute Nachricht ist: Sie können Ihre Ängste in den Griff bekommen. Und dabei unterstützt Sie der kleine Coach. Er zeigt Ihnen:
- Was hinter Ihrer Angst steckt und wie Sie diese durch Vermeidung vielleicht noch schlimmer machen.
- Einfache Übungen, um Ihre Angst zu überwinden, von systematischer Desensibilisierung, über Konfrontationstraining und achtsamkeitsbasierten Verfahren bis zur Progressiven Angstbewältigung.
- Wie Sie Anti-Angst-Strategien und Techniken für den Fall entwickeln, dass Angst übermächtig zu werden scheint.
Kleiner Coach, große Wirkung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der kleine Anti-Angst-Coach
Die besten Strategien gegen Angststörungen und Panikattacken
Dr. Dipl.-Psych. Dietmar Ohm
1. Auflage 2023
25 Abbildungen
Dank
An dieser Stelle möchte ich meiner Tochter Luna Lynn China herzlichen Dank aussprechen. Sie hat meine Arbeit durch wertvolle Anregungen unterstützt.
Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Celestina Filbrandt, Executive Editor beim TRIAS Verlag, die den Anstoß dafür gab, dieses Buch in dieser Reihe zu verfassen. Mein Dank gilt auch »meiner« Lektorin Frau Julia Jochim, die die Erstellung dieses Buches durch ihre kompetente, angenehme und unkomplizierte Art sehr gefördert hat.
Angst, lass nach!
»Wenn ich höre und sehe, was in der Welt los ist, wird mir angst und bange!« Solche Sätze sind heute immer häufiger zu hören. Kein Wunder, die seit Jahren anhaltende Pandemie, deren Ende nicht absehbar ist, schränkt nicht nur unser aller Leben ein, sondern sie stellt auch eine gesundheitliche Bedrohung bis hin zum Tod dar. Als wäre das nicht schon belastend genug, kommen die schlimmsten kriegerischen Auseinandersetzung seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hinzu. In dieser Situation haben viele Ängste eine reale Basis.
Angst hat prinzipiell eine wichtige Schutzfunktion und dient sowohl bei Menschen als auch bei Tieren der Abwehr oder Vermeidung von Gefahren. Allerdings kommt es auf das rechte Maß und auf einen konstruktiven Umgang mit Ängsten an. Denn besonders wenn Ängste von Dingen ausgelöst werden, die, wie die Pandemie oder ein Krieg, nicht einfach verschwinden, kann eine dauerhafte Angst zu einer großen Beeinträchtigung werden. Auch können bereits bestehende Ängste durch äußere Bedrohungen verstärkt werden und sich zu behandlungsbedürftigen Angststörungen entwickeln. Diese können sich, wenn sie unbehandelt bleiben, verschlimmern und sich auf immer weitere Lebensbereiche ausdehnen.
Es können jedoch nicht nur äußere Bedrohungen zu Ängsten führen, sondern oft sind diese auch »hausgemacht«. Diese Erkenntnis mag zunächst überraschend sein. Aber sie eröffnet effektive Möglichkeiten des Selbst-Coachings und einer konstruktiven Bewältigung durch Einstellungs- und Verhaltensänderungen – je eher, desto besser.
Der kleine Anti-Angst-Coach zeigt Ihnen Wege zur Angstbewältigung auf. Zunächst werden wir das Phänomen Angst näher beleuchten und die Frage beantworten, wie wir Ängste frühzeitig erkennen und einordnen können. Außerdem geht es um die Frage, wann es sich um realistische Ängste und wann um eine behandlungsbedürftige Angststörung handelt. Welche Arten von Angststörungen es gibt, welche Ursachen bekannt sind und warum Vermeidungsverhalten ein Problem ist, wird ebenfalls geklärt. Ergebnisse der aktuellen Hirnforschung geben dabei wichtige Einblicke in das Phänomen Angst.
Für eine konstruktive Bewältigung von Ängsten steht eine Reihe wissenschaftlich überprüfter Vorgehensweisen zur Verfügung: Ansätze wie die Systematische Desensibilisierung, Expositionstraining, Achtsamkeitsübungen, Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), Yoga, Progressive Relaxation und Mentales Training können effektive Hilfe bieten. Auf die Bedeutung kaum bewusster, automatischer Denk- und Bewertungsmuster werden wir ebenfalls eingehen. Früh übernommene Denk- und Bewertungsmuster können sich zu automatisierten angstverstärkenden Denkstilen verfestigen. Diese zu erkennen und zu verändern hilft, übersteigerte Ängste abzubauen und die Lebensqualität zu verbessern.
Wie so oft im Leben gilt auch beim Thema Angstbewältigung: Viele Wege führen nach Rom. Es gibt kein Patentrezept, sondern es gilt, den individuell passenden Weg zu finden. Der Anti-Angst-Coach bietet die geeigneten Wegbeschreibungen.
Bei langjährig bestehenden Angststörungen reicht möglicherweise Selbsthilfe nicht aus. In diesem Fall ist psychotherapeutische Hilfe empfehlenswert. Der Anti-Angst-Coach eignet sich auch zur Begleitung und Unterstützung einer laufenden Psychotherapie. Durch die umfangreichen Informationen und die Übungsangebote kann die Therapie deutlich intensiviert und abgekürzt werden.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Dank
Angst, lass nach!
Keine Angst vor Angststörungen
Angst: Was ist das? Wofür brauchen wir sie?
Unterschiede zwischen Furcht, Angst und Panik
Unrealistische Ängste
Der Angst aus dem Weg gehen
Angst bei andauernden Belastungen
Psychophysiologische Aspekte von Angst
Was geschieht im Gehirn?
Zusammenhänge zwischen Stress und Angst
Angst vor Blut, Verletzungen und Spritzen
Wie wird Angst erlebt?
Leide ich unter einer Angststörung?
Ursachen für Angststörungen
Klassische Konditionierung
Angst durch Modelllernen
Stress und Traumatisierungen
Ängstigende Informationen
Alkohol und andere Drogen
Medikamente
Antidepressiva
Erkrankungen
Genetik
Fazit
Angststörungen: Wenn Angst zur Dauerqual wird
Generalisierte Angststörung (GAS)
Panikstörung
Agoraphobie
Soziale Phobie
Spezifische Phobien
Trennungsangststörung
Was die Angst aufrechterhält und verschlimmert
Vermeidungsverhalten
Angst vor körperlichen Aktivitäten und Sport
Angst und Depression: häufig Hand in Hand
Angst bewältigen lernen
Wo die Angst ist, ist der Weg
Die Exposition
Systematische Desensibilisierung von Angst
Erstellen einer Angsthierarchie
Systematische Desensibilisierung in der Vorstellung:
Systematische Desensibilisierung in der Realität:
Der schnellere Weg: die Angewandte Entspannung
Einfach oder schwer anfangen?
Hinweise der Hirnforschung für die Angsttherapie
Am Ball bleiben!
In unterschiedlichen Situationen üben!
Bei Angst und Panik Bewegung
Sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen!
Prüfen, ob die eigenen Erwartungen richtig sind
Sicherheitsverhalten? Nein danke!
PC und Smartphone als Helfer: Exposition virtuell
Angstgedanken erkennen und verändern
Woher kommen automatisierte Angstgedanken?
Positiver, realistischer Denkstil: Wie das geht
Mentales Training mit positiven Vorsätzen
Positive Vorsätze durch Entspannungstraining verstärken
Verhaltensexperimente
Achtsamkeitsbasierte Angstbewältigung
Atemmeditation
Körperhaltung
Meditation: Wie es geht
Meditation und Körperreise: Bodyscan
Bodyscan: Wie es geht
Gehmeditation
Welche Arten der Gehmeditation gibt es?
Wie das achtsame Gehen geht
Zur Einstimmung: Gleichgewicht und Bodenkontakt wahrnehmen
Anleitung zur Gehmeditation
Gehmeditation und Lächeln
Gehmeditation und Bodyscan
Gehmeditation und Atmung
Yoga: Achtsamkeit in der Bewegung
Was lässt sich mit Yoga erreichen?
Worauf ist beim Üben zu achten?
Achtsames Stehen
Der Berg: Verbindung von Erde und Himmel
Hand-Fuß-Stellung
Der Stuhl
Heldin
Variation der Heldin
Der Baum
Tänzerin
Akzeptanz und Befreiung: ACT!
Ich habe Angstgedanken, ich bin sie nicht
Befreiender Humor
Progressive Relaxation
Erst anspannen – dann entspannen
Sport, Spiel – Entspannung
Übungshaltungen
Der Übungsablauf
Das Grundprinzip der Progressiven Relaxation:
Alles hat ein Ende …: die Zurücknahme
Progressive Relaxation in 10 Schritten
Übungsablauf der Kurzform in 10 Schritten
Entspannung und Achtsamkeit
Ruhevorstellungen
Bodyscan
Kurzentspannung durch mentales Training
Zeitaufwand
Anleitung: Mentale Kurzentspannung
Differenzielle Entspannung
Signalwort »Loslassen«
Differenzielle Entspannung im Alltag
Mentales Training
Mentales Training bei Panikattacken
Mentales Training bei Angststörungen
Generalisierte Angststörung (GAS)
Expositionstraining: Wo die Angst ist, ist der Weg
Service
Literatur
Empfehlungen von Dr. Dietmar Ohm
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
© S. Schneider/Thieme (Foto); © Susi Schaaf, Bellheim (Zeichnung) |
Keine Angst vor Angststörungen
Man sollte den Gegner kennen: Sehen wir uns also das Thema Angststörung mit all seinen Facetten einmal genau an.
Angst: Was ist das? Wofür brauchen wir sie?
Angst hat für uns Menschen eine zentrale Funktion – sie schützt uns. Sie kann aber auch zum Problem werden.
Bei der Entwicklung des Wortes Angst im Laufe von Jahrtausenden spielte ursprünglich offenbar der gutturale – also kehlig klingende – Laut »ng« eine Rolle: eine lautmalerische Beschreibung, dass es einem die Kehle zuschnürt. Ähnliche Bedeutungen finden sich beispielsweise auch im Lateinischen, Griechischen und Indogermanischen. Tatsächlich wird es für jemanden, der unter Angst leidet, oft eng im Leben. Freiheit und Bewegungsspielraum werden entweder durch äußere Einflüsse oder durch eigene angstauslösende Bewertungen eingeschränkt. Im Lauf der Entwicklungsgeschichte der Menschen hat sich die Angst für den Kampf um das Überleben als nützlich herausgestellt. Wir sind gewissermaßen die Nachkommen von »Angsthasen«, da Menschen mit geringer Angstbereitschaft sich zu oft großen Gefahren ausgesetzt und dadurch ihr Leben frühzeitig verloren haben. Interessanterweise tragen wir offenbar auch genetisch Erfahrungen unserer Vorfahren in uns, da Ängste vor Schlangen, Tieren, Spinnen und Höhe auch in Gegenden stark verbreitet sind, in denen in dieser Hinsicht keine besonderen Risiken mehr bestehen.
Bis heute spüren wir Furcht und Angst in Situationen, die für uns zu einer realen Gefahr werden könnten. Es ist richtig und notwendig, derartige Situationen zu vermeiden, um Schaden oder sogar Lebensbedrohung abzuwenden. Beispiel 1 macht diese positive Schutzfunktion deutlich.
Beispiel 1
Der Überholversuch
»Ein Autofahrer ist spät dran und hat Angst, einen wichtigen Termin zu versäumen. Ausgerechnet jetzt fährt auf der kurvigen und unübersichtlichen Strecke ein langsamer Lastwagen vor ihm. Es ist dunkel, regnerisch und nebelig. Er möchte gern überholen. Bei seinem Überholversuch an einer unübersichtlichen Stelle bricht er das Manöver aus Furcht vor einem Unfall ab. Nur Bruchteile von Sekunden später sieht er ein Auto entgegenkommen. Glücklicherweise hat ihn seine Furcht dazu gebracht, das waghalsige Überholmanöver abzubrechen, denn andernfalls hätte er einen schweren Unfall verursacht.
Ängste haben eine positive Bedeutung nicht nur in schwerwiegenden Gefahrensituationen. Sie können uns dazu motivieren, Aufgaben zu bewältigen und notwendige, aber unangenehme Pflichten zu erledigen. Eine leichte Angst vor einer bevorstehenden Prüfung kann dazu führen, angenehme Freizeitaktivitäten zurückzustellen, um intensiv zu lernen.
Furcht und Angst erfassen »den ganzen Menschen« und äußern sich in unseren Gefühlen, Gedanken, Körperreaktionen und im Verhalten. So spürt der überholende Autofahrer im ersten Beispiel ein ausgeprägtes Gefühl von Aufregung und Furcht. Außerdem schießen ihm Gedanken durch den Kopf wie »Wenn jetzt einer entgegenkommt, dann knallt es«. Außerdem spürt er sein Herz rasen, seine Hände krampfen sich um das Lenkrad, auf der Stirn spürt er Schweiß und im Kopf einen starken Druck. Er tritt auf die Bremse, lenkt im wahrsten Sinne des Wortes ein und vermeidet damit einen schweren Unfall.
Angst drückt sich über den Körper aus.
Furcht und Angst
gehören genauso wie Freude, Trauer und Ärger zum normalen Erleben,
können als Reaktion auf eine tatsächlich bestehende Gefahr eine wichtige Schutzfunktion haben,
betreffen den ganzen Menschen: Gedanken, Gefühle, körperliche Reaktionen und Verhalten,
können sich in sehr unterschiedlicher Intensität und in verschiedensten Reaktionen äußern.
Unterschiede zwischen Furcht, Angst und Panik
Furcht wird meist durch eine spezifische äußere Bedrohung ausgelöst. Es geht also um eine akute reale Gefahr; beispielsweise ein Auto, das auf eine Person zurast.
Angst hat dagegen ihren Ursprung in einem Erleben von Bedrohungen, wobei es dabei um mehr oder weniger reale Vorstellungen geht, was alles passieren könnte. Bei Angststörungen sind diese Vorstellungen meistens unrealistisch überzogen. Beispiele sind Spinnenangst, Kleintierangst, Sozialangst und übermäßige Angst vor Unfällen im Straßenverkehr. Furcht und Angst können sich bis zur Panik steigern, also einer übermächtigen Angst, die zu unüberlegten Reaktionen führen kann.
Auch wenn diese begrifflichen Unterschiede genau genommen bestehen, werden »Furcht« und »Angst« meistens gleichbedeutend benutzt.
Unrealistische Ängste
Das zweite ▶ Beispiel zeigt, dass Angst ihre positive Schutzfunktion verlieren und sich unrealistisch und destruktiv entwickeln kann. Dieses Phänomen lässt sich am Beispiel einer Alarmanlage veranschaulichen. Wenn eine Alarmanlage korrekt arbeitet und richtig eingestellt ist, wird sie immer dann anspringen, wenn tatsächlich eine Gefahr gegeben ist. Wenn sie allerdings auch in harmlosen Situationen reagiert und unnötig Lärm und Aufregung verursacht, hat sie natürlich ihre positive Wirkung eingebüßt. Eine ständig ohne Grund aufheulende Alarmanlage kann zu einer quälenden Nervenbelastung werden.
Ähnlich ist es mit unserem Angsterleben. Wenn es nicht nur durch reale Gefahren und tatsächliche Gefährdungssituationen ausgelöst wird, dann können wir in einen Zustand eines völlig sinn- und nutzlosen, quälenden Daueralarms geraten. Im Extremfall leiden Menschen über viele Stunden oder sogar permanent unter ihr. Unrealistisch überzogene Ängste können sich auf alle Aspekte des Lebens beziehen; sie finden im Alltagsleben leicht einen »fruchtbaren Nährboden«. Das liegt daran, dass es kaum absolute Sicherheiten im Leben gibt. Natürlich hat der Taxifahrer im obigen Beispiel recht, wenn er von Gefahren beim Autofahren ausgeht. Bis zu seinem Unfall hatte er sich jedoch über diese Gefährdungen wenig oder keine Gedanken gemacht. Er hatte – ohne dies bewusst zu reflektieren – ein gewisses Restrisiko in Kauf genommen. So ist es bei den meisten Alltagsaktivitäten. Wir können nie völlig ausschließen, dass etwas Schädigendes passiert. Obwohl zu Fuß gehen weniger gefährlich ist als Autofahren, setzt sich selbst ein Fußgänger natürlich einem gewissen Risiko aus.
Damit wir unseren Alltag bewältigen können, ist es daher wichtig, dass wir Risiken realistisch einschätzen und bereit sind, ein gewisses Restrisiko in Kauf zu nehmen. Andernfalls wären wir zur aktiven Lebensgestaltung nicht mehr in der Lage, da der Daueralarm unserer Angst jede Tätigkeit behindern würde.
Beispiel 2
Der Taxifahrer
»Einem Taxifahrer wird in einem stark befahrenen Kreisverkehr die Vorfahrt genommen, sodass es zur Kollision kommt. Glücklicherweise wird er nicht verletzt, aber »der Schreck sitzt ihm in allen Gliedern«. Ihm wird übel, schwindelig und er zittert am ganzen Körper. Er kann nicht weiterfahren. Nach diesem Unfall erlebt der Taxifahrer erstmals in seinem Leben starke Angst beim Autofahren, insbesondere, wenn er auf den Kreisverkehr zufährt, in dem der Unfall geschehen ist. Er beginnt, teilweise aufwändige Umwege zu fahren, um den »gefährlichen« Kreisverkehr zu vermeiden. Es gibt große Schwierigkeiten, da sich Fahrgäste über die unnötigen Umwege beschweren. Er stellt fest, dass er auch bei anderen Kreisverkehranlagen Angst bekommt, und beginnt, auch diese zu meiden. Schließlich spürt er in immer mehr Verkehrssituationen Angst, bis er sich nach einiger Zeit sogar ängstigt, wenn er ins Auto einsteigt. Er ist nicht mehr in der Lage, seinen Beruf auszuüben.
Katastrophisierung
Unter »Katastrophisierung« versteht man die gedankliche Beschäftigung mit unrealistischen und überzogen negativen Aspekten, insbesondere in unklaren Situationen.
Der Angst aus dem Weg gehen
Durch den Unfall erlitt der oben genannte Taxifahrer einen derartigen Schock, dass er nicht mehr in der Lage war, Alltagsgefahren realistisch zu beurteilen. Er begann, das Risiko, einen weiteren Unfall zu erleiden, völlig unrealistisch zu überschätzen. Er erwartete schließlich, dass er unweigerlich verunglücken würde, wenn er durch einen Kreisverkehr führe. Aufgrund dieser Überzeugung war es natürlich nur konsequent, dass er begann, jeden Kreisverkehr zu meiden.
Dieses ▶ Vermeidungsverhalten bringt schwerwiegende Probleme mit sich. Zum einen kann nicht gelernt werden, dass die katastrophisierenden Bewertungen einer als ängstigend erlebten Situation völlig überzogen sind, da die Realitätsprüfung fehlt. Da der Taxifahrer nicht die Erfahrung macht, den Kreisverkehr unbeschadet zu befahren, kann sich bei ihm die Überzeugung verstärken, dass es sicher zu einem Unfall gekommen wäre, hätte er es getan. Zum anderen kommt es meistens dazu, dass sich unrealistische Ängste auch auf andere Bereiche ausweiten: Es stellt sich schnell die Frage, warum denn ein bestimmter Kreisverkehr weniger gefährlich sein sollte als ein anderer. Dieses Generalisieren der unrealistischen Ängste kann weite Bereiche des Alltagsverhaltens treffen und so wie im obigen Beispiel zu massiven Behinderungen in der Lebensgestaltung führen.
Angst bei andauernden Belastungen
Bei auf reale Gefahren bezogenen Ängsten sind wir von einer positiven Schutzfunktion ausgegangen. Dies trifft zwar in der Regel zu, dennoch gibt es Ausnahmen. Hier bestehen zwar durchaus reale Gefährdungen, aber die Angst hat ihre Schutzfunktion verloren, da sich die Gefahr nicht abwenden lässt. Die Angst wird somit zu einem negativen, belastenden Faktor. Extreme Beispiele sind unheilbare Erkrankungen sowie der bevorstehende Tod. Auch treten bei schweren Erkrankungen meist Ängste auf, insbesondere wenn diese chronisch verlaufen und mit starken Schmerzen verbunden sind. Das Gleiche gilt für bevorstehende Operationen und Eingriffe. Wenn beispielsweise wegen einer Krebserkrankung operative Eingriffe sowie eine medikamentöse oder Strahlenbehandlung bevorstehen, treten meist ausgeprägte Ängste und Sorgen vor bleibenden Schädigungen, Behinderungen bis hin zur Angst vor einem nahenden Tod auf. Hieran können sich auch weitere Ängste knüpfen, die die gesamte Lebenssituation und Lebensgestaltung betreffen. Beängstigende Fragen können aufkommen wie: »Wird meine Familie, wird mein Partner in dieser schweren Krise zu mir halten? Werde ich als chronisch kranker Mensch überhaupt noch den Lebensanforderungen gewachsen sein? Hat das Leben für mich jetzt überhaupt noch einen Sinn?«
Die Angst vor Schmerzen hat bei chronischen Erkrankungen ebenfalls eine reale Basis. Trotz Schmerzmedikation lassen sich Schmerzen nicht völlig verhindern. Angst vor Schmerzen und Erwartungsspannungen führen jedoch zu einer Intensivierung der erlebten Schmerzen. Hieraus resultiert dann wiederum eine Steigerung der Angst. Häufig geraten Patient*innen in einen Teufelskreis aus Angst und Schmerz.
Bei chronischen Erkrankungen und bevorstehenden operativen und sonstigen Eingriffen können Belastungen, Schmerzen und Probleme nicht verhindert werden. Umso wichtiger ist auch hier eine aktive und konstruktive Auseinandersetzung mit den Ängsten. Ein resignatives Hinnehmen von Ängsten und Bedrohungserlebnissen führt meist zu keiner Lösung oder Linderung. Auch Verdrängen und Überspielen können in aller Regel meist nur kurzfristig Erleichterung verschaffen.
Hilfreich ist meistens ein offener Umgang mit den Ängsten, was am besten in vertrauensvollen und einfühlsamen Gesprächen geschehen kann. In diesen Gesprächen kann auch geklärt werden, ob beispielsweise durch katastrophisierende Gedanken die bestehende Belastungssituation unrealistisch übersteigert und dadurch unnötig starke Angst provoziert wird.
Viele Menschen, die sich in den geschilderten Belastungssituationen befinden, erleben Entspannungsverfahren wie die Progressive Relaxation als eine hilfreiche Erleichterung und als eine Möglichkeit, Spannungen, Ängste und Schmerzen auf nicht medikamentöse Weise besser zu bewältigen.
Untersuchungen an Krebspatient*innen, die eine Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen, machen deutlich, dass tägliche Übungen der Progressiven Relaxation in dieser schweren Zeit hilfreich sind. Durch regelmäßige Übungen traten weniger Übelkeit und Erbrechen auf und Angst wurde besser bewältigt.
Psychophysiologische Aspekte von Angst
Angst betrifft den »ganzen Menschen«. Dies gilt sowohl für realistische als auch für unrealistische Ängste.
Warum sind beim Angsterleben nicht nur Denken und Fühlen, sondern auch der Körper betroffen? Dies hängt mit der Entwicklungsgeschichte der Menschen zusammen, in der sich die Angst als eine Reaktion mit hohem Wert für das Überleben entwickelt hat.
Sympathikus und Parasympathikus
Der Sympathikus ist ebenso wie sein Gegenspieler, der Parasympathikus, Teil des vegetativen Nervensystems. Der Sympathikus versetzt den Körper in die Lage, sich zu wehren oder zu fliehen, der Parasympathikus kommt in Ruhe- und Regenerationsphasen zum Zug und »regelt« den Organismus wieder herunter.
Wenn beispielsweise in grauer Vorzeit plötzlich ein gefährlicher Säbelzahntiger auf einen Menschen zustürmte, war es notwendig, möglichst schnell zu fliehen oder sich mit einem Gegenangriff zu wehren. In beiden Fällen war es günstig, körperliche Energie zu mobilisieren, um möglichst viel Kraft und Schnelligkeit zur Verfügung zu haben. Einsetzende Angst führt dementsprechend zu einer Alarmierung und Mobilisierung des gesamten Organismus. Kräfte für den Angriff oder die Verteidigung werden freigesetzt. Insofern ist Angst als ein wichtiger Stressreiz oder Stressor anzusehen, der zu einer so genannten Bereitstellungsreaktion führt. Hierbei spielt das vegetative Nervensystem eine wichtige Rolle, das bei Angst meist mit einer Erhöhung der Sympathikus-Aktivität reagiert. Das führt u. a. zu einer Pulsbeschleunigung, zu einem Blutdruckanstieg, zur Intensivierung der Atmung und zu Anspannungen der Muskulatur. Man kann also sagen, dass »der Kessel unter Dampf gesetzt« wird, um eine gefährliche Situation mittels körperlicher Aktivitäten zu bewältigen.
Bei besonders starker Angst kommt es häufig zu Einschränkungen der Konzentration und des Denkvermögens, bis hin zu Denkblockaden. Dieses Phänomen hatte möglicherweise seinen Wert darin, dass es in der Frühzeit im Kampf um das Überleben oft wichtiger war, schnell zu reagieren, als lange zu überlegen.