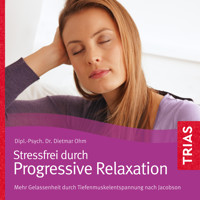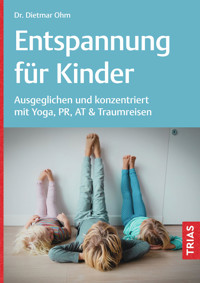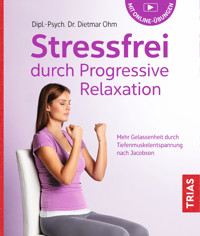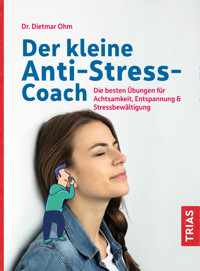
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Der kleine Coach
- Sprache: Deutsch
Für innere Ruhe und Gelassenheit!
Fühlen Sie sich gestresst? Haben Sie das Gefühl, nur noch von A nach B zu rennen und überhaupt nicht mehr zur Ruhe zu kommen? Dann kann der kleine Anti-Stress-Coach Ihnen helfen, wieder runterzukommen, sich zu entspannen und gelassener zu werden.
Er zeigt Ihnen:
- Erste Hilfe gegen Stress: Die besten Tipps und Tricks, wenn gar nichts mehr geht.
- Entspannung statt Hektik: Einen vielfältigen Übungsmix aus Achtsamkeit und Meditation, die in jeden Alltag passen.
- Stress beginnt im Kopf: Finden Sie heraus, was Ihre persönlichen Auslöser sind und welche Mentalübungen dagegen wirken.
Kleiner Coach, große Wirkung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der kleine Anti-Stress-Coach
Die besten Übungen für Achtsamkeit, Entspannung & Stressbewältigung
Dr. Dipl.-Psych. Dietmar Ohm
1. Auflage 2022
100 Abbildungen
Dank
An dieser Stelle möchte ich meiner Tochter stud. psych. Luna Lynn China herzlichen Dank aussprechen. Sie hat meine Arbeit durch wertvolle Anregungen unterstützt.
Bedanken möchte ich mich auch bei Celestina Filbrandt, Executive Editor beim TRIAS Verlag, die den Anstoß dafür gab, dieses Buch in dieser Reihe zu verfassen. Mein Dank gilt auch »meiner« Lektorin Julia Jochim, die die Erstellung dieses Buches durch ihre kompetente, angenehme und unkomplizierte Art sehr gefördert hat.
Stress, lass nach!
»Warum brichst du bei dem vielen Stress eigentlich nicht zusammen?« – »Dafür habe ich einfach keine Zeit!« Schon mal gehört? Eigentlich ist das nicht zum Lachen, denn viele Menschen kämpfen sich mit wachsenden körperlichen und seelischen Beschwerden durch ihren stressreichen Alltag, mit einem entsprechenden Verlust an Lebensqualität.
Dabei ist Stress nicht grundsätzlich negativ. Vielmehr brauchen wir ein gewisses Maß an Stress, damit das Leben nicht eintönig, langweilig und frustrierend wird. Aber es kommt auf das rechte Maß an und auf den richtigen Umgang mit Belastungen. Stress ist nicht immer ein äußerer Einfluss, sondern oft »hausgemacht«. Diese Erkenntnis mag zunächst unangenehm sein. Andererseits eröffnet diese Selbsterkenntnis jedoch effektive Möglichkeiten des Selbstcoachings und des Abbaus von Belastungen durch Einstellungs- und Verhaltensänderungen. Je eher, desto besser.
Der kleine Anti-Stress-Coach zeigt Ihnen in diesem Buch Wege zur Stressbewältigung auf. Um sinnvolle Änderungen einzuleiten, ist zunächst eine Bestandsaufnahme wichtig. Daher werden wir zunächst das Phänomen Stress näher beleuchten und die Frage beantworten, wie wir ihn rechtzeitig erkennen können. Die »Anti-Stress-Formel« zeigt den Weg zu einer konstruktiven Art der Stressbewältigung.
Dann geht es an die konkreten Verhaltensweisen. Zuerst gehen wir auf das Thema »Erste Hilfe« bei akutem Stress ein – wenn man bereits tief im Schlamassel steckt, gilt es schnell gegenzusteuern. Der kleine Anti-Stress-Coach stellt Ihnen hier einen Erste-Hilfe-Koffer zur Verfügung. Längerfristig hilft es, den Stress durch dauerhafte Verhaltensänderungen und Bewältigungsstrategien auszubalancieren, wobei Achtsamkeit, Entspannung, Ausgleich und Erholung helfen. Die Widerstandskraft gegen Stress – also Resilienz – wächst auf diese Weise. Zur Auswahl stehen Achtsamkeitsübungen, Meditation, Progressive Relaxation, Autogenes Training, Yoga, Zapchen und Powernap.
Wir sind Stressbelastungen meist nicht hilflos ausgeliefert, sondern können lernen, dem Stress aktiv und kompetent zu begegnen. Soziale Kompetenz, Zeitmanagement, Arbeitsorganisation und effektiver Umgang mit Problemen können dabei helfen, Stressbelastungen zu verringern. Auf die Bedeutung kaum bewusster, automatischer Denk- und Bewertungsmuster werden wir ebenfalls eingehen. Früh übernommene Denk- und Bewertungsmuster können sich zu »inneren Antreibern« entwickeln. Diese zu erkennen und zu verändern hilft, Wohlbefinden und Gesundheit zu verbessern. Falls der Stress trotzdem zu belastend werden sollte, geht es darum, die »Notbremse« zu ziehen – auch für den Extremfall hält der Anti-Stress-Coach Tipps bereit.
Wie so oft im Leben gilt auch beim Thema Stress: Viele Wege führen nach Rom. Es gibt kein Patentrezept, das für jeden und für alle Lebenssituationen gleichermaßen geeignet ist. Es geht daher darum, den individuell passenden Weg oder eine Kombination von geeigneten Möglichkeiten zu finden und in die Tat umzusetzen. Die entsprechenden Wegbeschreibungen finden sich in diesem Buch.
Auf geht’s! Der Anti-Stress-Coach zeigt ohne Stress begehbare Wege.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Dank
Stress, lass nach!
Das Phänomen Stress
Woher kommt der Stress?
Die Rolle des Nervensystems
Eustress und Disstress
Wir haben es in der Hand
Leben wir in einer Stressgesellschaft?
Öl aufs Feuer: gesundheitlich riskantes Verhalten
Alkohol
Rauchen
Medikamente
Fehlernährung
Bewegungsmangel
Resümee
Schutzfaktoren und Resilienz
Körperliche Fitness: dem Stress davonlaufen
Soziale Unterstützung: Geteiltes Leid ist halbes Leid
Selbstwirksamkeit und Optimismus: Ich schaffe das!
Stress rechtzeitig erkennen und abfangen
Die »Anti-Stress-Formel«
Stress-Signale wahrnehmen
Akuten Stress verringern
»Erste Hilfe«
Früherkennung
Akzeptanz
Mein Erste-Hilfe-Stein
Ins Hier und Jetzt kommen
Bewusstes Ausatmen und »Dampf ablassen«
Positive und beruhigende Selbstgespräche
Die Gedanken sind frei: innerer Ort der Ruhe
Humor: Wer lacht, lebt länger!
Bewusstes Lächeln
Stress durch Bewegung abbauen
Stress ausbalancieren
Achtsamkeit und Meditation
Atemmeditation
Körperhaltung
Meditation: Wie es geht
Meditation und Körperreise: Bodyscan
Bodyscan: Wie es geht
Gehmeditation
Welche Arten der Geh-Meditation gibt es?
Was ist achtsames Gehen?
Anleitung zur Geh-Meditation
Gehmeditation und Lächeln
Gehmeditation und Bodyscan
Gehmeditation und Atmung
Frust und Ärger rauslassen: Mit den Füßen stampfen
Wer nicht genießt, wird ungenießbar
Progressive Relaxation
Erst anspannen – dann entspannen
Sport, Spiel – Entspannung
Übungshaltungen
Der Übungsablauf
Das Grundprinzip von Anspannung und Entspannung bei der Progressiven Relaxation
Alles hat ein Ende: die Zurücknahme
Progressive Relaxation in 10 Schritten
Übungsablauf der Kurzform in 10 Schritten
Kurzentspannung durch mentales Training
Anleitung: mentale Kurzentspannung
Autogenes Training
Die Übungsformeln des Autogenen Trainings
Übungshaltungen
Alles hat ein Ende: die Zurücknahme
Der Übungsablauf
Autogenes Training und Achtsamkeit
Yoga
Was kann Yoga?
Worauf ist beim Üben zu achten?
Achtsames Stehen
Berg: Verbindung von Erde und Himmel
Hand-Fuß-Stellung
Mondsichel
Held/Heldin
Variation Held/Heldin
Stuhl
Sonnengruß
Baum
Tänzerin
Katze
Dynamische Brücke
Windbefreiende Stellung
Krokodil
Zapchen: Spaß gegen Stress
Gähnen
Nap
Schaukeln
Armschwingen
Schütteln
Seufzen
Tätscheln
Summen
Lachen
Hocken
Sich locker hängenlassen
Ächzen und Stöhnen
Sich strecken
Komisch sprechen
Pferdeschnauben
Prusten
Powernap
Wirkung
Powernap: Wie lange? Wann?
Stress aktiv begegnen
Kompetenzaufbau zur Stressbewältigung
Stressabbau durch soziale Kompetenz
Das ist mein Recht: Wie setze ich es angemessen durch?
Beziehungen gestalten
Um Sympathie werben, andere Menschen für sich gewinnen
Zeitmanagement und Arbeitsorganisation
Eisenhower-Prinzip
ALPEN-Methode
Pomodoro-Technik
Probleme lösen mit System
Stress beginnt im Kopf
Das ABC-Modell: Lerne, positiv zu denken!
Praktische Anwendung des ABC-Modells
Mentales Training mit positiven Vorsätzen
Positive Vorsätze durch Entspannungstraining verstärken
Mit Achtsamkeit Gedanken-Stress abbauen
Empfehlungen von Dr. Dietmar Ohm
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
© New Africa/stock.adobe.com (Foto); Susi Schaaf, Bellheim (Zeichnung) |
Das Phänomen Stress
Stress ist heutzutage allgegenwärtig – mit dem kleinen Anti-Stress-Coach halten wir gegen. Sehen wir uns zum Einstieg dieses Phänomen etwas genauer an.
Woher kommt der Stress?
Stress betrifft Körper und Psyche des Menschen und kann im Extremfall krank machen. Dennoch ist er nicht automatisch negativ – zu einem gewissen Grad brauchen wir ihn.
Stress ist prinzipiell etwas Natürliches. Menschen und Tiere hatten ihn schon immer, wenn sie sich herausfordernden Situationen gegenübersahen. Der Begriff für dieses Phänomen wurde allerdings erst in den 1940ern vom österreichisch-kanadischen Arzt und Biochemiker Hans Selye (1907–1982) geprägt. Vorher war »Stress« nur in der Materialwirtschaft bekannt und bezeichnete Belastungen, die auf Materialien einwirken und diese bei zu hoher Intensität verformen oder beschädigen.
Tatsächlich trifft es diese Definition ganz gut: Stress kann unheilvolle Wirkungen entfalten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor übermäßigem Stress und hat ihn zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhundert erklärt. Befragungen ergeben, dass über 80 Prozent der deutschen Bevölkerung zumindest gelegentlich unter Stress leiden; ein Drittel fühlt sich fast ständig durch Stress überlastet. Studien zeigen, dass 50 bis 60 % aller verlorenen Arbeitstage mit Stressbelastungen in Zusammenhang stehen. Daraus entstehen nicht nur enorme volkswirtschaftliche Schäden, sondern auch Leid, Krankheit und Einbußen an Lebensqualität. Stress ist nicht nur ein inzwischen weltweit verbreiteter Begriff, sondern fast alle Lebensbereiche sind betroffen.
Die Rolle des Nervensystems
Um die Zusammenhänge zwischen Stress, Körper und Psyche besser zu verstehen, ist eine Betrachtung unseres Nervensystems sinnvoll. Das menschliche Nervensystem lässt sich in einen willkürlich gesteuerten Bereich und einen normalerweise nicht willkürlich beeinflussbaren Bereich unterteilen. Unsere bewussten Handlungen werden durch das willkürliche Nervensystem gesteuert. Dieses ist vor allem für unsere Handlungen und unsere Beziehungen zur Umwelt wichtig. Dagegen regelt das unwillkürliche oder vegetative Nervensystem die Lebensfunktionen (z. B. Atmung, Verdauung, Herztätigkeit, Stoffwechsel).
Das vegetative Nervensystem arbeitet weitgehend unabhängig vom bewussten Willen. Das heißt jedoch nicht, dass es völlig abgekoppelt wäre, insbesondere seelische Vorgänge wirken sich auf das vegetative Nervensystem und damit auf Körperfunktionen aus. Hierbei spielt das Zusammenwirken des Sympathikus und des Parasympathikus eine wesentliche Rolle. Während der Sympathikus vorwiegend eine aktivierende Funktion hat (z. B. Beschleunigung des Herzschlages, Erhöhung des Blutdruckes) und damit Leistung ermöglicht, wirkt der Parasympathikus vor allem in Richtung Energiespeicherung, Erholung und Stärkung. Das Ziel dieses Zusammenwirkens ist ein ausgeglichener, harmonischer Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Verausgabung und Erholung.
Einen aktivierenden Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem und damit auf unsere Körperfunktionen haben alle Erlebnisse und Erfahrungen, die wir als herausfordernd, erschreckend oder alarmierend erleben. Wir sprechen bei diesen Erfahrungen allgemein von Stressreizen oder Stressoren. Das vegetative Nervensystem reagiert mit Pulsbeschleunigung, Blutdruckanstieg, einer Erhöhung des Blutzuckers, der Blutfette und der Blutgerinnungsfähigkeit. Diese Reaktionen sind Ausdruck einer inneren Alarmsituation: Der Körper stellt Energie bereit, um sich auf eine Aktivität vorzubereiten, nämlich auf Flucht oder Angriff. Dies ist durch die Entwicklungsgeschichte des Menschen bedingt: Während des Großteils seiner Geschichte stand der Mensch vor allem vor Herausforderungen, die er körperlich bewältigen musste. Für die Jagd oder einen bevorstehenden Kampf ist es sinnvoll, wenn durch Erhöhung von Puls, Blutdruck, Blutfetten und Blutzucker die Energiereserven des Körpers mobilisiert werden. Das Gleiche gilt für die Vorbereitung auf eine eventuell nötig erscheinende Flucht, hier ergibt sogar die verstärkte Gerinnungsfähigkeit des Blutes einen Sinn: Bei einer möglichen Verletzung wird der Blutverlust geringer gehalten.
Schema eines gesundheitlich günstigen Stressablaufs (Eustress)
Eustress und Disstress
Stressbelastung ist gesundheitlich völlig unbedenklich, solange die Alarmsituation nicht allzu lange anhält, die mobilisierte Energie durch körperliche Aktivität wieder abgebaut wird und es ausreichend Zeit zur Erholung gibt. Um gesund, widerstandsfähig und leistungsfähig zu bleiben, brauchen wir sogar einen (gesunden) Stress, denn bei Unterforderung, bei zu wenig Anregung und Aufregung droht erfahrungsgemäß gesundheitlicher Schaden.
Fallbeispiel Eustress
Herr P. stellt bei seiner Arbeit als Bauingenieur fest, dass ein Kollege einen Fehler gemacht hat. Nun besteht die Gefahr, dass er einen wichtigen Termin nicht einhalten kann. Herr P. spürt eine wachsende Aufregung und auch Ärger. Er wartet jedoch nicht lange ab, sondern geht gleich zu dem Kollegen. Er schildert seinen Ärger in einer günstigen Weise, d.h., er sagt direkt, worüber er sich ärgert, vermeidet aber vorwurfsvolle, drohende oder beleidigende Äußerungen. Der Kollege geht auf Herrn P. ein, und gemeinsam suchen sie einen Ausweg und finden schließlich eine befriedigende Lösung. Herrn P. fällt ein Stein vom Herzen. Als er beruhigt zu seinem drei Stockwerke höher gelegenen Büro zurückgeht, nimmt er die Treppe anstelle des Fahrstuhls. Er kann sich noch einige Minuten ausruhen, bevor er sich der nächsten Aufgabe zuwendet.
Obwohl es in dem Fallbeispiel zum Eustress um Aufregung und Ärger geht, handelt es sich um Eustress, gesunden Stress. Die Anspannung ist nur von kurzer Dauer und Entspannung sowie körperliche Aktivität bilden ein ausreichendes Gegengewicht.
Fallbeispiel Disstress
Nach einer anstrengenden Autofahrt durch den dichten morgendlichen Stoßverkehr und nach längerer Parkplatzsuche kommt Herr S. bereits gereizt und verärgert in die Firma. Mit dem Fahrstuhl fährt er in sein Büro und erfährt dann von einem Fehler eines Mitarbeiters, durch den seine Terminplanung völlig durcheinandergebracht wird. Er spürt starken Ärger in sich aufsteigen und denkt bei sich: »Schon wieder hat Kollege K. etwas verbockt. Mit ihm zu reden ist ja völlig sinnlos.« Obwohl er bereits völlig durch Termine überlastet ist und auch noch die zusätzlichen Probleme aus dem Weg räumen muss, nimmt er eine weitere eilige Arbeit an. Er ärgert sich dann über sich selbst, dass er wieder einmal nicht Nein sagen konnte. Als ein Kollege ihn um eine Auskunft bittet, reagiert er äußerst gereizt, was einen heftigen und ärgerlichen Wortwechsel zur Folge hat. Obwohl er schon die Mittagspause teilweise für die Arbeit genutzt und das Kantinenessen hastig hinuntergeschlungen hat, kommt er wieder einmal – wie so oft – viel zu spät aus der Firma. Da er sich sehr abgespannt fühlt, nimmt er den Fahrstuhl statt der Treppen. Dann beginnt die nervenaufreibende Heimfahrt durch die verstopften Straßen. Zu Hause angekommen, fühlt er sich völlig ausgebrannt, aber gleichzeitig auch aufgedreht, innerlich unruhig und gereizt. Nach dem aufregenden Krimi im Fernsehen fühlt er sich weiterhin so unruhig, dass er lange Zeit im Bett wach liegt und grübelt. Dabei geht ihm auch die Frage durch den Kopf: »Mache ich eigentlich irgendetwas verkehrt?«
Leider herrschen im Alltag vieler Menschen chronische Überforderungen vor. Der krank machende, überfordernde Stress wird auch als Disstress bezeichnet. Unsere moderne, industrialisierte Gesellschaft und die damit verbundene Lebensform hat die Gefahr von Disstress wesentlich erhöht: Körperliche Belastungen nehmen ab, während geistige, seelische und nervliche Belastungen u. a. durch Reizüberflutung (z. B. Fernsehen, Computer, berufliche Überforderungen, Verkehrsdichte, Lärm) ständig zunehmen.
Es ist gesundheitlich unbedenklich, wenn Überforderungen nur ab und zu vorkommen, denn das kann der Organismus ausgleichen. Chronischer Disstress ist jedoch problematisch. Die Auswirkungen auf den Körper sind vielfältig, wobei vor allem das Herz-Kreislauf-System betroffen ist. Es kann u. a. zu schnellem Puls (Herzklopfen), unregelmäßigem Herzschlag und Blutdruckveränderungen kommen. Außerdem sind Störungen der Magen- und Darmtätigkeit möglich, was zu entsprechenden Beschwerden führen kann. Disstress betrifft auch die Muskulatur: Es kommt meist zu Muskelverspannungen. Häufig liegt beispielsweise die Ursache für Kopfschmerzen in verspannter Nacken- und Schultermuskulatur, während Rückenschmerzen durch verspannte Rückenmuskulatur zustande kommen.
Eine dauerhafte Aktivierung des Sympathikus und eine damit einhergehende langanhaltende Dämpfung des für die Erholung zuständigen Parasympathikus durch Disstress und damit die Verminderung der aufbauenden und energiegewinnenden Fähigkeiten des Körpers schwächen die Abwehrkräfte und erhöhen allgemein die Krankheitsanfälligkeit. Daher treten bei chronischer Überforderung vermehrt Infekte wie z. B. Schnupfen, Erkältungen, Magen- und Darmbeschwerden auf. Aber auch schwerere Erkrankungen können durch eine Schwächung des Immunsystems begünstigt werden.
Es gibt andererseits Beschwerdebilder, die nicht durch eine Überaktivierung des Sympathikus, sondern durch eine Überaktivierung des Parasympathikus verursacht werden. In diesen Fällen kommt es bei Belastungen nicht zur normalen Stressreaktion, sondern diese bleibt in der Vorphase stecken. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich jemand bei Herausforderungen gar nicht zum Widerstand oder zur Auseinandersetzung mit dem Problem aufraffen kann, weil er zu verängstigt, resigniert oder wie gelähmt ist. Wenn diese Zustände von Hilflosigkeit, Schwäche und Angst häufig und schließlich sogar gewohnheitsmäßig auftreten, kann es durch eine Überaktivität des Parasympathikus zu Störungen der vegetativen Steuerung kommen. Die Folge sind dann Beschwerden wie Schwindelgefühle, Durchblutungsstörungen und Mattigkeit durch Absinken des Blutdrucks, Übelkeit und Verdauungsstörungen durch Verkrampfungen der Muskeln in Magen und Darm sowie Luftnot durch ein Zusammenziehen der Bronchien. Nicht selten treten auch Kopfschmerzen und Neigung zum Erröten auf.
Disstress begünstigt nicht nur das Entstehen von Beschwerden und Erkrankungen. Chronische Überforderung beeinträchtigt auch das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Überforderte und überreizte Menschen fühlen sich meist unwohl und unausgeglichen. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit werden beeinträchtigt. Nicht selten reagieren chronisch überforderte Menschen auch mit Gefühlen von Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit und Angst oder verhalten sich gereizt und aggressiv.
Schema eines gesundheitlich ungünstigen Stressablaufs (Disstress)
Wir haben es in der Hand
Wie die Fallbeispiele zeigen, ist Stress allerdings nicht einfach nur ein äußerer Einfluss. Zwar wirken viele Stressreize wie beispielsweise Lärm, Hektik, Hitze oder ein ungeduldiger, cholerischer Chef als äußere Stressoren. Aber auch die Art, wie wir Situationen und Einflüsse interpretieren und mit ihnen umgehen, spielt eine wichtige Rolle. Während Herr P. nach Überwindung seines anfänglichen Ärgers in günstiger Weise auf seinen Kollegen zugeht und mit ihm gemeinsam eine Lösung für das Problem findet, ist es bei Herrn S. anders: Ihm stehen sein Ärger oder auch soziale Ängstlichkeit und falscher Stolz im Weg, sodass er seine Probleme in sich hineinfrisst.
Ein Erklärungsmodell für das Zusammenwirken äußerer und innerer Einflüsse auf das Stresserleben stammt von dem amerikanischen Psychologen Richard Lazarus. Ob ein Einfluss als Stressor wirkt, hängt in diesem Modell stark davon ab, wie jemand die Situation wahrnimmt und bewertet. Beispielsweise leiden manche Menschen unter Unsicherheit und sozialen Ängsten, weshalb sie Selbstbehauptung und aktive Konfliktbewältigung vermeiden. Andere interpretieren eine Konfliktsituation dagegen als eine Herausforderung, der sie sich gewachsen fühlen. Eine weitere wichtige Rolle spielen Bewältigungsstrategien. Beispielsweise können bereits Gedanken wie »Ich bleibe ganz ruhig« oder »Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten« helfen, mit Konflikten besser zurechtzukommen. Dagegen verschlimmern »katastrophisierende« Gedanken wie »Wenn ich nachfrage, werde ich für dumm gehalten« Gefühle von Unsicherheit und Angst. Überforderung und Disstress drohen immer dann, wenn das Gleichgewicht zwischen den äußeren Anforderungen einerseits und den subjektiven Bewertungen und Bewältigungsfähigkeiten andererseits gestört ist.
Bei den Bewältigungsstrategien wird zwischen »problemlösender« und »emotionsregulierender« Funktion unterschieden. Problemlösende Strategien beziehen sich auf die konkrete Veränderung einer Situation, beispielsweise durch Veränderung der Zeitplanung, Setzen von Grenzen, Einhalten von Ruhephasen, Abbau von Reizüberflutung durch weniger Lärm usw. Zu problemlösenden Strategien kann es auch gehören, an den eigenen Ansprüchen, Erwartungen, Zielen und Gewohnheiten zu arbeiten, um beispielsweise Selbstüberforderungen abzubauen. Dagegen dienen »emotionsregulierende« Strategien der Kontrolle der körperlichen und psychischen Reaktionen auf Stressbelastungen. Entspannungsverfahren wie ▶ Autogenes Training und ▶ Progressive Relaxation sowie ▶ Yoga haben beispielsweise eine wichtige emotionsregulierende Funktion und können helfen, Stressbelastungen konstruktiv zu bewältigen.
Leben wir in einer Stressgesellschaft?
Die Stressbelastungen