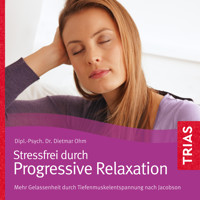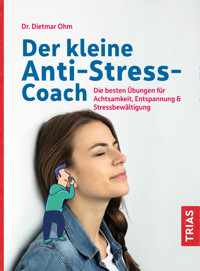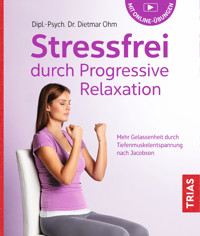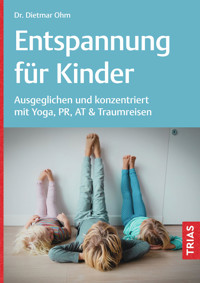
15,99 €
Mehr erfahren.
Kinderleicht zur Ruhe kommen
Hohe Anforderungen in der Schule, Freizeit-Stress am Nachmittag und immer "on" am Smartphone oder Computer. Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafstörungen sind die Folge. Gerade Kinder brauchen Ruhe-Inseln im hektischen Alltag.
Diese schaffen Sie durch spontane Achtsamkeits-Momente am Familientisch oder beim Kuscheln auf dem Sofa. Aber am besten hilft Ihrem Kind eines der bewährten Entspannungsverfahren, das es wie ein Stress-Schutzschild nachhaltig resilient macht.
- Ganz kindgerecht entspannen: Yoga, Progressive Relaxation, Autogenes Training, Zapchen und Entspannungsgeschichten.
- Zugabe Spaßfaktor: So bauen Sie viele Entspannungs-Momente im Familienalltag ein.
- Einfach mitmachen: Mit einladenden Übungsfotos und zauberhaften Illustrationen - allein, zu zweit oder in der Gruppe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entspannung für Kinder
Ausgeglichen und konzentriert mit Yoga, PR, AT & Traumreisen
Dr. phil. Dietmar Ohm
2. Auflage 2025
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Entspannung und Entspannungsverfahren für Erwachsene sind in aller Munde. Doch auch Kinder haben Stress und sind psychischen Belastungen ausgesetzt. Gesundheitliche Beschwerden, Entwicklungsstörungen und Schulprobleme können die Folge sein. Hier setzt dieses Buch an und zeigt eine Reihe Entspannungsverfahren für Kinder auf.
Autogenes Training und Progressive Relaxation sind am bekanntesten und am besten erforscht. Auch Yoga wird zunehmend bei Kindern mit guten Ergebnissen eingesetzt. Das in Deutschland noch relativ unbekannte Psychotherapieverfahren Zapchen wird in diesem Buch erstmals in einer Version für Kinder vorgestellt. Alle vier Verfahren können und sollen eigenverantwortlich von den Kindern durchgeführt werden, zu Beginn mit Unterstützung der Eltern.
Entspannungsverfahren helfen uns, mit den Belastungen und Herausforderungen des Alltags besser zurecht zu kommen. Nicht nur die Konzentrationsfähigkeit und Lernleistung werden besser, wir sind auch gesünder und fühlen uns insgesamt besser. Entspannungsverfahren sind zwar kein Allheilmittel, aber regelmäßiges Üben ist ein wichtiger eigener Beitrag, um die seelische und körperliche Gesundheit zu schützen und zu stärken. Vorbeugen ist besser als heilen.
Die einzelnen Entspannungsverfahren werden kurz dargestellt. Anleitungstexte und Entspannungsgeschichten, in denen in kindgerechter Weise die verschiedenen Übungen präsentiert werden, helfen, direkt loszulegen. So macht das Üben richtig Spaß!
Dieses Buch richtet sich an Sie, die Eltern, die für ihre Kinder effektive Verfahren zu Selbstentspannung, Stressbewältigung und Gesundheitsvorsorge suchen. Sie sind für Kinder bei der Stress- und Belastungsbewältigung als Vorbilder von fundamentaler Bedeutung. Machen Sie deshalb bei den Übungen mit – Sie werden selbst von den Effekten profitieren.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Kinder unter Stress
Lernziel: einfach entspannen
Was Stress im Kinderkörper verursacht
Bewältigungsstrategien
Entwicklungs- und Verhaltensprobleme bei Kindern
Hyperkinetisches Syndrom
Aggressives Verhalten
Angststörungen
Entspannung bei Kindern: Ziele, Möglichkeiten, Grenzen
Verschiedene Methoden
Was bewirkt Entspannungstraining?
Was können Kinder mit Entspannungstraining erreichen?
Entspannen – körperorientierte Wege
Sinne an! Achtsamkeit im Alltag
Achtsamkeitsübungen für Kinder
Wie lange kannst Du es hören?
Das lautlose Papier
Wo war es?
Mein Erste-Hilfe-Stein
Stampfe mit den Füßen
Das Autospiel
Innerer Ort der Ruhe und Kraft
PR – anspannen, um besser loszulassen
Die Armhebeprobe
Erst anspannen – dann entspannen
Für welches Alter eignet sich PR?
Wann sollte von PR abgesehen werden?
Geeignete Übungssituationen für Kinder
Sport, Spiel – Entspannung
Zur Rolle von Eltern, Pädagogen und Therapeuten
Die Übungshaltungen
Die Liegeposition
Die Sitzhaltung
Die angelehnte Sitzposition
Die Droschkenkutscherhaltung
Übungsablauf
Die Übungen der Progressiven Relaxation
Das Grundprinzip Anspannung und Entspannung bei der PR
Wie fühlt sich Entspannung an?
Alles hat ein Ende – die Zurücknahme
Wie es geht: eine Vorübung
Übungsprogramme und Entspannungsgeschichten für Kinder
Kurzübung der PR in 10 Schritten ab 8–10 Jahren
Beim Sportfest
1. Hand und Unterarm
2. Andere Hand und anderer Unterarm
3. Oberarme (Bizeps)
4. Oberarme (Trizeps)
5. Schultern
6. Gesicht
7. Rückenmuskeln
8. Bauchmuskeln
9. Oberschenkel- und Gesäßmuskeln
10. Unterschenkel
Reise durch den Körper
Abenteuer in der Südsee (PR in 7 Schritten)
Aufbau der Entspannungsgeschichte
Zur Vorbereitung
PR in 7 Schritten für Kinder ab 6 Jahren
Kombination mit anderen Entspannungsverfahren
Entspannungsvertiefung durch Ruhevorstellungen
Entstehenlassen eines Ruhebildes in der Entspannung
Übung mit einer bestimmten Ruhevorstellung
Wie der Lernprozess gefördert werden kann
Körperängste und psychovegetative Beschwerden
Die PR im Alltag
PR gemeinsam üben
Übungsprotokolle als Lernhilfe
Yoga – Dehnen, Kräftigen, Relaxen
Was kann Yoga?
Was ist im Kinder-Yoga anders?
Für welches Alter eignen sich Yoga-Übungen?
Wie sollten die Übungen den Kindern nahegebracht werden?
Geeignete Übungssituationen für Kinder
Zur Rolle von Eltern, Pädagogen und Therapeuten
Yoga im Märchenwald
Der Berg (ab 3 Jahre)
Der Baum schlägt Wurzeln (ab 3 Jahre)
Der Baum wächst und bekommt Äste (ab 3 Jahre)
Der Baum im Wind (ab 3 Jahre)
Drehung und Atmung (ab 4 Jahre)
Der Stuhl (ab 4 Jahre)
Der Baum hat lange Zweige (ab 4 Jahre)
Die Palme (ab 5 Jahre)
Baum im Gleichgewicht (ab 4 Jahre)
Der Farn (ab 4 Jahre)
Die Mondsichel (ab 3 Jahre)
Die Sonne geht auf und unter (ab 3 Jahre)
Hase Langohr ruht sich aus (ab 3 Jahre)
Katze Karla reckt den Rücken (ab 3 Jahre)
Langohr streckt Vorder- und Hinterpfoten (ab 3 Jahre)
Langohr balanciert (ab 4 Jahre)
Langohr streckt Hinterpfoten und Rücken (ab 4 Jahre)
Langohr wälzt sich hin und her (ab 4 Jahre)
Langohr passt auf (ab 4 Jahre)
Langohr übt Balance im Sitzen (ab 4 Jahre)
Langohr verbeugt sich (ab 3 Jahre)
Langohr will losrennen (ab 4 Jahre)
Langohr grüßt die Sonne und die Erde (ab 5 Jahre)
Wächter im Wald (ab 4 Jahre)
Atemübungen im Yoga
Tierstimmen nachmachen
Die Fee Farfalla atmet die gute Waldluft (ab 3 Jahre)
Die Fee Farfalla atmet mit Langohr (ab 3 Jahre)
Atmen und balancieren (ab 6 Jahre)
Das Nasenspiel (ab 5 Jahre)
Blumen erwachen und gehen schlafen (ab 4 Jahre)
Die Hummel (ab 5 Jahre)
Farfallas Kater (ab 4 Jahre)
Der Gorilla (ab 3 Jahre)
Der Löwe (ab 5 Jahre)
Der Holzhacker (ab 4 Jahre)
Die Mondsichel und der Atem (ab 5 Jahre)
Atemgymnastik (ab 6 Jahre)
Entspannungsgeschichten und Yoga
Die Sonne (ab 3 Jahre)
Langohr macht einen Ausflug (ab 4 Jahre)
Abenteuer im Zauberwald (ab 5–6 Jahre)
Reise durch den Körper
Wie der Lernprozess gefördert werden kann
Yoga im Alltag
Yoga gemeinsam üben
Zapchen – locker werden, Spaß haben
Körper und Seele beeinflussen sich
Für welches Alter eignen sich Zapchen-Übungen?
Geeignete Übungssituationen für Kinder
Zur Rolle von Eltern, Pädagogen und Therapeuten
Zapchen-Übungen für Kinder
Gähnen
Nickerchen
Schaukeln
Armschwingen
Schütteln
Tätscheln
Seufzen
Summen
Hocken
Lachen
Sich locker hängen lassen
Ächzen und Stöhnen
Sich strecken
Komisch sprechen
Pferdeschnauben
Prusten
Tschu, Tschu, Eisenbahn
Die Seele entspannen – imaginative Wege
AT – durch Vorstellung zur Ruhe kommen
Was ist beim AT für Kinder anders?
Für welches Alter ist AT geeignet?
Wann sollte vom AT bei Kindern abgesehen werden?
Geeignete Übungssituationen für Kinder
Welche Übungshaltungen sind zu empfehlen?
Zur Rolle von Eltern, Pädagogen und Therapeuten
Übungen des Autogenen Trainings für Kinder
Übungsdauer und Rücknahme
Übungsablauf beim AT
Anleitungstext für AT: zur Vorbereitung
Ruhe
Schwere
Wärme
Atmung
Bauch (Sonnengeflecht)
Stirn
Herz
Entspannungsgeschichte und Autogenes Training
Die Klassenarbeit (ab Schulalter)
Wie der Lernprozess gefördert werden kann
Kombination von AT mit anderen Entspannungsverfahren
Entspannungsvertiefung durch Ruhebilder
Körperängste und psychovegetative Beschwerden
Autogenes Training im Alltag
Autogenes Training gemeinsam üben
Fazit: Was bringen Entspannungsverfahren?
Übungsprotokoll: Wie wirkt die Progressive Entspannung(1) bei Dir?
Service
Literatur
Begleitende Audio-Übungen
1. Mach Dich locker
2. Dein Körper – ein Instrument
3. Abenteuer Südsee, Teil 1
4. Progressive Entspannung mit Dr. Locker
5. Abenteuer Südsee, Teil 2
6. Yoga im Märchenwald
7. Yoga mit Häschen Langohr und Kater Karl
8. Die Bärenhöhle im Frühling (AT-Traumreise)
9. Dein Kraft-Ort
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Impressum
Kinder unter Stress
Stress – was genau ist darunter zu verstehen? Warum und auf welche Weise beeinflusst Stress die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern?
Lernziel: einfach entspannen
Auch Kinder können unter Stress stehen. Unkonzentriertheit, auffälliges Verhalten oder Zurückgezogenheit sind mögliche Folgen.
Schulangst, Nervosität, Konzentrationsstörungen und stressbedingte körperliche Beschwerden wie Kopf-, Magen- und Darmbeschwerden nehmen bei Kindern zu. Viele Kinder wirken nervös und angespannt, sind häufig unkonzentriert, lustlos oder erschöpft. Ein hohes Lebenstempo, Reizüberflutung, unsichere Familienbindungen, hoher Fernseh-/Videokonsum, Computerspiele, schulischer Leistungsdruck, Zeitmangel der Eltern – das sind nur einige Stichwörter, die deutlich machen, welchen nervlichen Belastungen Kinder heute ausgesetzt sind.
Überfordernde Stressbelastungen werden zu Recht immer wieder für eine Vielzahl von Beschwerden und Erkrankungen bei Kindern verantwortlich gemacht.
Was Stress im Kinderkörper verursacht
Um die Verbindung zwischen Psyche und Körper besser zu verstehen, ist eine Betrachtung unseres Nervensystems sinnvoll. Das menschliche Nervensystem lässt sich in einen willkürlich gesteuerten Bereich und einen normalerweise nicht willkürlich beeinflussbaren Bereich unterteilen. Unsere bewussten, willkürlichen Handlungen werden durch das willkürliche Nervensystem gesteuert. Dieses ist vor allem für unsere Beziehungen und Handlungen nach außen, zur Umwelt wichtig. Dagegen regelt das unwillkürliche oder vegetative Nervensystem die inneren Lebensfunktionen (z. B. Atmung, Verdauung, Herz, Stoffwechsel). Das vegetative Nervensystem arbeitet weitgehend unabhängig vom bewussten Willen. Aber es ist nicht völlig unabhängig, insbesondere seelische Vorgänge wirken sich auf das vegetative Nervensystem und damit auf Körperfunktionen aus. Hierbei spielt das Zusammenwirken des Sympathikus und des Parasympathikus, der beiden Teile des vegetativen Nervensystems, eine wesentliche Rolle.
Während der Sympathikus vorwiegend eine aktivierende Funktion hat (z. B. Beschleunigung des Herzschlags, Erhöhung des Blutdrucks) und damit Leistungen ermöglicht, wirkt der Parasympathikus vor allem in Richtung Energiespeicherung, Aufbau und Erholung. Das Ziel dieses Zusammenwirkens ist ein ausgeglichener, harmonischer Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Verausgabung und Erholung. Einen aktivierenden Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem und damit auf unsere Körperfunktionen haben alle Erlebnisse und Erfahrungen, die wir als herausfordernd, erschreckend oder alarmierend erleben. Wir sprechen bei diesen Erfahrungen allgemein von Stressreizen oder Stressoren. Das vegetative Nervensystem reagiert mit Pulsbeschleunigung, Blutdruckanstieg, einer Erhöhung des Blutzuckers, der Blutfette und der Blutgerinnungsfähigkeit. Diese Reaktionen sind Ausdruck einer inneren Alarmsituation: Der Körper stellt Energien bereit, um sich auf eine Aktivität vorzubereiten. Genau genommen bereitet er sich auf eine körperliche Aktivität vor, nämlich auf Flucht oder Angriff. Dies hat seinen Grund in der Entwicklungsgeschichte der Menschen. Denn während des längsten Abschnitts der Geschichte standen die Menschen vor allem vor Herausforderungen, die sie körperlich bewältigen mussten. Für die Jagd oder einen bevorstehenden Kampf ist es sinnvoll, wenn durch Erhöhung von Puls, Blutdruck, Blutfetten und Blutzucker die Energiereserven des Körpers mobilisiert werden. Das Gleiche gilt für die Vorbereitung auf eine eventuell nötig erscheinende Flucht; hier ergibt sogar die verstärkte Gerinnungsfähigkeit des Blutes einen Sinn: Bei einer möglichen Verletzung wird der Blutverlust geringer gehalten.
Stressbelastung ist gesundheitlich völlig unbedenklich, solange die Alarmsituation nicht allzu lange anhält, die mobilisierte Energie durch körperliche Aktivität abgebaut wird und es ausreichend Zeit zur Erholung gibt.
Um gesund, widerstandsfähig und leistungsfähig zu bleiben, brauchen wir sogar einen (gesunden) Stress, denn bei Unterforderung, bei zu wenig Anregung und Aufregung droht erfahrungsgemäß gesundheitlicher Schaden.
Tina und die Mathearbeit
In einigen Tagen soll eine Mathematikarbeit geschrieben werden. Der Lehrer nimmt noch einmal Aufgaben durch, die in ähnlicher Art in der Klassenarbeit vorkommen werden. Trotz der Erklärungen des Lehrers versteht Tina noch nicht, wie eine bestimmte Aufgabe zu rechnen ist. Sie bekommt einen Schreck, wenn sie an die Mathearbeit denkt: Wie soll sie es richtig machen, wenn sie es jetzt nicht versteht? Sie merkt, dass sie ganz aufgeregt wird und ihr Herz klopft. Es ist ihr zwar etwas unangenehm einzugestehen, dass sie die Aufgabe noch nicht kapiert hat, aber sie gibt sich einen Ruck und meldet sich. Sie bittet den Lehrer, die Aufgabe noch einmal zu erklären, was dieser auch macht. Nach der nochmaligen Erläuterung der Rechenschritte fällt bei Tina der Groschen. Sie spürt deutlich, wie ihr ein Stein vom Herzen fällt und sie wieder ruhig und gelassen wird. In der Pause tobt sie sich zunächst auf dem Schulhof etwas aus, lehnt sich dann an eine Mauer und entspannt einen Moment.
Obwohl es im Beispiel von Tina um Aufregung geht, handelt es sich um Eustress, gesunden Stress, denn die Anspannung ist nur von kurzer Dauer und Entspannung sowie körperliche Aktivität bilden ein ausreichendes Gegengewicht.
Leider sieht die Wirklichkeit für viele Kinder heute so aus, dass nicht von gesunden Stressbelastungen gesprochen werden kann, sondern dass oft chronische Überreizungen und Überforderungen vorliegen. Verschlimmernd wirkt sich der weitverbreitete Bewegungsmangel aus. Der krank machende, überfordernde Stress wird auch als Disstress bezeichnet. Unsere moderne, industrialisierte Gesellschaft und die damit verbundene Lebensform haben die Gefahr von Disstress wesentlich erhöht: Die körperlichen Belastungen nehmen ab, während die geistigen, seelischen und nervlichen Belastungen u. a. durch Reizüberflutung (z. B. Fernsehen, Videospiele, Computer, Schulstress, Verkehrsdichte, Lärm) ständig zunehmen.
Timos Teufelskreis
Wieder einmal haben Timo und seine Eltern verschlafen. Timo kommt kaum aus dem Bett. Kein Wunder, gestern ist es wieder sehr spät geworden, da er sich nicht von seinem neuen Computerspiel trennen konnte. Nun aber schnell! Fürs Frühstück bleibt keine Zeit. Mit einer Scheibe Brot in der Hand läuft er zum Bus, den er gerade noch erreicht. Ihm fällt siedendheiß ein, dass er die Matheaufgaben noch nicht gemacht hat. Zum Glück ist sein Freund Klaus im Bus, der ihn die Aufgaben schnell abschreiben lässt. Gut sieht es zwar wegen der wackeligen Schrift nicht aus, aber immerhin hat er sie im Heft. In der Mathestunde rügt der Lehrer die verwackelten Zahlen in Timos Heft, was Timo sehr unangenehm ist. Als der Lehrer die neuen Rechenaufgaben erklärt, versteht Timo nichts. Er wird ganz ängstlich und aufgeregt: »Wie soll ich bloß die Mathearbeit schaffen, wenn ich nicht verstehe, wie die Aufgaben gerechnet werden?« Er mag gar nicht daran denken, was seine Eltern sagen, wenn er wieder eine Fünf bekommt. Aber er traut sich nicht, den Lehrer um eine erneute Erklärung zu bitten. Die anderen könnten ihn ja für dumm halten und der Lehrer ist sowieso schon sauer auf ihn. Timo fühlt sich immer unruhiger und unwohler. Als es endlich zur Pause klingelt, fühlt er sich sehr angespannt, aber irgendwie auch abgeschlagen und traurig. Er mag nicht mit den anderen herumtollen und setzt sich in eine Ecke, um mit seinem Handy zu spielen. Nebenbei isst er Süßigkeiten, die er sich zu Hause eingesteckt hat. Als sich ein anderer Junge zu ihm setzt und etwas fragt, reagiert Timo sehr gereizt, so dass es zum Streit kommt. Glücklicherweise klingelt es zur nächsten Stunde, bevor die beiden aufeinander losgehen können. Irgendwie kann sich Timo gar nicht richtig auf den Unterricht konzentrieren, er fühlt sich immer unwohler und bekommt Kopfschmerzen. Als die Schule vorbei ist, geht es durch den hektischen Verkehr der Großstadt wieder nach Hause. Nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben wartet sein Computerspiel schon auf ihn. Da es mit dem Fernsehen doch wieder länger als geplant wird, kommt er erst ziemlich spät ins Bett. Trotzdem ist er sehr aufgedreht und kann schlecht einschlafen ...
Dieser Tagesablauf von Timo ( ▶ S. Timos Teufelskreis) ist natürlich nur ein Beispiel, wie Disstress entstehen kann. Es ist gesundheitlich unbedenklich, wenn Überforderungen nur ab und zu vorkommen, denn das kann der Organismus ausgleichen. Chronischer Disstress ist jedoch problematisch. Die Auswirkungen des seelisch Erlebten auf den Körper sind vielfältig, wobei vor allem das Herz-Kreislauf-System betroffen ist. Es kann zu schnellem Puls (Herzklopfen), unregelmäßigem Herzschlag, Blutdruckveränderungen usw. kommen. Außerdem sind Störungen der Magen- und Darmtätigkeit möglich, was zu entsprechenden Beschwerden führen kann. Eine weitere wichtige Veränderung durch Disstress betrifft die Muskulatur: Es kommt meist zu Muskelverspannungen. Häufig liegt beispielsweise die Ursache für Kopfschmerzen in verspannter Nacken- und Schultermuskulatur, während Rückenschmerzen durch verspannte Rückenmuskulatur zustande kommen.
Eine lang anhaltende Dämpfung des Parasympathikus durch Disstress und damit die Verminderung der aufbauenden und energiegewinnenden Fähigkeiten des Körpers schwächen die Abwehrkräfte und erhöhen allgemein die Krankheitsanfälligkeit. Daher treten bei chronisch überforderten Kindern vermehrt Infekte wie z. B. Schnupfen, Erkältungen, Magen- und Darminfekte auf. Aber auch schwerere Erkrankungen können durch eine Schwächung des Immunsystems begünstigt werden.
Es gibt andererseits Beschwerdebilder, die nicht durch eine Überaktivierung des Sympathikus, sondern durch eine Überaktivierung des Parasympathikus verursacht werden. In diesen Fällen kommt es bei Belastungen nicht zur normalen Stressreaktion, sondern diese bleibt in der Vorphase stecken. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich jemand bei Herausforderungen gar nicht zum Widerstand oder zur Auseinandersetzung mit dem Problem aufraffen kann, weil er zu verängstigt, resigniert oder wie gelähmt ist. Wenn diese Zustände von Hilflosigkeit, Schwäche und Angst häufig und schließlich sogar gewohnheitsmäßig auftreten, kann es durch eine Überaktivität des Parasympathikus zu Störungen der vegetativen Steuerung kommen. Die Folge sind dann Beschwerden wie Schwindelgefühle, Durchblutungsstörungen und Mattigkeit durch Absinken des Blutdrucks, Übelkeit und Verdauungsstörungen durch Verkrampfungen der Muskeln in Magen und Darm sowie Luftnot durch ein Zusammenziehen der Bronchien. Nicht selten treten auch Kopfschmerzen und Neigung zum Erröten auf.
Wie die Fallbeispiele von Tina und Timo gezeigt haben, ist Stress allerdings nicht einfach nur ein äußerer Einfluss. Zwar wirken viele Stressreize wie beispielsweise Lärm, Hektik, Hitze oder ein ungeduldiger Lehrer als äußere Stressoren. Aber auch die Art, wie wir Situationen und Einflüsse interpretieren und mit ihnen umgehen, spielt eine wichtige Rolle dabei, ob wir Eustress erleben oder in Disstress geraten. Während Tina nach Überwindung ihrer Schüchternheit den Lehrer um zusätzliche Informationen bitten und damit ihre Lernblockade beseitigen konnte, war es bei Timo anders: Ihm stand seine Ängstlichkeit oder auch sein falscher Stolz im Weg, sodass er seine Probleme in sich hineinfraß.
Bewältigungsstrategien
Ein Erklärungsmodell für das Zusammenwirken äußerer und innerer Einflüsse auf das Stresserleben stammt von dem amerikanischen Psychologen Lazarus. Ob ein Einfluss als Stressor wirkt, hängt seiner Meinung nach zunächst stark davon ab, wie jemand die Situation wahrnimmt und bewertet. Beispielsweise leiden manche Kinder so unter Versagensängsten, dass sie blockieren, wenn sie vom Lehrer befragt werden, während sich andere Kinder freuen, eine Antwort geben zu dürfen. Eine weitere wichtige Rolle spielen die jeweiligen verfügbaren und genutzten Bewältigungsstrategien. Beispielsweise können bereits Gedanken wie »ich bleibe ganz ruhig« oder »es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten« helfen, mit Schulangst besser zurecht zu kommen. Dagegen verschlimmern »katastrophisierende« Gedanken wie »wenn ich nachfrage, halten mich alle für dumm« Gefühle von Unsicherheit und Angst. Überforderung und Disstress drohen immer dann, wenn ein gestörtes Gleichgewicht zwischen den äußeren Anforderungen einerseits und den subjektiven Bewertungen und Bewältigungsfähigkeiten andererseits besteht. Bei den Bewältigungsfähigkeiten wird zwischen »problemlösender« und »emotionsregulierender« Funktion unterschieden. Problemlösende Strategien beziehen sich auf die konkrete Veränderung einer Situation, beispielsweise durch Veränderung der Zeitplanung, Einhalten von regelmäßigen Lernzeiten, Abbau von Reizüberflutung durch weniger Lärm, weniger Fernsehen, Videospiele usw. Zu problemlösenden Strategien kann es auch gehören, an den eigenen Ansprüchen, Erwartungen, Zielen und Gewohnheiten zu arbeiten, um beispielsweise Selbstüberforderungen abzubauen. Dagegen dienen »emotionsregulierende« Strategien der Kontrolle der körperlichen und psychischen Reaktionen auf Stressbelastungen.
Dementsprechend hat Entspannungstraining eine wichtige emotionsregulierende Funktion und hilft, Stressbelastungen konstruktiv zu bewältigen. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Kind relativ gelassen in Belastungssituationen hineingeht oder ob starke Aufregung leicht zu Lernblockaden führt. Kinder, die Entspannungstraining praktizieren, haben außerdem den Vorteil, dass sie sich auch in einer Belastungssituation entspannen und damit schädlichen Disstress abbauen können. Mit mentalem Training können außerdem ungünstige Einstellungen und Katastrophisierungen verändert werden.
Kinderleicht entspannen
Chronische Überforderung
Disstress begünstigt nicht nur das Entstehen von Beschwerden und Erkrankungen. Chronische Überforderung beeinträchtigt auf jeden Fall zumindest das Wohlbefinden und die Lebensqualität. Überforderte und überreizte Kinder fühlen sich meist unwohl und unausgeglichen. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit in der Schule werden durch Disstress stark beeinträchtigt. Wenn die innere Anspannung zu gering ist (»null Bock«), werden erfahrungsgemäß viele Fehler gemacht. In einer geringgradigen Anspannung – also bei guter Motivation – werden die wenigsten Fehler gemacht, während bei starker Aufregung die Fehlerzahl drastisch ansteigt. Nicht selten reagieren Kinder auf chronische Überforderungssituationen auch mit Gefühlen von Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit und Angst oder reagieren gereizt und aggressiv.
Entwicklungs- und Verhaltensprobleme bei Kindern
Wie bereits betont wurde, ist chronischer Disstress natürlich nicht der einzige verursachende Faktor für gesundheitliche Probleme und Befindensstörungen bei Kindern. Allerdings kommt ihm ein relativ starker Einfluss zu. Ähnlich ist es bei Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Auch hier ist eine Reihe von Einflussfaktoren wie Erbanlage, vorgeburtliche Traumata und Umwelteinflüsse wirksam. Eine wichtige Rolle spielt wiederum chronischer Disstress als mitverursachender oder verschlimmernder Faktor.
Verhaltensstörungen bei Kindern können dahin gehend grob unterschieden werden, ob es sich um »nach innen« (internalisierende) oder »nach außen« (externalisierende) gerichtete Verhaltensstörungen handelt. Angststörungen und depressive Verstimmung werden als »nach innen« gerichtete Störungen bezeichnet. Dagegen gelten Hyperaktivität und Aggression als »nach außen« gerichtete Verhaltensstörungen.
Hyperkinetisches Syndrom
Die häufigste Diagnose bei Kindern ist das hyperkinetische Syndrom, dessen Kernsymptom die Hyperaktivität ist. Die betroffenen Kinder können nicht ruhig sitzen, laufen und springen (zu) viel herum, lärmen und zappeln übermäßig. Es ist nicht verwunderlich, dass es diesen Kindern meist auch schwerfällt, ihre Aufmerksamkeit längere Zeit auf ein Spiel oder eine Aufgabe zu richten.
Glücklicherweise stellt übermäßige Aktivität von Kindern nicht immer eine Entwicklungsstörung dar.
Gerade bei Kindern, die an der Schwelle zur hyperaktiven Störung stehen, ist eine möglichst frühzeitige Verbesserung der Entspannungsfähigkeit durch ein geeignetes Training zu empfehlen. Hierdurch kann der Entwicklung von Verhaltensstörungen vorgebeugt werden.
Aggressives Verhalten
Aggressives Verhalten ist grundsätzlich zur Lebensbewältigung notwendig. Von einer Verhaltensstörung spricht man erst dann, wenn sich Häufigkeit und Intensität deutlich vom Verhalten Gleichaltriger unterscheiden.
Aggressives Verhalten kann sich auf recht unterschiedlichen Ebenen zeigen:
Offen (z. B. Boxen, Treten) oder verdeckt-hinterhältig (Beinstellen,)
Körperlich (Schubsen, Schlagen) oder sprachlich (Anschreien, Verspotten)
Direkt (direkt gegen andere gerichtet) oder indirekt (Türen knallen, Gegenstände zerstören)
Aggressives Verhalten kann sich aber auch gegen die eigene Person richten, z. B. in Form von Nägelkauen, Kratzen, Selbstbeschimpfungen oder Selbstironie.
Angststörungen
Angst hat eine Schutzfunktion. Ängste und Unsicherheitsgefühle gehören bei Kindern zu einer gesunden Entwicklung dazu. Jeder neue Reifungsschritt - Kindergartenbeginn, Einschulung oder die zunehmende Lösung von den Eltern – stellt eine Herausforderung dar, die Angst und Unsicherheit mit sich bringt.
Ist Angst jedoch übermäßig stark ausgeprägt, wird sie zu einem Hemmschuh der persönlichen Entwicklung. Es kommt dann zu vermeidendem Rückzugsverhalten, wodurch Kinder Herausforderungen ausweichen, die ihrer Weiterentwicklung dienen.
Entspannung bei Kindern: Ziele, Möglichkeiten, Grenzen
Wie bereits dargestellt, spielen psychische Belastungen und Disstress bei der Entstehung von körperlichen und psychischen Störungen sowie bei Schul- und Lernproblemen eine große Rolle. Es liegt nahe, dass in der Verbesserung der Entspannungsfähigkeit eine wichtige Möglichkeit liegt, um gesundheitsschädlicher Überforderung entgegenzuwirken, stressbedingten Beschwerden vorzubeugen und bereits eingetretene Störungen zu bessern. Chronische Anspannung kann durch regelmäßig praktiziertes Entspannungstraining abgebaut und Disstress in Eustress umgewandelt werden. Darüber hinaus fördert Entspannungstraining das Wohlbefinden und eine gelassene Lebenshaltung. Da schulische Probleme häufig durch Leistungs- und Prüfungsangst sowie durch Überforderungsgefühle zustande kommen, trägt Entspannungstraining erfahrungsgemäß auch in diesem Bereich zu Verbesserungen bei. Entspannt lässt es sich leichter lernen und Prüfungen werden ohne starke Aufregung besser bewältigt. Untersuchungen zeigen, dass Entspannungstraining zu einer »entspannten Aufmerksamkeit« (»relaxed alertness«) beiträgt, die für schulische Leistungen von großem Vorteil ist.
Seitdem die geschilderten Wirkungen von Entspannungsverfahren wissenschaftlich belegt sind, haben sie bei der Behandlung von Krankheiten sowie beim Abbau von schulischen Problemen an Bedeutung gewonnen. Dabei ist der Gedanke der Selbststeuerung, Selbstverantwortung und Selbsthilfe wesentlich. Das regelmäßige Üben ist im Sinne eines gesundheitlichen Schutzfaktors ein wichtiger eigener Beitrag, um die seelische und körperliche Gesundheit zu schützen und zu stärken.
Verschiedene Methoden
Es wurden verschiedene psychologische Verfahren entwickelt, die zu erholsamer, vertiefter Ruhe führen. In Deutschland ist das Autogene Training nach Professor Schultz am bekanntesten. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Professor Schultz das Autogene Training in den 1920er-Jahren in Deutschland entwickelt hat. Etwa zeitgleich hat Dr. Edmund Jacobson die »Progressive Relaxation« als Entspannungsmethode in den USA vorgestellt, die dort heute einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Allerdings wird das Entspannungstraining nach Jacobson – anders als das Autogene Training – heute kaum noch in der ursprünglichen Form praktiziert. Da es gemäß der Originalmethode recht kompliziert und zeitaufwendig war, sind viele Abwandlungen vorgeschlagen worden. Es wurden auch unterschiedliche Namen für diese Art des Entspannungstrainings genutzt. In Deutschland werden statt des ursprünglichen Namens häufig die Begriffe »Tiefmuskelentspannungstraining (TME)« oder »Progressive Muskelentspannung (PME)« verwendet.
Neben dem Autogenen Training (AT) und der Progressiven Relaxation (PR) gibt es weitere Methoden, die eine vertiefte Entspannung zum Ziel haben: z. B. Funktionelle Entspannung, Yoga, meditative Verfahren und Zapchen. Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse liegen für AT, PR und Yoga vor. Zu dem relativ neuen Verfahren Zapchen gibt es positive Praxiserfahrungen, weshalb es in diesem Buch ebenfalls vorgestellt wird.
Was bewirkt Entspannungstraining?
Obwohl die verschiedenen Entspannungsmethoden auf recht unterschiedlichen Vorgehensweisen beruhen, führen sie zu ähnlichen Ergebnissen. So liegen beispielsweise für Autogenes Training und Progressive Relaxation Vergleichsuntersuchungen vor, die bei beiden Methoden sowohl in körperlicher als auch in seelischer Hinsicht weitgehend ähnliche Veränderungen fanden. Die körperlichen und seelischen Veränderungen, die im Zusammenhang mit einem Entspannungstraining auftreten, werden auch als Entspannungsreaktion bezeichnet.
Körperliche Veränderungen: Wie im Kapitel über Eustress und Disstress ausgeführt wurde, führen Anspannung und Entspannung zu deutlichen Veränderungen von körperlichen Funktionen. Eine wichtige vermittelnde Rolle spielt dabei das vegetative Nervensystem. Zu der bei Entspannungsverfahren auftretenden Entspannungsreaktion gehören u. a. die folgenden körperlichen Veränderungen:
Atmung: verlangsamte, gleichmäßige Atmung, verminderter Sauerstoffverbrauch
Herz-Kreislauf-System: Absinken von Herzfrequenz und Blutdruck (vor allem bei erhöhtem Blutdruck)
Muskulatur: Entspannung der Skelettmuskulatur
Haut: Veränderungen der elektrischen Hautleitfähigkeit
Gehirn: Veränderungen der elektrischen Hirnaktivität (im EEG sind Veränderungen festzustellen, die auf eine geistige Ruhigstellung hindeuten)
Veränderungen in Psyche und Verhalten:Die durch ein Entspannungstraining hervorgerufenen Veränderungen im seelischen Erleben sind individuell sehr unterschiedlich. Allerdings berichten die meisten Übenden – zumindest nach einiger Erfahrung mit dem Training – übereinstimmend von einem als angenehm empfundenen vertieften Ruhezustand. Menschen, die längerfristig regelmäßig mit dem Entspannungstraining üben, entwickeln meist eine zunehmende Gelassenheit.
Veränderungen durch Entspannungstraining können u. a. im Gefühlsbereich, im Denken und in der Konzentrationsfähigkeit sowie im Verhalten auftreten.
Veränderungen im Gefühlsbereich: Intensität von unangenehmen Gefühlszuständen werden gedämpft, Ärger, Wut und Angst abgebaut, angenehme Empfindungen treten in den Vordergrund
Veränderungen der Konzentrationsfähigkeit und des Denkens: Konzentration auf die eigene Person, störende Außengeräusche können ausgeblendet werden
Veränderungen im Verhalten: Verringerung von motorischer Unruhe und Hyperaktivität
Entspannungstraining und Schlaf: