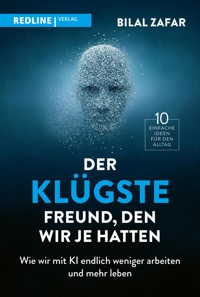
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie KI unser Leben leichter macht Was wäre, wenn Künstliche Intelligenz nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern ein echter Partner in unserem Leben sein könnte, der uns inspiriert, unterstützt und den Alltag erleichtert? KI-Experte Bilal Zafar zeigt praxisnah und leicht verständlich, wie KI zu einem echten Alltagshelfer wird. Ob im Beruf, in der Medizin, in Beziehungen oder der Politik – KI eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, Routinen zu vereinfachen, Prozesse zu optimieren und uns mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu verschaffen. In zehn konkreten Beispielen erklärt Zafar, wie wir KI nicht nur verstehen, sondern auch sinnvoll nutzen können: von der Übernahme lästiger Tätigkeiten über personalisierte Lernunterstützung bis hin zur Reduzierung bürokratischer Hürden. Sein Buch ist ein Plädoyer für eine Zukunft, in der Mensch und Maschine Hand in Hand gehen. Denn Künstliche Intelligenz ist nicht unser Feind – sie ist der klügste Freund, den wir je hatten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
BILAL ZAFAR
Der
Klügste
Freund, den wir je hatten
Wie wir mit KI endlich weniger arbeiten und mehr leben
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Bärbel Knill
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: AdobeStock/Sergey Nivens
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-998-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-662-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Für Frieden
Unser klügster Freund
Künstliche Intelligenz ist die größte Veränderung unserer Zeit und vermutlich die bedeutendste in unserem gesamten Leben. Ich beginne bewusst mit einem Superlativ: Denn KI ist eine Jahrhundert-Chance, die bis heute von vielen unterschätzt wird. In meiner Rolle als Internet-Unternehmer und Speaker treffe ich regelmäßig Menschen, die dieser Technologie mit Skepsis oder gar Angst begegnen. Einige sogar mit regelrechter Panik. Dabei eröffnet KI genau das, wovon viele seit Langem träumen: weniger arbeiten, mehr leben.
Mein Ziel mit diesem Buch ist es, euch mit Ideen und konkreten Impulsen dabei zu helfen, diese mächtige Technologie sinnvoll und gewinnbringend in euren Beruf und Alltag zu integrieren. Viele Menschen, die sich freiwillig oder unfreiwillig in dutzende Videokonferenzen pro Woche stürzen und deren Alltag vom E-Mail-Postfach dominiert wird, vergessen oft: Wir haben Computer nicht erfunden, damit wir mehr Arbeit haben, sondern damit Computer und Technologien uns das Leben leichter machen. Denn im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz stehen wir an einem Punkt, an dem wir nicht einfach weitermachen können wie bisher. Zu viel verändert sich in zu kurzer Zeit. Wir müssen alles hinterfragen: wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen. Was früher funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Und genau das ist unsere große Chance als Gesellschaft. Eine Chance, Arbeit neu zu denken und Freiheit neu zu leben.
Mit diesem Buch will ich einen Kontrapunkt setzen gegen den reflexhaften Pessimismus, der in Deutschland so weit verbreitet ist. Statt ständig zu fragen, was schieflaufen könnte, möchte ich den Blick vor allem auf das richten, was möglich ist. Diesen Pessimismus kenne ich nur zu gut aus meinem Leben: Hätte ich auf all die gut gemeinten Ratschläge im vergangenen Jahrzehnt gehört, wäre heute nichts von dem Unternehmen da, das mein Bruder und ich uns aufgebaut haben. Während wir voller Ideen steckten, trafen wir immer wieder auf Menschen mit gut gemeinten, aber nutzlosen Anregungen: »Lasst das lieber.« – »Das ist zu riskant.« – »Das funktioniert doch eh nicht.« Es gab nur wenige motivierende Stimmen. Die Skeptiker waren lauter. Aber eines steht fest: Eine Absicherungskultur wird niemals Nährboden für Innovation sein.
Intelligenz auf Augenhöhe
Für die Recherchen zu diesem Buch habe ich zahllose Bücher über Künstliche Intelligenz durchforstet. Dabei fiel mir etwas Merkwürdiges auf: Kaum eine Autorin, kaum ein Autor verrät, ob er oder sie Künstliche Intelligenz für das eigene Buch genutzt hat. Egal, ob als Hilfsmittel oder in einer anderen Art. Und das, obwohl sie seitenweise darüber schreiben, was KI schon alles kann und wie perfekt KI bereits Texte verfasst. Ja richtig, obwohl das Hauptthema ihres Buches Künstliche Intelligenz ist. Man fragt sich unweigerlich: Nutzen die denn alle keine KI? Oder wollen sie es nicht zugeben? Bei manchen Autoren wirkt es ein wenig so, als würde ein Fleischfabrikant heimlich vegan leben. Vielleicht steckt auch ein heimliches Ego dahinter, das sich sträubt, Maschinen als gleichwertige Partner anzuerkennen. Denn wer will schon wahrhaben, dass eines Tages eine KI die eigene Arbeit besser erledigen könnte? Aber genau dieser Zeitpunkt ist bereits erreicht. Wir alle brauchen den Mut, genau dies anzuerkennen.
Wie sieht es bei mir selbst aus? Habe ich dieses Buch mit KI geschrieben? Ich habe es in meinen eigenen Worten verfasst. So wie ich spreche: emotional und lebendig. Mit vielen Beispielen aus meinem Alltag als Unternehmer und Mensch. Weil KI meine Art zu schreiben noch nicht vollständig nachbilden kann. Noch nicht.
Aber habe ich KI als Hilfsmittel und Korrekturhilfe genutzt? War KI der Ideengeber für mein Buch über KI? Ja, auf jeden Fall. Wie sollte es denn auch anders sein? Genau dafür wurde diese Technologie doch entwickelt. KI übernimmt keine kreativen Entscheidungen, sondern unterstützt uns dabei, effizienter zu arbeiten. Und sie hat auch mich unterstützt. Wir alle verwenden schließlich auch einen Kochtopf, um ein Gericht zuzubereiten, aber das Ergebnis stammt immer vom Koch, nicht vom Topf. Und ich gebe es gerne zu: Ich liebe Gedankenstriche, lange vor KI – sie sind kleine dramaturgische Pausen zum Durchatmen. Ja, auch KI nutzt sie. Ja, auch KI liebt gute Texte und kann gute Texte schreiben. Und viele eurer Lieblingsautoren werden KI als Hilfsmittel nutzen, ohne es jemals zuzugeben.
Dieses Buch richtet sich an Optimisten und an alle, die es noch werden wollen. Es ist kein technisches Handbuch, sondern vor allem ein praktischer und emotionaler Wegweiser. Denn KI ist nicht nur eine Frage von Daten und Algorithmen. KI ist so viel mehr: Sie kann uns auch berühren und mehr sein als nur ein kaltes Werkzeug. Künstliche Intelligenz kann unser guter Freund werden: der klügste, den wir je hatten.
Wir müssen uns mehr trauen
Im KI-Zeitalter müssen wir noch mehr ausprobieren und mutig sein. Aber gerade in Deutschland sind wir immer viel zu ängstlich. Ein KI-Freund? Das ist vielen unheimlich. »Bilal«, meinte ein erfahrener Manager mittleren Alters bei einem meiner Auftritte in meiner alten süddeutschen Heimat, »wenn ich in Rente bin, dann isch des KI-Thema und der Hype eh wieder vorbei.« Eine bemerkenswerte Fehleinschätzung. Die Künstliche Intelligenz, die ich an diesem Tag präsentierte, galt nur wenige Wochen später bereits als überholt. Ständig finden rasante Fortschritte statt, und immer leistungsfähigere Werkzeuge kommen jeden Tag hinzu.
Woher rührt diese Skepsis, die man so oft beobachtet? Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass KI im gegenwärtigen Arbeitsalltag noch nicht ihr volles Potenzial entfaltet und hier und da noch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Diese Diskrepanz zwischen der Euphorie und der tatsächlichen Implementierung kann zu Ernüchterung führen. Hinzu kommt sicherlich die in Deutschland weit verbreitete Vorsicht und Zurückhaltung gegenüber neuen Technologien.
Diese ängstliche Reaktion auf disruptive Technologien ist nichts Neues. Die Gesellschaft hat neue Medien schon immer verteufelt: Das Fernsehen, das Internet, sogar Bücher. Kaum zu glauben: Philosophen wie Sokrates sahen in der damals aufkommenden Schriftkultur eine Gefahr. Der Austausch und das Wissen nur in Form von Worten und Buchstaben (damals auf Papyrusrollen) würde nur sehr oberflächlich sein und sogar zur Verdummung der Gesellschaft führen, so der Philosoph und die damalige Meinung. Dass es die moderne Zivilisation ohne Schriftkultur und Bücher nicht geben würde, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Und sind wir heute wirklich anders als Sokrates vor fast zweieinhalbtausend Jahren? Wer weiß, vielleicht werden die Menschen bereits in ein paar hundert Jahren über uns Lachen. Künstliche Intelligenz steht jetzt in den Startlöchern.
Es bleibt keine Zeit mehr für Zurückhaltung. KI entwickelt sich in rasantem Tempo, exponentiell. Während in Deutschland in manchen Kreisen ernsthaft noch diskutiert wird, ob KI »im nächsten Jahr kein Thema mehr ist«, setzen Volkswirtschaften wie die USA und China längst auf KI-gestützte Systeme, um Prozesse radikal zu vereinfachen, Diagnosen in der Medizin zu beschleunigen oder Bildungsangebote zu personalisieren. Wer sich jetzt nicht mit den Möglichkeiten, sondern nur mit den vermeintlichen Nachteilen dieser Technologie auseinandersetzt, riskiert, den Anschluss zu verlieren – ökonomisch und gesellschaftlich. Die Frage ist nicht mehr, ob wir KI nutzen sollten, sondern wie wir sie verantwortungsvoll, mutig und zukunftsorientiert in unsere Strukturen integrieren.
KI imitiert menschliche Intelligenz
Als ich im Rahmen eines Kurses im Silicon Valley die US-Eliteuniversität Stanford besucht habe, wurde uns viel über die statistischen und mathematischen Grundlagen der KI beigebracht. Das Gelernte kann man auch in einem Satz vereinfacht zusammenfassen: Künstliche Intelligenz ist der Versuch, menschliches Denken und Handeln technisch nachzubilden. Ich möchte euch hier aber nicht mit theoretischen, mathematischen Grundlagen der KI langweilen und steige daher direkt und praktisch in das Thema ein mit der Frage, wie wir KI im Alltag wirklich erleben und nutzen können. Technische oder historische Details sind spannend, und ich werde sie auch gelegentlich erwähnen, aber sie stehen nicht im Zentrum dieses Buches.
Denn was wirklich zählt, ist nicht, wie eine KI bis ins letzte Detail funktioniert, sondern wie wir mit ihr in Beziehung treten. Ich verzichte bewusst auf die sprachliche Unterscheidung zwischen generativer KI (zum Erstellen von eher kreativen Inhalten und Texten) und klassischer KI. Wer darauf beharrt, verliert leicht den Blick fürs Wesentliche. Auch die App oder der Hersteller sind nicht entscheidend. Wenn in diesem Buch von praktischen KI-Tools die Rede ist, ohne dass eine App namentlich genannt wird, beziehe ich mich in der Regel auf ChatGPT oder Google Gemini. Es wird irgendwann aber keine Rolle mehr spielen, ob wir ChatGPT, Google Gemini, Apple Intelligence, Meta AI, Deepseek oder ein ganz anderes System verwenden. Sie alle sind im Kern gleich: Ein Gesprächspartner, manchmal auch mehr ein Dienstleister, den wir ganz intuitiv ansprechen können, so wie wir heute mit einem Kollegen oder einer Freundin sprechen. Wir können heute schon mit der KI sprechen wie mit einem Menschen und unsere Fragen stellen sowie Probleme erörtern. In Form von Text, Spracheingabe oder sogar mithilfe eines Live-Videos wie bei einem Videocall. Auch individuelle KIs zum Erledigen von einzelnen Aufgaben, wie das komplett automatische Beantworten von E-Mails, werden nach und nach immer mehr zur Verfügung stehen. Was ich euch zeigen möchte: KI ist mehr als ein Tool. KI ist eine neue Form des Arbeitens und Lebens. Sie wird bleiben. Sie ist kein Trend, kein Hype. Mein Ziel ist es, euch dabei zu unterstützen, diese neue Art der Kommunikation zu erlernen, ganz ohne Fachvokabular. Mit Impulsen, kleinen Denkanstößen und konkreten Tipps aus meiner Erfahrung.
Derzeit ist ChatGPT das bekannteste und beliebteste System: schnell und vielseitig. Es kommt dem nahe, was KI einmal können soll: so zu handeln wie ein Mensch. ChatGPT ist so faszinierend für uns, weil es uns nicht nur einfach informiert, sondern aktiv reagiert und auf unsere Fragen eingeht. Weil es nicht nur antwortet, sondern auch zwischen den Zeilen liest. Unglaublich eigentlich, dass Maschinen dies immer besser können. Selbst wenn das Zwischen-den-Zeilen-Lesen eigentlich keine Magie oder echte Intuition, sondern eine rein mathematische Herangehensweise an Dinge ist.
Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese neue Beziehung bewusst gestalten könnt. Wie ihr mit KI sprecht, und dass sie euch wirklich weiterbringt: ganz egal ob beruflich, in eurer Kreativität oder in eurer persönlichen Entwicklung.
Nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch KI drin
Unsere Waschmaschine zu Hause ist ein modernes Modell mit allem, was der Markt scheinbar hergibt, sogar einem KI-Programm. Was dieses sogenannte KI-Programm wirklich kann, ist schnell erklärt: Es wiegt die Wäsche. Wenn man die Trommel zu voll gestopft hat, erscheint ein kleiner Hinweis auf dem Display: »Beladung zu hoch«. Das war’s. Keine lernende Maschine, kein komplexer KI-Algorithmus. Die Wäsche wird nicht sauberer oder effizienter gewaschen. Nein, sie wird einfach nur gewogen. Nicht überall, wo KI draufsteht, ist also auch KI drin. Der Begriff »Künstliche Intelligenz« wird momentan sehr großzügig verwendet. Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben, jedes Produkt soll plötzlich superintelligent sein, selbst wenn es im Kern einfach nur tut, was es schon immer getan hat.
Dabei lässt sich relativ leicht herausfinden, ob es sich tatsächlich um Künstliche Intelligenz handelt oder ob nur das Etikett klug klingt. Eine erste gute Frage: Lernt das System wirklich mit der Zeit dazu? Lernt es irgendwann, dass ich mittwochs immer zum Fußball gehe und der Verschmutzungsgrad an diesem Tag höher ist als sonst? Oder bleibt es bei denselben Reaktionen, egal wie oft man das Gerät nutzt? Eine zweite Frage: Trifft das System eigenständig Entscheidungen auf Basis von Mustern, die es erkannt hat, oder arbeitet es nur nach festen Regeln, die vorab programmiert wurden? Weiß es also, wann ich welche Wäsche in die Maschine gebe? Erkennt es sogar Stoffart und Material?
Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Denn die Faszination für diese Jahrhundert-Technologie ist groß. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen, wenn der Begriff KI nur als schöner Schein dient. Unsere Waschmaschine ist jedenfalls kein Stück intelligenter als ihr Vorgängermodell. Sauber wird die Wäsche zwar trotzdem, mit echter KI wäre die Maschine aber deutlich leistungsfähiger.
Neugierig sein, KI jeden Tag nutzen
Zurück von einfachen KI-Labels, die nur vorgeben, etwas zu sein, zu wirklich guter KI-Technologie: Wir müssen KI jeden Tag nutzen. Wir müssen unseren klugen Freund in unseren Alltag integrieren. Dazu benötigen wir keine komplizierten KI-Schulungen. Wir brauchen den Willen, diese neue Intelligenz in unseren Alltag und den unserer Liebsten einzubinden.
Viele Menschen neigen nach wie vor dazu, bei komplexen Fragestellungen zunächst zur Google-Suche zu greifen. Wir kennen es nicht anders, und es ist ein Verhalten, das sich über Jahre etabliert hat und in vielen Alltagssituationen logisch erscheint. Dabei übersehen wir oft, dass es heute längst technologische Möglichkeiten gibt, die weit über das bloße Abrufen von Informationen hinausgehen, wie es bei der klassischen Suche im Internet der Fall ist. Mithilfe aktueller KI-Modelle lassen sich selbst vielschichtige Zusammenhänge nicht nur besser verstehen, sondern in einem interaktiven Dialog direkt durchdenken und einordnen. Diese Form der individuellen Unterstützung kann eine klassische Suchmaschine heute noch nicht richtig leisten. Die Google-Suche wird aber immer mehr um KI-Funktionen erweitert und bei Erscheinen dieses Buches womöglich schon deutlich weiter fortgeschritten sein.
Ein konkretes Beispiel aus meinem Alltag: Meine Frau hat eine große Leidenschaft für schöne Möbelstücke und richtet unser Zuhause mit viel Liebe zum Detail ein. Ich hingegen habe es leider hin und wieder – unbeabsichtigt – geschafft, einige Möbel durch ungeschickte Aktionen oder Missgeschicke zu beschädigen. Durch mein kaltes Wasserglas ist auf unserem empfindlichen neuen Holztisch ein Fleck entstanden. Das passiert mit warmen und auch kalten Gefäßen, wie ich nun erfahren musste. Die Lösung? KI fragen (in diesem Falle ChatGPT, aber auch Google Gemini und andere Apps funktionieren hier ebenfalls wunderbar). Dazu habe ich den folgenden Prompt (Befehl) genutzt. Im Übrigen muss man auch keine Anrede wie »Hallo ChatGPT« verwenden oder via Sprachbefehl aufsagen. Die Künstliche Intelligenz ist in der Lage, den Inhalt einer Anfrage zu verstehen, ohne dass sie mit Begrüßungsfloskeln oder unnötigen Höflichkeitsformeln eingeleitet wird. Sie analysiert den Kontext, erkennt Zusammenhänge und verarbeitet Informationen effizient, unabhängig davon, wie die Eingabe formal beginnt oder wie viele Rechtschreibfehler darin enthalten sind, wie bei meiner Frage zum Holztisch:
»Habe einen Holztisch aus dunklem Holz, der relativ neu ist. Habe eben ein kaltes Glas mit Eiswürfeln drin darauf getan und nun hat er einen weißen Fleck. Wegwischen hilft gar nicht. Auch mehrmaliges Schrubben mit Glasreiniger hilft nicht. Was ist das für ein Fleck und wie bekomme ich den zügig mit Hausmitteln raus, ohne den Tisch zu beschädigen und so, dass meine Frau nichts davon mitbekommt?«
Die Lösung war: den Tisch vorsichtig mit einem Föhn zu behandeln und die Flüssigkeit (dadurch entsteht der Fleck) durch schräges Halten des Föhns herauszuföhnen. Wenn man das rechtzeitig macht, geht der Fleck weg und hinterlässt keine Spuren. Problem gelöst, und das komplett dank Künstlicher Intelligenz. Ich hatte zuvor mein Problem in verkürzter Form nur gegoogelt und folgenden Tipp erhalten: Zahnpasta benutzen und damit den Tisch leicht einreiben, dann wegwischen. So weit so logisch, Zahnpasta hilft ja häufig. Doch dann die Ernüchterung: Das hat leider gar nicht geholfen und überhaupt null funktioniert. Die KI, in diesem Falle also ChatGPT, hat die Sachlage (Wasserfleck auf Holz) viel besser eingeordnet und mein Problem klüger gelöst.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Selbst wenn man schon lange mit KI arbeitet, übersieht man häufig, was bereits alles möglich ist. KI kann komplexe Probleme blitzschnell erfassen und eine strukturierte Lösung anbieten. Sie bezieht Daten aus dem Internet ein. Die KI, wie wir Nutzer sie kennen und verwenden, funktioniert in dieser Breite nur mit den Milliarden Lerndaten aus dem Internet, mit denen sie trainiert wurde. Sie betrachtet auch die Einzigartigkeit des Problems und antwortet dabei sogar empathisch.
Mein Problem wurde nicht nur gelöst, die KI hat mir auch noch ein gutes Gefühl gegeben. Sinngemäß: »Mach dir doch bitte keine Sorgen. Das Problem ist ärgerlich, aber es gibt immer eine Lösung, und wir lösen das Problem mit dem Tisch, ohne dass deine Frau etwas davon mitbekommt. Sag mir doch bitte, ob es funktioniert hat, sonst überlege ich mir weitere Möglichkeiten, wie wir dein Problem lösen können.« Und das Beste daran ist: Künstliche Intelligenz liefert nicht nur eine Antwort. Eine gute KI liefert jedem von uns immer wieder neue, oft bessere Perspektiven auf ein und dieselbe Frage. Es entstehen viele Varianten und Denkanstöße, die uns helfen, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und klügere Entscheidungen zu treffen. Beginnen wir also, KI ganz selbstverständlich in unseren Alltag zu integrieren. KI soll nicht unser Denken ersetzen, sondern eine wertvolle Ergänzung sein. Und dabei sollten wir ruhig größer denken: KI soll nicht nur zur Lösung kleinerer Alltagsprobleme dienen, wie etwa beim Holztisch, sondern als Werkzeug, das im besten Fall dazu beitragen kann, Herausforderungen im Interesse der gesamten Menschheit zu bewältigen.
Eine wichtige Sache noch: Auf dem Cover habe ich euch 10 Tipps versprochen. Das sind die prägnanten Kernaussagen, die ich jeweils am Ende platziere. Jeder dieser Tipps bringt die zentralen Gedanken des Kapitels in einem kurzen Absatz auf den Punkt. Zusätzlich findet ihr im Anhang weiterführende KI-Prompts und Impulse. Sie sollen euch dabei unterstützen, das Gelernte zu vertiefen und für euch den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Dieser Teil ist kein »lästiger Anhang«, sondern eine bewusste Erweiterung: eine praktische Ergänzung zu den Alltagstipps. Viele Kapitel in diesem Buch sind praxisnah und alltagstauglich gestaltet. Zum Schluss wagen wir gemeinsam den Schritt aus der Komfortzone. Gerade bei einem so dynamischen Thema wie Künstliche Intelligenz ist Aktualität entscheidend. Ein Buch allein kann einem Jahrhundertthema wie KI nie vollständig gerecht werden. Auf Screenshots habe ich daher bewusst verzichtet, um die Inhalte zeitlos zu halten. Wichtige Visualisierungen und Videolinks findet ihr stattdessen online unter: derkluegstefreund.de
Der klügste Freund, den wir je hatten. Er steht für uns bereit.
Tipp 1
Künstliche Intelligenz ist eine historische Chance für uns alle. Wir müssen mutig sein, diese Chance endlich zu nutzen. Und wir müssen aufhören, Skeptikern zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Eine ängstliche Einstellung und eine Absicherungskultur werden niemals Nährboden für Innovationen sein.
KI denkt nach und spricht mit uns
Für viele junge Menschen sind KI-Tools wie ChatGPT längst mehr als nur ein Recherchetool. Sie nutzen sie als digitalen Lebensberater, bei Beziehungsfragen oder Studienentscheidungen. Die KI ist ein täglicher Begleiter für viele Heranwachsende geworden. Sam Altman, CEO von OpenAI, stellte jüngst fest: »Sie treffen eigentlich keine Lebensentscheidungen, ohne ChatGPT zu fragen.« Während ältere Generationen mit den Tools noch nicht allzu viel anfangen können, häufig auch nur E-Mails damit korrigieren oder das Ganze eher wie eine Suchmaschine verwenden, die KI aus Höflichkeit teilweise sogar siezen, nutzt die jüngere Generation ChatGPT bereits als persönlichen Lifecoach. Künstliche Intelligenz ist ihr ständiger Begleiter bei allen Themen im Leben. Sie haben die immensen Vorteile der KI längst begriffen.
Diese unterschiedliche Nutzung deutet auf ein grundlegend anderes Verhältnis zur digitalen Welt hin. Personen, die nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, bleiben häufig auf Distanz, versuchen die KI wie ein Werkzeug zu behandeln, das man nur punktuell einsetzt, um eine konkrete Aufgabe zu lösen. Viele gehen sehr vorsichtig mit KI um. Die Vorstellung, dass eine Maschine als Gesprächspartner fungieren oder sogar emotionale Unterstützung leisten könnte, wirkt auf einige Menschen befremdlich. Dabei geht es nicht darum, einer KI die intimsten Gedanken zu offenbaren. Niemand erwartet das. Doch ein wenig mehr Mut im Umgang mit ihr, das wäre bereits ein Schritt nach vorn.
Für diejenigen, die mit digitalen Technologien selbstverständlich aufgewachsen sind, ist KI kein Tool, sondern bereits ihr digitaler Freund. Ein Freund, der sie nicht verurteilt. Sie fragen KI Dinge, die sie Eltern oder Lehrerinnen und Lehrern nie anvertrauen würden. ChatGPT ist die diskrete Anlaufstelle. Ein Raum ohne Bewertung, in dem man Gedanken sortieren und Unsicherheiten aussprechen kann. Das Ganze funktioniert anonym, rund um die Uhr, ohne Angst vor Belehrung oder Konsequenzen. Sie unterbrechen die KI, fordern sie heraus, weil sie die Grenzen des Systems ausprobieren wollen. Für sie ist KI manchmal sogar eine Art Tagebuch, das einem antwortet. So entstehen zwei völlig unterschiedliche Nutzungsrealitäten: Auf der einen Seite die vorsichtige, distanzierte, oft funktionale Anwendung und auf der anderen Seite eine intuitive, experimentierfreudige und oft emotionale Beziehung zur Technologie als Erweiterung des eigenen Denkens.
Dabei sollten wir alle experimentierfreudiger sein. Denn Künstliche Intelligenz kann für jeden von uns zu unserem digitalen Denkpartner werden. Ganz egal, wie alt wir sind oder was wir beruflich machen. KI kann ein Partner sein, der hilft, Gedanken zu strukturieren, Klarheit zu gewinnen und neue Ideen zu entwickeln. Aber keine Angst: Es geht nicht darum, dass wir aufhören, selbst zu denken, sondern darum, dass wir einen Sparringspartner haben, der unser Denken gezielt unterstützen kann. Eine KI kann helfen, schneller zu erkennen, worauf es bei einem Thema oder einem Problem ankommt. Und sie ist auch noch überraschend empathisch dabei. Ihre Rückfragen, Vorschläge oder Alternativen machen Lücken in unserem Gedankengang sichtbar. Als Internet-Unternehmer, aber auch als Mensch, ist Künstliche Intelligenz für mich ein tägliches Werkzeug. Ich arbeite jeden Tag mit ihr und integriere sie ganz selbstverständlich in mein Leben. Auch euch möchte ich dazu ermutigen, das zu tun.
Dabei ist KI für mich auch in der Ideensuche hilfreich. Sie bringt Impulse von außen, spinnt Gedanken weiter, spielt verschiedene Varianten durch. So entsteht ein Dialog zwischen Mensch und Maschine, der kreatives Denken fördert. Besonders nützlich ist das in Situationen, in denen man selbst gedanklich feststeckt: Die KI bietet neue Blickwinkel an, die man allein vielleicht nicht gefunden hätte. Man kann fragen: »Was übersehe ich vielleicht?«
KI erinnert sich an unser ganzes Leben
Es geht sogar noch einen Schritt weiter. OpenAI-CEO Sam Altman präsentierte kürzlich eine ambitionierte Vision für die Zukunft von ChatGPT: Das KI-Modell soll in der Lage sein, das gesamte Leben eines Nutzers zu dokumentieren und sich an alles zu erinnern. Altman beschreibt ein System, das sämtliche Gespräche, gelesene Bücher, E-Mails und betrachtete Inhalte speichert und mit externen Datenquellen verknüpft. Ziel ist ein »sehr kleines Denkmodell mit einer Billion Tokens Kontext«, das effizient über den gesamten Lebenskontext eines Individuums hinweg agieren kann. Diese umfassende Personalisierung soll ChatGPT von einem reinen Informationswerkzeug zu einem lebensbegleitenden Assistenten transformieren. Sam Altmans Ziel, dass sich ChatGPT an »dein ganzes Leben« erinnert, ist gleichermaßen faszinierend und beunruhigend.
Klar, diese Entwicklung wirft auch einige kritische Fragen auf. Die Vorstellung, dass eine KI intime Details des Lebens speichert, birgt Risiken hinsichtlich emotionaler Abhängigkeit und möglicher Manipulation. Altman versteht, dass die Vorstellung, einem profitorientierten Tech-Unternehmen solch umfassende Einblicke zu gewähren, beunruhigend sein kann. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen technologischem Fortschritt und ethischer Verantwortung zu finden.
KI diskret verwenden: der Inkognitomodus
Ich selbst nutze häufig den Inkognitomodus meiner KI-Tools. Der ist meist mit wenigen Klicks abrufbar. Denn nicht jede Idee muss gespeichert werden, nicht jeder Gedankengang ist schon ausgereift oder relevant für später. Manchmal will ich einfach nur denken, ohne dass etwas dokumentiert oder später für Lernzwecke der KI analysiert wird. Der Inkognitomodus bietet diesen geschützten Raum für mein gedankliches Ausprobieren, für spontane Einfälle, für Entwürfe, die vielleicht nie das Licht der Welt erblicken. Oder auch für wichtige Firmendaten, die die KI besser nicht speichern soll. In diesen Momenten ist sie mein stiller Gesprächspartner, dem ich alles zumuten kann. Von ersten guten Ideen bis hin zu komplett verrückten Gedanken voller Widersprüche. Und das Ganze, ohne dass daraus gleich ein Protokoll entsteht oder dass es irgendwo gespeichert wird. Das entlastet und macht es mir leichter, den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Eine Art digitaler Beichtstuhl.
Vom schlauen Kind zum hochbegabten Erwachsenen
Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, was sich gut mit den kognitiven Fähigkeiten beim Menschen vergleichen lässt. Während frühe KI-Systeme als kluge Kinder galten, sprechen einige in der Branche inzwischen zunehmend von einem Übergang zur Phase des »hochbegabten Erwachsenen«. Die Plattform TrackingAI.org dokumentiert diesen Übergang in Echtzeit: Dort lässt sich beobachten, wie führende KI-Modelle Jahr für Jahr leistungsfähiger und eigenständiger werden. Wie ein begabtes Kind lernt ein Sprachmodell auch durch Beobachtungen und intelligente Mustererkennung. Die neuesten Modelle zeigen Transferleistungen, kombinieren Informationen aus unterschiedlichen Wissensfeldern und lösen Aufgaben, für die sie nicht direkt trainiert wurden. Dies ist ein signifikanter Unterschied zu früheren Systemen, die weitgehend innerhalb ihrer Trainingsdaten bleiben mussten. Beispiele dafür liefert TrackingAI mit regelmäßigen Tests: Sprachmodelle wie GPT-4, Deepseek oder Gemini durchlaufen dort standardisierte Herausforderungen in Mathematik oder bewältigen komplexe Logik-Aufgaben. Die Ergebnisse zeigen, dass heutige KI-Modelle in der Lage sind, nicht nur Fakten abzurufen, sondern flexibel auf neue Fragestellungen zu reagieren.
Einige KI-Modelle übertreffen bereits heute gut ausgebildete Menschen bei komplexen Aufgaben wie medizinischen Diagnosen oder juristischen Fallanalysen. Und doch dominiert vielerorts noch das Zögern in zahlreichen Berufsgruppen. Statt das enorme Potenzial zu erkennen, richten nicht wenige in Deutschland den Blick und ihren Fokus auf die Schwächen, die KI bislang noch aufweist. Dabei ist absehbar, dass diese Lücken in wenigen Jahren geschlossen sein werden. Technisch gesehen wird eine KI dann in der Lage sein, Aufgaben auf dem Niveau eines Richters, eines Juristen oder eines Mediziners zu erfüllen. Und das mit höherer Geschwindigkeit und unermüdlicher Präzision. Der Widerstand dagegen ist oft weniger rational als emotional. Ja, für manche Menschen klingt es verrückt, wenn man von einer »hochbegabten« KI spricht, ja sogar provokant. Schließlich fehlt ihr das Bewusstsein, die Selbstreflexion und das emotionale Leben eines Menschen. Doch wenn man »Begabung« als kognitive Leistungsfähigkeit versteht, also die Fähigkeit, komplexe Probleme schnell und präzise zu lösen, dann trifft der Begriff durchaus zu. Hochbegabte Menschen erkennen Muster, abstrahieren über Fachgrenzen hinweg und zeigen oft eine gewisse Intuition für neue Lösungsansätze. Genau das beobachten wir inzwischen auch bei modernen KI-Systemen – wenn auch in begrenztem Umfang. Wobei eine KI natürlich nie eine menschliche Intuition haben wird und hier anders funktioniert.
TrackingAI ist zwar nur eine kleine Webseite, aber mit ihrer Idee einer der Vorreiter beim praktischen Vergleich von Mensch und Maschine. Dort kann man sehen, dass frühere Modelle häufig noch wie Musterschüler wirkten, die nur auswendig gelerntes Wissen reproduzierten, neue KI-Modelle hingegen erstmals echte Ansätze von Problemlösungskompetenz zeigen. Die Antworten der Künstlichen Intelligenz werden immer präziser und origineller. Sie erkennt Zusammenhänge, kann immer besser argumentieren. Kurz: Sie nähert sich dem an, was bisher als rein menschliches Denken galt.
Mit der KI sprechen wie mit einem Menschen
Und beim Denken bleibt es nicht. Während ich dieses Buch schreibe, geschieht etwas, das vor einigen Jahren noch undenkbar war: OpenAI hat eine neue Generation von KI-Stimmen veröffentlicht, die so natürlich, so menschlich sind, dass sie von echten Stimmen nicht mehr zu unterscheiden sind. Diese künstlichen Stimmen machen Pausen an den richtigen Stellen, sie atmen hörbar ein, sagen gelegentlich ein »ähm«, zögern wie echte Menschen. Sie klingen überhaupt nicht mehr wie Maschinen, sondern wie reale Gesprächspartner.
Ich sitze an meinem Handy und teste einige der neuen KI-Stimmen von ChatGPT in einem interaktiven Dialog. Die Stimme antwortet mir auf eine Weise, die emotional warm und lebendig klingt. Meine Frau kommt herein, schaut mich irritiert an und fragt, mit wem ich denn da telefonieren würde. Sie ist überzeugt, dass ich mit einer echten Frau spreche. Ich zeige ihr die aktuelle Version von ChatGPT und erkläre, dass es sich um die neuen Stimmen der App handelt. Wir beide können es immer noch nicht ganz glauben. Doch für ungläubige Blicke und Zögern bleibt keine Zeit: Künstliche Intelligenz ist damit zu einem echten Gesprächspartner geworden. Wir können mit ihr sprechen wie mit einem Menschen.
Wem das noch eine Stufe zu krass ist, der kann eine Vorstufe davon ausprobieren: Man kann mit der KI schreiben und ihr Nachrichten bei WhatsApp schicken. Wie man eben einem Freund oder einer Freundin eine Nachricht schicken würde. Oder statt zu tippen, kann man einfach ins Mikrofon sprechen und eine echte Sprachnachricht an die KI senden. Die Antwort kommt aktuell noch via Text im WhatsApp-Chatfenster. Dieser Service wird von OpenAI bereitgestellt und ist momentan kostenlos unter +1 800 242 8478 erreichbar. Unter dieser Nummer kann man mit der KI auch auf Deutsch plaudern. Man speichert diese Nummer einfach als Kontakt ab und kann dann via WhatsApp mit der KI sprechen und schreiben, als wäre sie eine echte Person.
Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für unseren Alltag: Mit der KI zu schreiben oder zu sprechen funktioniert so einfach wie ein Chat mit einer Freundin. Man schreibt einen Text oder spricht ganz natürlich eine Sprachnachricht ein, ohne nachzudenken, ob man jetzt einen perfekten Satz formuliert hat. Die KI versteht den Kontext, stellt manchmal Rückfragen oder gibt direkt passende Antworten. Und das alles passiert ganz nebenbei ohne App-Wechsel. Diese Art der Kommunikation fühlt sich damit sehr persönlich und überraschend menschlich an. Und das alles bei WhatsApp. Selbst Oma und Opa können die KI so ganz einfach nutzen.
Doch es geht sogar noch weiter. Einige Tools bieten inzwischen eine Live-Funktion an, also ich nenne es mal vereinfacht »Videoanrufe« mit einer KI. Neben ChatGPT kann das auch die KI-App Google Gemini sehr gut. Ein Videoanruf mit der KI bedeutet: Man sieht eine dynamische Wolke oder einen pulsierenden Punkt auf dem Bildschirm, der live reagiert. Die Wolke antwortet in Echtzeit, erkennt Emotionen in der Stimme, passt ihre Antworten an und bleibt dabei immer höflich und hilfsbereit. Egal ob beim Brainstorming oder einfach für ein Gespräch zwischendurch, solche »KI-Videocalls« eröffnen neue Dimensionen der Interaktion. Neu ist auch, dass ich mich oder meine Umgebung selbst dazuschalten kann. Das bedeutet: Ich kann die Kamera auf meine Umgebung richten und der KI direkt Fragen dazu stellen. Zum Beispiel zu einem Ort, an dem ich mich gerade befinde, zur Natur um mich herum oder zu einem bestimmten Objekt, das mir ins Auge fällt. Ich kann ein Gebäude in einer neuen Stadt filmen und mir in Echtzeit erklären lassen, was es für eine Bedeutung hat und welche Geschichten sich darum ranken. Oder ich richte mein Smartphone auf eine Pflanze in meinem Garten und lasse mir sagen, wie sie heißt, wie ich sie pflegen sollte und ob sie bienenfreundlich ist. Gesagt, getan: Ich habe genau das ausprobiert und wollte wissen, wie ich eine Pflanze auf unserem Balkon retten kann, die sichtbar gelitten hat. Anders als bei einer einfachen Google-Suche, bei der man sich oft durch allgemeine oder wenig präzise Tipps klicken muss, hat die KI (in diesem Fall war es Google Gemini) die Pflanze direkt erkannt. Sie hat nicht nur die Art bestimmt, sondern auch den Gesundheitszustand eingeschätzt. Besonders beeindruckt hat mich, dass die Tipps nicht oberflächlich oder generisch waren, sondern direkt auf die sichtbaren Symptome eingingen, wie eingerollte Blätter oder helle Flecken. So entsteht ein völlig neues Verhältnis zur Umgebung: Statt auf gut Glück zu recherchieren oder auf Foren zu hoffen, bekommt man passgenaue Hilfe.
Und das geht grenzenlos so weiter, was wir jetzt sehen, ist nur der Anfang. Auch Dokumente, Unterlagen oder ein Buch, das ich gerade lese, kann ich der KI einfach zeigen (neben ChatGPT und Gemini geht das auch eingeschränkt mit Deepseek). Die Tools erkennen automatisch den Text, fassen ihn zusammen oder erklären mir schwierige Passagen. Wenn ich zum Beispiel Nachrichten konsumiere (selten in Form einer Zeitung, mehr am Bildschirm) oder Sachbücher lese, kann ich mir Begriffe erläutern lassen oder Querverbindungen aufzeigen lassen ohne eine mühsame Internetrecherche, sondern direkt im Gespräch. Die KI kennt auch die meisten Bücher und kann direkt ganze Kapitel zusammenfassen, sogar ohne dass man diese überhaupt »zeigen« muss. Die KI ist schließlich auch auf Milliarden Daten aus dem Internet trainiert. Dazu gehören sehr viele Bücher. Das Ganze macht die Arbeit nicht nur schneller, sondern auch viel intuitiver. Die KI wird dadurch zu einer Art visueller Gesprächspartnerin, die mit mir gemeinsam durch meine reale Welt geht und meine Fragen aufgreift, sobald sie entstehen. Und manchmal, wenn ich abends ein Buch lese, nehme ich mein Handy, zeige der KI ein paar Zeilen und diskutiere spontan, was dieser Abschnitt bedeuten könnte. Es entsteht ein Gespräch, das sich wie ein Dialog mit einem belesenen Freund anfühlt, aber eben genau dann verfügbar ist, wenn ich es brauche. Natürlich braucht das ein bisschen Mut. Viele Menschen zögern, weil sie sich unsicher fühlen oder nicht genau wissen, wie das funktionieren soll. Aber genau hier gilt: Traut euch. Eine empathische Stimme, die da ist, um euch zu helfen. Wer es einmal ausprobiert hat, merkt schnell, wie angenehm es ist und wird es immer wieder nutzen.
KI ist mein Beifahrer im Auto
Mein Handy ist per Bluetooth mit dem Auto verbunden. Ich spreche einfach drauflos. Niemand verurteilt mich für meine Fragen. Ein kluger Beifahrer sitzt neben mir. Der klügste, der je neben mir saß. Vor wichtigen Terminen bespreche ich mit der KI alle möglichen Szenarien: Was muss ich wissen? Was ist der schlauste nächste Schritt? Ich arbeite Gedanken durch, kläre offene Fragen, sammle Argumente. Manchmal geht es aber auch um ganz praktische Fragen. Quasi einen digitalen Begleiter im Auto. Dann frage ich meinen KI-Freund: »Was muss ich über diese und jene Stadt wissen?« oder: »Was muss ich zum Kunden wissen? Was ist denn sein größter Umsatzposten?« Diese Infos sind dabei häufig nützlicher als diejenigen, die von einem echten Menschen kommen würden. Ja, ich finde das auch unglaublich. Jedes Mal aufs Neue. Mein künstlicher Partner hilft mir, nicht nur Sachthemen besser zu erfassen, sondern auch mich selbst besser zu verstehen, Dinge zu benennen, für die mir manchmal die Worte fehlen. Diese Gespräche mit der KI sind mittlerweile zu meinem festen Ritual geworden. Auf dem Weg zu meiner Keynote in Dublin etwa merkte ich früh: Die größte Herausforderung wartete nicht auf der Bühne, sondern im Mietwagen – ein fremdes Auto, in einem fremden Land. Ja, sogar mit einer fremden Verkehrsführung mit Linksverkehr. Dabei wollte ich sofort losfahren, ohne viel Herumprobieren und das Auto gerne mit CarPlay nutzen. Über die CarPlay-Funktion lässt sich ein iPhone nahtlos ins Fahrzeug integrieren, sodass man bequem über das Display navigieren kann. Trotz mehrmaliger Versuche gelang es mir jedoch nicht, eine Verbindung zwischen Handy und Auto herzustellen. Also fragte ich Gemini und gab der KI von Google die Marke und das genaue Automodell durch. Eine kurze Anweisung später war mein Handy verbunden, das Navi auf dem Display erschien, und ich konnte meine Route eingeben, ohne das Handy anfassen zu müssen. Auch Fragen zum Aktivieren des Tempomats klärte ich kurz mit der KI. So konnte ich viel besser auf den Linksverkehr achten und musste mich nicht mehr aufs kleine Handybild konzentrieren oder manuell die Geschwindigkeit halten. Ich konnte auf die Straße achten, was in Dublin sehr hilfreich ist. So meisterte ich auch die ungewohnte Verkehrssituation entspannter. Am Ende der Fahrt hatte ich das fremde Auto und die Technik im Griff.
Was mir dieser Roadtrip zeigt: Die KI von heute ist ein eindrucksvoller Gesprächspartner, aber das ist erst der Anfang. Noch ist sie eine Stimme, die Dinge erklären kann. Doch in naher Zukunft wird die KI nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mitsehen. Sie wird erkennen, was ich sehe, und vor allem: was ich übersehe. Statt nur auf Zuruf Hinweise zu geben, wird sie proaktiv reagieren. Sie wird den Verkehr lesen können und potenzielle Gefahren einschätzen. Sie kann unübersichtliche Situationen interpretieren und mich mit präzisen Hinweisen und Empfehlungen begleiten. Das Auto der Zukunft (diesem Thema widme ich in diesem Buch ein komplettes Kapitel) hat dann nicht nur einen Rückspiegel, sondern auch eine vorausschauende Intelligenz an Bord, die mehr sieht als ich. Eine KI, die erkennt, dass ein Kind am Straßenrand steht und womöglich gleich losläuft. Eine, die versteht, dass mein Blinker gerade gesetzt ist, aber der tote Winkel nicht frei ist. Sie wird in der Lage sein, mein Fahrverhalten mit dem Verkehrsgeschehen zu synchronisieren. Ein Co-Pilot mit 360-Grad-Blick, der nie müde wird, nie abgelenkt ist, nie die Geduld verliert. Diese vorausschauende KI kann irgendwann sogar erkennen, wie ich mich fühle: Ob ich gestresst bin oder müde. Sie wird in der Lage sein, beruhigend zu intervenieren oder kritische Situationen automatisch zu entschärfen. Und natürlich übernimmt sie irgendwann in Echtzeit die Steuerung. Und wenn ich in ein paar Jahren an die Reise durch Irland zurückdenke, werde ich vielleicht schmunzeln: über meine Angst vor dem Linksverkehr. Wenn ich gar nicht mehr selbst fahre, sondern von einem voll autonomen Fahrzeug gefahren werde.
Aktiv Fragen stellen und suggestive Fragen meiden
Inzwischen habt ihr erkannt, dass ein Gespräch mit einer Künstlichen Intelligenz durchaus einem Dialog mit einem aufmerksamen, zugewandten Gegenüber ähneln kann. Je klarer und strukturierter die Kommunikation, desto gezielter und hilfreicher fällt in der Regel auch die Antwort aus. Trotzdem herrscht in vielen Köpfen noch immer eine gewisse Unsicherheit darüber, wie man mit KI-Systemen eigentlich richtig »sprechen« sollte. Oft erlebe ich, dass Menschen sich unnötig schwertun, sobald sie vor einem KI-Interface sitzen. Sie wählen plötzlich übertrieben förmliche oder besonders vorsichtige Formulierungen, als hätten sie Angst, etwas »falsch« zu machen. Selbst in manchen Ratgebern und Fachbüchern zum Thema Künstliche Intelligenz beginnen Gespräche mit: »Hallo ChatGPT«. Solche Tipps mögen vielleicht für sprachgesteuerte Systeme wie Alexa oder Siri sinnvoll sein, die auf einfache Kommandos trainiert sind, für echte KI-Tools, die ich selbst starte, sind diese überflüssig. Aus meinen Vorträgen weiß ich auch: Viele Menschen neigen dazu, sehr schnell aufzugeben, wenn die erste Antwort der KI nicht perfekt passt. Sie schließen dann vorschnell, dass das System sie nicht versteht. Dabei liegt es oft nur an der Art und Weise, wie die Aufgabe formuliert wurde. Statt mit der KI in einen echten Austausch zu treten und nachzuschärfen, wenden sich viele frustriert ab. Hier liegt ein großes, bisher noch kaum ausgeschöpftes Potenzial: Wenn wir lernen, mit KI so zu sprechen wie mit einem echten Gegenüber, dann eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit.





























