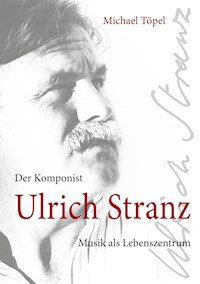
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Es gibt, gerade in der neuen Musik, Tendenzen, das Schlimme, das Hässliche in der Welt aufzuzeigen, die Menschen wachzurütteln - was überhaupt in der modernen Kunst heute der Fall ist (Malerei, Theater). Dadurch bezieht diese Art von Kunst ihre Berechtigung, hässlich, unangenehm zu sein. Meine Musik tut das nicht. Man könnte sagen, ich versuche die Menschen friedlich zu stimmen, ihnen Ruhe zu spenden, damit sie zu sich kommen, sensibel werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ganz persönlich ist Musik für mich das Zentrum des Lebens,
von dem alles ausgeht und auf das alles zugeht.
Ulrich Stranz
Dieser Musik ist der Wunsch eigen, etwas Organisches sprechen und
fließen zu lassen; manchmal verträumt und bereit, eine innere Lichtung
zu betreten, scheint sie eine durchaus nicht modische Liebenswürdigkeit
zum Tönen zu bringen. Nicht fremd ist Ulrich Stranz aber auch kraftvolles
Musizieren sowie die Schaffung komplexer Zusammenhänge,
das Imaginieren von fast Unvorstellbarem.
Peter Michael Hamel
INHALT
Vorwort
LEBEN
1.
Von der Geburt bis zum Abitur
„… kaum, dass er einmal Krähtöne herausbringt.“
Herkunft
Umzug nach Erlenbach
1955: München, Gymnasialzeit
2.
Intermezzo und Studium
Piccolospieler in Uniform
In der Kompositionsklasse von Günter Bialas
Zu zweit
Tonalität
Zeitungsausschnitt mit Folgen
Das wiedergefundene Manuskript
Between
3.
Utrecht
Erfolgreiche DAAD-Bewerbung
Aufbaustudium
Reise zum „Warschauer Herbst“ 1972
Heirat
„Projekt für großes Orchester“
Verlagsbindung
4.
Zürich
Als Geiger in der Camerata
„… mein neuer Wohnsitz …“
Auszeichnungen
Lehrtätigkeit in München und Zürich
Nachwuchsarbeit, Arbeit mit Musikliebhabern
Notengrafik
Freundschaften, Verbunden-sein
Ballettmusik
Titelsuche und -wahl
Betrachtungen ausgewählter Werke
Krankheit
Nachrufe
TEXTE
Einleitung
5.
Vorträge, Selbstportraits, zum Metier
[Über das Kommentieren der eigenen künstlerischen Arbeit]
Clemens Kühn im Gespräch mit Ulrich Stranz
Warum Oper?
Ist Komponieren lehrbar/lernbar?
Fragen an junge Komponisten
Ad multos annos, liebe Camerata!
Gesunde Ernüchterung
Auf meinem Schreibtisch
Selbstportrait
[Statement über das eigene Schaffen]
Annäherung und Entfernung, oder: Der Weg als Ziel
Am dünnen Faden
[Über alte Musik]
Vortrag über „Auguri“ und über die „Musik für Klavier und Orchester“ [Nr. 1]
[Über das Metier]
Über Kollegen, Weggefährten über Ulrich Stranz
Peter Michael Hamel: Über Ulrich Stranz
Ulrich Stranz: Über Peter Michael Hamel
circulus vitiosus [Ulrich Stranz über Peter Michael Hamel]
circulus pseudo-logicus [Peter Michael Hamel über Ulrich Stranz]
…lebt da einer in all dem den Idealen… [Ulrich Stranz über den Dirigenten Räto Tschupp anlässlich seines 70. Geburtstages am 30. Juli 1999]
Wilhelm Killmayer über Ulrich Stranz [1976]
Wilhelm Killmayer über Ulrich Stranz [Undatiert, wahrscheinlich 1980er Jahre]
Wilhelm Killmayer: Laudatio auf Ulrich Stranz [anlässlich der Verleihung des Gerda- und Günter-Bialas-Preises 2000]
Ulrich Stranz: Dank [für die Verleihung des Gerda- und Günter-Bialas-Preises 2000]
Werkkommentare
diversono
nicht mehr-noch nicht
Tachys
Déjà vu
Innenbilder
Klangbild
C-Cis-Laute
Erstes Streichquartett
Zeitbiegung
Trio d’anches
Musik für Klavier und Orchester [Nr. 1]
Zweites Streichquartett
Contrasubjekte
Szenen für Orchester
Auguri
Sieben Feld-, Wald- und Wiesenstücke
Janus
Cinq Moments musicaux
Trio für Violine, Violoncello und Klavier
Meditation (aus: Sechs Skizzen für Klavier)
Überwindung
Doppelkonzert
Erste Sinfonie
Bläserquintett
Coniunctio
Serenade
Musik für Klavier und Orchester Nr. 2
Streichquartette [Konzertmoderation]
Selbstgespräch
Aus dem Zusammenhang
Durchquerung
Der Sinn des Lebens
Cello mit acht Saiten (Interview über „Musik für zwei Violoncelli und Orchester“)
Vier Intermezzi für Streichquartett
Anstieg-Ausblick (Interview)
Aus den analytischen Schriften
Vom Rand in das Innere. Zu Wilhelm Killmayers „The woods so wilde”
Nachwort
Diskographie (Auswahl)
Online zugängliche Stranz-Werkverzeichnisse
Über den Autor
Notenanhang
Ulrich Stranz: Klavierstück
Kommentar zum Notenanhang
VORWORT
Dieses Buch soll an den Komponisten Ulrich Stranz (1946-2004) erinnern. Er gehörte zu den schöpferischen Naturen, die bereits verhältnismäßig früh mit erstaunlich ausgereiften Werken und mit stupendem handwerklichem Können auf sich aufmerksam machen konnten. Schon sein erstes Werk für großes Orchester, das 1974 mit 28 Jahren komponierte „Tachys“, bietet in der ganz allmählichen Veränderung der Satzdichte einen eindrucksvollen Beleg für seine Arbeit mit unterschiedlichen Pinselstärken – von der durch einen Einzelton und seiner Aura musikalisierten Zeit bis zur al-fresco-Klanggeste mit rhythmisch subtil gestalteter Innenbewegung reichend. Seine Partituren schrieb er nur selten mit leichter Hand. Anflügen traumwandlerischer Sicherheit für ein rasches, spontaneistisches Komponieren stand er fern und verschwieg nicht die Anstrengungen, die Unwägbarkeiten des Metiers. Ganz im Gegenteil! Er selbst hatte das Komponieren einmal als Vergnügen bezeichnet, doch hat es gewiss Phasen gegeben, in denen er es selbst auch als Passion erlebt hat, wobei „Passion“ in der mehrfachen Deutbarkeit des Wortes gesehen werden muss. Der von ihm im Zusammenhang mit Formulieren von Musik wiederholt benutzte Begriff „Kampf “ lässt hier einiges ahnen. Immer wieder schildert er in seinen diversen Werkkommentaren, Vorträgen und Interviews die – letztlich wohl notwendigen – Zweifel und Ungewissheiten über die endgültige Form und Gestalt einer zu komponierenden Musik. Diese Dokumente bestechen häufig durch exzellent formulierte Gedanken über den an sich nicht verbalisierbaren Vorgangs des Komponierens. Sie verbinden sich beim Lesen zu einem Blick in die kreative Werkstatt eines sehr skrupulös und reflektiert arbeitenden Komponisten, dessen abgeschlossenen Werken man ihren sehr verletzlichen Entstehungsprozess nicht mehr anmerkt. Er selbst sah sich wohl auch als ein Auf-dem-Weg-Gehender: Unterwegs auf seinem ganz eigenen Weg, den er als „Wünschelrutengang“ bezeichnete. Die entscheidende „konstruktive Leitidee“ für das in Arbeit befindliche Werk galt es zu finden. Da neben seiner Musik auch seine Texte so sehr viel über ihn aussagen, aber – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht oder ansonsten nur schwer zugänglich sind, werden sie in diesem Buch abgedruckt, wo nötig, mit kurzen Erläuterungen versehen.
Mit einigen Betrachtungen ausgewählter Werke soll seine Musik gewürdigt und zu ihrem erneuten Spielen und Hören angeregt werden. Es ist Musik die anrühren kann und – in vielen seiner Kompositionen – eine bereichernde Verbindlichkeit, eine selbsterklärende Fasslichkeit besitzt, ohne dass sie sich dem Publikum je anbiedert.
Ulrich Stranz war ein weltoffener, von sehr unterschiedlichen Menschen sowohl charakterlich als auch künstlerisch geschätzter und verehrter Vollblutmusiker! Für ihn stand zwar immer das Komponieren im Zentrum, doch hat er über Jahrzehnte auch als Geiger in verschiedenen Berufs- und Liebhaber-Orchestern sowie als Pädagoge gewirkt, wodurch sich so mancher Kontakt ergab. Aus manchen Kontakten erwuchsen Freundschaften. Aus ihnen ergaben sich auch kompositorische Anregungen oder mitunter sogar Kompositionsaufträge. Sein von ihm mit Konsequenz, absoluter Lauterkeit und Authentizität beschrittener Lebensweg mit vielen Erfolgen ist beeindruckend. Wie fast jeder Mensch musste auch er Enttäuschungen, Schicksalsschläge, Krankheiten und Widerstände ertragen: Es bot sich ihm nicht die erhoffte Absicherung durch eine feste Hochschulstelle, auch Widerstände gegen einzelne Werke, etwa gegen seine „Musik für Klavier und Orchester“ (Nr. 1) bei ihrer Uraufführung in Donaueschingen, musste er hinnehmen. Aus diesem Leben einiges zu schildern, auch mithilfe von Dokumenten und Selbstzeugnissen sowie Abbildungen, ist das Anliegen des ersten Teils dieser Monographie, während der zweite Teil eine weitgestreute Auswahl seiner schriftlichen Selbstzeugnisse und einige Texte von Weggefährten über ihn versammelt.
Er schreibt in seinen Texten wiederholt über seinen verehrten Lehrer Günter Bialas, wie dieser dem Studenten immer auf gleicher Augenhöhe begegnet ist. Auch Ulrich Stranz selbst zeichnete diese insbesondere unter Künstlern nicht allzu häufige Charakterstärke aus: Man ging einfach gern mit ihm um, er konnte durch sein breites Spektrum an Gesprächsthemen sein Gegenüber für sich gewinnen, sein feiner, nie verletzender oder auf Kosten anderer abzielender Humor bleibt unvergessen. Er war alles andere als ein ausschließlich auf Musik beschränkter Mensch: Noch jetzt bereite ich einige Gerichte gemäß seiner praktischen Anleitung zu. Er wusste ebenso seinen stotternden Bootsmotor wieder flott zu bekommen. Die Freude an der Natur, am Draußen-sein, das Genießen des Wassers aber ebenso der Gebirgslandschaft, darüber hinaus aber auch das Interesse an technischem Equipment neuester Bauart, etwa an Computern oder Notensatzprogrammen, stehen für den weiten, in vielerlei Hinsicht gewiss auch genussvollen Blick auf seine Umgebung! Diese Weite mag mitunter auch die Fokussierung auf das unter immer größerem Zeitdruck abzuschließende Werk nicht erleichtert haben. Obgleich er tagtäglich viele Stunden in seinem Kompositionsstudio zugebracht hat, machte es ihm sein gewissenhaft-zögerliches Arbeitstempo nicht eben einfach. Dies beschreibt er in einem seiner Texte: „Da ich ziemlich langsam komponiere, gerate ich gegen den Lieferungstermin vor einer Uraufführung hin fast regelmäßig in Zeitnot.“
Über viele Jahre bin ich als Lektor für neue Musik im Bärenreiter-Verlag auch für Ulrich Stranz zuständig gewesen. Gern erinnere ich mich an redaktionelle Treffen mit ihm im Studio in der Zürcher Bergstraße, die immer sehr effizient waren. Auf diese effiziente Arbeitsphase folgte dann regelmäßig der bereichernde Genuss eines anregenden Austausches, wobei es auch sehr humorvoll zugehen konnte! Eines Abends, nach getaner Arbeit, lotste er mich in eine Bar am Römerplatz. Sie schien einem Gemälde von Edward Hopper entsprungen zu sein. Es war das Lokal, in dem, wie er berichtete, auch Elias Canetti häufig verkehrte, der eine Straßenecke weiter wohnte. Wir hofften, ihn dort zu treffen, doch leider war er an jenem Abend nicht da. Dann fragte Ulrich Stranz die Kellnerin, was sie von Canetti halte. Die junge Frau interpretierte diese Frage weniger auf sein literarisches Werk als auf ihre persönlichen Begegnungen mit ihm bezogen. Sie atmete tief ein, um sich zu sammeln, dann resümierte sie: „Er ist ein sehr alter und sehr, sehr weiser Herr,“ mit erfreuter Miene ergänzte sie, „der immer ein gutes Trinkgeld gibt!“ Wir haben uns über dieses wunderbar ehrliche Urteil amüsiert. Nach dieser Dienstreise, zog ich selbstverständlich ein Buch von Canetti aus dem heimischen Bücherregal, begleitet von einem erinnernden Lächeln.
Ulrich Stranz’ Musik wird nur noch sehr selten aufgeführt – was für ein Kontrast zu der erstaunlich langen Liste von Orchestern und Ensembles, die seine Musik einst gespielt haben! Man sollte sich davor hüten, die Bedeutung oder den Wert eines Komponisten und seiner Werke daran zu messen, welche Aufführungsquote sie im öffentlichen Musikleben haben, welchen Rang sie bei der Mainstream-Konzertprogrammierung einnehmen. Ohne hiermit direkte Vergleiche zu Ulrich Stranz oder zwischen den nachfolgend genannten Namen untereinander ziehen zu wollen: Es gibt viele unumstritten hochbedeutende Persönlichkeiten, deren Werke man viel zu selten im Konzert erleben kann. Wann hört man heutzutage noch Musik von Wilhelm Killmayer, von Günter Bialas oder von Karl Amadeus Hartmann? Andere Komponisten sind weltberühmt, aber de facto nur mit sehr wenigen oder gar nur mit einem einzigen Werk – etwa Carl Orff und Max Bruch. Auch in der gehobenen Unterhaltungsmusik gibt es das: Von Kurt Noack wird nur noch „Heinzelmännchens Wachtparade“ gespielt, ein Stück, das Stranz im Übrigen geschätzt hat. – Viele Komponisten erleben es immer wieder: Ihre Werke werden programmiert, aber vor allem das Neueste aus ihrem Schaffen. Da sie weiterhin Neues produzieren, bleiben sie immerhin damit in den Konzerten präsent. Noch! Es führt zu weit, hier nach den Gründen für dieses Phänomen zu suchen. Vermutlich gehört aber das Schielen nicht weniger Veranstalter nach einer Ur- oder zumindest Erstaufführung in ihrem Programm dazu, wenn sie zeitgenössische Musik spielen lassen. Vor 30 Jahren entstandene Werke eines noch lebenden Komponisten haben es meist deutlich schwerer als seine neuen Arbeiten.
Karl Amadeus Hartmann schrieb 1957 in seinem Aufsatz „Warum ist Neue Musik so schwer zu hören?“: „Niemandem steht ein Urteil zu über den endgültigen Wert des noch Werdenden. Was ein Zeitgenosse 1913 über Strawinskys ‚Sacre‘ schrieb: ‚In Wirklichkeit hat das mit Musik in dem Sinne, wie die meisten unter uns dies Wort verstehen, gar nichts zu tun…‘, sagt nur etwas über eine Zeit, aber nichts über das Werk. Erst die vergangene Zeit, die Geschichte, entscheidet über Bleiben oder Vergessen-werden.“ Aus dem In-Vergessenheit-geraten könnten manche vielleicht Rückschlüsse auf den momentanen „Marktwert“ ziehen, doch der hat sich schon immer als eine problematische und inkonstante Messgröße in allen künstlerischen Disziplinen erwiesen.
Aus seinem Aufsatz anlässlich des 70. Geburtstags des Dirigenten Räto Tschupp kann diese auf den Jubilar gemünzte, fein formulierte Beurteilung auf Ulrich Stranz selbst, den vor nunmehr 75 Jahren Geborenen, Anwendung finden, auch dies ein Zeichen von Freundschaft: „Unauffällig, ohne falsche Attitüde, lebt da einer in all dem den Idealen von Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit nach.“
DANKSAGUNGEN
Mein herzlicher Dank gilt allen, die in sehr unterschiedlicher Weise zur Realisierung dieses Buches beigetragen haben; dies geschah durch großzügige Spenden oder durch wertvolle Hinweise, durch Antworten auf meine diversen biographischen, werkbezogenen oder zeitgeschichtlichen Fragen, durch die Erlaubnis zum unentgeltlichen Abdruck von Texten oder Bildern, durch institutionelle oder durch anderweitige Unterstützung, durch das Besorgen von Dokumenten, die teilweise an entlegenen Stellen aufgespürt werden mussten, oder aber auch durch freundschaftliche grafikdesigntechnische Hilfe sowie allgemein durch motivierenden Zuspruch von vielen Seiten!
Torbjörn Bergflödt (Interviewpartner von U. Stranz)
Dr. Jürgen Brandhorst (GEMA-Stiftung)
Jan Baruschke (DOMINO Medienservice, Lübeck, er gestaltete dieses Buch)
Hans Heinrich Coninx
Dr. Urs Fischer (Zentralbibliothek Zürich, Musikabteilung)
Prof. Dr. h. c. Peter Michael Hamel
Dr. Peter Hanser-Strecker
Dr. René Karlen (Stadt Zürich)
Martina Killmayer
Renate Kohwagner-Zirkel (Bayerische Akademie der Schönen Künste)
Ernst Langmeier
Ljuba Manz
Dr. Gabriele Meier
Irene Meier, geb. Stranz
Christopher Peter (Schott Verlag)
GV Ruzio (†)
Angelika Salge (Zentralbibliothek Zürich, Musikabteilung)
Prof. Hansjörg Schellenberger
Leonhard Scheuch (Bärenreiter-Verlag)
Christoph Schlüren
Beat Schwarz
Esther Schoellkopf Steiger und Prof. Peter Steiger
Prof. Kurt Suttner
Kitty Weinberger (†)
Ganz besonders danke ich Isabella Stranz! Ohne ihre Anregung, ohne ihre intensive motivierende Begleitung und vor allem ohne ihre vielen Antworten auf meine Fragenlisten hätte dieses Buch nicht entstehen können.
Lübeck, im Frühjahr 2021
Michael Töpel
Leben
1 VON DER GEBURT BIS ZUM ABITUR
„… kaum, dass er einmal Krähtöne herausbringt.“
Ein Glücksfall! In Ulrich Stranz Nachlass findet sich der Kohlepapier-Durchschlag eines mit Schreibmaschine getippten Rundbriefes seiner Eltern über die Umstände seiner Geburt und seiner ersten Lebenstage:
„Familie Wilhelm Stranz
Schönberg üb. Mühldorf (Obb.)
Schönberg, den 21. Mai 1946
Ihr Lieben!
Unser kleiner Stammhalter ist angekommen. Ulrich heißt er; fürs erste wird er Uli genannt. Eigentlich war er ein bisschen voreilig, weil er 8 Tage früher ankam als er angemeldet war. Am 10.5.46 um 5 Uhr 5 Minuten war er schon da, nachdem seine Mutti gerade vor einer Stunde ins Krankenhaus zu Neumarkt-St. Veith in Oberbayern gebracht worden war. Das ging alles so glatt und schnell, weil ein tüchtiger Arzt und eine gute Hebamme zur Stelle waren, sonst hätte der Kleine seiner Lage entsprechend doch größere Schwierigkeiten gemacht. […] Als Schreihals hat er sich überhaupt noch nicht hervorgetan, kaum, dass er einmal Krähtöne herausbringt. Er verspricht somit ein ziemlich Ruhiger in seiner Art zu werden, wenn auch die Ärmchen, sobald er wach wird, ziemlich viel in Bewegung sind und seine blauen Äuglein schon herumwandern, als wollten sie alles erfassen, was rundherum geschieht. […]“
Die Geburtsurkunde zeigt, wie in einer erzkatholisch-konservativen Region Bayerns während der unmittelbaren Nachkriegszeit dem Evangelisch-Lutherischen die Anerkennung als eine dem Katholischen gleichgestellte Konfession verweigert wird, zugleich ist es ein Dokument der Abgrenzung gegenüber andersgläubigen Flüchtlingen: Ulis evangelisch-lutherische Mutter wird bloß als „gottgläubig“ eingestuft.
Abb. 1.1: Geburtsurkunde von Ulrich Wilhelm Stranz
Uli wird zwar katholisch getauft, doch konvertieren sein Vater und er selbst vor seiner Kindergarten- und Schulzeit zum evangelisch-lutherischen Glauben, denn seine Eltern wollen eine Kindergarten- und Schulerziehung durch katholische Ordensleute verhindern. Er tritt in den 1970er Jahren in Zürich aus der Kirche aus. Der Austritt befreit ihn nicht von der Kirchensteuer.
Herkunft
Seine Eltern arbeiten in Berlin, wo sie sich in den späten 1930er Jahren kennenlernen. Die Mutter hat dort eine Anstellung als kaufmännische Bürokraft, zuvor hatte sie in Bautzen und Zittau gelebt, der Vater ist als Diplom-Kaufmann tätig, nachdem er zuvor eine Ausbildung zum Schiffsbauer absolviert hat. Im August 1939, nur ein paar Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, heiraten sie in der Hauptstadt. Beide sind gleichaltrig – Jahrgang 1909 –, Helene Stranz, geb. Vater, stammt aus Bautzen (†29.07.2005 in Bad Aibling), Wilhelm Stranz ist gebürtiger Kölner († 27.07.1980 in München).
Die Mutter kann sich im Februar 1945 von Berlin aus nach Oberbayern durchschlagen, wo der Vater seit einiger Zeit bereits in einem Rüstungsbetrieb dienstverpflichtet ist, zuvor war er Soldat an der Ostfront und dort u. a. auf der Krim stationiert. In Schönberg bei Mühldorf in Oberbayern, weit entfernt von allen Verwandten, finden die Eltern nach dem Kriegsende eine sehr bescheidene Unterkunft in einem Bauernhaus, wo sie sich als zwangseinquartierte Flüchtlinge mit den übrigen Bewohnern trotz der offen gezeigten Ablehnung – so gut es geht – zu arrangieren versuchen. Obwohl sie auf dem Lande leben, ist die Versorgung mit Lebensmitteln bemerkenswert karg. Die Bauern gewähren dem Ehepaar Stranz überwiegend nur Buttermilch, kaum Vollmilch. Dieser Zustand bleibt auch noch nach der Geburt des Sohnes bestehen. Wahrscheinlich ist es auf mangelhafte Ernährung zurückzuführen, dass der kleine Uli mit seiner Zunge immer wieder Kalk von den Wänden des Bauernhauses schleckt.
Abb. 1.2: Uli mit seiner Mutter. Rückseitig von ihr beschriftet: „Erinnerung an Kirchweih in Schönberg am 20.10.46“
Zu den Großeltern mütterlicherseits, die in Bautzen leben, gibt es einen engen Kontakt, doch wird er später durch die deutsche Teilung erheblich erschwert. Nach dem Ableben des Großvaters wird die Großmutter in den Westen geholt, wo sie bis zu ihrem Tod bei Familie Stranz lebt. Der Großvater ist ein musischer Mensch, er malt Bilder, die auch in Ulis elterlicher Wohnung hängen. Vor allem ist er sehr musikalisch. Ohne je eine fundierte Ausbildung erhalten zu haben, beherrscht er verschiedene Instrumente immerhin so gut, dass er als vielseitiger Musikant mit Tanz- und Volksmusik auf Festen und Hochzeiten spielt.
Umzug nach Erlenbach
1948 verbessert sich die Situation ganz erheblich, denn der Vater bekommt eine vergleichsweise gut bezahlte Anstellung als Kaufmann in einer Glanzstofffabrik in der Nähe von Aschaffenburg. Die Familie zieht nach Erlenbach am Main, wo sie zur Miete in einem kleinen Reihenhaus wohnt. Uli berichtet später von einer glücklichen Zeit in diesem Ort, wo auch seine Liebe zum Wasser erwacht. Als besondere Abenteuer erlebt er die Paddeltouren zusammen mit seinem Vater auf dem Main im Klepper-Faltboot. In Erlenbach wird im März 1951 die Schwester Irene geboren, mit der er sich sehr gut versteht. Er erweist sich eher als ein „Mamakind“, Irene ist dagegen ein ausgeprägtes „Papakind“. Im Frühling 1952 wird Uli in Erlenbach eingeschult, wobei die Eltern Wert auf die nicht-konfessionelle Ausrichtung der Grundschule legen.
Abb. 1.3: Einschulung in Erlenbach 1952, seinerzeit noch zu Ostern
Er geht gern zur Schule und das Lernen fällt ihm leicht, seine Zensuren sind trotz verhaltenen Fleißes gut, zumindest in der Grundschule. Selbstverständlich gehört schulisches Musizieren, auch auf der Blockflöte, zum Lehrplan. In der Familie fällt sein leidenschaftliches, intonationssicheres Pfeifen auf. In einem Gespräch mit Christoph Schlüren berichtet er im Jahre 1996 über frühe musikalische Prägungen: „Ich hörte mit größter Freude Radio, egal welche Musik. Irgendwann wurde mir dann bewusst, dass hinter all dieser Musik Menschen stecken, die sie geschaffen haben. Das bewunderte ich unendlich, dass einer etwas so Schönes und Vollendetes machen kann.“1 Außerdem liebt er das Zeichnen, auch später erweist sich immer wieder seine überdurchschnittliche Handfertigkeit in dieser Disziplin, die sich schon früh in einigen Comics zeigt.
Sein Vater gehört der Wandervogelbewegung an, er singt gern und sehr ausdrucksvoll, wobei er sich selbst auf der Gitarre begleitet. Im Hause Stranz genießt die Musik, vor allem alles, was pauschal unter dem Sammelbegriff „Klassik“ verstanden werden kann, einen hohen Stellenwert: Man hört häufig Schallplatten und zählt zu den regelmäßigen Konzertbesuchern, vor allem seit dem Umzug nach München.
1955: München, Gymnasialzeit
1955 erhält Ulis Vater eine Stelle als Prokurist in einem Münchner Pharmazieunternehmen. Es hat seinen Sitz in einem Hochhaus in der Schwabinger Leopoldstraße. Erneut steht für die Familie ein Wechsel an, jetzt in die bayerische Hauptstadt mit ihrem im Verhältnis zu Erlenbach unendlich reicheren kulturellen Leben und Angebot, was sich für Ulis umfassende Ausbildung als großer Gewinn herausstellt. Die Eltern unterstützen seine musikalische Begabung, die sich schon in Erlenbach andeutet. Mit zehn Jahren erhält er in München seinen ersten Musikunterricht, eine selbst für damalige Zeiten ein wenig „schrullige“ Art der Unterweisung bei einem Privatmusikerzieher namens Schick, einem absoluten Wagnerianer mit einem Hund namens „Wotan“ und mit Kindern, die ebenfalls wagnerinspirierte Namen tragen. Sehr anschaulich beschreibt Ulrich Stranz dessen spezielle Art des Unterrichts:
„1956 kam ich, als Zehnjähriger, zu meinem ersten Geigenlehrer. Zusammen mit seiner Frau führte er in einem kleinbürgerlich-proletarischen Vorstadtviertel von München, wo ich mit meinen Eltern lebte, eine von zahlreichen Schülern besuchte private Musikschule. Neben Geige unterrichteten die beiden Cello, Klavier, Akkordeon, Gitarre und Zither, vielleicht auch noch anderes, das mir entgangen ist.
Das Zimmer, in dem ich meine Lektionen erhielt, wurde mehr oder weniger ausgefüllt von zwei Konzertflügeln, drapiert mit schweren Teppichen, und von einem großen Wandschrank mit Glastüren, durch welche der Blick auf eine Sammlung wertvoller Geigen fiel. Letztere war beliebter Gesprächsstoff, wenn es zu einer Abschweifung oder Unterbrechung im Unterricht kam, was meist in ursächlichen Zusammenhang mit dem Wiederanzünden des ausgegangenen Zigarrenstummels stand. An den Wänden war kaum ein Platz frei, an dem nicht ein Bild oder Plakat hing. An die Motive erinnere ich mich nicht mehr genau, neben Landschaften in Öl kommt mir aber noch deutlich eine Reproduktion eines R.-Wagner-Portraits in den Sinn. Alles in allem hatte die Räumlichkeit einen gewissen Höhlencharakter und wirkte sehr düster.
Eine düstere Erscheinung war, allerdings nur äußerlich, auch mein Lehrer. Im wie wettergegerbt wirkenden Gesicht prangte ein riesiger Schnauzbart, das Haupthaar des damals wohl an die Sechzig gehenden Mannes war noch voll und, wie der Schnauz, rabenschwarz. Dagegen lässt sich sein Gemüt aus der zeitlichen Ferne nicht mehr so einfach erfassen. Das Spektrum meiner Erinnerung reicht von Herzlichkeit, Wärme und echter Anteilnahme bis zu angeberischem Gebaren und Intoleranz gegenüber letztlich weit überlegenen Musikerpersönlichkeiten, deren Namen meine Eltern und ich von den Hüllen unserer Schallplatten kannten und ab und zu uns Gespräch brachten.
Allzu viele Details des Unterrichts sind mir nicht meinem Gedächtnis hängen geblieben. Immer wieder wurde an der Bogenführung gearbeitet. Die stereotype Forderung, mit viel Druck möglichst nahe am Steg zu streichen und das klanglich hässliche Ergebnis meiner diesbezüglichen Bemühungen stoßen mir, nach Jahrzehnten, gerade zum ersten Mal wieder auf. Was heutige Didaktiker sich die Haare raufen ließe, mir letztlich nicht im Geringsten geschadet hat, war das Vorgehen meines Lehrers in den etwa ersten zwei, drei Monaten, nachdem er mich, nach ausgiebiger Gehörprüfung, zu sich genommen hatte. Eine Dreiviertel-Geige und ein Bogen waren erworben und warteten auf mich und ich auf sie. Doch bevor mir erlaubt wurde, diese verlockenden Dinge auch nur in die Hand zu nehmen – unerlaubt tat ich’s zu Hause natürlich trotzdem, hatte ich einen Grundkurs in Theorie zu absolvieren, der von der Begegnung mit der Notenschrift über den Quintenzirkel und die Intervalle bis an die Grenze der Harmonielehre reichte. In diesen damals von mir quälend empfundenen Stunden erklang kein einziger Geigenton. Der strenge Meister bediente das Klavier, ich sang und pfiff. Und ich kritzelte von Anfang an Noten, trotz der dafür zu erleidenden Schelte (!?…), nicht viel später auch selbst erfundene.“2
Die selbst erfundenen Noten: Ulrich Stranz beschreibt 1996 seine ersten kompositorischen Erfahrungen.3 „Der Wunsch zu komponieren wurde durch die Mehrstimmigkeit der Unterrichts-Duos ausgelöst. Also schrieb ich auch solche Duos, dann Streichquartette. Ein Klavier war nicht in Reichweite. Da kam ich zu einem Tonbandgerät, einem TK 20, und nun multiplizierte ich mein eigenes Spiel per Band. Das alles geschah ohne jegliche theoretischen Kenntnisse, völlig autodidaktisch. Ich bastelte instinktiv Konsonanzen aneinander. Meine Eltern hielten nichts von meiner Komponiererei, da mein Lehrer meinte, ich sollte mehr Geige üben statt der überflüssigen Notensetzerei. Bei diesen Kinderwerken hatte ich keinen Gedanken an Form im Sinne richtiger ‚Werke‘, es waren allesamt kurze Stückchen.“ Uli erhält später zusätzlich Klavierunterricht, wobei hervorzuheben ist, dass zur selben Zeit auch seine Mutter Klavierstunden nimmt, doch mit dem Lernerfolg ihres Sohnes kann sie sich nicht messen lassen, obwohl das Klavier für Uli weniger ein Instrument zum Vorspielen als zum Kennenlernen zusätzlicher musikalischer Perspektiven ist, vor allem im harmonischen Sinne. Es dient ihm vor allem zur Hörkontrolle im Zuge des Komponierens.
Mit dem Umzug nach München steht auch der Schulwechsel von der Grundschule zum Gymnasium an. Die Eltern entscheiden sich für das humanistische Maximiliansgymnasium, welches höchstes Renommee genießt, wo er sich mit Griechisch und Latein wertvolle altsprachliche Kenntnisse erwirbt. Im Maximiliansgymnasium kommt es zu einer für Uli wichtigen Begegnung mit dem jungen Musiklehrer Kurt Suttner. Er erinnert sich:
„Meine erste Begegnung mit Uli Stranz fand im Jahr 1960 statt. Die erste Schule, an der ich als Schulmusiker tätig war, war das Maximiliansgymnasium in München. Dort übernahm ich die Leitung des Schulorchesters. Stranz war als Geiger Mitglied des Orchesters. Er wandte sich an mich mit der Frage, ob ich bereit wäre, mit ihm über einen Kompositionsversuch für Streichtrio (Violine, Viola und Violoncello) zu sprechen. Ich erklärte mich bereit, diese Komposition nach den Orchesterproben klingend ‚auszuprobieren‘. In diesen ‚Versuchsproben‘ ergaben sich sofort Gespräche über die Situation der Neuen Musik. Es stellte sich heraus, dass Uli im Besitz von Schallplattenaufnahmen der Streichquartette von Béla Bartók war und dass für ihn diese Kompositionen die Anregung waren, selbst einen Versuch zu einer Komposition zu ‚wagen‘. Wir führten sehr intensive Gespräche. Das Thema ‚Neue Musik‘ existierte im Rahmen meines Schulmusikstudiums an der Münchner Musikhochschule damals so gut wie überhaupt nicht. Ich selbst hatte mich als Mitbegründer des Vokalensembles ‚cappella antiqua München‘ sehr intensiv mit der Musik des Mittelalters, mit der Epoche von Guillaume de Machault und der Renaissance beschäftigt. Daher war mir Musik, die nicht auf der Basis des klassisch-romantischen Dur-Moll-Systems aufgebaut war, durchaus geläufig. Daraus ergaben sich sehr interessante Gespräche über tonale Strukturen in Kompositionen. Uli Stranz stellte mir seine Aufnahmen der Streichquartette von Bartók zum Anhören zur Verfügung. Zu einer öffentlichen Aufführung des Kompositionsversuches von Stranz kam es nicht, da ich das Maxgymnasium bereits nach eineinhalb Jahren wieder verließ. Leider bin ich nicht im Besitz von Aufzeichnungen dieser Kompositionsversuche des jungen Schülers Stranz. Der schnelle Griff zum Fotokopierer war damals noch unbekannt.“4
Stranz beschreibt eine wichtige Anregung für sein kompositorisches Selbststudium, die sich aus einer Zufallsbegegnung ergeben hat: „Als Vierzehnjähriger war ich mit meinen Eltern in den Alpen, in einem Gipfelrestaurant. Meine ganzen Gedanken kreisten zu jener Zeit um die Entstehung eines meiner beiden Jugendstreichquartette [Nr. 1 in A-Dur, Nr. 2 in g-Moll]. Da hörte ich ein Gespräch am Nachbartisch, aus dem ich entnahm, dass der von vielen Bewundererinnen umgebene alte Herr nebenan ein leibhaftiger Komponist war. Ich nahm meinen Mut zusammen, ging zu ihm hin und sagte ihm, dass auch ich ein richtiger Komponist werden wollte. Er fragte mich: ‚Hast du denn eine Ahnung von Formenlehre?‘ Wer dieser Komponist war, habe ich nie erfahren. Aber zum nächsten Weihnachtsfest schenkte mir mein Vater die Formenlehre von Erwin Ratz, die lange eine Bibel geblieben ist.“5
Geradezu elementar wirken die Bartók-Quartette auf ihn: Er bekam, als er „13 oder 14 war, Karten zu einem Konzert-Zyklus des Végh-Quartetts geschenkt, in dem neben Werken der Klassik alle sechs Bartók-Quartette gegeben wurden. Die völlig unvorbereitete Begegnung mit Letzteren ließ den Jungen in schwerste Zweifel über das Alleinseligmachende reiner Dreiklangsharmonik fallen, ließ ihn erst einmal hilflos süchtig nach mehr herb-süßer Medizin aus dem bis dahin unerahnten Klang-Paradies zurück und löste zum ersten Mal und auf so drastische Art wie später nie wieder eine Entwicklung aus […] auf ein damals so schnell noch nicht Greifbares.“6 Die Entdeckung der modernen Klassiker des 20. Jahrhunderts wirkte auf Stranz nach anfänglicher Verunsicherung geradezu katalysatorisch: „Als erste Partituren besorgte ich mir die Bartók-Streichquartette und versuchte, seinen Stil zu imitieren. Ich hatte keine Ahnung von der technischen Seite, schrieb aber ein Streichtrio in dieser spröden Harmonik, das wir in der Schule aufführten.“ Es handelt sich um das auch von Kurt Suttner erwähnte, leider nicht mehr auffindbare Streichtrio. Auch die von Stranz erwähnten Jugendstreichquartette sind verschollen.
Kurt Suttner hatte das Streichtrio zur Begutachtung weitergeleitet, wie Stranz 1987 berichtet, und zwar ausgerechnet an Günter Bialas: „Um das Jahr 1960 hatte ich, als Terzianer, etwas, von dem ich annahm, es handle sich um ein musikalisches Werk, zu Papier gebracht und mich mit der Bitte um Begutachtung desselben an den Leiter des Schulorchesters gewandt. Der junge Musiklehrer, die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmend, kündigte an, er wolle meine Partitur an jemand Kompetenteren weiterleiten. Dann, nach banger Wartezeit, ließ mir endlich ein mir naivem Knaben bis dahin unbekannter Professor Bialas ausrichten, dieses und jenes an meinem Stück sei gelungen, anderes weniger, auf alle Fälle aber habe ich Phantasie, ja, ich könne, sollte ich es wünschen und gewisse Voraussetzungen erfüllen, später einmal in seine Kompositionsklasse eintreten.
Zurückblickend erkenne ich klar, in welchem Maße die wohlwollende Bialassche Botschaft mir damals über die nachfolgenden Jahre zum seelischen Proviant, zu einer inneren Antriebsquelle wurde. Ohne sie wäre der kindliche Zeitvertreib des Notenaufschreibens womöglich nie in ernsthaftere kompositorische Bemühungen übergegangen, wäre ich nicht tatsächlich Student in Bialas‘ Klasse an der Münchner Musikhochschule geworden, ich würde, wer weiß, jetzt nicht einen der schönsten Beruf ausüben.“7
Ulis schulische Leistungen werden nach und nach schwächer, schließlich muss er eine Klasse wiederholen, kurz zuvor beichtet er seinen auf Reisen befindlichen Eltern: „Leider kann ich Euch heute keine gute Botschaft mitschicken. Ich habe eine 5 bekommen. Vielleicht schreiben wir am Samstag wieder eine Lateinarbeit. Hoffentlich wird es besser! Bitte seid mir nicht böse!“ Allerdings glänzt er im Fach Musik, außerdem wird seine Mitwirkung im Orchester sehr geschätzt, was sich in der Widmung der Schulleitung des Maximiliansgymnasiums in einem Buchgeschenk zeigt. Zu jenem Zeitpunkt hat Kurt Suttner dieses Gymnasium bereits verlassen, um für drei Jahre als Musiklehrer an die Deutsche Schule nach Addis Abeba, Äthiopien, zu wechseln, ansonsten hätte er als Leiter des Schulorchesters diese Auszeichnung sicher mitunterschrieben.
Abb. 1.4: Uli Stranz Interesse an neuer Musik war der Schulleitung wohlbekannt, was sich in der Wahl des ihm als Geschenk überreichten Buches von Anton Webern widerspiegelt.
Kurt Suttner unterrichtet drei Jahre im Auslandsschuldienst. Währenddessen wechselt Uli Stranz vom Maximiliansgymnasium auf das private Derksen Gymnasium München, ein Intermezzo. Danach geht Stranz im September 1964 auf das Musische Gymnasium München, welches ein Jahr später in Pestalozzigymnasium umbenannt wird. Und dort kommt es ein paar Monate später zur erneuten Begegnung mit Kurt Suttner: „Nach meiner Rückkehr nach Bayern im Jahr 1965 wurde ich an das Musische Gymnasium in München versetzt. Zu meiner Überraschung hatte Uli Stranz die Schule gewechselt und war am Pestalozzigymnasium in der Abiturklasse Mitschüler von Peter Michael Hamel und Joachim Krist. Die drei Schüler Hamel, Stranz und Krist prägten in diesem Jahr sehr stark das musikalische Leben an der Schule. Hamel organisierte eine Gruppe von singbegeisterten Schülerinnen und Schülern und bat mich, mit ihnen Chormusik einzustudieren. Aus dieser chorbegeisterten Schülergruppe entwickelte sich ein kleiner Kammerchor.“8 Für diesen Schulchor komponiert Stranz einen Kanon: „Das Nasobem“ (nach dem berühmten Gedicht aus Christian Morgensterns „Galgenliedern“). Die Wahl gerade dieses humoristisch-vielschichtigen Textes spricht für Stranz Vorliebe für feine Sprachkomik, die in einer ganz anderen Liga angesiedelt ist als ein einfacher „Jux“, und für die surreale Erfindung eines Tieres, von dem manche behaupten, dass es nicht existiert. Inzwischen ist es längst auch enzyklopädisch belegt. – Peter Michael Hamel, einer seiner Freunde seit der Schulzeit auf dem Pestalozzigymnasium, berichtet von Stranz riesiger Science-Fiction-Bibliothek. So sehr fern ist da der „Nasenschreiter“ nicht.
Abb. 1.5: Ulrich Stranz, Das Nasobem, 1965, Handschrift: Tusche auf rastriertem Transparentpapier (Nachlass Ulrich Stranz, Zentralbibliothek Zürich, Signatur: Mus NL 73 : C 7 : 1)
Das Nasobēm
Auf seinen Nasen schreitet einher das Nasobēm, von seinem Kind begleitet. Es steht noch nicht im Brehm.
Es steht noch nicht im Meyer. Und auch im Brockhaus nicht. Es trat aus meiner Leyer zum ersten Mal ans Licht.
Auf seinen Nasen schreitet (wie schon gesagt) seitdem, von seinem Kind begleitet, einher das Nasobēm.
Christian Morgenstern
Musikalisch begegnet Stranz diesem Text mit einem etwas „schrägen“ C-Dur. Amüsant ist auch der Aufführungshinweis am Ende des Kanons, der Chor könne ihn – „je nach Verfassung“ – auch in anderen Tonarten singen! Von diesem Stück hat sich die oben abgebildete Reinschrift auf Transparentnotenpapier erhalten. Stranz hat den Kanon im Hinblick auf die damals günstigste Art des Reproduzierens mittels Lichtpause auf diesem empfindlichen Material notiert, auf dem Schreibfehler mit einer scharfen Klinge vorsichtig abgezogen werden müssen. Bei der Korrektur auf der abgeschabten und meist etwas aufgerauten Stelle wirkt sich dies auf das Schriftbild aus. Das mit besonderer Sorgfalt notierte Autograph dieses bislang unpublizierten Kanons zeigt den Eifer, aber auch die Freude des jungen Komponisten am gelungenen Werk. Die Mitglieder des Schulchores singen aus den mittels Lichtpause vervielfältigten Kopien dieser Handschrift.
Kurt Suttner: „Die von Hamel organisierte Chorgruppe war die Gründungszelle eines Schulchores. Hamel und Stranz waren mit Begeisterung dabei. Wir beschäftigten uns intensiv mit Chorwerken von Fritz Büchtger, bei dem Hamel und Stranz damals Kompositionsunterricht erhielten. Wir erarbeiteten Stücke von Hugo Distler, Paul Hindemith, Wilhelm Killmayer und anderen ‚modernen‘ Komponisten.“9
Wie das für die „Nasobem“-Vertonung benutzte Transparentpapier mit Notenlinienvordruck die reproduktionstechnischen Möglichkeiten jener Zeit dokumentiert, zeigt auch das unten wiedergegebene Faltblatt mit dem Programm eines Schulkonzerts neuer Musik solch typische Elemente, wie den mit Schreibmaschine getippten Text und eine mittels Buchstabencollage gestaltete Titelseite. Dieses Programm ist bereits mittels Fotokopie vervielfältigt worden.
Abb. 1.6: Programmzettel eines Schulkonzertes unter Mitwirkung des von Kurt Suttner geleiteten „Kleinen Chores“ und mit frühen Werken von Stranz, Hamel und Krist
Kurt Suttner: „Ich stellte sehr bald fest, dass Uli Stranz und Joachim Krist an der klingenden Darstellung von Kompositionen für Singstimmen nicht extrem interessiert waren. Aber Hamel mit seiner mitreißenden Begeisterung brachte es immer wieder fertig, dass auch diese beiden instrumental orientierten jungen Komponisten voll in dieser Gruppe integriert waren. Stranz präsentierte seinen Kanon nach Morgenstern ‚Das Nasobem‘, der mit Begeisterung von den Schülern gesungen wurde. Offensichtlich war Uli sehr angesprochen vom Wortwitz des Christian Morgenstern – ganz sicher einer der Gründe, warum er später nochmals drei Gedichte von Morgenstern vertonte, obwohl er als Komponist die Chormusik nicht als sein eigentliches Instrument empfand.“
Abb. 1.7: Ulrich Stranz als Oberstufenschüler auf dem Gymnasium
1963, also bereits während der Zeit seines „schulischen Intermezzos“, beginnt Uli Stranz mit einer fundierten musikalischen Ausbildung in der „staatlich genehmigten musikalischen Bildungsstätte“ – wie es im Briefkopf der Semesterzeugnisse heißt –, dem Münchner „Waltershausen Seminar“. Er kommt in die Violinklasse von Erich Keller, dem Primarius des Keller-Quartetts und Ersten Konzertmeisters des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Außerdem erhält er privaten Kompositionsunterricht bei dem auch für seine pädagogische Sensibilität sehr geachteten Fritz Büchtger, einem unermüdlich für die neue Musik tätigen Konzertorganisators und der Anthroposophie verpflichten Komponisten, der nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer sich auch auf den Zwölftonpionier Josef Matthias Hauer berufenden, von Zahlenmystik und spiritueller Weltordnung geprägten Zwölftonmusik fand. Büchtger hat die derart strukturierte Tonwelt und seine so entstandenen, überaus akribisch ausgehörten Kompositionen als eine Art Entsprechung der Planetenkonstellation und Tierkreiszeichen im Makroskopischen gedeutet und dies in einer Zeichnung dargestellt, in der er noch weitere Dimensionen und Verbindungen aufzeigt.10
Abb. 1.8: Die Zwölfordnung der Planeten, Tierkreiszeichen und Töne. Zeichnung von Fritz Büchtger (vgl. Abb. 1.9)
Aus der Zeit des Kompositionsunterrichts bei Büchtger existiert ein bislang unpubliziertes Violinstück, welches Stranz 1966 seinem Vater zum Geburtstag gewidmet und sicher auf der Violine vorgetragen hat, denn der Vater beherrschte dieses Instrument nicht. Bemerkenswert ist die Kreiszeichnung oberhalb des Notenabschnitts, in die Stranz den Verlauf der Zwölftonreihe einzeichnet, auf der seine – im Übrigen sehr fein formulierte – Miniatur beruht:
fis-g-d-f-h-a-gis-cis-dis-ais-e-c
Anfang und Ende der Reihe (fis und c) liegen auf der von Stranz gestrichelt eingezeichneten Horizontlinie des Kreises. Wenn man ihn mit einem Uhrzifferblatt vergleicht, beginnt der Tönezirkel mit dem c auf der 9, die Töne wandern im Uhrzeigersinn weiter in Quintsprüngen („Quintenzirkel“), auf der 3 ist das fis erreicht, dort beginnt der Linienverlauf der Zwölftonreihe dieses Stücks. Die Form der Tonordnung rings um den Kreis entspricht exakt der Büchtger-Grafik. Die optische Entsprechung ist unverkennbar. Stranz nutzt in seinem „Air“ ausschließlich die Grundreihe, die sich leicht abzählen lässt. Das Entscheidende und Eigenständige jedoch, was sich bereits an dieser Miniatur abzeichnet, ist, dass nicht die Zwölftontechnik die musikalische Formulierung dominiert, sondern umgekehrt: Sie bildet eine diskrete, zusammenhangbildende Basis für eine sinnliche, oft zu musikantischer Diesseitigkeit tendierende Musik, in der sich das Konstruktive weder beim Spielen noch beim Hören aufdrängt. Eine Qualität, die sich schon hier deutlich ankündigt, sie zeichnet in jeweils spezifischer Weise auch die späteren Werke von Stranz aus, auch bei sich deutlich ändernder konstruktiver Basis.
Abb. 1.9: Ulrich Stranz, „Air“ für Violine solo, 1966 (Handschrift)
Den Weg zur Dodekaphonie findet Stranz nicht erst durch Büchtger, sondern im Zuge seiner intensiven autodidaktischen Arbeit, wie er 1996 beschreibt: Bereits zuvor hatte ich „für mich ganz alleine das Zwölftonsystem entdeckt und in dieser Richtung experimentiert. Durch über die Formenlehre von Ratz weiterführende Lektüre war ich auf Zwölftontheoretiker wie Hanns Jelinek und Ernst Krenek gestoßen. Bei Büchtger ging es dann richtig in die Dodekaphonie hinein. Für ihn war diese Sprache eine Selbstverständlichkeit, der einzige mögliche Weg in die Zukunft – darüber musste man nicht einmal sprechen. Büchtger war ein sehr freundlicher Mensch, der aber die Frustration, nicht ganz durchgedrungen zu sein mit seinem Schaffen, nicht völlig verbergen konnte. Aber sein Ethos und seine Strenge prägten uns. Auch war sein Kontrapunktunterricht wertvoll – da ging es weniger um die Regeln Ton gegen Ton, sondern vor allem darum, unabhängige Charaktere in der Gleichzeitigkeit gegeneinander zu setzen."11 Im Waltershausen Seminar wird die Ausbildung durch die theoretischen Disziplinen Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Musikgeschichte sowie durch Klavier als instrumentales Zweitfach ergänzt. Von den ersten vier Semestern (1963-65) existieren noch die Halbjahreszeugnisse. Auffallend sind die eher mäßigen Zensuren im „Fleiß“ sowie im „Fortschritt“: Er erreicht nur eine befriedigende bzw. ausreichende Beurteilung, ebenso in Violine und erst recht im Zweitfach Klavier, wo ihm im ersten Semester sogar ein Mangelhaft attestiert wird. Der Kommentar lautet denn auch: „Ulrich Stranz hat die Anlagen zu einem guten Geiger – im Klavierspiel müsste er viel mehr arbeiten.“ Jedoch durchwegs sehr gut sind seine Zensuren, wenn es um neue Musik geht. Der Schwerpunkt zeichnet sich überdeutlich ab. Ich greife weit voraus, wenn ich Stranz aus dem Gedächtnis zitiere; Ende der 1990er Jahre beschrieb er seine instrumentalen Fähigkeiten auf der Violine so: „Ich spiele jetzt wesentlich besser als während meines Violinstudiums!“ – Vom letzten Unterrichtsjahr liegt kein Zeugnis vor. Sein Vorankommen muss sich jedenfalls enorm beschleunigt haben, denn seine Leistungen auf der Violine werden von Zeitzeugen wie Peter Michael Hamel als sehr hoch beschrieben.
Abb. 1.10: Zeugnis des Waltershausen Seminars (Ausschnitt)
„Unser erstes Bier tranken wir im Stehausschank beim Deutschen Museum an der Isarbrücke, kurz nach Schuljahresbeginn im Herbst 1964. Stranz war damals neu in die zwölfte Parallelklasse des Musischen Gymnasiums gekommen, schon damals qualifizierter Geigenschüler von Erich Keller, und wurde ein wertvoller Zuwachs unseres Schulorchesters, so wie der Joachim Krist als dritter im Bunde. Stranz, ein knappes Jahr älter als ich war zeitweilig mein Nachbar im mehrklassigen Physikunterricht. Ihm verdanke ich vor allem das Selbstverständnis, schon damals in erster Linie Komponist zu sein. Er nahm mich auch zu Fritz Büchtger mit. […] Noch in der Schulzeit und in den Jahren danach betrieben wir ein reges Experimentieren, Tonbandbasteleien, musique concrète, Geräuschmusik und elektronische Modulation.“12 Aber nicht ausschließlich der Musik, sondern auch dem genussvollen Leben zeigt sich Stranz zugeneigt, wie Hamel schildert: „Er war stets modisch geschmackvoll gekleidet; in Sachen Popmusik auf dem neuesten Beatles-Stand schwang er gerne das Tanzbein, war bei den Mädchen beliebt, und mit seiner Geige improvisierte er höchst witzig und einfallsreich in allen Stilen.“
Vermutlich auch durch Büchtger angeregt, der als Präsident der Musikalischen Jugend Deutschlands e. V. wirkt, besucht Stranz gegen Ende seiner Schulzeit mehrfach die von dieser Sektion der Jeunesses Musicales durchgeführten Musikkurse in Weikersheim. Jahrzehnte später wird er dort selbst als Dozent tätig sein.
Im Sommer 1966 endet Stranz Gymnasialzeit mit einem gut bestandenen Abitur. Laut Hamel waren Stranz Lieblingsfächer neben Musik vor allem Deutsch und Geschichte. Stranz sprachliche Sensibilität zeigt sich in vielen seiner in diesem Buch abgedruckten Texte.
Die Chorbegeisterung dieses außergewöhnlichen Jahrgangs mit Begabungen wie Hamel, Stranz und Krist im Zentrum wird „nachwirken“: Denn aus der Keimzelle des schulischen Kammerchores entwickelt sich der renommierte „via-nova-chor München“. Aber bereits der Kammerchor des Pestalozzigymnasiums wird bejubelt: „Die eigentliche Überraschung hinsichtlich der Interpretation bot jedoch der Kammerchor des Pestalozzigymnasiums unter der intuitiven Leitung von Kurt Suttner. Dieser Chor ist absolute Spitzenklasse – bravissimo!“13
Kurt Suttner berichtet über die weitere Geschichte:
„Nach dem Abitur und im darauffolgenden Schuljahr erweiterte sich die Besetzung der kleinen Singgruppe, Hamel und Stranz absolvierten ihre ‚militärische Zwangspause‘, Hamel als Küchensoldat beim Lufttransportgeschwader Neubiberg, Stranz als Flötist bei der Bundeswehrmusik. Beide nahmen weiterhin Kompositionsunterricht bei Fritz Büchtger. Hamel komponierte sein erstes a-cappella-Chorwerk ‚tief stummen wir‘, nach Gedichten von August Stramm. Der Schulchor des Pestalozzi-Gymnasiums sang 1968 die Uraufführung im Rahmen des ersten Münchner Tonkünstlerfestes. Aus diesem von Hamel und Stranz ins Leben gerufenen Chorensemble entwickelte sich später nach meiner dreijährigen Tätigkeit am Kultusministerium in Tananarive in Madagaskar der ‚via-nova-chor München‘, der bis zum Jahr 2003 unter meiner Leitung viele zeitgenössische Kompositionen, darunter 36 Chorkompositionen zur Uraufführung brachte.“14 Dieser Chor besteht noch heute – was für eine faszinierende Historie!
1Ulrich Stranz 1996 im Gespräch mit Christoph Schlüren. Ich danke Herrn Schlüren herzlich für die Erlaubnis zur Wiedergabe der von ihm schriftlich festgehaltenen Aussagen von Ulrich Stranz. Im Folgenden: Stranz 1996.
2 Ulrich Stranz, Trockenkurs, in: Anfänge. Erinnerungen zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten an ihren frühen Instrumentalunterricht, hrsg. von Marion Saxer, Hofheim 2003, S. 83f.
3 Stranz 1996.
4 Aus Kurt Suttners Antworten auf einen per E-Mail zugesandten Fragenkatalog des Autors (Ende 2020). Im Folgenden: Suttner 2020.
5 Stranz 1996, auch im Folgenden.
6 Ulrich Stranz, Annäherung und Entfernung, oder der Weg als Ziel. Aus einem Vortrags-Manuskript, vgl. S. 175
7 Ulrich Stranz, Günter Bialas zum 80. Geburtstag, in: Musica 1987.
8 Suttner 2020.
9 Suttner 2020, auch im Folgenden.
10 Zit. nach Gabriele E. Meyer, Neue Musik in München, Fritz Büchtger (1903-1978) zum 100. Geburtstag, München 2003, S. 9.
11 Stranz 1996.
12 Peter Michael Hamel, Über Ulrich Stranz, in: Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München 1986, S. 473, im Folgenden: Hamel 1986.
13 Karl-Robert Danler, in: Musikalische Jugend, Aug./Sep. 1968. In dem besprochenen Konzert erklang auch eine – leider nicht mehr auffindbare – „Inventio“ von Ulrich Stranz, die vom Rezensenten jedoch ziemlich distanziert aufgenommen wurde: „Nicht viel mehr als eine Arbeit aus dem Kompositionsunterricht für Fortgeschrittene…“
14 Suttner 2020.
2 INTERMEZZO UND STUDIUM
Piccolospieler in Uniform
Nach dem bestandenen Abitur und der für junge Männer obligatorischen Musterung steht für Ulrich Stranz und ebenso für seinen Freund Peter Michael Hamel der Wehrdienst auf der Agenda. Die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht wurde in Deutschland erst im Sommer 2011 vollzogen, eine in Zeiten des Kalten Krieges undenkbare Vorstellung. Eine Wahl zugunsten des Zivildienstes wird von beiden Abiturienten nicht getroffen. Vater Stranz schreibt einen zwar Einspruch gegen die Einberufung seines Sohnes, doch ohne Erfolg. Der Jahrgang 1946 ist zahlenmäßig „mager“, so dass quasi alle eingezogen werden. Aber Ulrich Stranz sucht das Unvermeidliche, den bevorstehenden Dienst, immerhin so nah wie möglich an die für ihn im Zentrum stehende Musik anzubinden. Aus dieser Vorstellung erwächst wieder ein starker autodidaktischer Impetus, den er auch schon im Zuge seines kompositorischen Selbststudiums entwickelt hatte, nur ist er in diesem Fall spieltechnischer Natur: In unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Abitur besorgt er sich eine Piccoloflöte. Darauf beginnt er eigenständig und ohne zusätzliche pädagogische Hilfestellung mit dem Selbststudium. Die Begabung und ebenso der starke Wille dürften auch genetisch veranlagt sein: Schon der Großvater mütterlicherseits hatte es – wie bereits erwähnt – auf autodidaktischen Wegen zum beliebten Fest- und Hochzeitsmusikanten gebracht. Ulrich Stranz kommt mit dem Piccolospiel gut und rasch voran. Er ist schließlich so erfolgreich, dass er gleich nach der militärischen Grundausbildung von Oktober bis Dezember 1966 in Landsberg am Lech in das Musikkorps der Luftwaffe in Neubiberg als Piccolospieler aufgenommen wird. Hamels Grundausbildung findet zeitlich parallel und in räumlicher Nähe im Lager Lechfeld statt. An freien Sonntagen treffen sich beide in Augsburg in der blauen Uniform der Luftwaffe, die beim Ausgang getragen werden muss. Hamel hätte ebenfalls gern beim Musikkorps Neubiberg mitgewirkt, doch wird sein Hornspiel als zu schlecht beurteilt. Stattdessen wird ihm ein Platz in der Nachschubstaffel als Küchengefreiter zugewiesen. Doch auch dort verlieren sich beide nicht aus den Augen: Bei der sogenannten Formalausbildung des Musikkorps marschiert Stranz auf seinem Piccolo blasend und in die Formation eingebunden auch am Fenster der Küche vorüber. Diese Phase der Dienstzeit im Lufttransportgeschwader Neubiberg dauert von Januar 1967 bis zum März 1968. Die anschließend nicht mehr benutzte Piccoloflöte aus Ebenholz liegt noch Jahrzehnte später im Riedener Chalet von Isabella und Ulrich Stranz vor den Büchern im Regal – wie ein Souvenir aus einer sehr anderen Zeit. Inzwischen hat sie dieses Instrument Peter Michael Hamel geschenkt. Gern würde man diese kleine Flöte, aber generell Instrumente nach ihren Erlebnissen befragen können. Sie wüssten einiges zu berichten.
Wenngleich nur in begrenztem Maße, doch immerhin kann Ulrich Stranz sogar seine kompositionshandwerklichen Fähigkeiten in den Dienst des Musikkorps stellen, indem er einige Blechbläsersätze instrumentiert, die auch aufgeführt werden. Von diesen Arrangements existiert keines mehr in seinem Nachlass. Peter Michael Hamel berichtet 2020 in einer E-Mail an den Autor, wie sich die Musik sogar verkürzend auf die Dienstzeit seines Freundes auswirkt und wie sie zudem die militärische Rangordnung vorübergehend außer Kraft setzt: „Uli hat auch Streichquartett mit höheren Dienstgraden gespielt, er war dann auch am Wochenende beschäftigt, diese Tage wurden ihm angerechnet, dadurch kam er früher raus als ich im März 1968. Lustig: Bei den Quartettproben ging der Dienstbefehl auf ihn über: ‚Herr Stabsfeldwebel, Sie haben wieder falsch intoniert!‘
‚Jawoll, Herr Gefreiter!‘“
Während der Wehrdienstzeit nehmen Stranz und Hamel gemeinsam privaten Kompositionsunterricht bei Büchtger. Hamel berichtet über die Fahrten mit dem grauschwarzen VW-Käfer, den Ulrich Stranz von seinem Vater geschenkt bekommt, die sie jeweils am Mittwoch von der Neubiberger Kaserne nach München zu Büchtger in die Schellingstraße 54 führen. Dafür waren 30,- DM Honorar aufzubringen. Eine überaus lohnende Investition, denn Hamel hebt Büchtgers Offenheit hervor, da er seine anthroposophisch motivierte Zwölftonschreibweise seinen Schülern nicht zwanghaft auferlegt, vielmehr bereitet er die Freunde in aller stilistischen Offenheit auf die Aufnahmeprüfung an der Münchner Staatlichen Hochschule für Musik vor, denn beide wollen bei Professor Günter Bialas studieren, was auch Büchtger empfiehlt, unbedingt bei ihm und nicht bei einem anderen Professor, etwa dem damals durchaus berühmteren Harald Genzmer.
Auch Stranz sieht es so: Büchtger hatte es vollkommen „richtig begriffen, wohin unser weiterer Weg führen sollte. Und das war gewiss nicht der akademische Neoklassizismus, der in München auch vertreten war. Noch während der Zeit bei ihm streckte ich meine Fühler in Richtung Heterophonie aus – was mich immer sehr interessierte, ist der Klang: nicht im Einzelton, sondern als ‚Klangsatz‘. Solche Dinge probierte ich in meinem ‚Nullten‘ Streichquartett erstmals aus, welches dann im [von Büchtger geleiteten] ‚Studio für Neue Musik‘ uraufgeführt wurde.“15 Die Bedeutung dieses „Studios für neue Musik“ und Büchtgers Einsatz für die Finan





























