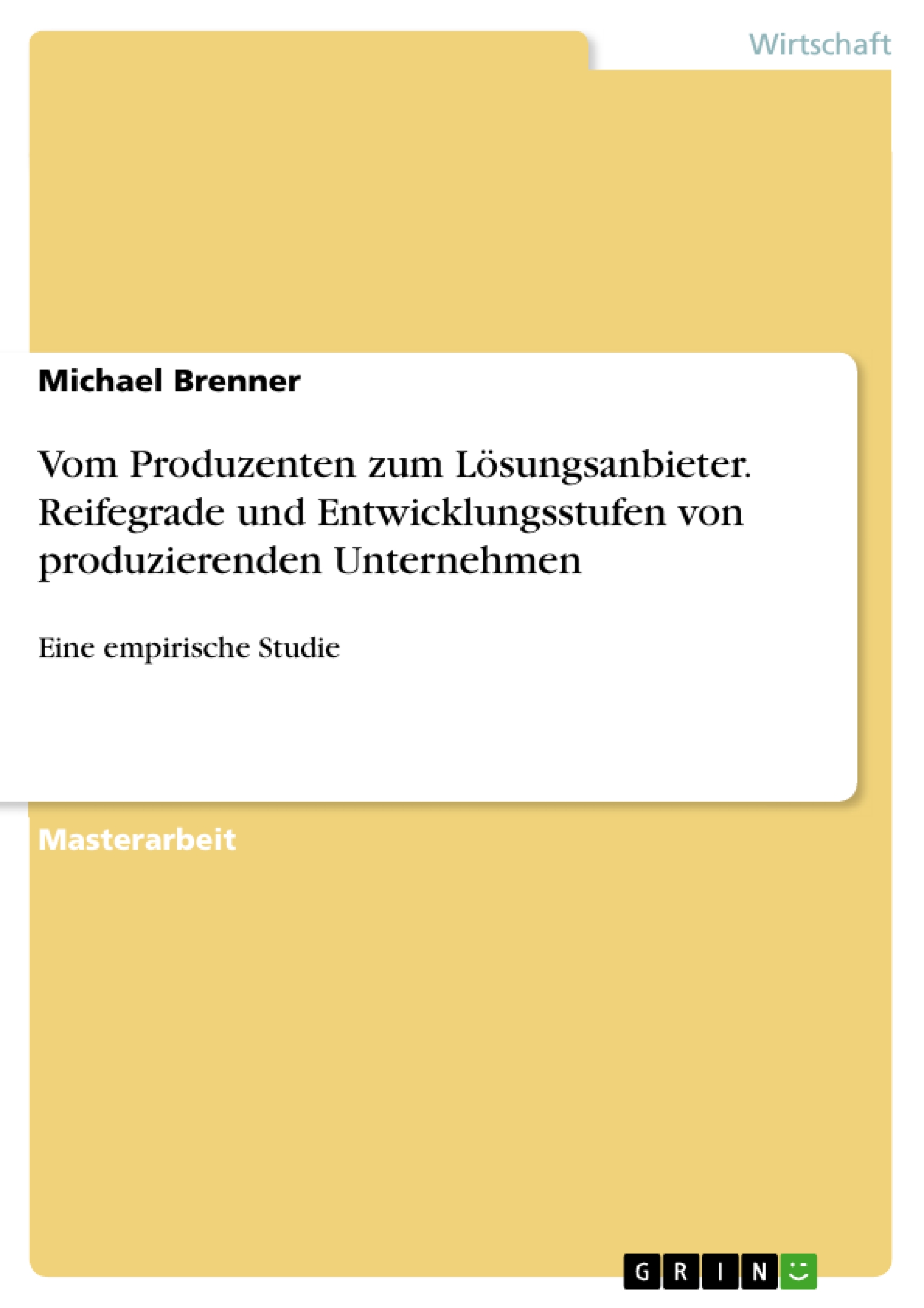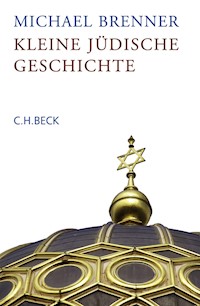23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Juedischer Verlag im Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde München zum Schauplatz ungewöhnlicher politischer Konstellationen: Kurt Eisner wurde im November 1918 der erste jüdische Ministerpräsident eines deutschen Staates, während jüdische Schriftsteller wie Gustav Landauer, Ernst Toller und Erich Mühsam sich im April 1919 für die Räterepubliken engagierten. Die jüdische Gemeinde war eher konservativ ausgerichtet, und selbst die orthodoxen Mitglieder besuchten nach dem Synagogenbesuch gerne das Hofbräuhaus. Doch Anfang der zwanziger Jahre gab es bereits einen Nazi als Polizeipräsidenten, antijüdische Tendenzen in Politik, Presse und Kirche sowie Judenausweisungen und offene Gewalt gegen jüdische Bürger auf der Straße. Die »Stadt Hitlers« wie Thomas Mann die spätere »Hauptstadt der Bewegung« bereits im Juli 1923 nannte, wurde zum Ausgangspunkt für den beispiellosen Aufstieg der hier gegründeten nationalsozialistischen Partei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Ähnliche
Michael Brenner
Der lange Schatten der Revolution
Juden und Antisemiten in Hitlers München 1918-1923
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag
Für meine Mutter
Inhalt
1 Perspektivenwechsel
»Das Ganze eine namenlose jüdische Tragödie«
Jüdische Revolutionäre machen noch keine jüdische Revolution
Die gute alte Zeit?
Die »Judenfrage« rückt in den Mittelpunkt
2 Jüdische Revolutionäre in einem katholischen Land
Chanukka 5679 (November 1918)
»Es ist wohl das Judenblut in mir, das sich empört« – Kurt Eisner
»Mein Judentum … lebt in allem, was ich beginne und bin« – Gustav Landauer
»Ich werde noch einmal zeigen, daß ich einer vom Alten Testament bin!« – Erich Mühsam
»Gehöre ich nicht zu jenem Volk, das seit Jahrtausenden verfolgt, gejagt, gemartert, gemordet wird …?« – Ernst Toller
»Mein Kopf denkt jüdisch, russisch fühlt mein Herz« – Eugen Leviné
»Landfremde bolschewistische Agenten« – Juden im Kampf gegen die Räterepublik
3 Pogromstimmung in München
Pessach 5679 (April 1919)
»Wir wollen keinen bayerischen Trotzki« – Die Stimmung kippt
»Eine Regierung von Jehovas Zorn« – Die Haltung der katholischen Kirche
»An den Galgen«: Radikalisierung in Ton und Tat
»Die Trotzkis machen die Revolution und die Bronsteins zahlen den Preis«: Jüdische Reaktionen
4 Der Hort der Reaktion
Rosch Haschana 5681 (September 1920)
»Die Bewegung … musste einen Ort zum Vorbild werden lassen« – Hitlers Testgelände
»Die Ostjuden-Gefahr« – Erste Judenausweisungen
»Reisende, meidet Bayern!« – Manifestationen der Gewalt
»Jetzt hat Deutschland seinen Dreyfus-Prozess« – Justizskandal und Skandaljustiz
5 Die Stadt Hitlers
Sukkot 5684 (September 1923)
»Alles, was faul und schlecht war im Reich« – Die Hauptstadt des Antisemitismus
»Morgen baumelt ihr alle« – Der heiße Herbst 1923
»Eine Verhöhnung des deutschen Volkes« – Nachklänge 1924
6 Perspektivenvielfalt
Grabsteine
Lebenswege
Deutungen
Purim 5693 (März 1933)
Zeittafel
Dank
Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Anmerkungen
1 Perspektivenwechsel
»Sehr schönes Thema, die Revolution und die Juden. Behandeln Sie dann nur auch den führenden Anteil der Juden an dem Umsturz.«1
Gustav Landauer an Martin Buber,
2. November 1918
»Das Ganze eine namenlose jüdische Tragödie«
Die Trauerfeier für den ermordeten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner am 26. Februar 1919 auf dem St. Martinsplatz vor dem Münchner Ostfriedhof war ein Ereignis, das in der Geschichte des deutschen Judentums einmalig dasteht. Ein jüdischer Deutscher, der wenig später selbst Regierungsverantwortung in der bayerischen Räterepublik übernehmen sollte, hielt die Grabrede auf einen jüdischen Ministerpräsidenten, der drei Monate zuvor die sieben Jahrhunderte regierende Dynastie der Wittelsbacher gestürzt hatte. Beide hatten sich schon lange von der Religion ihrer Vorfahren losgesagt, und doch wussten beide genau, dass sie ihre Bande mit der jüdischen Gemeinschaft nicht lösen konnten. So hielt Gustav Landauer, einer der engsten Weggefährten Eisners und im April 1919 Volkskommissar für Volksaufklärung, Unterricht, Wissenschaft und Künste, es für angebracht, am Sarg des ermordeten bayerischen Ministerpräsidenten, vor Tausenden Trauergästen, darauf zu verweisen, wer Kurt Eisner gewesen ist: »Kurt Eisner, der Jude, war ein Prophet, weil er mit den Armen und Getretenen fühlte und die Möglichkeit, die Notwendigkeit schaute, der Not und Knechtung ein Ende zu machen.«2
Kurt Eisner, der Jude. Meistens waren es seine Feinde, die ihm seine Herkunft unter die Nase rieben. Ein ganzes Konvolut wüster antisemitischer Beschimpfungen findet sich im Nachlass Eisners. Landauer, der nur wenig später grausam ermordet wurde, ging es kaum besser, ebenso den anderen jüdischen Trägern und Gegnern dieser Revolution und ihrer Nachbeben. Doch auch unter den Juden selbst war die jüdische Herkunft vieler Revolutionäre ein heftig diskutiertes Thema. In ihrer Mehrzahl waren sie entschiedene Gegner der Revolution oder standen ihr zumindest mit der Sorge gegenüber, sie müssten am Ende den Preis für die Taten der Eisners und Landauers zahlen. Der Philosoph Martin Buber, ein enger Freund Landauers und ein Bewunderer Eisners, hatte München auf Einladung Landauers im Februar 1919 besucht. Er reiste am Tag der Ermordung Eisners ab und fasste den Eindruck seines Besuchs in München so zusammen: »Eisner hatte ich in die Dämonie seiner zwiegespaltenen Judenseele hineingesehen, das Verhängnis strahlte aus seiner Glätte hervor, er war gezeichnet. Landauer wahrte sich mit äußerster Anstrengung der Seele den Glauben an ihn und deckte ihn, ein Schildträger von erschütternder Selbstverleugnung. Das Ganze eine namenlose jüdische Tragödie.«3
Gustav Landauer inmitten einer Menschenmenge bei Kurt Eisners Beerdigung auf dem Münchner Ostfriedhof
Nicht lange vorher, am 2. Dezember 1918 hatte Landauer Buber noch aufgefordert, über genau diese Aspekte zu schreiben: »Lieber Buber, Sehr schönes Thema, die Revolution und die Juden. Behandeln Sie dann nur auch den führenden Anteil der Juden an dem Umsturz.«4 Bis heute ist dieser Wunsch nicht eingelöst worden. Das von Landauer genannte Thema wird in der historischen Forschung zwar immer wieder erwähnt, ist aber letztlich eine Marginalie geblieben. Auch in der Flut neuer Veröffentlichungen aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums der Revolution weisen Historiker und Journalisten eher verschämt darauf hin, dass die prominentesten Akteure der Revolution und der beiden Räterepubliken jüdischer Herkunft waren.5 In ihren Biographien wird zumeist hervorgehoben, dass sie sich gar nicht mehr als Juden betrachtet hätten.6
Der Grund für die Zurückhaltung bei diesem Thema liegt auf der Hand. Man begibt sich im Allgemeinen auf sehr dünnes und sehr glattes Eis, wenn man über die Juden und ihre Beteiligung am Sozialismus, Kommunismus und den revolutionären Bewegungen forscht. Ganz dünn wird das Eis dann, wenn es sich um den Ort handelt, der unmittelbar nach Ende des revolutionären Geschehens zur Wirkungsstätte Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Bewegung wurde. Zu oft ist dieses Thema von antisemitischer Seite dazu benutzt worden, antijüdisches Verhalten zu rechtfertigen.7 So hat Hitler selbst in Mein Kampf das Kapitel seiner Wirkungszeit in München ab dem November 1918 mit »Beginn meiner politischen Tätigkeit« betitelt und den direkten Zusammenhang zwischen dem, was er als »Judenherrschaft« betrachtete und seinem politischen Erwachen hergestellt.8
In bürgerlichen Kreisen diente das Motiv der Verbindung zwischen Juden und Linken, wenn auch nicht als Rechtfertigung, so oftmals doch als Erklärungsansatz für den Antisemitismus. Golo Mann, der als Gymnasiast selbst Zeuge der Ereignisse in München war, sei als eines von vielen Beispielen herausgegriffen, weil er eine durchaus problematische, aber eben nicht untypische, moralische Wertung vornimmt und sich explizit auf die Münchner Episode bezieht: »Nicht das Judentum – das gibt es gar nicht –, aber einzelne Menschen jüdischer Abstammung haben durch ihre revolutionäre Agitation, ihre revolutionären Experimente in der Politik in Mitteleuropa zu gewissen Zeiten eine schwere Schuld auf sich geladen. Der Versuch etwa, der im Frühling 1919 in München gemacht wurde, dort ein Sowjetregime zu errichten, wurde zu einem Teil unbestreitbar von Juden gemacht, und das war in der Tat ein sträflicher, ungeheurer Unfug, der nicht gut ausgehen konnte und durfte.« Unter den Revolutionären waren gewiss »edle Menschen«, wie etwa Gustav Landauer, resümiert er. »Dennoch können wir als Historiker an den radikal-revolutionären Wirkungen des Judentums nicht mit einer ableugnenden Geste vorübergehen. Sie haben schwere Folgen gehabt, sie haben der Ansicht, wonach das Judentum in seiner Gesamtheit oder überwiegend revolutionär, umstürzlerisch, subversiv sei, Nahrung gegeben.«9 Noch schärfer zugespitzt hatte es unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg der Historiker Friedrich Meinecke formuliert: »Zu denen, die den Becher der ihnen zugefallenen Macht gar zu rasch und gierig an den Mund führten, gehörten auch viele Juden. Nun erschienen sie allen antisemitisch Gesinnten als die Nutznießer der deutschen Niederlage und Revolution.«10
Für viele zeitgenössische Beobachter und spätere Interpreten ließ sich die Frage der Kausalität klar beantworten: Das sichtbare Hervortreten jüdischer Revolutionäre, von denen die meisten zudem nicht aus Bayern stammten, verursachte eine Gegenbewegung, die sich in einem bisher nicht gekannten Ausmaß antisemitischer Hetze und Gewalt Platz verschaffte. Jüdische Zeitzeugen wollten den Zusammenhang ebenso erkannt haben wie Antisemiten. Ein Teil dieses Buches wird darauf näher eingehen. Selbst Revolutionäre verwiesen aus der Sicht von 1933 auf diesen Zusammenhang, wenngleich aus anderer Perspektive. Am »Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland« schrieb Ernst Toller in der Vorbemerkung zu seiner Autobiographie Eine Jugend in Deutschland: »Wer den Zusammenbruch von 1933 begreifen will, muß die Ereignisse der Jahre 1918 und 1919 in Deutschland kennen, von denen ich hier erzähle.«11
Zu den Grundprinzipien historischer Analyse gehört es, prädeterministischem Denken eine Absage zu erteilen.12 Das Geschehen von 1918/19 und von 1920 bis 1923 musste keineswegs zwangsläufig zu den Ereignissen von 1933 führen. Dennoch können wir auch als Historiker unser Wissen von dem, was 1933 und in den Folgejahren passiert ist, nicht einfach ausblenden. Eine Geschichte der Revolution und der Reaktion in München, die 1930 geschrieben worden wäre, hätte zwangsläufig andere Bewertungen vorgenommen als eine Geschichte, die nach 1945 geschrieben ist. Nicht, weil sich nachträglich etwa der Ablauf der historischen Ereignisse geändert hätte, sondern weil sich unser Blickfeld verschoben hat und sich in der Zwischenzeit andere Fragestellungen ergeben haben. Wäre Hitler 1933 nicht zum Reichskanzler ernannt worden, so wären die Münchner Geschehnisse zwischen 1918 und 1923 wohl eine Randepisode der deutschen Geschichte geblieben. So aber suchen wir, und dies ist durchaus legitim, nach Erklärungen für das zentrale Ereignis der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wir suchen nach ihnen an vielen Stellen, aber eben auch und ganz besonders an jener Schnittstelle der Geschichte, an der Hitler gemäß der Überzeugung der meisten heutigen Historiker den Kern seines späteren politischen Weltbildes entwickelte.
Übereinstimmung besteht darüber, dass von Hitler vor 1919 keine antisemitischen oder antikommunistischen Ansichten überliefert sind. Dabei gehen die Meinungen, ob er in der ersten Hälfte des Jahres 1919 zunächst eine sozialistische Phase durchlaufen hat oder von einer anderen Partei zurückgewiesen wurde, ob er damals bereits politisch interessiert oder noch unpolitisch war, auseinander.13 Anton Joachimsthaler hat als einer der ersten Historiker auf die Bedeutung dieser Phase für die Herausbildung von Hitlers Weltanschauung hingewiesen und kategorisch erklärt: »In dieser Zeitspanne in München liegt der Schlüssel zu Hitlers Einstieg in die Politik, nicht in Wien! Die Revolution und die spätere Räteherrschaft, die die Stadt München und die Menschen aufs tiefste erschütterte, lösten Hitlers Haßgefühle auf alles Fremde und Internationale sowie auf den Bolschewismus aus.«14 Andreas Wirschings differenzierter Betrachtung zufolge war es das besondere Klima in Bayern im Sommer 1919, das ihm eine Bühne für die Entfaltung seiner neuen Rolle auf seiner Suche nach Authentizität bot: »Was er auf ihr demagogisch repetierte, verstärkte, zuspitzte und am Ende wohl auch glaubte, war zunächst nichts anderes als die in Bayern und in seinem Heere omnipräsente völkisch-nationalistische, antibolschewistische und antisemitische Propaganda … Was Hitler also erst zum Trommler und dann zum ›Führer‹ machte, war keineswegs eine Idee, eine festgefügte, granitene Weltanschauung. Vielmehr fand er seine Bühne und die dazu passende Rolle eher zufällig.«15 Die folgenden Kapitel wollen die Fragen nach dem Ursprung von Hitlers Weltbild und seiner Rolle in den politischen Geschehnissen der folgenden Jahre nicht noch einmal neu aufrollen. Vielmehr wollen sie jene Bühne beleuchten, auf der er nun seine neue Rolle erprobte.
Erst aus dem Wissen um die späteren Ereignisse können wir zu der Erkenntnis gelangen, dass München eine Bühne für Hitler und ein ideales Testgelände für den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung bildete. Dabei müssen wir uns stets bewusst sein, dass die Frage der Kausalität nie eindeutige Antworten generieren kann.16 Wenn man suggeriert, dass Hitler und andere Antisemiten wirklich jüdische Revolutionäre benötigten, um ihre Ideologie auszubreiten, so leistet man dem Argument Vorschub, dass die Juden am Ende an ihrem Unglück selbst schuld waren. Ohne einen Trotzki und eine Luxemburg, ohne einen Landauer und einen Leviné wäre das antisemitische Weltbild vielleicht um die Figur des »Judäo-Bolschewisten« ärmer und hätte sich auf die Stereotype der Juden als Kriegsgewinnler, Wucherer und Kapitalisten, als Christusmörder und Ungläubige beschränken müssen. Hätte dies einen Unterschied in der erstaunlichen Erfolgsgeschichte antisemitischer Bewegungen gemacht? Wir können über diese Frage spekulieren, sie aber nicht überzeugend beantworten.
Auch aus diesem Grund wäre es falsch, als Historiker vor den heute im politischen Alltag wieder auflebenden Phrasen antisemitischer Propaganda zu kapitulieren und so zu tun, als hätte es die jüdischen Revolutionäre, Sozialisten und Anarchisten nicht gegeben, als wäre ihre Prominenz in diesem einen kurzen Moment der deutschen Geschichte nicht für alle sichtbar gewesen und als hätten sie ihr Judentum verleugnet. Drehen wir den Spieß doch in Gedanken einmal um: Wäre die nachfolgende Geschichte anders verlaufen, so hätte man dieses Kapitel auch als Erfolgsgeschichte für die deutschen Juden werten können, als eine Episode, auf die sie hätten stolz sein können, statt sich ihrer schämen zu müssen. Man stelle sich ruhig einen Moment lang vor, die Revolution Kurt Eisners hätte Wurzeln geschlagen, die Weimarer Republik hätte überlebt und Walther Rathenau wäre nicht ermordet worden, sondern Außenminister geblieben.17 Wir würden dann die Geschichte einer erfolgreichen deutsch-jüdischen Emanzipation schreiben, in der die Religion und Herkunft der führenden Politiker ihrem politischen Aufstieg nicht im Weg gestanden hätten, wie dies etwa tatsächlich in Italien und Frankreich der Fall war. Diese Hoffnung haben manche Zeitgenossen für einen kurzen Moment im November 1918 geäußert. Sie werteten die Tatsache, dass mit Kurt Eisner ein Jude Ministerpräsident eines deutschen Staates wurde, als Beweis einer gelungenen Integration. Doch kippte die Wahrnehmung sehr rasch, und als Martin Buber im Februar 1919 von einer jüdischen Tragödie sprach, teilte die jüdische Öffentlichkeit bereits diese Meinung.
Dieses Buch will sich keineswegs auf die Spuren kontrafaktischer Geschichte begeben. Es will auch nicht die Ereignisse dieser Jahre ein weiteres Mal zusammenfassen; dies ist häufig genug und durchaus überzeugend getan worden.18 Was dieses Buch dagegen anregen möchte, ist ein Perspektivenwechsel. Es will jene Aspekte einblenden, die die bisherige Forschung zumeist ausblendete, und das Geschehen stärker in den Kontext der jüdischen Geschichte einordnen. Denn auch aus diesem Blickwinkel haben die Ereignisse, die sich in München zwischen 1918 und 1923 abgespielt haben, weit mehr als nur lokale oder regionale Bedeutung. In den folgenden Kapiteln soll den Fragen nachgegangen werden: Wie standen die jüdischen Revolutionäre zu ihrem Judentum und wie hat es sie geprägt? Wie reagierten die nichtjüdische Umwelt und die jüdische Gemeinschaft auf ihr Tun? Wie verwandelte sich die kurz vorher noch als behagliche Heimat geltende Stadt innerhalb weniger Jahre zu einem feindlichen Gelände?
Nicht zufällig beginnt dieses Buch mit einem Zitat aus einem Brief an Martin Buber. Der einflussreichste deutsch-jüdische Philosoph seiner Generation und wohl des gesamten 20. Jahrhunderts beobachtete bei seinem Besuch in München im Februar 1919 in aller Tragweite, was nur wenige Zeitgenossen wahrnahmen: die jüdische Dimension der Ereignisse. Er hatte Eisner getroffen, er kannte das literarische Werk Erich Mühsams und die ersten Veröffentlichungen Ernst Tollers, Gustav Landauer hatte mehrere Artikel für seine Zeitschrift Der Jude beigesteuert. Dass sie alle nun im Zentrum des politischen Geschehens standen, ließ Buber nichts Gutes erahnen. Wenn er notierte, »Das Ganze eine namenlose jüdische Tragödie«, dann meinte der bewusste Zionist damit nicht nur die innerjüdische Zerklüftung und nicht nur die Ermordung Eisners, sondern auch die unsichtbare Mauer, die sich zwischen den jüdischen Revolutionären und ihrer bayerisch-katholischen Umwelt auftat. Buber kannte diese Umwelt besser als die meisten Beteiligten der Münchner Revolution, stammte doch seine Frau Paula Winkler aus einer Münchner katholischen Familie.19
Die Rolle, die Buber in der deutsch-jüdischen Philosophie seiner Zeit spielte, hatte Hermann Cohen in der vorhergehenden Generation eingenommen. War Bubers Einwirken auf Landauer äußerst bedeutend, so spielte Cohen eine wichtige Rolle in der Herausbildung von Kurt Eisners Denken. Eisner selbst bezeichnete den Neukantianer und Religionsphilosophen aus Marburg einmal als die einzige Person, die »geistigen Einfluß auf das Innerste meines Wesens« nahm.20 Eisner und Landauer ohne Cohen und Buber zu verstehen, hieße Marx ohne Hegel zu lesen.
Wenn der jüdische Kontext der Protagonisten der Münchner Revolution in diesem Buch in den Mittelpunkt gestellt wird, soll damit nicht gesagt werden, dass dieser auch in ihrer Selbstwahrnehmung eine zentrale Rolle spielte. Aber ihre jüdische Herkunft, und oftmals auch ihre eigene Reflexion darüber, so die Argumentation dieses Buches, bildete einen Bestandteil ihrer komplexen Persönlichkeiten und wurde ihnen zudem immer wieder von außen vorgehalten. Auch wenn sie ihre formalen Bindungen zur jüdischen Religionsgemeinschaft gelöst hatten, so war ihnen ihre jüdische Herkunft – im Gegensatz etwa zu Rosa Luxemburg oder Leon Trotzki – keineswegs nur ein lästiger Geburtsfehler. Dass dies bisher in der Forschung kaum berücksichtigt wurde, hat mit der oft zugeschriebenen Kausalität zwischen den Ereignissen von 1918/19 und dem Antisemitismus der folgenden Jahre zu tun. Wenn die Revolutionäre wirklich »Juden« waren und nicht nur »jüdischer Herkunft«, dann könnten die Antisemiten ja womöglich ein legitimes Argument haben, so lautete bereits die Argumentation vieler jüdischer Zeitgenossen, die sich deutlich von ihnen distanzierten.21
Waren sie denn nun wirklich Juden? In seinem mittlerweile klassischen Beitrag zum Verständnis der modernen jüdischen Erfahrung hat der Trotzki-Biograph Isaac Deutscher die Figur des »nichtjüdischen Juden« näher beleuchtet und dabei die im Judentum verwachsene Tradition des jüdischen Häretikers nachgezeichnet. Mit Blick auf Spinoza, Marx, Heine, Luxemburg und Trotzki schrieb er: »Jeder von ihnen gehörte zur Gesellschaft und doch wieder nicht, war ein Teil von ihr und wiederum nicht. Dieser Zustand hat sie befähigt, sich in ihrem Denken über ihre Gesellschaft, über ihre Nation, über ihre Zeit und Generation zu erheben, neue Horizonte geistig zu erschließen und weit in die Zukunft vorzustoßen.«22 Für die meisten der Münchner Revolutionäre traf dies ebenso zu. Sie waren nicht Teil der organisierten jüdischen Gemeinde, und die meisten von ihnen hatten auch keinen positiven Bezug zur jüdischen Religion oder zur Religion überhaupt. Doch sie verleugneten ihr Judentum auch nicht. Mit Sigmund Freud waren sie »gottlose Juden« – Juden, deren Judentum nicht eindeutig in Begriffen wie Religion, Nation oder gar Rasse definiert werden konnte.23 Genau diese Ambiguität war, wie der Soziologe Zygmunt Bauman bemerkte, auch ein Grund dafür, dass die Juden in der neuen Staatenordnung nach dem Ersten Weltkrieg und ihrer Vorstellung von eindeutigen Definitionen der Nationen auf enorme Widerstände stießen. Gerade weil sie – etwa in ihrer Sprache, ihrem Habitus und ihrem Aussehen – nicht als die Anderen erkennbar waren, wurden sie in den Augen ihrer Gegner zu besonders gefährlichen Feinden.24
Historiker haben, wie schon die Zeitgenossen, nach Gründen dafür gesucht, warum in der Umbruchszeit zwischen 1917 und 1920 relativ viele jüdische Akteure – Leon Trotzki, Lew Kamenew und Grigori Sinowjew in St. Petersburg, Béla Kun in Budapest und Rosa Luxemburg in Berlin – führende Rollen im revolutionären Geschehen Europas einnahmen.25 Sie haben dafür verschiedene Antworten gefunden. Die für die hohe jüdische Beteiligung an den revolutionären Bewegungen genannten Begründungen greifen zumeist auf die Bedingungen jüdischen Lebens vor der Revolution zurück. Im Zarenreich, wo die meisten Juden lebten, wurden sie systematisch unterdrückt und konnten sich an der aktiven Politik nicht beteiligen. Viele von ihnen erblickten im Sozialismus eine Möglichkeit, ihrer eigenen sozialen Notlage zu entkommen. In Deutschland wären sie seit der rechtlichen Gleichstellung 1871 zwar theoretisch zur politischen Mitbestimmung in der Lage gewesen und auch in den Parlamenten vertreten, doch hatten sie nur im linksliberalen und linken Lager die Möglichkeit, voll akzeptiert zu werden. Daher waren auch die meisten jüdischen Reichstagsabgeordneten vor dem Ersten Weltkrieg Sozialdemokraten, obwohl die große Mehrheit der jüdischen Wähler für die bürgerlichen Parteien der Mitte stimmte.26
Selbstverständlich gab es auch vorher, angefangen mit Karl Marx (dessen antijüdische Aussagen freilich bekannt waren) und Ferdinand Lassalle, bereits zahlreiche Pioniere der Arbeiterbewegung, die jüdischer Herkunft waren. Die Säkularisierung der im Judentum verankerten messianischen Traditionen und der mit den biblischen Propheten verbundene Gerechtigkeitsanspruch in Bezug auch auf andere benachteiligte Bevölkerungsschichten war ein weiterer Grund für das Engagement vieler Juden zugunsten revolutionärer Belange.27 Für den Historiker Saul Friedländer scheint es, »als habe der Tätigkeit der jüdischen Revolutionäre in Deutschland ein fraglos naiver, aber sehr humaner Idealismus zugrunde gelegen: eine Art säkularisierter Messianismus, als ob die Revolution die Erlösung von allen Leiden bringen könnte. Viele glaubten auch, daß die Judenfrage mit dem Sieg der Revolution verschwinden werde.«28 Gershom Scholem sah im Anarchismus – mehr als im Zionismus – die messianische Utopie umgesetzt: »Es liegt in der Natur der messianischen Utopie ein anarchisches Element, die Auflösung alter Bindungen, die in dem neuen Zusammenhang der messianischen Freiheit ihren alten Sinn verlieren.«29 Mit George Mosse kann man in Bezug auf die deutsch-jüdischen Revolutionäre auch die Transformation der Traditionen des deutsch-jüdischen Bildungsbürgertums in einen radikalen politischen Universalismus anführen.30 Zudem bot die internationale Arbeiterbewegung die Aussicht auf eine Heimat jenseits der Gemeinschaft der Nationen, von denen die Juden oft als wurzellos zurückgewiesen wurden.31 Schließlich kommt noch ihre Bereitschaft hinzu, »sich mit der stigmatisierten Klasse des Proletariats zu solidarisieren, da sie als Intellektuelle am sozialen Stigma ihrer Herkunft gelitten hatten.«32
Keiner dieser Beweggründe – von dem Ausschluss aus dem konservativ-bürgerlichen Lager über die Säkularisierung des prophetischen Denkens und des Messianismus bis hin zur Aussicht auf eine Heimat in der internationalen Arbeiterbewegung und der Identifizierung mit anderen sozial randständigen Gruppen – kann unter den Tisch gekehrt werden, doch sollte man sich davor hüten, nach einem einzelnen Motiv zu suchen, das für alle der in München – oder anderswo – beteiligten jüdischen Revolutionäre ausschlaggebend war. Was auch immer im Einzelfall die wichtigsten Gründe für ihren Aktivismus waren: unbestreitbar ist, dass in Deutschland weder vorher noch nachher jemals so viele jüdische Politiker im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen wie während des halben Jahres zwischen November 1918 und Mai 1919. Das Auftreten eines jüdischen Ministerpräsidenten und jüdischer Minister und Volkskommissare war in Deutschland vor allem deswegen so auffallend, weil im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie Italien und Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg im Kaiserreich Juden keine Regierungsverantwortung anvertraut wurde.33 »Bis zum November 1918 hatte die deutsche Öffentlichkeit Juden politisch nur als Parlamentarier und Parteifunktionäre, vornehmlich der linken Parteien, wie auch als Mitarbeiter in den Gemeindevertretungen gekannt. Nun erschienen sie plötzlich in leitenden Regierungsstellen, saßen an Bismarcks Schreibtisch, bestimmten die Geschicke der Nation.«34 1919 jedoch konnten die Zeitgenossen nicht übersehen, was der Literaturhistoriker und Schwiegersohn Albert Einsteins, Rudolf Kayser, in den Neuen Jüdischen Monatsheften unmissverständlich ausdrückte: »So maßlos er von antisemitischer Seite übertrieben, und so ängstlich er vom jüdischen Bürgertum verleugnet wird: der große jüdische Anteil an der heutigen revolutionären Bewegung steht fest; er ist immerhin so groß, dass kein Zufall, sondern eine innere Tendenz ihm gebieten muss; er ist Auswirkung des jüdischen Wesens in eine modern-politische Richtung.«35
Es gab auch in Berlin in dieser Phase jüdische Politiker mit Regierungsverantwortung, wie Kurt Rosenfeld als Leiter des Justizministeriums und Hugo Simon als Finanzminister, und mit Paul Hirsch war ein Jude sogar für kurze Zeit preußischer Ministerpräsident. Doch in keiner Stadt war die Beteiligung von Juden am revolutionären Geschehen so ausgeprägt wie in München.36 Hier waren unter den prominentesten Vertretern der Revolution und der Räterepubliken Menschen jüdischer Herkunft in großer Zahl vertreten. Dazu gehörten neben Eisner auch sein ihm stets zur Seite stehender Sekretär Felix Fechenbach und sein schon in jungen Jahren getaufter Finanzminister Edgar Jaffé, wie auch Landauers Mitstreiter in der ersten Räterepublik, Ernst Toller und Erich Mühsam, Otto Neurath und Arnold Wadler. Der führende Kopf der zweiten Räterepublik war der aus Russland stammende Kommunist Eugen Leviné. In seinem Umkreis wirkten weitere russische Kommunisten wie Towia Axelrod und Frida Rubiner.
Die einzige Stadt, die in dieser Beziehung und zu dieser Zeit eine Parallele zu München aufweisen kann, ist Budapest. István Déak schrieb über die im März 1919 errichtete ungarische Räterepublik: »Juden hatten in den 133 Tagen der Räterepublik 1919 nahezu ein Monopol an politischer Macht.«37 Und wie in München wurden sie von der ein halbes Jahr später an die Macht geschwemmten Reaktion unter Admiral Horthy zum Sündenbock für alle Verbrechen der Epoche erklärt.38
Jüdische Revolutionäre machen noch keine jüdische Revolution
Doch die andere Seite der Medaille wird oft vergessen. Genauso wie die jüdischen Revolutionäre nichts mit der offiziellen jüdischen Gemeinde zu tun haben wollten, distanzierte sich die große Mehrzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinde von der Revolution. Sie fühlten sich als direkte Opfer der Ereignisse, da sie ohne ihr Zutun mit der Revolution identifiziert wurden. Manche von ihnen wandten sich direkt an Eisner oder die Akteure der Räterepublik, um sie zum Rücktritt zu bewegen oder zumindest um ihnen ihre Ablehnung kundzutun. Einzelne jüdische Aktivisten versuchten sogar die Räterepublik zu stürzen. Die jüdischen Zeitungen machten unmissverständlich klar, dass ihre Leserschaft mit keiner radikalen politischen Position identifiziert werden wollte. So tauchen auf den folgenden Seiten neben den bekannten Namen der jüdischen Revolutionäre und der antisemitischen Reaktionäre auch zahlreiche Protagonisten auf, die heute in Vergessenheit geraten sind.
Der Bogen der Akteure mit jüdischem Familienhintergrund in diesem Geschehen ist äußerst weit gespannt. In den folgenden Kapiteln begegnen uns Figuren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da sind natürlich die bekannten Namen wie Kurt Eisner, Felix Fechenbach, Gustav Landauer, Ernst Toller und Erich Mühsam, die nicht nur politisch, sondern auch und oftmals in erster Linie literarisch in Erscheinung treten. Neben ihnen stehen die Kommunisten der Zweiten Räterepublik Eugen Leviné und Towia Axelrod. Wir treffen aber auch die damals prominenten Anwälte Philipp Löwenfeld und Max Hirschberg, die sich gemeinsam mit vielen anderen Münchner Juden für einen gemäßigten Sozialismus und gegen den »kommunistischen Terror« aussprechen.39
Erstmals konnten in dieser Zeit Frauen ihre Stimme im öffentlichen Raum hörbar machen. In München traten sie nicht in der ersten Reihe der politischen Aktivisten auf, was sich auch in dieser Darstellung widerspiegelt. Dennoch sind gerade die Lebensläufe einiger dieser jüdischen Frauen besonders faszinierend. Die im Vorfeld der Revolution prominenteste Mitstreiterin Kurt Eisners war die aus Polen stammende Sarah Sonja Lerch-Rabinowitz, die im Januar 1918 Arbeiter und Arbeiterinnen in Munitionsfabriken zum Streik motiviert hatte und sich im Gefängnis München-Stadelheim wenig später das Leben nahm. Ihre Schwester Rahel Lydia Rabinowitz vertrat ebenso radikale, allerdings völlig anders ausgerichtete Ansichten. Als Zionistin argumentierte sie, ein Jude dürfe keine öffentliche Position in einem deutschen Staatswesen einnehmen. Davon unterschied sich die Ärztin Rahel Straus, die – ebenfalls als Zionistin – die Juden keineswegs als Fremdlinge in Deutschland ansah. Frida Rubiner wiederum spielte als überzeugte Kommunistin eine aktive Rolle während der zweiten Räterepublik.
Wir begegnen orthodoxen Juden wie dem Herausgeber der in Regensburg ansässigen Deutschen Israelitischen Zeitung, Rabbiner Seligmann Meyer, der zur Wahl der konservativen Bayerischen Volkspartei aufruft, dem Vorsitzenden des orthodoxen Synagogenvereins Ohel Jakob, Kommerzienrat Siegmund Fraenkel, der sich in einem offenen Brief von den jüdischen Mitgliedern der Räteregierung distanziert und wenige Jahre später von Nationalsozialisten auf der Straße zusammengeschlagen wird, sowie den unterschiedlichen Mitgliedern der Feuchtwanger-Familie.
Dann gibt es die Beobachter der Szene, die von außen kommend, ihre Eindrücke schildern, wie Victor Klemperer, der Privatdozent an der Münchner Universität war und für die Leipziger Neuesten Nachrichten berichtet. Obwohl selbst bereits protestantisch getauft, beschreibt er mit zunehmendem Schrecken den Antisemitismus der Zeit – so wie er später einer der nachdrücklichsten Chronisten der NS-Herrschaft werden sollte. Gershom Scholem, damals noch Gerhard, macht auf seinem Weg von Berlin nach Jerusalem in München Zwischenstation. Hier beginnt er mit seiner Promotion über das Buch Bahir seinen Weg zum wichtigsten Erforscher der jüdischen Mystik und hier knüpft er freundschaftliche Bande zu dem späteren Literaturnobelpreisträger Samuel Josef Agnon, der mitten in den Revolutionswirren Anfang April 1919 im Auftrag seines Gönners Salman Schocken von Leipzig nach München zog, um mit der Zeichnerin Tom (Martha) Freud, einer Nichte Sigmund Freuds, an einem hebräischen Kinderbuch zu arbeiten.
Schließlich muss man noch eine Kategorie von Personen erwähnen, deren Denk- und Handlungsweisen zumindest teilweise mit ihrer eigenen Distanzierung von ihrem jüdischen Hintergrund zu erklären sind – einem Phänomen, das der Philosoph Theodor Lessing in einer vieldiskutierten Schrift aus dem Jahre 1930 etwas verkürzend als »Jüdischen Selbsthass« bezeichnete. Hierzu kann man einen der einflussreichsten Münchner nach dem Ersten Weltkrieg zählen: den konservativen Publizisten Paul Nikolaus Cossmann, Herausgeber der Süddeutschen Monatshefte, entscheidender Kopf hinter der wichtigsten Tageszeitung, den Münchner Neuesten Nachrichten und einer der Hauptverbreiter der Dolchstoßlegende. Er war ebenso zum Christentum konvertiert wie der gebürtige Ungar Ignatz Trebitsch-Lincoln, der nach seinen Rollen als kanadischer Judenmissionar, englischer Unterhausabgeordneter und deutscher Spion Anfang der zwanziger Jahre in München auftauchte, um gemeinsam mit Rechtsradikalen die Fäden eines Komplottes zu ziehen, das eine reaktionäre Alpenrepublik zum Ziel hatte. Zu guter Letzt muss man in dieser Reihe wohl auch den Eisner-Mörder Graf Anton von Arco nennen, der zwar nicht als Jude auf die Welt kam, aber seine Tat auch damit rechtfertigte, dass er sich trotz des jüdischen Hintergrunds seiner Mutter Emmy von Oppenheim in der rechtsradikalen Thule-Gesellschaft Anerkennung verschaffen wollte.
Teilweise befanden sich die jüdischen Akteure in ganz offenem Konflikt untereinander. Erich Mühsam lehnte die Politik des Ministerpräsidenten Kurt Eisner als zu gemäßigt ab. Der Pazifist Ernst Toller lieferte sich während der zweiten Räterepublik heftige Auseinandersetzungen mit dem Kommunisten Eugen Leviné, der wiederum Toller, Mühsam und Landauer der völligen »Ahnungslosigkeit« bezichtigte. Eisner kam aus dem moderaten Flügel der Sozialdemokratie und schloss sich wegen seiner langsam wachsenden Ablehnung des Krieges der USPD an; Landauers Weltanschauung war durch Grundprinzipien des Anarchismus geprägt; Leviné handelte im Auftrag der Kommunistischen Partei. Diese Konflikte reichten weit über Meinungsverschiedenheiten hinaus. Am Palmsonntag 1919 versuchten die sozialdemokratischen Rechtspraktikanten Franz Guttmann und Walter Löwenfeld die Räterepublik militärisch zu Fall zu bringen. 1922 standen sich in einem Hochverratsprozess Paul Nikolaus Cossmann als Kläger und Felix Fechenbach als Angeklagter gegenüber. Der politische Riss ging oftmals quer durch die Familien. Ein Cousin Ernst Tollers kämpfte 1919 als Leutnant der weißen Garde im Freikorps Epp. Die Geschwister Erich Mühsams waren Zionisten, und sein Cousin, der Schriftsteller Paul Mühsam, verurteilte den »Massenterror der Spartakusgruppe« scharf. Der Bruder des sozialdemokratischen Nürnberger Landtagsabgeordneten Max Süßheim war der bürgerlich-konservative Orientalist und Münchner Privatdozent Karl Süßheim, der 1919 deutschnational wählte.40
Der antisemitische Mythos einer »jüdischen Revolution« ist daher ebenso absurd wie die Schutzbehauptung der jüdischen Gemeinde, die jüdischen Revolutionäre seien alle keine Juden mehr. Es gab keinen politischen Konsens unter den jüdischen Revolutionären, geschweige denn unter der jüdischen Gemeinschaft insgesamt. Konstatieren kann man lediglich die rege Beteiligung jüdischer Akteure auf allen Seiten, und zwar aus Gründen, die – wie oben genannt – keineswegs geheimnisvoll, sondern historisch durchaus nachvollziehbar sind. Juden wurden für einen kurzen historischen Moment auf die politische Bühne gespült – und dies wiederum lieferte ihren Gegnern Munition. Diese suchten nach einfachen Erklärungen für Deutschlands Niederlage im Weltkrieg, den Untergang der Monarchie, die Frage nach der Kriegsschuld und die auferlegten Strafmaßnahmen. Die militärische Niederlage oder das Versagen der alten politischen Führungsschicht waren mit dem Ehrgefühl dieser rechtsnationalen Kreise nicht vereinbar. So fand man die Sündenböcke für die nun entstehende Dolchstoßlegende dort, wo sie am leichtesten zu identifizieren waren: bei den Juden und bei den Linken. Wenn sie beides in einem vereinten, war die Zielscheibe besonders groß.
Die gute alte Zeit?
Nicht nur der Wahlmünchner Thomas Mann betrachtete mit Entsetzen die Verwandlung Münchens innerhalb weniger Jahre von einem Zentrum »heiterer Sinnlichkeit«, von »Künstlertum« und »Lebensfreundlichkeit« zu einer Stadt, die als »Hort der Reaktion, als Sitz aller Verstocktheit und Widerspenstigkeit« verschrien war und die man nun eine »dumme, die eigentlich dumme Stadt nannte«. Vor dem Krieg war München die liberale Stadt, Berlin das Zentrum der Reaktion gewesen: »Hier war man künstlerisch, dort politisch-wirtschaftlich. Hier war man demokratisch und dort feudal-militaristisch. Hier genoß man einer heiteren Humanität, während die harte Luft der Weltstadt im Norden einer gewissen Menschenfeindlichkeit nicht entbehrte.« 1926, als er diese Sätze über München schrieb, hatte er bereits »mit Kummer sein gesundes und heiteres Blut vergiftet gesehen durch antisemitischen Nationalismus.«41 Der gebürtige Münchner Lion Feuchtwanger nahm diesen Wandel zum Thema seines Romans Erfolg, der aus geringster Distanz die besondere Atmosphäre Münchens in den frühen zwanziger Jahren plastischer beschreibt als jedes historische Werk dies tun könnte. Darin heißt es: »Früher hatte die schöne, behagliche Stadt die besten Köpfe des Reichs angezogen. Wie kam es, daß die jetzt fort waren, daß an ihrer Stelle alles, was faul und schlecht war im Reich und sich anderswo nicht halten konnte, magisch angezogen nach München flüchtete?«42 Die Berliner Beobachter mochten bei der Lektüre von Thomas Mann oder Lion Feuchtwanger daran erinnert sein, dass die Vossische Zeitung schon im Oktober 1923 diese Entwicklung der bayerischen Landeshauptstadt konstatiert hatte: »Im Kaiserreich war München demokratisch und das Asyl all derjenigen im Norden als revolutionär verschrienen Elemente, die der Unduldsamkeit norddeutscher Polizeiorgane weichen mussten. Jetzt ist wiederum München deutscher Asylort. Aber nun für die Vertreter jener alten preußischen Junkerherrschaft, gegen die die Bayern früher nicht genug Sturm laufen konnten.«43
Um die Geschehnisse der Zeit nach dem Krieg richtig einzuschätzen, ist zumindest ein kurzer Rückblick in die Zeit davor unabdingbar. Die Stereotypen sind klar. Die Prinzregentenzeit war »die gute alte Zeit«, der Weltkrieg zerstörte die alte Ordnung, und die Revolution sowie die beiden kurzlebigen Räterepubliken legten den Grundstein für die darauffolgende Reaktion. Wie heißt es doch in der Eröffnungssequenz einer der beliebtesten bayerischen Fernsehserien der Bundesrepublik, dem Königlich Bayerischen Amtsgericht: »Ja, ja, es war halt doch eine liebe Zeit, die gute alte Zeit in Bayern, damals als noch Seine Königliche Hoheit der Herr Prinzregent regierte, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel damals und die Menschen waren typisch; die Burschen schneidig, die Dirndln sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals; denn für Ruhe und Ordnung sorgte die Gendarmerie. Und für die Gerechtigkeit das Königliche Amtsgericht.«44
In der populären Rezeption hat sich dieses konservativ idealisierte Bild der Prinzregentenzeit bis heute erhalten. Auch für die Juden schien in dieser Zeit die Welt noch in Ordnung gewesen zu sein – zumindest auf den ersten Blick. Man hat das Bild vor Augen, wie sich der orthodoxe jüdische Familienklan der Feuchtwangers nach dem morgendlichen Synagogenbesuch am Samstag und dem kleinen Mittagsimbiss zu Hause am Nachmittag geschlossen zum Kaffeetrinken an seinen Stammtisch ins Hofbräuhaus begab. Selbstverständlich ließen sie, da das Mitführen von Geld am Schabbat verboten ist, anschreiben und beglichen die Rechnung an einem Wochentag. Nicht selten endete das Fasten am Versöhnungstag Jom Kippur bei einer Maß im Festzelt auf dem Oktoberfest.45 Und die Biergärten schienen wie geschaffen für die orthodoxen Juden. Man konnte sein koscheres Essen selbst mitbringen, und das nach dem Reinheitsgebot gebraute Bier entsprach allen jüdischen Speise- und Trinkvorschriften.
Die Münchner Juden, die mit Ausnahme von wenigen Familien, wie eben der älteren Generation der Feuchtwangers, ihre Strenggläubigkeit längst abgelegt hatten, pflegten die gleiche bayerische Mundart wie ihre christlichen Nachbarn. Sie liebten die Berge und verbrachten die Sommerferien an den bayerischen Seen, sie waren treue Anhänger der Wittelsbacher Monarchie. Jüdische Firmen wie das Trachtenhaus Wallach trugen zur Verbreitung von Lederhosen und Dirndln bei. Münchner Juden standen an der Spitze der Löwenbräu-Brauerei und des FC Bayern München. Unter ihnen waren Bankiers und Kaufhausbesitzer, Ärztinnen und Anwälte, Salondamen und Sekretärinnen, aber auch Lumpenhändler und Bettler, ostjüdische Industriearbeiter und Handwerker. Sie waren Königstreue und Revolutionäre, Religiöse und Atheisten. Mit Stolz verwiesen sie auf ihre Hauptsynagoge im Stadtzentrum, die auf vielen Postkarten neben der Frauenkirche die Silhouette der Stadt prägte. In Anwesenheit der Spitzen der Stadt wurde sie am 16. September 1887 in einem feierlichen Festakt eingeweiht. Sie sah von außen aus wie eine neoromanische Kirche. Die Gottesdienste wurden von Orgelmusik umrahmt, was ein fester Bestandteil der liberal geprägten Gemeinden war, aber für die orthodox geprägte Minderheit einen Verstoß gegen das jüdische Religionsgesetz bedeutete. Diese errichtete fünf Jahre später die kleinere, aber ebenfalls prachtvolle orthodoxe Synagoge Ohel Jakob (Jakobs Zelt). Die Synagogenbauten reflektieren die stetig zunehmende Zahl der jüdischen Bevölkerung in München, die von 2000 im Jahre 1867 auf 11 000 im Jahre 1910 angewachsen war.46
Seit der Jahrhundertwende änderte sich das Gesicht der jüdischen Gemeinde. Waren es vorher vor allem Zuwanderer aus fränkischen und schwäbischen Landgemeinden, die auf der Suche nach Arbeit und gesellschaftlichem Aufstieg in die Landeshauptstadt gezogen waren, so kamen nun zunehmend Juden aus den östlichen Gebieten Europas, vor allem aus der zum Habsburgerreich gehörenden Provinz Galizien, die für viele Juden und Nichtjuden im Westen als Inbegriff der kulturellen Rückständigkeit galt und die von dem selbst dort aufgewachsenen Schriftsteller Karl Emil Franzos abschätzig als »Halb-Asien« bezeichnet wurde.47 Vor dem Ausbruch des Krieges waren etwa ein Viertel der Gemeindemitglieder sogenannte »Ostjuden«, die sich vor allem in der Isarvorstadt niederließen und von ihren westjüdischen Glaubensgenossen nicht immer mit offenen Armen begrüßt wurden.
Die 1887 errichtete Hauptsynagoge prägte das Münchner Stadtbild bis zu ihrem Abriss 1938
Mit der 1897 gegründeten Zionistischen Bewegung wollten die wenigsten der Münchner Juden etwas zu tun haben. Daran ließen sie keinen Zweifel, als Theodor Herzl, vor allem wegen der zentralen Lage und günstigen Verkehrsanbindung der Stadt, den ersten Zionistenkongress an der Isar plante. Er hatte bereits die Einladungen drucken lassen, als ihm von Seiten der Israelitischen Kultusgemeinde in München wie auch des Allgemeinen Rabbinerverbands in Deutschland unmissverständlich signalisiert wurde, dass er sich einen anderen Ort suchen müsse, da die Münchner Juden, wie ihre restlichen Glaubensgenossen im Reich, nicht im Traume daran dachten, ihre Heimat an der Isar, am Main oder an der Spree zu verlassen, um sich an den Gefilden des Jordans niederzulassen. So wurde nicht München, sondern das schweizerische Basel die Geburtsstätte des politischen Zionismus. In München entstand eine zahlenmäßig kleine und vor allem von der Unterstützung der zugewanderten osteuropäischen Juden zehrende zionistische Ortsgruppe. Wie andernorts in Deutschland, war ihr Ziel nicht etwa, selbst nach Palästina auszuwandern, sondern eine nationale Heimstätte für die von den Pogromen geplagte, wirtschaftlich verarmte und wesentlich größere jüdische Bevölkerung des Zarenreichs zu schaffen.48
Die jüdische Gemeinschaft Münchens empfand sich als Teil der Stadt, konnte aber auch zahlreiche eigene Institutionen aufweisen, von Wohltätigkeitsorganisationen bis zu Studentenverbindungen, vom Jüdischen Schwesternheim bis zum Jüdischen Frauenbund. Die im politischen Sinn wichtigste Organisation war die Ortsgruppe des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der es sich auf seine Fahnen geschrieben hatte, überall dort einzuschreiten, wo die auf dem Papier seit der Reichsgründung verbriefte rechtliche Gleichstellung der Juden gefährdet war. Im Parteienspektrum fühlten sich die meisten Münchner Juden, wie die Juden im restlichen Deutschland, am ehesten durch die Nationalliberalen und Progressiven vertreten. Von den rechtsstehenden Parteien trennte sie deren offener oder versteckter Antisemitismus, von der Sozialdemokratie, die weitgehend noch eine Klassenpartei darstellte, in den meisten Fällen ihre wirtschaftlichen Interessen.
Sie lebten in einer Stadt, deren Ruf als kultureller Mittelpunkt Deutschlands seit der Jahrhundertwende zunehmend von Berlin herausgefordert wurde. Doch blieb München zunächst weiterhin das Zentrum zahlreicher kultureller Unternehmungen, von den Künstlern der Münchner Sezession bis zu den Satirikern und Karikaturisten der Zeitschrift Simplicissimus, von der einem neuen Kunststil den Namen gebenden Zeitschrift Jugend bis zu den richtungsweisenden Malern des Blauen Reiter. München war in jenen Jahren die Heimat solch unterschiedlicher Charaktere wie Heinrich und Thomas Mann, Rainer Maria Rilke und Ludwig Thoma, Frank Wedekind und Lion Feuchtwanger. Die Malerfürsten Franz von Lenbach und Franz von Stuck residierten hier ebenso wie der Dichterfürst Stefan George mit seinem Kreis. Das kulturelle Leben spielt sich zumeist auf engstem Raum in dem von Franziska von Reventlow als Wahnmoching bezeichneten Schwabing ab. Man wähnte sich in diesen wenigen Quadratkilometern zwischen dem als Café Größenwahn bekannten Café Stefanie und dem Café Luitpold, zwischen dem Alten Simpl und dem Kabarett Elf Scharfrichter als Walhalla und als Olymp, als Hauptort der deutschsprachigen Kultur und als gemütliche bayerische Provinz, als Bohème und als Avantgarde zugleich.
So rosig wie im Königlich Bayerischen Amtsgericht dargestellt war die gute alte Zeit jedoch keineswegs. Auch nicht für die Juden. Die traditionellen antijüdischen Ressentiments waren trotz der 1861 erfolgten offiziellen Gleichstellung der Juden im Königreich Bayern nie ganz verschwunden. Der Name Antisemitismus tauchte in Deutschland erstmals 1879 auf und repräsentierte eine neue, pseudowissenschaftliche Variante des Judenhasses, der man nun auch durch den Übertritt zu einer christlichen Konfession nicht entkommen konnte. 1891 gründete sich in München die erste offen antisemitische Organisation, der Deutsch-Soziale Verein. Der Kartograph Ludwig Wenng gab mit dem Deutschen Volksblatt das Presseorgan des Vereins heraus, wie der Untertitel – Bayrische antisemitische Zeitschrift für Stadt und Land – verdeutlichte. Später benannte der Verein sich in Antisemitische Volkspartei um. In München wie in ganz Bayern blieben die antisemitischen Parteien weit weniger erfolgreich als in vielen anderen Teilen des Reichs und erreichten kaum mehr als 1 Prozent der Stimmen. Dass es aber ein gewisses Potential für antisemitisches Ideengut gab, wurde deutlich, als der reichsweit bekannte Antisemit Hermann Ahlwardt 1895 bei einer Versammlung 5000 Besucher anzog. Einen Teilerfolg erzielte die sich nun nach dem Vorbild der Partei des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger nennende Christlich-Soziale Vereinigung, als es ihr mit Hilfe eines Wahlbündnisses mit dem Zentrum gelang, bei der Kommunalwahl in München 1905 einen antisemitischen Kandidaten in das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten zu entsenden.49 Wie weit antisemitische Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft bestanden, war auf der neugotischen Fassade des eben errichteten Neuen Rathauses weithin sichtbar. Das hier dargestellte jüdische Paar ist so ausgestattet, wie sich die breite Öffentlichkeit die Juden vorstellte: der Mann mit einem Geldsack, die Frau mit einem Schmuckkästchen. In den Worten des Historikers Andreas Heusler war der Antisemitismus »das gemeinsame Glaubensbekenntnis, auf das sich alle völkisch-nationalistischen Gruppierungen, Korporationen und Sekten im München der Jahrhundertwende einigen konnten.«50 Hinzu kam, dass München noch vor Kriegsende das Zentrum der alldeutschen Agitation war und in den Kreisen der Anarchisten und Freidenker, wie Erich Mühsam behauptete, den Ruf der Stadt mit der reaktionärsten Polizei hatte.51
Bereits vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war in München eine Epoche zu Ende gegangen. Symbolisiert wurde dies durch den Tod des Prinzregenten Luitpold. An die Stelle des volkstümlichen Herrschers rückte mit dessen Sohn Ludwig III. ein Fürst an die Spitze, dem von vielen vorgehalten wurde, dass er sich 1913 zum König krönen ließ, obwohl der geistig kranke eigentliche Throninhaber Otto noch am Leben war. Auch im Volke war die politische Gärung zu spüren. Als im Dezember 1914 trotz des Kriegs in München Gemeindewahlen stattfanden, konnten die Sozialdemokraten ihre 1911 errungene Stellung als stärkste Partei weiter ausbauen. Wenige Monate später wurde aufgrund der Versorgungsprobleme die Nahrung rationiert, und es wurden Lebensmittelmarken in der Stadt eingeführt. Für die Münchner noch viel schlimmer, gab es ab 1916 nur mehr Dünnbier.52 Zu dieser Zeit begann sich eine Gruppe von Friedensgesinnten im Gasthof »Goldener Anker« zu versammeln. Aus dieser Gruppe, in der um Kurt Eisner auch Ernst Toller und Sarah Sonja Lerch-Rabinowitz beteiligt waren, ging im Januar 1918 die Streikbewegung in Münchner und Nürnberger Munitionsfabriken hervor.
Der Ausbruch des Kriegs mit Kaiser Wilhelms Bekenntnis zum Burgfrieden, in dem es keine Unterschiede der Parteien und Konfessionen mehr geben sollte, leitete auch für die Juden nur kurzfristig ein Ende der gesellschaftlichen Barrieren ein. Spätestens mit der 1916 vom preußischen Kriegsminister angeordneten Zählung der Juden, die auch das bayerische Heer betraf, war die Unterscheidung wiederhergestellt.53 In Bayern mehrten sich ebenfalls mit zunehmender Kriegsdauer die desillusionierten Stimmen. So warnte der Münchner Rabbiner Cossmann Werner auf der Hauptversammlung des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens im Februar 1917: »Wir gehen schweren Zeiten entgegen, darüber täuschen wir uns nicht. Der nationale Chauvinismus ist erwacht …« Der Münchner Kaufmann Siegmund Fraenkel sagte nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg sogar Pogrome gegen die Münchner Juden voraus.54 Die 1917 gegründete Deutsche Vaterlandspartei propagierte in ihrem Münchner Verband nicht nur annexionistische Kriegsziele, sondern positionierte sich auch antisemitisch und zählte zu den Wegbereitern der ultranationalen und völkischen Bewegungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Zu ihren Mitgliedern gehörten neben Industriellen und bürgerlichen Intellektuellen auch der Volksdichter Ludwig Thoma, der Verleger Julius Lehmann, Cosima Wagner und Houston Stewart Chamberlain sowie der spätere Gründer der Deutschen Arbeiterpartei (der Vorläuferin der NSDAP), Anton Drexler.55
Die »Judenfrage« rückt in den Mittelpunkt
Die antisemitischen Exzesse der Zeit nach dem Krieg wären undenkbar gewesen, wenn nicht bereits vorher ein fruchtbarer Boden dafür bestanden hätte. Antijüdische Ressentiments hatten tiefe Wurzeln geschlagen, die bis weit in die Vormoderne reichten und immer wieder vor allem anlässlich politischer Umbrüche an die Oberfläche drangen. Dies geschah sowohl im Umfeld der Wiederherstellung der restaurativen Verhältnisse in den antijüdischen Ausschreitungen von 1819 wie auch im Umfeld der gescheiterten Revolution von 1848, als Tausende von Petitionen aus ganz Bayern gegen die vorgesehene Emanzipation der Juden eingingen. Während des Kaiserreichs wucherten diese Ressentiments zumeist unterirdisch weiter.56 Es ist kein Zufall, dass sie 1918/19 wiederum in einer Zeit des Umsturzes sichtbar wurden. Eisner und seine Genossen verursachten den Antisemitismus nicht, die mit ihnen verbundenen Ereignisse reaktivierten ihn lediglich.
Was sich jetzt aber grundsätzlich geändert hatte, war die Allgegenwärtigkeit der »Judenfrage«. Es würde sich wohl lohnen, systematisch zu untersuchen, wie selten das Wort »Jude« in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und wie häufig es nach dem Krieg in der Presse vorkam. Ab 1919 verging kaum eine Woche, in der nicht von den Juden als Kommunisten oder Kapitalisten, Drückebergern oder Kriegsgewinnlern berichtet wird oder derartige Berichte dementiert werden. Wenn von fremdstämmigen oder landfremden Elementen die Rede ist, sind diese zumeist als Codewörter für Juden gemeint. Ebenso wenn die Ausdrücke Wucherer und Schieber fallen. Die rechte Presse machte die Juden verantwortlich für den Verlust des Krieges, für die Revolution und für den »Schandfrieden« von Versailles. Doch auch in der bürgerlichen und linken Presse ist nun andauernd von den Juden die Rede: wenn über die Revolutionäre und ihr blutiges Ende berichtet wird; wenn die Ausweisungsaktion gegen die Ostjuden diskutiert wird; wenn ein jüdischer Minister ermordet wird und ein Abgeordneter öffentlich bestreitet, jüdisch zu sein; wenn ein jüdischer Kaufmann auf offener Straße zusammengeschlagen wird und wenn Schmierereien an den Synagogen angebracht werden.
Die Tendenz der Artikel ist unterschiedlich: Mal sind sie gegen und mal für die Juden gestimmt. Doch die häufige Frequenz der jüdischen Thematik lässt sich nicht übersehen. Im München der frühen zwanziger Jahre bildet sich die Vorstellung heraus, dass die »Judenfrage« – egal, was man darunter verstand, von immenser Bedeutung war. Dass die Juden weniger als zwei Prozent der Münchner Bevölkerung ausmachten, spielte dabei keine Rolle. In der öffentlichen Wahrnehmung war die »Judenfrage« in München präsent, lange bevor sie in anderen Teilen des Reichs ebenso wahrgenommen wurde.
Bevor München die Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung wurde, war sie bereits die Hauptstadt des Antisemitismus in Deutschland geworden. Dazu machten sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht nur die hohe Konzentration antisemitischer Gruppierungen von der Thule-Gesellschaft über die Freikorps bis zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, nicht nur das radikal antisemitische Netzwerk baltendeutscher Emigranten um den späteren NS-Ideologen Alfred Rosenberg und dessen Verbreitung antisemitischer Machwerke des Zarenreichs,57 nicht nur der judenfeindliche Schriften publizierende Verlag von Julius Lehmann und Zeitungen wie der Völkische Beobachter, der im Umland beheimatete Miesbacher Anzeiger oder das Blatt des Hitler-Mentors Dietrich Eckart, Auf gut deutsch, nicht nur Synagogenschmierereien, Friedhofsschändungen und brutale Überfälle auf jüdische Bürger. Dazu machte sie vor allem der Umstand, dass der Antisemitismus in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg unmittelbar in die Mitte der bayerischen Politik, der Ordnungskräfte, der Justiz und der Medien eingedrungen war.
Es gab damit keine Ordnungsinstanz, die das explosive Gemisch, das sich in München nach dem Ersten Weltkrieg herausgebildet hatte, entschärft hätte. Im Gegenteil, der bayerische Ministerpräsident und Generalstaatskommissar Gustav von Kahr sorgte in seiner »Ordnungszelle« Bayern dafür, dass sich dieses Gemisch auch tatsächlich entzündete. Er initiierte 1920 und 1923, nur wenige Tage, nachdem er seine jeweiligen Ämter angetreten hatte, die Ausweisung ostjüdischer Bürger aus Bayern. Führende Köpfe im Münchner Polizeipräsidium, inklusive ihres Präsidenten Ernst Pöhner und des Leiters der Politischen Abteilung, Wilhelm Frick, frönten einem offenen Antisemitismus und gehörten zu den frühesten Nationalsozialisten. Während Verbrechen von links mit harten Strafen geahndet wurden, lobten zahlreiche bayerische Richter die Verbrechen von rechts als heldenhafte vaterländische Taten und verhängten milde Strafen. Die wichtigsten Münchner Zeitungen waren ab 1920 ins rechte Fahrwasser gekommen. Für Thomas Mann war München bereits im Juni 1923 »die Stadt Hitlers«.58
Der Anfang des Aufstiegs einer antisemitischen Bewegung in Deutschland ging mit Hitlers erstem Versuch, die Macht zu erobern, am 9. November 1923 vorläufig zu Ende. Trotz des Scheiterns des Putsches war die Marginalisierung der jüdischen Bevölkerung erfolgreich erprobt worden. Die Identifizierung der Revolution als ein jüdisches Unternehmen, die Brandmarkung von Juden als Drückeberger und Kriegsgewinnler, die zwei Mal versuchte Ausweisung osteuropäischer Juden und schließlich die Gewaltexzesse der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923 sandten ein deutliches Signal an die Münchner Juden. Während die Bevölkerung der Stadt weiter anwuchs, nahm die Zahl ihrer jüdischen Einwohner zwischen 1910 und 1933 deutlich ab und sank von 11 000 auf 9000. Einige ihrer bekanntesten Namen verließen die Stadt München und das Land Bayern. Jüdische Reisende wurden aufgefordert, Bayern zu meiden. Damals konnte niemand wissen, dass dies nur das Vorspiel eines Dramas war, das sich zehn und zwanzig Jahre später neu entfalten sollte, als die »namenlose jüdische Tragödie« einen Namen erhalten sollte.
2 Jüdische Revolutionäre in einem katholischen Land
»Juden sind die Jakobiner der Epoche.«
Jakob Wassermann1
Chanukka 5679 (November 1918)
Man schrieb den 25. Kislew des Jahres 5679, oder im bürgerlichen Kalender den 28. November des Jahres 1918. Wie in der ganzen Welt, so versammelten sich auch die Juden Münchens am Abend im Familienkreis, um das erste Licht des Chanukkafestes anzuzünden. Man gedachte des Wunders von Jerusalem, wo zwei Jahrtausende vorher der jüdischen Tradition zufolge der Tempel von den Makkabäern wieder geweiht wurde, nachdem er von den griechischen Herrschern geschändet worden war. Das wenige übriggebliebene geweihte Öl hätte eigentlich nur für einen Tag reichen sollen, doch der Überlieferung zufolge brannte es wunderbarerweise acht Tage lang. So begehen die Juden seitdem ein achttägiges Lichterfest, das sowohl an den Makkabäeraufstand wie auch an das Lichtwunder erinnern soll.
Im Jahre 5679 hatte das Chanukkafest eine ganz besondere Bedeutung. Es war der erste jüdische Feiertag nach dem Ende des Weltkriegs, in den auch Hunderttausende jüdischer Soldaten in ganz Europa gezogen waren und aus dem viele nicht mehr zurückkamen. Der Krieg war beendet, Zar und Kaiser waren gestürzt, neue demokratische Staaten entstanden. In Deutschland wollten die Juden endlich die volle Gleichstellung nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der gesellschaftlichen Realität genießen; in Osteuropa kämpften sie als nationale Minderheit für eine weitgehende kulturelle und rechtliche Autonomie; und in Palästina versprachen die neuen britischen Herrscher ihnen gar eine eigene nationale Heimstätte.
Für die bayerischen Juden kam aber noch etwas ganz Unerwartetes hinzu. An der Spitze des neuen Freistaats stand seit drei Wochen mit Ministerpräsident Kurt Eisner der erste Jude, der jemals einen deutschen Staat regierte. Ein neues Chanukkawunder? Ein moderner Makkabäer an der Isar? Keineswegs. Eisner selbst feierte, soweit wir wissen, weder Chanukka noch irgendeinen anderen jüdischen Feiertag. Er kam vielmehr einen Monat später mit seinem Weggefährten Gustav Landauer im schwäbischen Krumbach zusammen, um gemeinsam mit dessen Töchtern die Weihnachtsfeiertage zu begehen. Auch der Dichter Erich Mühsam, der für sich in Anspruch nahm, noch vor Eisner die Republik ausgerufen zu haben und später neben Landauer eine wichtige Figur in der Räterepublik war, hatte sich längst von der jüdischen Religion entfernt. Statt Lichter anzuzünden gründete er während des Chanukkafestes die »Vereinigung Revolutionärer Internationalisten«.
Eisner, Landauer und Mühsam entstammten ebenso jüdischen Familien wie zahlreiche weitere Akteure der Revolution und der Räterepublik, darunter Eisners Privatsekretär Felix Fechenbach, sein Finanzminister Edgar Jaffé, sein Mitstreiter und späterer Mitbegründer der Ersten Räterepublik Ernst Toller, der führende Kopf der Zweiten Räterepublik Eugen Leviné und dessen kommunistischer Genosse Towia Axelrod, um nur die wichtigsten Namen zu nennen.2 Keiner von ihnen feierte das Chanukkafest, und doch waren sie sich gerade während der vorweihnachtlichen Zeit sehr wohl der Tatsache bewusst, dass sie im katholischen Bayern bestenfalls als Außenseiter, wenn nicht gar als Fremdlinge empfunden wurden. Erich Mühsam drückt in seinem Gedicht »Heilige Nacht« genau diese Außenseiterstellung auf seine eigene ironisierende Weise aus.
Geboren ward zu Bethlehem
ein Kindlein aus dem Stamme Sem.
Und ist es auch schon lange her,
seit's in der Krippe lag,
so freun sich doch die Menschen sehr
bis auf den heutigen Tag.
Minister und Agrarier,
Bourgeois und Proletarier –
es feiert jeder Arier
zu gleicher Zeit und überall
die Christgeburt im Rindviehstall.
(Das Volk allein, dem es geschah,
das feiert lieber Chanukah.)3
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der jüdischen Akteure auf allen Seiten des revolutionären Geschehens genau aus dieser von Mühsam angedeuteten Außenseiterperspektive und untersucht ihre eigene Positionierung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Dabei soll keineswegs suggeriert werden, dass sie eine einheitliche politische Gruppierung bildeten. Ganz im Gegenteil: Unter den jüdischen Revolutionären waren Sozialdemokraten, Kommunisten und Anarchisten. Sie bekämpften sich untereinander heftig. Viele standen ihren nichtjüdischen Genossen näher als ihren jüdischen (Un-)Glaubensgenossen. Ihre politische Ideologie ist Gegenstand zahlreicher Forschungen und kann hier nicht nochmals behandelt werden. Es soll auch nicht der Eindruck entstehen, als ob nur Juden eine wichtige Rolle im revolutionären Geschehen spielten. Gewiss gab es auch zahlreiche prominente nichtjüdische Akteure. Doch die Fragen, auf die in diesem Kapitel nach Antworten gesucht wird, sind klar definiert: In welcher Beziehung zum Judentum standen die jüdischen Revolutionäre und welchen Einfluss hatte ihre Herkunft auf ihre politische Tätigkeit?
»Es ist wohl das Judenblut in mir, das sich empört« – Kurt Eisner
Die Revolution kam für viele Münchner überraschend. Dass ausgerechnet im agrarisch geprägten Bayern, dessen konservativ-klerikale Regierung zudem über gute Beziehungen zur sozialdemokratischen Opposition verfügte, die erste deutsche Republik entstehen sollte, schien undenkbar.4 Der König ging am Nachmittag des 7. November 1918 ruhig im Englischen Garten spazieren. Wie der Bayerische Kurier berichtete, marschierten die Massen von Demonstranten just in dem Moment am Landtag vorbei, »in dem der Minister v. Brettreich nichts ahnend eben über Kartoffelversorgung sprach.«5 Die meisten Münchner wussten zwar von der gewaltigen Demonstration an der Theresienwiese mit etwa 60 000 Teilnehmern, ebenso wie sie von den Demonstrationen in den Tagen davor erfahren hatten. Doch sie hatten auch gehört, dass der Vorsitzende der Mehrheitssozialisten, Erhard Auer, unter den schützenden Armen der Bavaria, dort wo während des Oktoberfests die Bierkrüge klingen, zu Reformen aufgerufen hatte und nach dem Marsch zum Friedensengel seine Anhänger nach Hause schickte. Er wollte eine Evolution und keine Revolution, und hatte um Mitternacht den noch amtierenden Innenminister von Brettreich aufgesucht. Vergeblich drängte er ihn, den Umsturz noch militärisch zu verhindern, um die bereits versprochene Koalitionsregierung unter Einschluss der Sozialdemokraten in einer konstitutionellen Monarchie mit Verhältniswahlrecht und weitgehender Eindämmung der Rechte der Reichsrätekammer noch in die Tat umzusetzen.6
Kurt Eisner, der Vorsitzende der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), die sich 1917 aufgrund ihrer Gegnerschaft zum Krieg von der SPD abgespalten hatten, war in jener Nacht mit seinen Anhängern nicht nach Hause gegangen. Er erkannte die Bedeutung des Augenblicks an jenem ersten Jahrestag der russischen Revolution. Seine Anhänger marschierten zu den Kasernen weiter, wo sich ihnen die Soldaten massenweise anschlossen. »Der Marsch hatte begonnen und war unaufhaltsam«, schrieb als aktiver Teilnehmer Oskar Maria Graf. »Keine Gegenwehr kam. Alle Schutzleute waren wie verschwunden. Aus den vielen offenen Fenstern der Häuser schauten neugierige Menschen auf uns herunter. Überall gesellten sich neue Trupps zu uns, nun auch schon einige Bewaffnete. Die meisten Menschen lachten und schwatzten, als ging's zu einem Fest. Hin und wieder drehte ich mich um und schaute nach rückwärts. Die ganze Stadt schien zu marschieren.«7
Auch seitens des alten Regierungsapparats wurde kein Widerstand geleistet. Ungehindert gelangten Eisners Gefolgsleute in die königliche Residenz. Der Schlossverwalter Jakob Willner notierte später: »Als die allerhöchsten Herrschaften die Residenz verlassen hatten, machte ich im Königsbau die Fenster zu, half die Lichter auszulöschen, und nachdem der diensttuende Offiziant und der Lakai, die weiterhin keine Instruktion hatten, abgetreten waren, schloss ich sämtliche Türen ab und begab mich in den Kapellenhof.«8 Die Revolution spielte sich in München zu einem guten Teil in den Bierkellern ab. Im Mathäserbräu hatten sich Arbeiter-, Soldaten und Bauernräte formiert, und hier rief Kurt Eisner als deren Vorsitzender am Abend des 7. Novembers den Volksstaat Bayern aus. Wohl bewusst um die Symbolik der Orte, sollte die formelle Regierungsübernahme allerdings nicht in einem Bierkeller, sondern im Landtag stattfinden, in dem noch bis sechs Uhr abends das alte Parlament getagt hatte. Hier ließ sich Eisner gegen Mitternacht zum Ministerpräsidenten der in einer längeren Proklamation nun auch als Freistaat bezeichneten neuen Republik ausrufen.9
Der Pazifist Eisner hatte das Unerwartete vollbracht und eine ganz unblutige Revolution gemacht. Bayern, so wollte er der Welt zeigen, kann das schaffen, was andernorts nicht gelungen ist: einen friedlichen Wechsel der Herrschaftsform zu vollziehen. Viele Münchner Bürger befanden sich im Schlaf, als die Ereignisse im Mathäserbräu und im Landtag sich überschlugen. »München war als Hauptstadt des Königreich Bayern zu Bett gegangen, um als Hauptstadt des bayerischen ›Volksstaats‹ zu erwachen«, notierte Josef Hofmiller, ein konservativer Publizist, angesehener Romanist und Gymnasialprofessor am Münchner Ludwigsgymnasium am 9. November 1918 in sein Tagebuch.10 Und ganz ähnlich schrieb der Münchner Rechtsanwalt Max Hirschberg im Juli 1919 rückblickend für ein amerikanisches Lesepublikum: »The people of Munich went to bed as usual on November 7, railing at the thin war-beer, and awoke astonished on November 8 as citizens of the first German democratic republic.«11
Nun regierte also ein jüdischer Journalist aus Berlin das katholische Bayern von eben jenen Räumen aus, die das Machtzentrum der seit sieben Jahrhunderten herrschenden Wittelsbacher Dynastie gebildet hatten. »Rot ist die im Straßenbilde vorherrschende Farbe geworden. Rote Fahnen flattern vom Domturm und Rathaus, rote Plakate unterrichten die Bevölkerung davon, daß die neuen Machthaber die Dynastie Wittelsbach für abgesetzt erklären, die zahllosen militärischen Wachtposten tragen rote Armbinden, rote Fahnen und Standarten kennzeichnen die militärischen Autos, sogar die Pferde der Wachtposten tragen roten Kopfschmuck.«12
Jubelnde Soldaten begrüßen am Morgen des 8. November 1918 vor dem Mathäserbräu die Ausrufung der Republik
Dass dies beim konservativen Münchner Bürgertum, dessen Chronist Hofmiller war, auf Unverständnis und Ablehnung stieß, mag nicht verwundern: »Bayern ist für diese ganze Entwicklung nicht reif und wird es niemals … Wir sind nicht für die Republik geschaffen. Das monarchische Gefühl sitzt uns im Blut seit vielen 100 Jahren … Der Altbayer will jemand über sich haben, mit einer Krone auf dem Kopf und nicht mit einem Zylinder; der eine Uniform anhat und nicht einen Frack; der am Oktoberfest in einem von sechs Pferden gezogenen Wagen fährt und nicht in einem Auto. Herrscherhaus und Volk sind bei uns seit 700 Jahren zusammengewachsen; das kann nicht von heut auf morgen durch noch so ideal gemeinte Sprüche eines Literaten beseitigt werden.«13 Für den liberalen Landtagsabgeordneten Ernst Müller-Meiningen galt Kurt Eisner noch am 8. November als eine »komische Straßenfigur«, die Revolution zunächst als ein »Karnevalsspaß«.14
Es lässt sich nicht feststellen, was in Bayern schwerer wog, dass der neue Herrscher »a Preiß« war oder »a Jud«. Dass für Eisner beides keine große Rolle spielte, interessierte die Öffentlichkeit wenig, denn für diese galt, in den Worten des Historikers Sterling Fishman: »Der vollbärtige Eisner sprach wie ein Preuße, klang wie ein Sozialist und sah aus wie ein Jude.«15 In seinen unveröffentlichten Memoiren beklagte der spätere bayerische Ministerpräsident und Generalstaatskommissar Gustav von Kahr, dass das bayerische Volk »sich von dem preußischen Juden Eisner und seiner Sippe und den ins Land hereingebrochenen preußischen Matrosen verleiten und terrorisieren ließ.«16 Da nützte es wenig, dass Eisner nicht nur mit der Unterstützung von Intellektuellen und Soldaten rechnen konnte, sondern auch Seite an Seite mit dem blinden Bauernführer Ludwig Gandorfer, sowie nach dessen tödlichem Autounfall am 10. November 1918 mit seinem Bruder Karl, marschierte und den Bayerischen Bauernbund in seine Regierung mit einbezogen hat.
Der Romanist Victor Klemperer berichtete damals für die Leipziger Neuesten Nachrichten aus München. Der zum Protestantismus konvertierte Sohn eines Rabbiners, der später für seine akribische Chronik des Überlebens während des Dritten Reichs bekannt werden sollte, schilderte die Begeisterung der die Revolution tragenden Münchner Bevölkerung für Eisner und konnte seine Verwunderung darüber nicht verbergen: »Noch einmal, dies hier war wirklich eine bayrische Volksversammlung, ganz offensichtlich aus Arbeitern, Handwerkern, Krämern zusammengesetzt – und Eisner war Redakteur am Berliner ›Vorwärts‹ gewesen, war (für viele Bayern ein Synonym) ›Preiß und Jud‹: wie kam dieser Münchner Enthusiasmus zustande, was für ein Mensch war der Ministerpräsident?« Von Klemperer stammt eine der treffendsten Charakterisierungen des Menschen Eisner: »Ein zartes, winziges, gebrechliches, gebeugtes Männchen. Dem kahlen Schädel fehlen imposante Maße, das Haar hängt schmutziggrau in den Nacken, der rötliche Vollbart wechselt ins Schmutziggraue hinüber, die schweren Augen sehen trübgrau durch Brillengläser. Nichts Geniales, nichts Ehrwürdiges, nichts Heroisches ist an der ganzen Gestalt zu entdecken, ein mittelmäßiger verbrauchter Mensch, dem ich mindestens 65 Jahre gebe, obschon er noch ganz im Anfang der Fünfzig steht. Sehr jüdisch sieht er nicht aus, aber germanisch wie sein Gegner Levien oder bajuwarisch wie sein Verehrer Unterleitner erst recht nicht. Und wie er nachher auf dem Podium herumwitzelt (er bleibt nicht hinter dem Rednerpult stehen), erinnert er mich doch an Karikaturen jüdischer Journalisten, an Schmock, an Wippchen, an Dr. Ulk … Und doch war es absolut und steigend komisch, wie hier ein erfolgssicherer Feuilletonist sorglos daherplauderte …, und dieser Feuilletonist hatte den bayrischen Thron gestürzt und war jetzt der Beherrscher Bayerns, und sein entzücktes Publikum – ich mußte mir das immer wiederholen – war nicht das Literatenhäufchen der ›geistigen Arbeiter‹, sondern buchstäblich das Volk von München.«17
Als Anführer des Januarstreiks 1918, der allein in München mehr als 10 000 Arbeiter in Rüstungsfabriken mobilisieren konnte und der Eisner bis Oktober 1918 ins Gefängnis gebracht hatte, hatte sich der bis dahin nur in engen Zirkeln bekannte USPD-Vorsitzende einen Namen unter der Münchner Arbeiterschaft gemacht. Wie kein anderer repräsentierte er den pazifistischen Flügel dieser gegen den Krieg gerichteten Protestpartei, die sich im Jahr zuvor von der