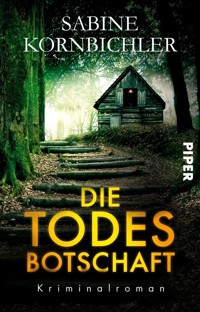12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
München. Ein Tag wie jeder andere. Die Dogwalkerin Mia bringt Albert, den Dackel ihrer schwer kranken Kundin Berna, zurück. Die alte Dame erwartet sie bereits an der Tür, sie wirkt benommen und fahrig, behauptet, ihr Neffe sei zu Besuch, und schickt Mia mit der Bitte fort, in zwei Stunden noch einmal wiederzukommen. Später reagiert sie jedoch nicht auf ihr Klingeln. Alarmiert dringt Mia in das Haus ein und findet dort Spuren einer heftigen Auseinandersetzung. Sie entdeckt Berna, die erdrosselt in ihrem Bett liegt. Von diesem Moment an ist sie für die Polizei eine wichtige Zeugin – und für den Täter eine ernst zu nehmende Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-99027-1
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Mint Images/GettyImages
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
1Irgendwo im Erdgeschoss ...
2Ich war alles ...
3Es fühlte sich ...
4Tom erwartete mich ...
5Ein paar Minuten ...
6Um kurz nach ...
7Über Nacht zog ...
8Der Rest des ...
9Das Café Luitpold ...
10Im strömenden Regen ...
11Gegen Abend zeigte ...
12Zielscheibe mit zehn ...
13Die Morgensonne schien ...
14Charlottes Worte waren ...
15Mit Bernas Tod ...
16Kommissar Tannreuther und ...
17Was hatte Berna ...
18Die Hunde erdeten ...
19Den ganzen Tag ...
20Als ich mit ...
21Den Abend verbrachten ...
22Während der Trainingsstunde ...
23Bevor ich zu ...
24Gegen Abend ging ...
25Nachdem ich fast ...
26Hedwig Konrad musste ...
27Hedwig Konrads Wohnzimmer ...
28Janette erfüllte meine ...
29Um kurz nach ...
30Während mir die ...
31Während ich im ...
32Es war der ...
33Während Armin Nawrath ...
34Ich wollte den ...
35In meinem Kopf ...
36Damit fehlten zwanzig ...
37Als ich zur ...
38Markus schien aus ...
»Wenn du mich tötest, gibt es kein Zurück mehr. Dann öffnest du eine Tür, die du nie wieder schließen kannst.«
»Ich habe sie schon längst geöffnet. Lange vor dir. Und der Luftzug, der durch sie hindurchströmt, wärmt mich.«
1
Irgendwo im Erdgeschoss schlug eine Tür. Coco richtete sich auf, spitzte die Ohren und gab ein heiseres Bellen von sich, bevor sie den Kopf zurück auf den Rand ihres Körbchens legte. Ein Windzug, dachte ich und konzentrierte mich wieder auf Berna Kiening, die in einem warmen Hausanzug auf ihrem Bett saß, auf den Knien einen Block, auf dem sie aufgelistet hatte, was sie an diesem Abend mit mir besprechen wollte.
Während das Pendel der antiken Standuhr in gleichmäßigem Rhythmus hin- und herschwang, wartete ich darauf, dass sie fortfuhr, aber sie hielt den Blick auf einen Punkt hinter mir gerichtet und lauschte. Das Geräusch, das aus den Tiefen des Hauses zu uns gedrungen war, hatte sie beunruhigt.
Ich schlug vor nachzusehen, aber sie winkte ab und sagte, wir hätten Wichtigeres zu tun. Vermutlich hatte sie unten ein Fenster nicht richtig geschlossen, ich könne mich darum kümmern, wenn ich später hinunterging. Es sollte beiläufig klingen, wirkte aber eher angestrengt. Irgendetwas schien sie zu beschäftigen. Als sie meinen skeptischen Blick bemerkte, zuckte sie die Schultern. Was solle ihr passieren, das ihr nicht längst passiert sei, meinte sie mit einem Lächeln, das die Augen nicht erreichte. Ihr Todesurteil sei längst gesprochen, und es würde sich wohl kaum jemand dazu hinreißen lassen, es vor der Zeit zu vollstrecken. Im Gegenteil: Ihre Familie tue alles, um es zu verhindern. Keiner von ihnen verstünde ihre Entscheidung – was sie ihnen nicht einmal verübeln könne, schließlich steckten sie nicht in ihrer Haut. Man müsse leiden, um Leid zu begreifen.
Während sie Mühe hatte, sich einigermaßen verständlich zu artikulieren, ballte sie die Hände zu Fäusten, sodass ihre Knöchel weiß hervortraten. In Situationen, in denen anderen längst die Tränen liefen, riss sich Berna, wie ich sie im Stillen nannte, immer noch zusammen. Ich kannte niemanden mit einer solchen Disziplin, niemanden, der dem eigenen Tod nach außen hin so gefasst entgegensah. Und einmal mehr wünschte ich, ihr Schicksal wäre ein anderes, eines, das die Möglichkeit, steinalt zu werden, nicht so kategorisch ausschloss.
Berna Kiening war neunundsechzig und vorzeitig gealtert. In ihre feinen Züge hatten sich Falten gegraben, die nicht vom Lachen erzählten, sondern von Amyotropher Lateralsklerose, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die innerhalb von ein paar Jahren zu einer vollständigen Lähmung führt. Da diese Krankheit sie ohne dauerhafte Magensonde und künstliche Beatmung auf lange Sicht umbringen würde, hatte sie einen Termin in der Schweiz vereinbart. Auf den Tag genau vier Wochen blieben ihr bis zu ihrem selbstbestimmten Tod. Bis dahin wollte sie ihren gewohnten Alltag leben, der längst nicht mehr ohne fremde Hilfe zu bewältigen war. Für die häuslichen Belange hatte sie eine Haushälterin engagiert, für ihre schwarze Zwergpudelhündin Coco hatte sie mich, eine Dogwalkerin.
Wir kannten uns seit meiner Kinder- und Jugendzeit in Pullach. Ich war mit ihrer Nichte zur Schule gegangen und hatte lange Zeit einen ihrer beiden Neffen angehimmelt. Vor zwei Jahren war es mir gelungen, ihn elf Monate lang für mich zu gewinnen.
Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Es war leiser dieses Mal, undefinierbarer, aber laut genug, um uns beide aufhorchen zu lassen. Coco brach in lautstarkes Bellen aus und baute sich vor der geschlossenen Schlafzimmertür auf. Ohne auf Berna zu hören, die versuchte, mich zurückzuhalten, ging ich zur Tür und öffnete sie. Die Hündin stürmte an mir vorbei in den dunklen Flur und von dort aus die Treppe hinunter. Ihr Gebell war wütend und ohrenbetäubend, wurde jedoch leiser, je weiter sie sich entfernte. Kurz darauf hörte ich sie im Garten.
Ich konzentrierte mich auf die Geräusche im Haus, versuchte herauszuhören, ob sich unten etwas Ungewöhnliches tat. Die Lampe im unteren Flur warf ihren schwachen Lichtschein nur bis zur halben Treppe. Ich ging zum Geländer, beugte mich darüber und sah nach unten, während es zwischen meinen Schulterblättern kribbelte. Es war, als würde mich jemand beobachten.
»Haben Sie unten eine Tür offen gelassen?«, rief ich ins Zimmer und spürte, wie das Kribbeln in einen Schauer überging. »Coco ist im Garten.« Schlagartig brach ihr Gebell ab. Die eintretende Stille war beängstigender als jedes Geräusch.
Da Berna nicht antwortete, bewegte ich mich rückwärts Richtung Schlafzimmer und drehte mich im Türrahmen kurz zu ihr um. Mit zusammengepressten Lippen saß sie in ihre Kissen gelehnt da und schien durch mich hindurchzusehen. In ihrer Miene spiegelte sich eine Mischung aus Unsicherheit und Wut.
»Frau Kiening?«, fragte ich, als Coco plötzlich neben mir auftauchte und mit einem Satz zurück in ihr Körbchen sprang. Dass sie zurück war, hätte mich beruhigen können, tat es aber nicht. Irgendetwas stimmte da unten nicht. Ich tastete nach meinem Handy, um die Polizei zu rufen.
»Es ist nur eine Tür, Mia, nichts weiter«, sagte Berna. So klangen Kinder, die sich im Wald fürchteten und deshalb sangen. Am liebsten hätte ich in diesen Gesang eingestimmt. Stattdessen schüttelte ich den Kopf und zog das Handy aus der Hosentasche.
»Du bist doch sonst nicht so ängstlich«, sagte sie in der verwaschenen, leicht lallenden Art, die ihr die Krankheit aufzwang, weil sie auch ihre Zunge lähmte.
»Sonst stehen bei Ihnen in der Dunkelheit auch keine Türen offen«, konterte ich.
»Beruhige dich bitte! Es ist alles in Ordnung.« Wie um ihre Worte Lügen zu strafen, geriet ihr Atem außer Kontrolle. Sie drückte die flache Hand aufs Dekolleté. »Schalte einfach das Licht im Flur ein, das wird alle bösen Geister vertreiben, sollte es hier welche geben.«
Für einen Augenblick verfingen sich unsere Blicke ineinander. Es kam mir vor, als versuche jede von uns beiden, den nötigen Mut in der anderen zu finden. Ich schalt mich eine Närrin, mir von einer offen stehenden Tür und ein paar Geräuschen den Schneid abkaufen zu lassen. Würde hier irgendeine Gefahr lauern, würde Coco uns warnen. Vielleicht hatte sich vorhin eine Katze durch die Tür ins Haus geschlichen, und sie hatte sie bis in den Garten gejagt. Nichts weiter!
Ich ging zurück in den Flur, streckte die Hand aus und tastete nach dem Lichtschalter. In diesem Moment nahm ich im Augenwinkel einen Schatten wahr, der blitzschnell auf mich zuflog. Alles schien gleichzeitig zu passieren – der brutale Griff um mein Handgelenk, die Drehung, die mir fast das Schultergelenk auskugelte, und der Stoß, der mich zu Boden schleuderte. Mittendrin mein Schrei, der durch den Hausflur gellte. Lautes Getrampel auf der Treppe und wieder Cocos Gebell. In all das mischten sich Bernas Rufe.
Mein Schreck war so umfassend, dass ich zuerst nichts spürte, keinen Schmerz, gar nichts. Ich lag der Länge nach auf dem Boden, die Arme zum Schutz über dem Kopf verschränkt. Vorsichtig bewegte ich meine Gliedmaßen, dann richtete ich mich zitternd an der Wand auf. In meinen Ohren rauschte es, und mein Herz klopfte so heftig, als wollte es meine Brust sprengen.
Berna Kiening tauchte im Türrahmen auf. Mit einer Hand stützte sie sich auf ihren Stock, mit der anderen hielt sie sich im Türrahmen fest. Auch sie zitterte. Sie verlagerte das Gewicht, stützte sich mit der Schulter ab und schaltete das Flurlicht ein, das grell jede Ecke ausleuchtete. Dann streckte sie die Hand nach mir aus, um mit den Fingerspitzen über meine Wange zu streichen.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie, wobei es ihr noch schwerer als sonst fiel, ihre Worte zu artikulieren.
Ich atmete gegen mein Herzklopfen an und bewegte vorsichtig meine Gliedmaßen. »In Filmen fragen sie das immer in Situationen, in denen etwas ganz offensichtlich überhaupt nicht in Ordnung ist.«
»Wenigstens funktioniert dein Humor noch, das ist ein gutes Zeichen. Bist du verletzt?«
»Nichts, was über blaue Flecke hinausginge. Die auf meiner Seele mitgerechnet.« Auf zitternden Beinen bewegte ich mich ein Stück von der Wand weg und hielt nach meinem Handy Ausschau, das mir bei dem Angriff aus der Hand geflogen war. Es lag auf einer der Treppenstufen. Ich ging hin und holte es.
»Bitte nicht, Mia. Keine Polizei!« Sie streckte abwehrend ihre Hand aus.
»Es war jemand hier im Haus, Frau Kiening, und er hat mich angegriffen. Dasselbe hätte er mit Ihnen tun können. Was, wenn ich nicht da gewesen wäre? Wenn er versucht hätte, Sie auszurauben? Oder schlimmer – Sie zu töten?«
»Er ist längst fort.«
»Die Polizei wird nach ihm suchen.«
»Hast du ihn erkannt? Kannst du ihn beschreiben?«
»Nein, aber das spielt auch keine Rolle. Niemand darf einfach so in Ihr Haus eindringen, mich durch die Luft schleudern und damit dann auch noch davonkommen. Wir sollten wenigstens versuchen …«
»Komm … bitte! Lass es mich dir erklären.« In der schleppenden Geschwindigkeit, die ihr die Krankheit aufzwang, bewegte sie sich zurück zum Bett, ließ sich mit einem Stöhnen auf die Kante sinken und robbte sich dann Richtung Kopfende, um sich anzulehnen und die Beine hochzulegen.
Widerstrebend folgte ich ihr. Meinen Stuhl, der neben ihrem Bett stand, richtete ich so aus, dass ich die Tür im Blick behielt.
»Du weißt, dass meine Familie nichts von meinem selbstbestimmten Sterben hält.«
Ich nickte. Sie hatte mir selbst davon erzählt.
»Sie tun eine ganze Menge, um mich davon abzuhalten. Mal versuchen sie es mit Tränen, mal mit Drohungen.«
»Drohungen?«
»Man könnte meinen Geisteszustand untersuchen und mich im Extremfall entmündigen lassen.«
»Wer droht Ihnen damit?«
Sie winkte ab. »Das spielt keine Rolle.«
»Um jemanden auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen, braucht man Anhaltspunkte.«
»Genau die versucht man zu schaffen.«
Ich starrte sie völlig perplex an. »Wie?«
»Durch so etwas wie eben.«
Sekundenlang war nichts zu hören außer dem Ticken der Standuhr.
»Sie meinen, Ihre Familie inszeniert einen Überfall, um Sie entmündigen zu lassen?« Hätte ich raten sollen, wer von ihren Verwandten zu solch einem Vorgehen fähig war, hätte ich spontan auf Niko getippt, einen ihrer Neffen. Ihm traute ich inzwischen eine Menge zu.
»Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute es.« Sie schluckte. »Was macht man, wenn Drohungen nicht fruchten? Man setzt sie in die Tat um und inszeniert Situationen, die mich als verwirrt erscheinen lassen, als unzurechnungsfähig.« Sie knetete ein Stofftaschentuch mit den Fingern. »Warum, glaubst du, hat Coco den Angreifer nicht angebellt?«
Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. »Weil sie ihn kennt«, antwortete ich fassungslos.
»Vor einer Woche habe ich unten schon mal ein Geräusch gehört und die Polizei alarmiert. Zwei überaus gewissenhafte Beamte waren hier und haben alles durchsucht. Ihnen ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Ich werde dieses Prozedere heute ganz sicher nicht wiederholen.«
»Aber ich kann bezeugen, dass jemand im Haus war, jemand, der hier definitiv nicht hingehört – Familie hin oder her.«
Sie schob das Taschentuch unter ihren Oberschenkel, legte beide Hände übereinander aufs Dekolleté und betrachtete mich. »Mir bleiben noch vier Wochen, Mia. Diese Zeit ist mir wertvoll, ich möchte sie nicht mit Aussagen bei der Polizei vergeuden. Ich möchte mich verabschieden – von allem, was mir in meinem Leben lieb war.«
»Das verstehe ich, aber es bedeutet auch, dass Ihre Familie davonkommt. Wollen Sie das wirklich?«
Dieses Mal erreichte ihr Lächeln die Augen. Es war unendlich traurig. »Am Ende relativiert sich vieles, auch das Bedürfnis nach Vergeltung.«
»Aber …«
Sie schüttelte den Kopf. »Geh bitte hinunter und schließ die Tür. Und dann lass uns über Coco reden. Deswegen habe ich dich heute Abend schließlich zu mir gebeten.«
2
Ich war alles andere als ein Hasenfuß, aber ich war auch nicht lebensmüde. Was, wenn sie sich täuschte und der Überfall einen ganz anderen Hintergrund hatte? Wenn der Angreifer sich immer noch im Haus aufhielt? Sie bemerkte mein Zögern und sah mich eindringlich an. Traute ich ihr zu, dass sie mich wider besseres Wissen einer Gefahr aussetzte? Würde sie auch nur eine Sekunde lang daran zweifeln, dass im Erdgeschoss lediglich eine Tür offen stand, die es zu schließen galt, würde sie mich nicht um diesen Gefallen bitten. Ich brauchte keine Angst mehr zu haben, der Spuk war vorbei.
»Okay«, sagte ich, lieh mir ihren Stock aus, der einen massiven Griff hatte, fasste ihn wie einen Baseballschläger und schärfte all meine Sinne, während ich in Begleitung von Coco, die das Ganze für ein Spiel hielt, Zimmer für Zimmer komplett erhellte und absuchte. Im Wohnzimmer stieß ich schließlich auf die offen stehende Terrassentür. Die Gardinen bewegten sich im Wind und verursachten mir ein Frösteln, das nichts mit der kalten Luft zu tun hatte, die ins Zimmer strömte. Mit Wucht schloss ich die Tür, als könnte ich damit einen Schlusspunkt hinter das Ganze setzen. Dann atmete ich tief durch und lief mit Coco im Schlepptau wieder nach oben ins Schlafzimmer. Die Festbeleuchtung ließ ich im ganzen Haus eingeschaltet.
Ich lehnte den Stock an den Nachttisch. »Mein Bedarf an Mutproben ist für die nächste Zeit gedeckt, Frau Kiening«, sagte ich trocken. »Ihre Familie wird Sie hoffentlich mit weiteren Attacken verschonen.«
»Davon gehe ich aus. Jetzt gibt es ja eine Zeugin dafür, dass ich bei klarem Verstand bin und mir nichts einbilde. Mir tut nur leid, dass du dabei zu Schaden gekommen bist, Mia. Das hätte nicht passieren dürfen, damit sind sie zu weit gegangen.« Sie hielt inne, um wieder zu Atem zu kommen. »Sollte man dich nach meinem Tod auf meinen Geisteszustand ansprechen …«
»Wer sollte das wohl tun?«, unterbrach ich sie.
»Jemand, dem mein Testament gegen den Strich geht, das mein Notar für mich aufgesetzt hat und das ich noch in dieser Woche unterschreiben werde. Aber lassen wir das!Viel wichtiger ist, was mit Coco geschieht.« Ihre Sprache wurde immer schleppender.
Als sie ihren Namen hörte, hob die Hündin den Kopf. Berna betrachtete sie schweigend und wandte sich dann wieder mir zu. Ihr war anzumerken, dass die vergangene Stunde über alle Maßen an ihren Kräften gezehrt hatte. Nur mit Mühe hielt sie ihre Augen offen. Ich schlug vor, an einem anderen Abend wiederzukommen, aber sie bestand darauf, es jetzt zu tun. Sie könne erst dann ruhig schlafen, wenn für Coco alles Nötige geregelt sei.
Wie sich herausstellte, hatte sie bereits entsprechend vorgesorgt. Karolin, ihre Nichte, würde Coco zu sich nehmen. Da sie jedoch wenig Erfahrung mit Hunden hatte, nahm Berna mir das Versprechen ab, ihr in der ersten Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dann bat sie mich zu gehen, sie sei nun doch ziemlich erschöpft.
Es fiel mir schwer, sie allein zurückzulassen. Obwohl sie sich ganz offensichtlich beruhigt hatte und gefasst wirkte, bat ich sie, ihren Hausarzt anrufen zu dürfen, damit er nach ihr sah. Aber das lehnte sie ab. Von den Umständen abgesehen sei mit ihr alles in Ordnung. Sie dankte mir, dass ich ihre Wünsche respektierte, betonte noch einmal, wie unendlich leid ihr der Angriff tue, und verabschiedete sich bis zum nächsten Morgen von mir.
Auch wenn sie mir eine ebenso überzeugende wie erschütternde Erklärung für den Überfall geliefert hatte, verließ ich das Haus mit einem mulmigen Gefühl. Es war Viertel vor elf, als ich mich auf mein Fahrrad schwang und mich fragte, wie der Eindringling hineingelangt war, denn die Terrassentür im Wohnzimmer war nicht aufgehebelt worden. Derartige Spuren wären auch hinderlich gewesen, wenn es jemand so darstellen wollte, als bilde Berna sich das alles nur ein.
Alle Familienmitglieder und ein paar andere, zu denen auch ich zählte, konnten sich über einen Fingerabdruckscanner Zugang zum Haus verschaffen, damit Berna in ihrem eingeschränkten Zustand nicht zur Tür laufen musste. Ich kannte mich mit solchen Schließsystemen nicht aus, aber ich hielt es für möglich, dass sie jeden Zugang registrierten. Entweder hatte sich derjenige mit seinem Fingerabdruck hineingelassen und dann die Terrassentür geöffnet, was eventuell nachzuweisen war, oder er hatte sie schon vorher so manipuliert, dass sie einfach von außen zu öffnen war. Das würde sich wohl eher nicht nachweisen lassen.
Der Angreifer war ein Mann gewesen, dessen war ich mir ziemlich sicher. Und er war alles andere als schwerfällig gewesen. Seinen Bewegungsabläufen nach zu urteilen, war er sportlich. Bernas Schwager, der alte Nawrath, schied damit aus. Er war ein paar Jahre älter als sie und übergewichtig. Blieben seine Söhne, Niko und Dominik, und meineVermutung, wer von beiden es gewesen sein könnte. Bei der Vorstellung packte mich eine ungeheure Wut, und ich trat kräftiger in die Pedale.
Es war ein Wunder, dass ich heil zu Hause ankam, denn ich hatte keinen Blick für das, was um mich herum geschah. Während ich die Treppen unseres Hauses hinaufstieg, einem dieser gesichtslosen Sechzigerjahre-Bauten inmitten des quirligen Uni-Viertels in der Maxvorstadt, und die Tür zu meiner Dreier-WG aufschloss, drängten sich die Bilder des Überfalls noch einmal vor mein inneres Auge. Es kam mir perfide vor zu hoffen, dass er tatsächlich nur von einem ihrer Angehörigen inszeniert worden war.Aber besser man wusste, wer der Feind war.
Bogart, mein Gasthund für diese Nacht, kam verschlafen aus der Küche, streckte sich und lief mir dann wedelnd entgegen. Ich beugte mich zu ihm und strich ihm übers Fell.Auf dem Weg in mein Zimmer bemerkte ich den Lichtschein unter Lukas’Tür, er arbeitete sicher, wie immer um diese Zeit. Bei Charlotte war alles dunkel, sie war noch unterwegs. Schade, ich hätte gerne noch bei einem Glas Wein mit ihr geredet.
Fünf Minuten später stand ich unter der heißen Dusche. Die Wärme tat mir gut und löste meine verspannten Muskeln. Als meine Haut begann aufzuweichen, trocknete ich mich ab, schlüpfte in meinen Schlafanzug und lief hinüber in mein Zimmer, wo ich mich ins Bett kuschelte. Ich versuchte zu lesen, konnte mich aber auf keinen einzigen Satz konzentrieren. Mein Herz klopfte immer noch vor Wut und vom Nachhall der Angst.
Als ich mich gerade fragte, wie ich in dieser Nacht schlafen sollte, klingelte mein Handy. Es war Ute, Grete Gottwalds Tochter. Seit zwei Jahren teilten sich die beiden die Wohnung über unserer WG. Ihr Zusammenleben war genauso wie unseres dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt geschuldet. Eine Entscheidung, die die Einundsiebzigjährige fast vom ersten Tag an bereut hatte. Im Gegensatz zu ihrer ängstlichen Tochter war Grete durch und durch furchtlos, ein Charakterzug, den Ute als eine Form senilerVerrücktheit missdeutete.
Wie immer, wenn sie ihre Mutter suchte, klang sie aufgeregt und außer Atem. Ihre Mutter sei mal wieder nicht nach Hause gekommen. Davon, dass Grete ganz sicher nur irgendwo sitzen würde, um in Ruhe eine Zigarette zu rauchen, wollte sie wie immer nichts hören. Ob ich sie nicht mit einem der Hunde suchen könne, flehte sie mich an. Nur dieses eine Mal noch.
Diesen Satz hatte ich schon oft von ihr gehört. Obwohl mir bewusst war, dass Ute ihre Angst so nie loswerden würde, willigte ich ein. Eine Zigarette mit Grete würde mich auf andere Gedanken bringen. Nachdem ich meinen Schlafanzug gegen Jeans, Pulli und Steppjacke getauscht hatte, sprang ich mit Bogart die Treppen hinunter.
Draußen schlug mir die Kälte entgegen. Auch wenn die Tage jetzt, Mitte März, allmählich milder wurden und der Frühling die ersten Boten aussandte, sank das Thermometer in den Nächten immer noch nah an die Null-Grad-Grenze. Ich zog Bogart, dem dreijährigen Vizsla-Mix-Rüden, das Trailgeschirr über, hielt ihm eine Socke von Grete unter die Nase und gab ihm das Suchkommando. Im vergangenen Jahr hatte ich viel mit ihm trainiert und ihm dieVermisstensuche beigebracht. Eine Arbeit, die über meine eigentliche weit hinausging, die aber nicht nur mir Spaß machte, sondern vor allem den Hunden.
Bogart war ehrgeizig und fand ziemlich schnell die Spur. Diese führte durch die Straßen unseres Viertels über die Ludwigstraße zum Odeonsplatz. Kurz vor der Feldherrnhalle bog Bogart links ab in den Hofgarten und noch einmal links Richtung Pavillon. Auf einer der Bänke, die hinter einer Hecke verborgen waren, saß Grete. Nachdem ich den Rüden belohnt hatte, richtete ich meine Stirnlampe kurz auf Utes Mutter, die in einen warmen Mantel, Mütze und Schal gehüllt genüsslich rauchte und mir durch ihre schwarz umrandete Brille zuzwinkerte.
Ich schaltete die Lampe aus und setzte mich neben sie. »War es wieder so schlimm zu Hause?«
»Zigarette?«, überging sie meine Frage und hielt mir die Packung hin.
Der erste Zug reizte wie immer meine Bronchien, den zweiten genoss ich. Eingehüllt in die Dunkelheit saßen wir schweigend nebeneinander und rauchten, während Bogart an der Hecke entlang schnupperte und hier und da versuchte, das dichte Gestrüpp zu durchdringen.
»Vor lauter Angst vor dem Leben errichtet Ute nicht nur Zäune um sich, sondern auch um mich«, beantwortete Grete schließlich meine Frage. »Wenn sie wüsste, dass ich mich auf einer Dating-Plattform angemeldet habe, würde sie einen Herzinfarkt bekommen.« Vergeblich versuchte sie, mit dem Zigarettenrauch einen Ring zu formen. »Sie ist gut, ich kann sie dir wirklich empfehlen. Du hast diesem Kerl lange genug nachgeweint.« Sie betrachtete mich von der Seite. »Was hältst du von folgendem Profil für dich? Junge Frau, vierunddreißig, rote Haare, unvergessliche blaue Augen. Unkonventionell, querköpfig und charakterstark. Menschen, die sie mag, würde sie aus dem Feuer retten.«
»Klingt, als würde ich alle anderen darin umkommen lassen«, konterte ich mit einem Lachen und drückte die Zigarette auf dem Boden aus. »Vielleicht brauche ich gar keine Anzeige.«
»Ist mir da etwas entgangen? Wer ist es?«
Ich deutete auf Bogart. »Sein Besitzer.«
»Bist du verliebt?«
»Ziemlich.«
»Und er?«
»Ich glaube, er auch. Ich hoffe, er auch. Es ist noch völlig am Anfang.«
Als Bogart sich an mich drückte und vor Kälte zu zittern begann, schlug ich vor, den Heimweg einzuschlagen. Grete erhob sich und folgte mir. Unterwegs erzählte ich ihr von den Ereignissen in Berna Kienings Haus, von der Angst, die ich ausgestanden, und der Wut, die mich gepackt hatte. Grete war nicht leicht zu erschüttern, aber dieVorstellung, von der eigenen Familie auf so hinterhältige Weise unter Druck gesetzt zu werden, entlockte ihr ein paar deftige Kommentare. Da habe sie lieber eine lebensuntüchtige Tochter als solche nichtsnutzigen Neffen. Sie wusste, dass ich mich vor zwei Jahren in einen von ihnen verliebt hatte, und fragte mich, ob ich diesem Kerl, wie sie Niko nannte, seit er sich auf unschöne Weise von mir getrennt hatte, so etwas zutrauen würde.
»Hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich Nein gesagt.«
3
Es fühlte sich an, als sei es mitten in der Nacht, als ich schweißgebadet aus einem Albtraum erwachte. Ich versuchte, den Traum festzuhalten, aber er verflüchtigte sich in Sekundenschnelle. Zurück blieb ein diffuses Gefühl der Bedrohung.
Als ich das Licht einschaltete, regte Bogart sich in seinem Korb, stand auf und drehte sich einmal um sich selbst, um sich gleich darauf wieder hinzulegen. Aus der Küche hörte ich Geschirrklappern. Ich sah auf die Uhr, es war halb fünf. Da ich ohnehin nicht wieder einschlafen würde, folgte ich den Geräuschen in die Küche.
Charlotte, meine Freundin und Mitbewohnerin, brühte sich gerade einen Tee auf. Sie trug einen flauschigen Schlafanzug und dickeWollsocken, ihre widerspenstigen blonden Haare hatte sie zum großen Teil mit einer Spange eingefangen. So früh am Morgen bekam sie ihre Augen kaum auf und war nicht zum Reden aufgelegt. Ich stellte mich neben sie an die Arbeitsplatte, füllte Kaffee in die Maschine und schaltete sie ein. Dann schäumte ich Milch auf, schnitt mir eine Scheibe Brot ab und schob sie in den Toaster.
Schweigend setzten wir uns an den Küchentisch, auf dessen Holzplatte sich alle möglichen Gäste mit einem schwarzen Permanent-Filzstift verewigt hatten. Irgendeiner hatte nach einer durchzechten Nacht in betrunkenem Zustand damit begonnen und geschrieben, er könne tun, was er wolle, das Leben sei einfach nie ideal. Dieser Satz hatte uns alle animiert, ihn zu kommentieren. Charlotte hatte geschrieben, das Leben biete so unendlich viele Möglichkeiten. Wenn sie sich für eine entscheide, müsse sie eine andere ungenutzt verstreichen lassen. Und sie würde nie erfahren, wohin diese andere sie geführt hätte. Lukas, unser Mitbewohner, hatte in der Mitte des Tisches Sartre zitiert: Unser Leben hängt davon ab, was wir daraus machen, was aus uns gemacht wurde. Und ich hatte geschrieben, dass ein wundervolles Leben für mich bedeute, in mir selbst zu Hause zu sein.
Ich löste den Blick von der Tischplatte, bestrich mein Brot dick mit Butter und schichtete Himbeermarmelade darauf.
»Mir würde übel, wenn ich das um diese Uhrzeit essen müsste«, murmelte Charlotte und wandte den Blick ab.
»Ich weiß. Und hättest du gewusst, was bei deinem Job auf dich zukommt, hättest du dich ganz bestimmt für etwas anderes entschieden. Etwas, wo du erst um elf aufschlagen musst«, wiederholte ich trocken das, was sie bei solchen Gelegenheiten immer wieder betonte.
Charlotte war Personal Trainerin und arbeitete für ambitionierte Freizeitsportler, die in aller Herrgottsfrühe vor oder spätabends nach einem Vierzehn-Stunden-Tag an ihren Marathonzeiten feilten, und für Senioren, die bis ins hohe Alter fit und beweglich bleiben wollten, es aber sehr viel gelassener angehen ließen. Nachdem sie ihren Tee zur Hälfte getrunken hatte, lehnte sie sich zurück und streckte ihre langen Beine aus. Ganz allmählich kam Leben in sie. »Hat Grete wieder die Flucht ergriffen?«, fragte sie.
Ich nickte.
»Wie diese Frau so eine Tochter hervorbringen konnte, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Grete strotzt nur so vor Lebensfreude, und Ute hat Angst, jemand würde sie umbringen, sobald sie nach Einbruch der Dunkelheit das Haus verlässt. Apropos umbringen. Wie geht es eigentlich deiner Kundin, dieser Frau Kiening? Steht ihr Entschluss noch?«
»Ihre Familie terrorisiert sie deswegen.« Im Telegrammstil erzählte ich ihr von den Ereignissen des vorherigen Abends.
»Du glaubst, es war Niko? Im Ernst?«
»Ihm würde ich es am ehesten zutrauen.«
»An deiner Stelle würde ich ihn anzeigen.«
»Mal davon abgesehen, dass es nur eineVermutung ist, kann ich das Frau Kiening nicht antun. Sie hat es schwer genug.«
Charlotte krauste die Stirn. »Ich würde um jeden einzelnen Tag kämpfen.«
»Dazu müsstest du aber auch die Kraft haben. Und wenn du bei dieser Krankheit zu lange wartest, kannst du dich irgendwann nicht mehr davonmachen. Du erstickst an ihr, außer du lässt dich künstlich beatmen. Und das will sie auf keinen Fall.«
»Aber damit nimmt sie sich die Möglichkeit, herauszufinden … Ich meine, vielleicht ist es …« Charlotte verstummte.
Ich tippte mit dem Zeigefinger auf ihren Spruch auf der Tischplatte. »Wohin die Möglichkeit, sich nicht das Leben zu nehmen, führt, weiß sie ziemlich genau. Das ist keine Option für sie. Und ich kann verstehen, dass sie so entschieden hat. Ich würde mir diese letzten Meter auch ersparen.«
»Und ich würde immer hoffen, dass das Ruder auf den letzten Metern noch einmal herumgerissen wird. Gegen jede Wahrscheinlichkeit.«
Charlotte stand auf, stellte ihren Teebecher in die Spülmaschine und sagte, sie müsse sich fertig machen und in zehn Minuten aus dem Haus. Sie würde übrigens später noch einkaufen gehen und fragte, ob sie mir etwas mitbringen solle. Nach einem schnellen Blick in den Kühlschrank schrieb ich ihr einen Zettel mit den Dingen, die in meinem Fach fehlten.
Im Flur hörte ich sie an Lukas’ Tür klopfen und gleich darauf hineingehen. Unser Mitbewohner war Video-Cutter, arbeitete ausschließlich nachts, bevorzugt für irgendwelche unwiderstehlichen Instagram-Bloggerinnen, und nur mit Kopfhörern und schräger Musikbeschallung. Und er liebte Junkfood. Als er Charlotte seine Wünsche diktierte, hörte ich sie bei jedem einzelnen protestieren und ihm einen Vortrag halten. Sie hatte es immer noch nicht aufgegeben, ihm auszumalen, was er seinem Körper mit diesem Zeug antat, das eigentlich auf den Sondermüll gehörte.
Während die beiden noch diskutierten, kam Bogart in die Küche. Ich strich ihm über den Kopf, was ihm einen wohligen Laut entlockte, und beschloss, mich noch für eine knappe Stunde hinzulegen.
Um kurz nach halb acht kletterte ich an diesem Dienstagmorgen in meinen Fiat Ducato, um bei meinen Kunden die Hunde einzusammeln. In der Regel nahm ich nicht mehr als zehn mit auf meine Runde, aber es gab natürlich Ausnahmen, wenn jemand krank wurde oder unvorhergesehen wegmusste.
Coco holte ich als Letzte ab. Wie üblich klingelte ich und wartete dann ein paar Sekunden, bevor ich meinen rechten Daumen auf den Fingerabdruckscanner legte, damit sich die massive Holztür der Sechzigerjahre-Villa in der Osterwaldstraße öffnete. Meist war Berna um diese Uhrzeit noch im ersten Stock, aber an diesem Morgen rief sie mir aus der Küche entgegen, ihre Haushälterin sei krank, sie müsse zur Abwechslung mal wieder alleine zurechtkommen. Ich folgte ihrer Stimme und begrüßte sie, während Coco aufgeregt an mir hochsprang.
Berna trug ein graues Wollkleid, das ihr bis zu den Waden reichte, und um den Hals einen fein gewebten Schal in einem hellen Türkis. Ihre Haare sahen perfekt frisiert aus. Ich hatte eine ungefähreVorstellung davon, wie viel Zeit und Anstrengung sie das gekostet hatte. Sie musste sehr früh aufgestanden sein. Vermutlich hatte sie nicht viel geschlafen.
Ich bot ihr meine Hilfe an, aber sie schüttelte den Kopf und deutete auf Coco. Ihr sei wichtiger, dass ihr Liebling so schnell wie möglich hinaus komme. Außerdem hätte ich ihr schon genug geholfen. Ob ich alles gut überstanden hätte? Ich nickte. Was waren schon ein Albtraum und blaue Flecken gegen das, was sie durchmachte. Sie verabschiedete mich mit den Worten, es solle ein wunderschöner Tag werden, ich solle ihn genießen.
Der Wetterdienst hatte kräftigen Föhn angekündigt, der die Temperaturen bis siebzehn Grad ansteigen lassen würde. Bereits jetzt zeigten sich am Himmel hier und da die typischen weißen Föhnwolken. Ich genoss diesen Vormittag, er brachte mich auf andere Gedanken. Ich lief mit den Hunden hinunter ans Isarufer, setzte mich auf einen Stein, hielt das Gesicht in die Sonne und sah den Tieren beim Herumtollen zu. Einige von ihnen nahmen ein Bad, schüttelten das Wasser aus ihrem Fell und sprangen gleich wieder hinein. Andere waren wasserscheu so wie Coco, die sich neben mir niederließ, sich auf die Seite legte und von der Sonne bescheinen ließ. Auf sie würde eine großeVeränderung zukommen. Zum Glück wusste sie nichts davon.
Die restliche Zeit unseres Ausflugs machte ich mit den Hunden eine ausgedehnte Runde durch den Park. Die Wiesen waren übersät mit unzähligen Frühlingsboten. Überall waren bunte Schimmer zu sehen – von Winterlingen, Krokussen, Schneeglöckchen und Märzenbechern. Ich fotografierte sie, um sie später Berna zu zeigen, die kaum noch das Haus verlassen konnte.
Nach drei Stunden lieferte ich alleVierbeiner wieder ab. Zu Berna fuhr ich wie immer zum Schluss. Mein Daumen hatte nach dem üblichen kurzen Klingeln das Abdruckfeld des Scanners kaum berührt, als sich die Tür bereits öffnete. Meine kranke Kundin trat schwer atmend auf ihren Stock gestützt in den Türrahmen und lehnte sich sekundenlang Halt suchend dagegen. Sie schwankte leicht und wirkte benommen. In ihrem Gesicht zeichnete sich eine ungeheure Anstrengung ab. Im Vergleich zu unserer Begegnung am Morgen wirkte sie völlig verändert. Coco schien es nicht zu kümmern, sie sprang wedelnd an ihr hoch und verschwand dann in den Tiefen des Hauses.
»Brauchen Sie Hilfe, Frau Kiening?«, fragte ich sie besorgt.
Sie versuchte, sich aufrechter hinzustellen, und ließ ihren Blick auf mir ruhen, ohne zu antworten. Es war, als sehe sie mich an und sehe mich doch nicht. Als sei ihr Blick vorausgeeilt an einen Ort, der sich mir verschloss.
»Frau Kiening«, insistierte ich, »kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich jemanden anrufen?«
Wie in Zeitlupe schüttelte sie den Kopf. »Nicht nötig«, antwortete sie. »Es ist alles in Ordnung, Maria-Antonia. Der Junge ist gerade da … er kümmert sich.« Sie hielt inne und rang nach Luft. »Niko. Wir haben eine kleine … Auseinandersetzung. Nichts Dramatisches.«
Ich konnte mir lebhaft vorstellen, worum es bei dieser Auseinandersetzung ging. »Soll ich mit ihm reden?«, fragte ich und trat einen Schritt auf sie zu.
Aber sie wehrte ab. »Nicht nötig!« Wieder hielt sie inne und setzte neu an. »Eine Bitte habe ich allerdings: Kannst du Coco in zwei Stunden ausnahmsweise auf deine Nachmittagsrunde mitnehmen? Ich glaube, das würde ihr heute guttun.«
»Kein Problem, Frau Kiening. Das mache ich gerne.«
»Kann ich mich darauf verlassen?«
Eine solche Frage hatte sie mir noch nie gestellt. »Selbstverständlich.«
Auf ihren Stock gestützt kam sie ein paar vorsichtige, wackelige Schritte auf mich zu, umarmte mich fest, wofür sie all ihre Kraft zusammenzunehmen schien, und drückte mir dann einen Kuss auf die Stirn. Auch das hatte sie noch nie zuvor getan.
»Mach dir keine Sorgen, Mia, ich komme zurecht.« Sie drehte sich um und ging zurück ins Haus. »Pass mir gut auf Coco auf«, sagte sie über die Schulter hinweg, ohne sich noch einmal umzudrehen. Dann fiel die Haustür ins Schloss.
Ich blieb davor stehen. Ihre Worte hatten etwas bedrückend Endgültiges. Pass mir gut auf Coco auf, hallte es in meinem Kopf. Es hatte wie ein Abschied geklungen. Hatte sie aus der Erfahrung des gestrigen Abends heraus etwa beschlossen, den Zeitpunkt ihres Sterbens vorzuverlegen? Um sich ihren Entschluss nicht noch auf den letzten Metern von ihrer Familie torpedieren zu lassen? Ich versuchte, mich damit zu beruhigen, dass sie in den kommenden vier Wochen noch so viel vorhatte und dass sie nicht allein war. Obwohl Nikos Anwesenheit nicht unbedingt zur Beruhigung taugte, schon gar nicht eine Auseinandersetzung mit ihm. Was war das Richtige in dieser Situation? Gehen oder bleiben und noch einmal klingeln? Nur was sollte ich sagen, was ich nicht bereits gesagt hatte?
Schweren Herzens setzte ich mich schließlich in Bewegung. Während ich den Vorgarten durchquerte, fiel mir auf, dass Nikos Wagen nicht wie üblich in der Garageneinfahrt stand. Seltsam.
»Haben Sie was verloren?«, dröhnte mir von gegenüber die Stimme von Bernas Nachbarn Helmut Böhm entgegen. Mit einer Gartenschere in der Hand lehnte der Neunundsiebzigjährige am Gartenzaun und fixierte mich mit einem Blick, den Hunde haben, bevor sie zum Angriff übergehen.
»Ich habe nur nachgedacht«, rief ich über die Straße hinweg.
Laut Berna war Helmut Böhm der Schrecken der gesamten Nachbarschaft. Außer seiner achtzigjährigen Schwester, mit der er sich das Elternhaus teilte, kam niemand mit ihm zurecht. Er war gehässig, laut und ständig gereizt.
Mit der Gartenschere fuchtelte er in meine Richtung. »Zahlen Sie überhaupt Steuern? Eine wie Sie arbeitet doch bestimmt schwarz. Wer kann das schon nachprüfen«, ereiferte er sich.
An einem anderen Tag hätte es mir vielleicht Spaß gemacht, etwas zu kontern, doch an diesem ignorierte ich seine Tiraden einfach und sah noch einmal zu Bernas Haus. Ich meinte, dass eine der Gardinen im Erdgeschoss sich bewegte. Vielleicht hatte ich es mir aber auch nur eingebildet. Berna würde dort ganz bestimmt nicht stehen und mir hinterhersehen, nicht in ihrer Verfassung. Und Niko hatte nicht erst seit unserer Trennung völlig das Interesse an mir verloren.
Mit einer SMS hatte er mir nach elf Monaten den Laufpass gegeben. Unsere Charaktere seien genauso wenig kompatibel wie unsere Lebensentwürfe. Außerdem verabscheue er meine Begeisterung für alles, was kreucht und fleucht. Als PS hatte er hinzugefügt, er würde mich juristisch dafür belangen, sollte ich Firmeninterna ausplaudern, über die ich während unserer Affäre etwas erfahren hatte. Danach hatte er weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert.
Letztlich hatte er nur getan, was ich längst hätte tun sollen, denn unsere unterschiedlichen Charaktere waren auch für mich eine Hürde. Während es ihm jedoch lediglich gegen den Strich ging, dass ich das Leben von Tieren achtete wie das eines jeden anderen Wesens, beängstigte mich seine durch und durch skrupellose Seite, die einer seiner Mitarbeiter zu spüren bekommen hatte. Dunkel hatte Berna diese Seite genannt, als ich bei ihr Rat suchte. So dunkel, dass man sie besser unter den Teppich kehrte. Sie hatte mir damals das Versprechen abgenommen, Stillschweigen darüber zu bewahren.
Vehement schob ich die Gedanken daran beiseite, sie umnebelten nur mein Gehirn. Nach einem letzten, unsicheren Blick zum Haus stieg ich in meinen Ducato, wo Bogart mich freudig empfing.
4
Tom erwartete mich bereits im Fei Scho in der Nähe des Gärtnerplatzes. Ich war mehr als eineViertelstunde zu spät. Vom Eingang aus betrachtete ich ihn einen Moment, während er konzentriert durch sein Smartphone scrollte. Wie immer trug er Jeans und Hemd, beides schwarz wie sein Haar, dazu eine gleichfarbige Lederjacke, die älter zu sein schien als er selbst, und einen dicken Schal. In seinem Gesicht schien sich nichts an den genau dafür vorgesehenen Stellen zu befinden, alles war einen Hauch verrutscht, asymmetrisch und dafür umso interessanter. Er sah nicht aus wie ein hart arbeitender Finanzanalyst, sondern eher wie ein Lebenskünstler.
Sekundenlang beschleunigte sich mein Puls. Ich holte tief Luft und ging mit Bogart auf seinen Tisch zu. Der Rüde benahm sich, als hätte er ihn tagelang nicht gesehen, und Tom ging darauf ein, indem er ihn einmal komplett durchknuddelte. Erst dann ließ der Hund sich unter dem Tisch auf einer Decke nieder, die Tom extra für ihn mitgebracht hatte.
»Entschuldige dieVerspätung«, sagte ich und hängte meine Jacke über die Stuhllehne.
»Ist etwas passiert?« Er schob mir die Menükarte zu und schenkte mir Wasser ein.
Ich warf einen schnellen Blick in die Karte und entschied mich für ein Gemüse-Curry. »Eine meiner Kundinnen war heute in keinem guten Zustand. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht und wusste nicht, was ich tun sollte.«
Fragend hob er die Augenbrauen.
»Was machst du, wenn du den Eindruck hast, jemand braucht Hilfe, er – in dem Fall sie – diese Hilfe aber ablehnt?«
»Dann respektiere ich das, sofern diejenige erwachsen und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist.«
Die Kellnerin kam an den Tisch, nahm unsere Bestellungen auf und wandte sich dann gleich dem nächsten Tisch zu.
»Sie wirkte benommen. Angeblich war ihr Neffe im Haus. Sie sagte, sie hätten eine Auseinandersetzung, aber sein Auto stand nicht wie sonst in der Garageneinfahrt.«
»Kennst du ihn?«
»Er ist mein Exfreund.«
»Nikolai Nawrath?« Tom hob eine Augenbraue. Er und Niko kannten sich von diversen beruflichen Veranstaltungen.
Ich nickte.
Tom trank einen Schluck Wasser und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Nur gut, dass du nicht an ihm hängen geblieben bist. Er passt nicht zu dir.«
»So in etwa hat er das auch ausgedrückt«, entgegnete ich trocken.
Um seine Augen herum bildeten sich Lachfältchen. »Ich wüsste jemanden, der viel besser zu dir passen würde.«
»Flirtest du mit mir?«
»Ganz eindeutig.«
Mein Herz machte einen Hüpfer. »Um auf meine Kundin zurückzukommen … also …«
»Ja?«
»Sieh mich bitte nicht so an!«
In diesem Augenblick kam unser Essen, und ich machte mich über mein Curry her, als hätte ich seit Tagen nichts gegessen.
Tom ließ seines erst einmal stehen und beugte sich ein wenig vor. »Kann es sein, dass du schüchtern bist?«
»Und wenn?«
»Dann würde ich das bei meinen Annäherungsversuchen in Betracht ziehen.«
Ich musste lachen und legte den Löffel beiseite. »Können wir mal einen Moment lang ernsthaft reden?«
»Das tue ich schon die ganze Zeit.«
»Nikos Tante hat ALS und wird in vier Wochen in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Mich lässt nur das Gefühl nicht los, dass sie gerade jetzt stirbt. Sie ist inzwischen schon sehr eingeschränkt, aber heute war sie benommen. Als hätte sie jede Menge Tabletten geschluckt. Und als sie sich von mir verabschiedete, kam es mir vor, als sei es für immer. Sie hat zwar behauptet, Niko sei bei ihr, aber das muss nicht stimmen, denn sein Auto war nicht da. Vielleicht hat sie mich belogen, um in Ruhe gelassen zu werden.«
»Aber hätte sie dann gesagt, dass sie eine Auseinandersetzung haben? Das passt irgendwie nicht.«
»Vielleicht doch.« Ich erzählte Tom von den Ereignissen des vergangenen Abends und Bernas Erklärung. »Ein Streit wäre die logische Folge gewesen. Vielleicht wollte sie mich damit von Nikos Anwesenheit überzeugen.«
Tom sah mich fassungslos an. »Nikolai Nawrath hat dich überfallen?«
»Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich war, ich vermute es nur. Zumindest wäre es ihm zuzutrauen.«
»Hat er dich verletzt?«
»Ein paar blaue Flecken, mehr nicht«, redete ich es klein.
»Der Kerl gehört hinter Gitter. Deine Solidarität mit seiner Tante in allen Ehren, aber das geht zu weit!«
»Sie hat nicht mehr lange zu leben, Tom. Vielleicht ist sie auch längst tot. Sie hat mich gebeten, ihren Pudel ausnahmsweise mit auf die Nachmittagsrunde zu nehmen. Das hat sie noch nie getan.«
Er schien nicht zu verstehen, worauf ich hinauswollte.
»Ich befürchte, dass die Attacken ihrer Familie sie dazu bewogen haben, sich früher als geplant davonzumachen. Damit sie sie nicht entmündigen und ihren Freitod verhindern können.« Ich biss mir auf die Lippe. »Coco ist ihr Ein und Alles. Sie würde nicht zulassen, dass die Hündin mit ihr allein bleibt und bis morgen früh niemand bemerkt, dass sie tot ist.«
»Kannst du denn in ihr Haus?«
»Über den Fingerabdruckscanner.«
»Möchtest du, dass ich dich begleite?«
Sekundenlang war ich versucht, Ja zu sagen, aber vielleicht machte ich hier gerade die Pferde scheu. Und selbst wenn nicht, was sollte geschehen? Ich würde ins Haus gehen, Coco nehmen und das Haus wieder verlassen. Berna würde sich bemerkbar machen, wenn sie bemerkt werden wollte. »Danke, Tom, aber das ist nicht nötig.«
Als ich etwas mehr als eine Stunde später in Bernas Hausflur stand, bereute ich meinen Entschluss. Die Stille, die sich über das Haus gelegt hatte, war bedrückend. Normalerweise musste ich nur eintreten und nach Coco rufen, da schallte mir schon ihr aufgeregtes Gebell entgegen. Aber jetzt war kein Ton zu hören.
Noch einmal rief ich nach ihr. Nachdem ich einen Moment gewartet hatte, ging ich den Flur entlang, bis ich in das großzügig geschnittene Wohnzimmer gelangte, in dem gestern die Terrassentür offen gestanden hatte. Der Raum war von der Nachmittagssonne durchflutet, die Staubkörnchen in ihrem Licht tanzen ließ. Mein Blick fiel auf einen kleinen Beistelltisch, der üblicherweise neben einer der Couchen stand. Er war umgefallen und hatte eineVase mit zu Boden gerissen, die unzählige Scherben und eine großeWasserlache auf dem Parkett zurückgelassen hatte. Bunte Tulpen lagen verstreut herum.
Ausgerechnet jetzt mit dem Aufräumen zu beginnen, war ganz sicher das Unwichtigste, aber alles in mir sträubte sich, die Treppe hinaufzugehen und nach Berna zu sehen. Ich versuchte, den Moment hinauszuzögern, ging in die Küche, holte Lappen und Kehrblech, beseitigte Scherben und Blumenwasser und stellte die Tulpen in eine andereVase, die ich von einem der Küchenschränke angelte. Zurück im Wohnzimmer richtete ich den Beistelltisch auf und stellte die Blumen darauf. Vom Couchtisch nahm ich die zwei benutzten Whiskeygläser, brachte sie in die Küche und räumte sie in die Spülmaschine. Ich hatte das Gerät gerade wieder geschlossen, als ich Coco ganz entfernt jaulen hörte. Sie klang jämmerlich.
Ich folgte diesem Laut durch den Flur und die Treppe hinauf in den ersten Stock. »Coco?«
Wieder dieser lang gezogene Laut. Er kam aus dem Schlafzimmer, dessen Tür geschlossen war. Mit der Hand auf der Klinke holte ich tief Luft. Dann öffnete ich die Tür.
Berna Kiening lag ausgestreckt auf ihrem Bett, die Augen geschlossen. Zögernd ging ich zu ihr, beugte mich über sie und griff nach ihrer Hand. Sie war sehr kühl und weich. In dem Versuch, sie aufzuwecken, drückte ich sanft zu. Sie reagierte jedoch nicht. Sie atmete nicht mehr. Trotzdem glitten meine Finger zu ihrem Handgelenk und suchten dort vergeblich nach einem Puls.
Leise rief ich Cocos Namen. Sie musste hier irgendwo sein. Als sie fiepte, fand ich sie zusammengekauert unter dem Bett.
»Komm her, meine Kleine.«
Sie rührte sich nicht und drehte den Kopf von mir weg.
»Nun komm schon.«
Doch es war nichts zu machen, sie blieb, wo sie war. Ich setzte mich auf den Boden, lehnte mich mit dem Rücken gegen das Bett und zückte mein Handy, um Bernas Hausarzt anzurufen. Jemand musste offiziell ihren Tod feststellen.
Ich sagte, es sei ein Notfall, und ließ mich von der Arzthelferin zu Markus Langhorst durchstellen. Wir kannten uns seit Kindertagen, waren auf dieselbe Schule in Pullach gegangen, hatten gemeinsam mit den Nawrath-Kindern gespielt und waren uns in den vergangenen Monaten immer wieder bei Berna begegnet. Markus war sofort bereit, seine Sprechstunde zu unterbrechen, um bei Berna einen letzten Hausbesuch zu machen. Bevor er auflegte, trug er mir auf, zur Sicherheit einen Notarzt zu rufen. Aber sie sei tot, versicherte ich ihm, ein Notarzt könne da nichts mehr ausrichten. Ich solle trotzdem anrufen, insistierte er, nur zur Sicherheit, damit wir uns später nichts vorzuwerfen hätten.
Ich hätte ihm gerne gesagt, dass ich es mir später ganz sicher vorwerfen würde, wenn ein Notarzt noch einen Funken Leben in ihr entdeckte und sie gegen ihren Willen zurückholte. Aber es war nicht der Moment. Widerwillig tat ich, wie mir geheißen, und rief die eins eins zwei an.
Dann ging ich zu der Standuhr, öffnete die Tür und hielt das Pendel an. Augenblicklich legte sich Stille über den Raum. Ich wandte mich zu Berna und strich sanft über ihre Hand. Sie hatte es geschafft. Unerträglich war nur der Gedanke daran, was sie dazu bewogen hatte, früher als geplant zu gehen. Ich war mir sicher, dass es am gestrigen Vorfall und der damit verbundenen Sorge lag, ihrer Familie könne es doch noch gelingen, sie zu entmündigen. Dafür hatte sie einiges geopfert. Nicht nur die letzten Wochen des Abschieds, die ihr so wichtig gewesen waren, sondern auch ihr Testament, das sie nun nicht mehr unterschrieben hatte.
5
Ein paar Minuten nach dem Notarzt traf Markus ein. Er begrüßte mich kurz, sah irritiert zu Coco, die zwischen meinen Beinen kauerte und fiepte, und stürmte die Treppe hinauf, als könne er bei seiner Patientin noch etwas ausrichten. Während ich ihn oben mit seinem Kollegen sprechen hörte, ging ich zurück ins Wohnzimmer und rief von dort aus meine Kunden an, deren Hunde ich an diesem Nachmittag hätte ausführen sollen. Coco sprang auf meinen Schoß und drückte sich zitternd an mich.
»Ich weiß, du wirst sie vermissen. Aber bei Karolin wirst du es ganz bestimmt auch gut haben.« Als wäre das in dieser Situation ein Trost für das Tier, als könnte es mich verstehen.
Ich war so tief in meinen Gedanken versunken, dass ich erschrak, als Markus sich mit einem unglücklichen Stöhnen neben mich aufs Sofa fallen ließ. Coco hatte sich ebenfalls erschreckt, sie machte sich auf meinem Schoß ganz klein und rund und klemmte die Rute ein. Ihr Zittern fühlte sich an wie ein kleines Erdbeben. Ich legte meine Arme fest um sie.
Markus schloss für einen Moment die Augen und raufte sich mit beiden Händen seine kurz geschnittenen, dunkelblonden Haare, die – obwohl er erst sechsunddreißig war – an den Schläfen bereits ergrauten. In seine Stirn hatten sich tiefe Falten gegraben.
»Erinnerst du dich, was du auf unseren Küchentisch geschrieben hast?«, fragte ich ihn. »Das Leben ist nicht gerecht. Zu Frau Kiening war es das nicht.«
Er murmelte etwas, das ich nicht verstand.
»Was hast du gesagt?«
»Wir mussten die Polizei rufen. Sie werden gleich hier sein.«
»Wieso die Polizei?«
»Weil es so aussieht, als wäre sie umgebracht worden.«
»Sie hat sich selbst das Leben genommen«, entgegnete ich im Brustton der Überzeugung. »Vielleicht nicht ganz so, wie sie es ursprünglich geplant hat, aber …« Ich forschte in seinem Gesicht. »Du weißt doch, dass sie es vorhatte. Oder hat sie dir etwa nichts davon gesagt?« Berna hatte aus ihrem Entschluss zu sterben eigentlich kein Geheimnis gemacht. Markus als ihr Arzt wusste ganz sicher davon.
Er richtete sich auf und sah mich aufmerksam an. »Wie kommst du darauf, dass sie sich umgebracht hat?«
»Als ich heute Mittag Coco zurückgebracht habe, wirkte sie so benommen, als hätte sie Tabletten genommen. Und sie hat meine Hilfe abgelehnt.« Die Hündin sprang von meinem Schoß und versuchte, durch die einen Spaltbreit offene Wohnzimmertür zu entwischen. Vermutlich wollte sie zurück ins Schlafzimmer. Ich ging hin, schloss die Tür und ließ mich im Schneidersitz auf dem Boden neben ihr nieder. »Wieso glaubst du, sie könnte getötet worden sein?«
»Weil es unmissverständliche Anzeichen dafür gibt, dass sie erdrosselt wurde.« Mit dem Zeigefinger fuhr er sich am Hals entlang.
Ich sah ihn erschüttert an. »Erdrosselt? Aber wer …?«
»Um das zu klären, haben wir die Polizei gerufen«, fiel er mir ins Wort.
»Ihr müsst euch irren«, beharrte ich. »Wieso sollte man jemanden umbringen, der ohnehin in vierWochen gestorben wäre? Das ergibt doch gar keinen Sinn.« In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Ich fischte den drängendsten heraus. »Außer jemand wollte ihr weiteres Leiden ersparen. Jemand, der nicht länger dabei zusehen konnte, wie sehr sie sich quälte.« Ich folgte diesem Gedanken wie einer Spur, verwarf ihn dann jedoch. Wer einem anderen Leid ersparen wollte, brachte ihn nicht um, und falls doch, ganz sicher nicht auf so brutale Weise. »Und ihr täuscht euch ganz bestimmt nicht? Als ich sie gefunden habe, lag sie doch ganz friedlich da.« Ich sprang auf und stürmte in den ersten Stock, wohin mir Coco dicht auf den Fersen folgte.
Neben Bernas Bett kniete der Notarzt, ein Mittvierziger mit Halbglatze und Oberlippenbart. Er war gerade dabei, seine Ausrüstung zusammenzupacken, und sah auf, als er mich ins Zimmer kommen hörte.
»Stimmt das?«, fragte ich aufgeregt und gab mir erst gar nicht die Mühe, meine Stimme im Zaum zu halten, während ich auf das Bett zulief.
»Bleiben Sie draußen und halten Sie bloß den Hund zurück!«, forderte er mich auf. »Das hier ist höchstwahrscheinlich ein Tatort, die Kripo wird gleich hier sein.«
Ich nahm Coco auf den Arm, tat ein paar Schritte zurück und blieb im Türrahmen stehen. Von dort aus wanderte mein Blick über Bernas Körper. Alles wirkte unverändert, lediglich den Schal hatte man ihr abgenommen. Ich versuchte, die Male an ihrem Hals zu erkennen, von denen Markus gesprochen hatte. »Dann stimmt es, dass sie umgebracht wurde?«
»Ja.«
»Ganz sicher?«
Er stand auf, lockerte seine Beine und betrachtete die Tote. »Kein schöner Tod.«
Kein schöner Tod. Diese Worte fraßen sich durch meine Schädeldecke und schienen sich tief in meinem Gehirn einnisten zu wollen. Als ich Berna mittags in ihrem benommenen Zustand im Haus zurückgelassen hatte, hatte ich es für möglich gehalten, dass sie an diesem Tag sterben würde. Aber doch nicht so. Nicht durch fremde Hände. Nicht mit Gewalt.
Der Gedanke traf mich mit voller Wucht: Ich hatte ihr nicht geholfen. Weil …
»Hören Sie mich?«, drang eine tiefe, nasale Männerstimme in meine Gedanken.
Ich stellte meinen Blick scharf und richtete ihn auf einen Mann, der höchstens ein paar Jahre älter war als ich. Er trug einen dicken Rollkragenpullover, Jeans und eine Steppweste, hatte einen Bürstenhaarschnitt, Aknenarben und wachsame Augen. Ich nickte und merkte erst jetzt, dass ich Coco immer noch im Arm hielt. Wie ich hinunter ins Wohnzimmer gekommen war, konnte ich nicht sagen. Mit dem Rücken zurTerrasse stand ich verloren im Raum.
»Ludwig Scherf«, stellte er sich vor, »Kripo München. Und wer sind Sie?« Er nieste und schnäuzte sich die Nase mit einem Papiertaschentuch. »Heuschnupfen«, erklärte er mit einem Schulterzucken. »Die Frühblüher.«
Noch am Vormittag hatte ich im Englischen Garten die ersten Blüten bewundert und sie für Berna fotografiert. Sie schienen meilenweit fort zu sein und derVormittag eine Ewigkeit her. Ich riss mich zusammen und sah ihn an. »Maria-Antonia Kaminski«, stellte ich mich vor. »Ich habe Frau Kiening gefunden.« Mein Blick huschte kurz zu Coco. »Ich betreue ihre Hündin.«
Er deutete zum Sofa. »Setzen wir uns einen Moment.«
Ich folgte seiner Aufforderung, behielt dabei aber Coco im Arm, die an mir zu kleben schien.
Ende der Leseprobe