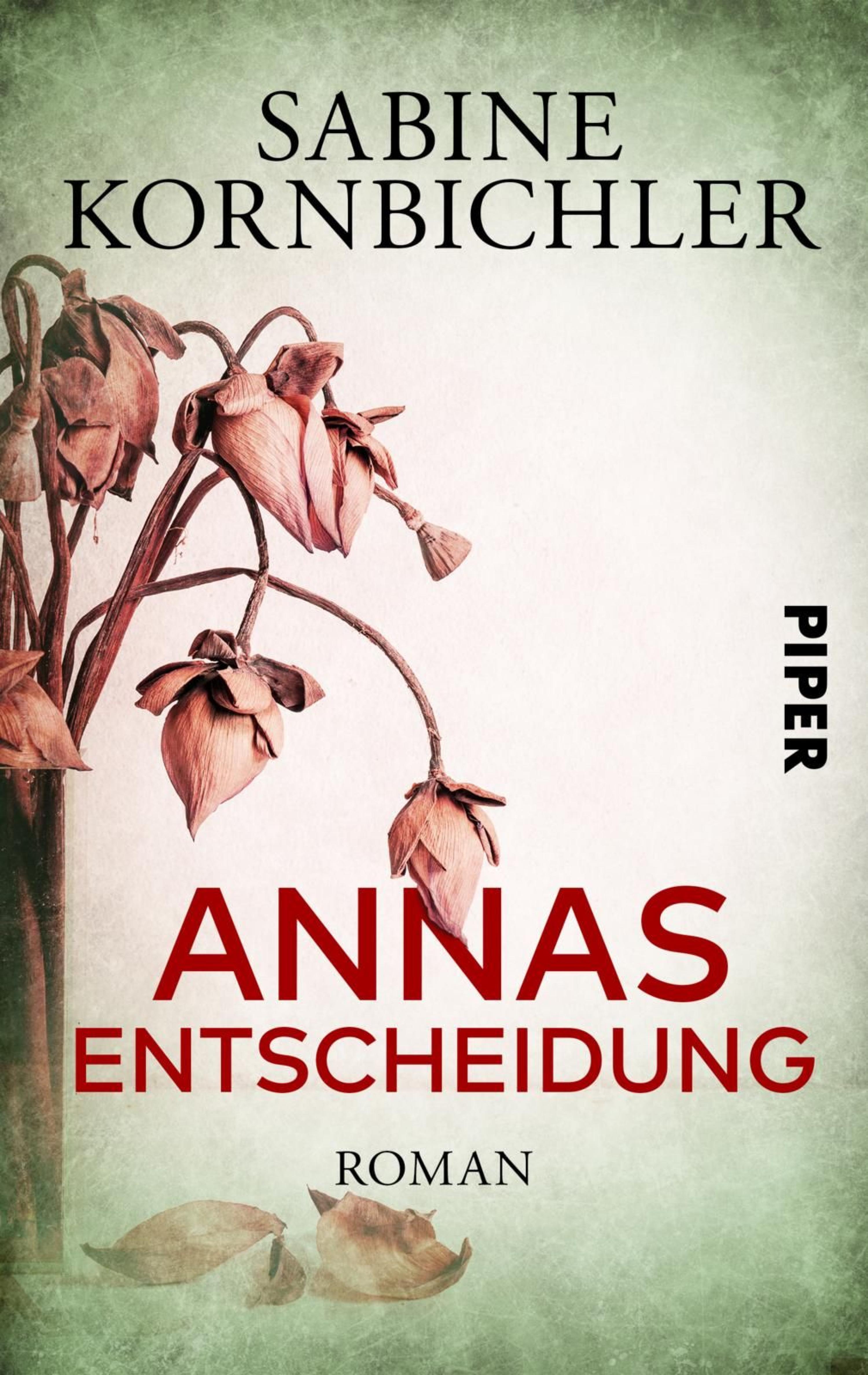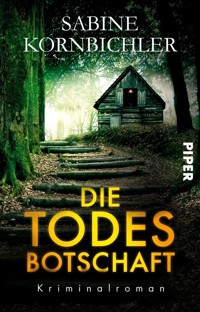8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Kristina Mahlos Auftrag als Nachlassverwalterin hat es in sich. Eine Verstorbene vererbt ihr beträchtliches Vermögen – jedoch nur unter der Bedingung, dass Kristina den Mord aufklärt, für den ihr Mann einst verurteilt worden war. Kris will den Fall ablehnen, doch dann entdeckt sie in der Wohnung der Toten einen Hinweis auf ihren eigenen Bruder Ben, der vor Jahren spurlos verschwand …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96085-4
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung und -motiv: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von plainpicture/Arcangel
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Die Stimme des Vaters war schwächer geworden mit den Jahren, doch seine Worte waren wie ein nie verhallendes Echo. »Es kommt darauf an, besser zu sein als die anderen. Nimm deinen Stift und schreib: Ich bin intelligenter. Ich bin mutiger. Ich bin schlauer. Ich bin skrupelloser. Ich bin überzeugender. Ich bin besser. Hast du das? Gut. Und jetzt schaust du jeden Morgen nach dem Aufstehen auf deine Liste. Wenn du dich anstrengst, kannst du bald hinter jede dieser Eigenschaften einen Haken machen.«
»Wozu?«
»Wozu wohl? Mit ihrer Hilfe lässt sich eine Karriere planen.« Der Vater hatte gelacht. »Oder ein perfektes Verbrechen.«
»Ein Verbrechen?«
»Hör gefälligst genau zu, wenn ich dir etwas erkläre. Ich rede von einem perfekten Verbrechen. Wer es nicht bis an die Spitze schafft, ist genauso ein Idiot wie ein Knastbruder. Wenn du Dummheit begreifen willst, musst du nur ein Gefängnis besuchen.«
Es war lange her, dass der Vater das gesagt hatte, aber seine Worte hatten nicht an Kraft verloren. War das jetzt perfekt? So perfekt, dass es nicht entdeckt wurde? Der abgelegene Ort, die nicht herzustellende Verbindung, das fehlende Motiv? Und die vielen Schaufeln Erde. Dumm war es ganz bestimmt nicht.
Einen Moment schien es, als stünde der Vater am Rand der Grube. Als gingen sie gemeinsam noch einmal die einzelnen Punkte seiner Liste durch … intelligenter … mutiger … schlauer. Gut!
1 Etwas war anders an diesem Morgen. Mit einem Ruck blieb ich stehen. Während ich mich Schritt für Schritt um die eigene Achse drehte, drückten sich winzige Steinchen in meine nackten Fußsohlen. In der Morgendämmerung betrachtete ich meine Umgebung, als sähe ich sie zum ersten Mal. Die Hofanlage am Ende einer schmalen Stichstraße beherbergte mehrere Gebäude: Das zweistöckige Wohnhaus mit weißer Fassade und dunkelroten Fensterläden, von denen einige zu dieser frühen Stunde noch geschlossen waren. Die lang gezogene Scheune mit Rundbogentor, deren obere Hälfte nachträglich mit Holzlatten verschalt und mit Fenstern ausgestattet worden war. Und schließlich das Nebengebäude, Simons Reich, in dessen Erdgeschoss noch alle Jalousien heruntergelassen waren. Nirgends brannte Licht. Alles war wie immer um diese Uhrzeit, und doch so seltsam anders.
Wann hatte mich dieses Gefühl beschlichen? Ich kehrte zu dem Augenblick zurück, als ich Simons Wohnung im ersten Stock des Nebengebäudes verlassen und leise die Tür hinter mir zugezogen hatte. Über die hölzerne Außentreppe war ich durch den Garten zum Innenhof gelaufen. Dabei hatte ich die To-do-Liste für diesen Tag vor meinem inneren Auge abgespult. Vielleicht war mir auf dem Weg etwas aufgefallen, unbewusst, im Vorübergehen. Ich wandte mich um und betrat durch den Bogen aus gelben Kletterrosen wieder den hinteren Garten, der das Areal zwischen dem Wohnhaus an der Längsseite und dem Nebengebäude an der Kopfseite des Grundstücks ausfüllte. Mein Blick wanderte von Simons Wohnungstür über die Wiese zum ehemaligen Hühnerstall, der als Geräteschuppen diente und dicht an der zwei Meter hohen Hecke stand, hinter der sich ein öffentlicher Park anschloss. Nichts. Ich ging ein paar Schritte weiter über das feuchte Gras, um auf die Terrasse des Haupthauses sehen zu können, die hinter Apfelbäumen und dem Gemüsegarten verborgen war. Auch hier nichts Ungewöhnliches.
Vielleicht hatte ich es gar nicht mit den Augen wahrgenommen. Ich spitzte die Ohren, hörte aber nur das Zwitschern der Vögel, den Hahn aus der Nachbarschaft und in der Ferne das Rauschen der A8 und A99. Der Wind trug den Duft der Kräuterbeete zu mir, Salbei, Rosmarin und Thymian.
Mit klopfendem Herzen lief ich zum zweiten Mal an diesem Morgen Richtung Wohnhaus. Und dann sah ich, was ich zuvor schon gesehen, aber nicht wahrgenommen hatte: Die Kerze war erloschen. Meine Adern fühlten sich an, als würde Eiswasser durch sie hindurchfließen.
Dort, wo die hüfthohe, mit Bonsaibäumchen vollgestellte Steinmauer auf die Ecke des Wohnhauses zulief, stand zum Hof hin eine Laterne aus Glas und Metallstreben mit einer dicken weißen Kerze darin. In den vergangenen sechs Jahren waren unzählige solcher Kerzen in dieser Laterne abgebrannt worden, und das Kerzenlicht war noch nie verlöscht. Solange es brannte, gab mein Vater den Glauben daran nicht auf, dass Ben noch am Leben war. Dass mein Bruder irgendwann zurückkehren würde.
Ich hielt den Atem an und schaute zu dem Fenster im ersten Stock, hinter dem sich das Schlafzimmer meines Vaters befand. In der Regel stand er nicht vor acht Uhr auf, es gab jedoch Ausnahmen. Ich horchte, ob sich dort oben etwas tat. Dann ging ich in die Knie und schaute durch das Glas auf die Kerze, die erst zu einem Drittel verbraucht war. Der schwarze Docht war nicht im Wachs versunken, wie ich im ersten Augenblick angenommen hatte. Auch der Wind konnte die Flamme nicht gelöscht haben, die Tür der Laterne war fest verschlossen.
So leise wie möglich öffnete ich die Haustür und lief über kalten Stein in den ersten Stock, wo meine Wohnungstür der meines Vaters gegenüberlag. Sie ließ sich geräuschlos aufsperren. Die alten Holzdielen im Flur würden längst nicht so kooperativ sein. Ich verlegte mich auf einen Zickzackgang. Mittlerweile wusste ich genau, welche Stellen ich meiden musste, um ohne ein Knarren in meine Küche zu gelangen. Ich schnappte mir das Feuerzeug von der Fensterbank und lief wieder nach unten.
Als ich mich gerade zu der Laterne bückte, wurde neben mir der Fensterladen aufgestoßen.
»Was machst du da?«, wollte meine Mutter wissen.
Blitzschnell hielt ich einen Finger vor die Lippen und gestikulierte mit dem Feuerzeug Richtung Laterne.
Sie beugte sich aus dem Fenster. »Oh mein Gott«, flüsterte sie und legte sich eine Hand auf die Brust.
»Das bedeutet gar nichts!«
Ihr Blick klebte an der Laterne. »Aber …«
»Scht!« Ich öffnete die Laternentür und entzündete die Kerze. Als die kleine Glastür wieder eingerastet war, richtete ich mich auf und atmete aus. »So, das war’s.«
»Kommst du auf einen Kaffee zu mir?«, fragte meine Mutter.
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Zeit. Heute fängt meine neue Mitarbeiterin an, und ich muss noch einiges vorbereiten.«
»Bitte … nur für fünf Minuten.«
Die Küche meiner Mutter war vom Duft frisch gebrühten Kaffees und aufgebackener Semmeln erfüllt. Sie stellte zwei dampfende Becher auf den runden Holztisch, um den herum Stühle in unterschiedlichen Formen und Farben standen. Ich saß wie immer auf dem hellblauen, sie auf dem lilafarbenen. Auch in den offenen Regalen, die mit Geschirr, Töpfen und Gläsern vollgestellt waren, ging es bunt zu. Nur bei der Deckenlampe, die aussah wie ein umgedrehter Eimer, hatte sie sich für Weiß entschieden.
Für sich selbst bevorzugte meine Mutter von jeher gedecktere Töne. Sie trug oft Schwarz, wobei sie ihren Stil ganz bewusst an der Mode orientierte und nicht an ungeschriebenen Gesetzen, wie eine Achtundfünfzigjährige sich zu kleiden habe. An diesem Morgen steckte ihr Körper in einem anthrazitfarbenen Jogginganzug, der ihre weibliche Figur betonte. Um die Hüften hatte sie einen Pulli geschlungen.
Ich ließ meinen Blick über ihr Gesicht gleiten, das von dunkelbraunen, von Silberfäden durchzogenen Haaren gerahmt wurde, die ihr bis zur Schulter reichten. Um ihre braunen Augen herum hatte sich ein Gespinst von Fältchen gebildet, ihre Haut war durchscheinend geworden. Wie ein Wäschestück vom häufigen Waschen sei ihre Haut von den vielen Tränen strapaziert worden, hatte sie einmal gesagt. Nicht nur die Haut. Auch ihre Augen schienen dem Weinen näher als dem Lachen. Immer noch. Aber wie hätte sich das auch ändern sollen?
Mein Blick wanderte zu dem Foto auf der Fensterbank, das meinen zwei Jahre jüngeren Bruder Ben und mich Arm in Arm zeigte. Es war ein paar Wochen vor seinem Verschwinden aufgenommen worden. Im Aussehen schlugen wir eindeutig nach unserem Vater. Ben hatte dunkelblondes Haar, meines war etwas heller und fiel mir in Wellen weit über die Schultern. Beide hatten wir hohe Wangenknochen und grüne Augen, seine waren grünbraun, meine grün mit einem Hauch von Bernstein. Ich hatte die vollen Lippen meiner Mutter geerbt. Groß gewachsen waren wir beide, allerdings überragte er mich mit einem Meter sechsundachtzig um zehn Zentimeter.
Ben hatte mir kurz vor der Aufnahme dieses Fotos verraten, dass er beabsichtige, sein Informatikstudium an den Nagel zu hängen, weil es ihm kaum neue Erkenntnisse beschere. Was er ohne einen Abschluss anfangen wolle, hatte ich ihn gefragt, und zur Antwort bekommen, ihm werde schon etwas einfallen. Und dann war ich diejenige gewesen, die sich von einem Tag auf den anderen etwas hatte einfallen lassen müssen. Ich schob die Erinnerung beiseite.
Nur mit Tanktop und Schlafanzughose bekleidet, begann ich allmählich zu frieren. Der Kaffee war noch zu heiß, um ihn zu trinken. Ich zog die Knie an, stützte die Fersen auf der Stuhlkante ab und schlang die Arme um die Unterschenkel.
»Du bist viel zu dünn angezogen, Kris. Möchtest du dir meinen Pulli umlegen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich werde gleich heiß duschen.«
Ihr Blick wanderte ziellos im Raum umher. Sie verschränkte ihre Hände ineinander, sodass die Knöchel weiß hervortraten. »Wie kann das sein?«
Als ich nicht sofort antwortete, wiederholte sie die Frage. Dieses Mal zitterte ihre Stimme.
»Vielleicht ist der Docht feucht geworden, oder eine Windböe hat es durch eine der Ritzen geschafft. Vielleicht wollte uns jemand einen Streich spielen«, versuchte ich meine Mutter zu beruhigen.
»Jemand, der uns kennt, müsste schon ein Sadist sein, um so etwas zu tun. Und Fremde wissen überhaupt nicht, welche Bedeutung diese Kerze für uns hat.«
»Mindestens zwei Zeitungen haben damals darüber berichtet. Über dieses Hoffnungslicht für Ben.«
»Selbst wenn sich noch jemand daran erinnern würde … so etwas tut doch keiner, das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Und ich weigere mich, an diesen übersinnlichen Hokuspokus zu glauben! Es reicht, wenn Papa überzeugt ist, Ben sei am Leben, solange diese Kerzen brennen.« Ich nahm den Kaffeebecher und stand auf.
Meine Mutter zog die Brauen zusammen. Eine steile Falte teilte ihre Stirn in zwei Hälften. »Und warum warst du vorhin so verstört da draußen?« Es lag nichts Rhetorisches in dieser Frage.
»Ich war nicht verstört, ich habe versucht zu verhindern, dass Papa einen Herzinfarkt bekommt, wenn er aufsteht und wie jeden Morgen als Erstes einen Blick auf diese verdammte Kerze wirft.«
»Nenn sie bitte nicht so.«
»Dieses Licht hat ausschließlich etwas mit Papa zu tun. Bens Leben hängt sicherlich nicht an so einem Wachsteil.«
»Es gibt Menschen, die daran glauben. Für deinen Vater ist es ein Weg, um durchzuhalten.« Mit dem Handrücken wischte sie sich über die Augenwinkel. »Trinkt er eigentlich immer noch so viel?«
Ich zuckte die Schultern. Sie wusste genau wie mein Vater, dass ich auf solche Fragen nicht antwortete. Trotzdem versuchten es beide immer wieder. Könnte ja sein, sie erwischten mal einen meiner nachgiebigeren Momente.
Vor fünf Jahren hatten meine Eltern sich getrennt und aus der linken Haushälfte zwei Wohnungen gemacht. Meine Mutter war in die untere, mein Vater in die obere gezogen. Als sie feststellten, dass die Trennung von Tisch und Bett nicht die erhoffte Erlösung brachte, hatten sie aufgehört, miteinander zu reden, und begonnen, ausschließlich über gelbe Klebezettel an den Briefkästen miteinander zu kommunizieren. Die Frage »Trinkst du immer noch so viel?« machte sich auf einem solchen Zettel natürlich nicht so gut – zumal die Briefkästen im Hausflur gleich hinter der Eingangstür angebracht waren. Und dort kam nicht nur ich vorbei.
»Mitten in der Nacht«, sagte sie leise, »wenn ich aus meinen Albträumen aufwache und die grauen Schatten über mich herfallen, gibt es Momente, die jede Hoffnung zunichtemachen. Aber am Morgen nehme ich all meine Kraft zusammen und stehe auf. Und dann ist die Hoffnung wieder da, dass Ben doch noch zurückkehrt, und diese Hoffnung trägt mich durch den Tag.«
Als ich nach einer heißen Dusche und einem Frühstück im Stehen hinunter ins Erdgeschoss lief, verbot ich mir jeden Gedanken an die Kerze und die schlaflosen Nächte meiner Mutter. Im Büro konzentrierte ich mich auf die Frage, was noch zu tun war, bevor Funda Seidl in einer Stunde ihren neuen Job bei mir antreten würde. Ich ließ meinen Blick durch den Raum wandern. Es war mir gelungen, ihn mit allem auszustatten, was in ein Büro gehörte, ihm gleichzeitig aber eine anheimelnde Note zu verleihen. Außer den beiden Schreibtischen, den rückenfreundlichen Drehstühlen und den PCs gab es grasgrüne Aktenschränke, ein urgemütliches Stoffsofa in Dunkellila und einen Couchtisch aus hellblauen Glasbausteinen, elfenbeinfarbene Raffrollos und einen Strauß weißer Hortensien aus dem Garten.
Ich hoffte, meine neue Mitarbeiterin würde sich hier wohlfühlen und nicht nach kurzer Zeit kündigen, wie es ihre beiden Vorgängerinnen mit der Begründung getan hatten, sie hätten sich die Abwicklung von Nachlässen anders vorgestellt, angenehmer irgendwie. Die eine hatte bei verwahrlosten Haushalten die Nase gerümpft, der anderen war vom Verwesungsgeruch schlecht geworden. Dabei hatte ich in den Bewerbungsgesprächen keine der Schattenseiten dieser Arbeit verschwiegen. Aber wie bei so vielem zeigte sich auch hier, dass die Vorstellung von etwas an die Realität nicht heranreichte. Wer nicht bereit war, auch einmal die Zähne zusammenzubeißen und zuzupacken, war bei der Nachlassverwaltung zum Scheitern verurteilt. Dabei bot sie einen Aspekt, der für mich alles andere aufwog: Ich sah mich als Anwältin der Toten, um deren Hinterlassenschaften und letzte Wünsche ich mich kümmerte.
Funda Seidl, mit ihren siebenundzwanzig fünf Jahre jünger als ich, hatte mir in ihrem Bewerbungsgespräch verraten, sie fühle sich zu jung, um immer das Gleiche zu machen. Arzthelferin sei sie lange genug gewesen, und als Mutter einer dreijährigen Tochter habe sie auch schon jede Menge Erfahrung sammeln können. Sie suche nach einer Halbtags-Herausforderung, und ihr sei garantiert absolut nichts zuwider. Ich hätte nicht sagen können, warum, aber ich hatte ihr geglaubt.
Nach einem Blick auf die Uhr setzte ich in der Küche eine Kanne Kaffee auf. Kaum hatte ich danach die Tür zu meinem kleinen Vorgarten geöffnet, wurde ich lautstark von einer zahmen Krähe begrüßt, die im Quittenbaum auf mich wartete. Mit schnellen Blicken in alle Richtungen prüfte Alfred, ob die Luft rein war, breitete schließlich die Flügel aus und landete auf dem Gartentisch, um sich wie jeden Tag mit einer Walnuss belohnen zu lassen. Sobald er sie aufgepickt hatte, verschwand er über die Buchenhecke hinweg, die mir zur Straße und zum Innenhof hin als Sichtschutz diente.
Ich nutzte die Zeit, bis der Kaffee durchgelaufen war, setzte mich auf die Holzbank und lehnte meinen Kopf gegen die Hauswand. Der Himmel war an diesem ersten Septembermorgen fast wolkenlos. Seit ein paar Tagen wurden die Nächte kühler, die ersten Blätter verfärbten sich, und die Sonne warf längere Schatten, aber sie wärmte noch immer. Ich schloss die Augen, sog den Duft der Quitten ein und landete doch gleich darauf mit meinen Gedanken wieder bei der Kerze. Unmöglich, dass sie von selbst ausgegangen war. Gäbe es irgendeinen Materialfehler, hätte sie nach dem erneuten Anzünden sofort wieder verlöschen müssen.
Das Röcheln der Kaffeemaschine setzte dem Gedankenkarussell ein Ende. Ich trug das Tablett mit Kanne und Bechern ins Büro und stellte es auf den Glasbausteinen ab. Als sich ein kleiner warmer Körper gegen meine Unterschenkel drückte, ging ich in die Knie und streichelte Rosa, die mir durch die offene Terrassentür in mein Büro gefolgt war. Kaum hatte ich unsere Begrüßungszeremonie beendet, verzog sich Simons fünfjährige Mischlingshündin in ihr Hundebett neben meinem Schreibtisch.
Ihren Namen verdankte sie ihrem Prinzessinnengehabe, für das laut Simon allein die Farbe Rosa in Betracht kam. Bei Regen riskierte sie lieber Inkontinenz, als auch nur eine ihrer Pfoten vor die Tür zu setzen. Außerdem bedurfte es stets einer weichen Unterlage, bevor sie sich auf dem Boden niederließ. Gegenüber Katzen, Kaninchen und Eichhörnchen präsentierte sie sich hingegen alles andere als rosa.
Auf das Klingeln an der Tür reagierte sie mit einem halbherzigen Bellen, bevor sie sich wieder zusammenrollte. Gleich darauf schlug die Glocke von St. Georg neunmal. Funda Seidl war pünktlich. Ich eilte in den Flur und zog das Blümchenkleid aus Samt glatt, das ich über meiner Jeans trug, bevor ich die Tür öffnete.
Als ich meiner neuen Mitarbeiterin gegenüberstand, wurde mir schlagartig bewusst, dass ich mich nicht allein deswegen für sie entschieden hatte, weil sie sich vor nichts ekelte. Sie machte den Eindruck, als sei sie voll unbändiger Vorfreude auf meiner Fußmatte gelandet. Ein wenig außer Atem pustete sie die Spitzen ihrer zu einem Bob geschnittenen dunklen Haare aus der Stirn und zupfte mit einer Hand an ihrer dunkelroten Wickelbluse herum. Die Beine ihrer hautengen Jeans steckten in Stiefeln mit Absätzen, die waffenscheinpflichtig hätten sein müssen, ihre eins sechzig aber um gut zehn Zentimeter aufstockten.
»Auf die Minute. Perfekt, oder? Ich hab mich wirklich selbst übertroffen. Weißt du, wie es ist, wenn eine Dreijährige ihren Kopf durchsetzen und mit genau den Stiefeln in den Kindergarten gehen will, die du gerade trägst?« Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Mein Gott, bin ich aufgeregt. Du gar nicht, oder?«
Ich musste lachen. »Komm rein.«
Mit drei Schritten war sie an mir vorbei, beugte sich zu Rosa, strich ihr über den Kopf und steuerte schnurstracks auf ihren neuen Schreibtisch zu. Ein in Alufolie gewickeltes Päckchen, das sie die ganze Zeit in einer Hand balanciert hatte, deponierte sie vorsichtig auf dem Schreibtisch, ihre überdimensional große Tasche ließ sie danebenplumpsen. Sie setzte sich auf den Drehstuhl, der unter ihrem Gewicht kaum nachgab. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Job hier freue. Ich hab kaum geschlafen heute Nacht.« Sie musterte mich. »Du hast aber auch nicht viel geschlafen, oder?«
»Ich schlafe nie viel.«
»Wie hältst du dann den Tag durch?«
»Mit Unmengen von Kaffee.« Ich setzte mich ihr gegenüber, erwiderte ihren Blick und stellte fest, dass ich ihr stundenlang hätte zuhören können. Ihre Stimme und ihre Art zu sprechen hatten etwas von einem sanft plätschernden Zimmerbrunnen.
»Übrigens rede ich nur so viel, wenn ich aufgeregt bin«, erklärte sie. »Früher habe ich dann Schluckauf bekommen. Das hat sich zum Glück gelegt.«
»Wie hast du dich aus der Nummer mit den Stiefeln gerettet?«, fragte ich.
»Indem ich behauptet habe, die Klingel bei meiner neuen Arbeitsstelle sei hoch über der Eingangstür angebracht und ich käme nur auf diesen Absätzen daran. Und wenn ich nicht klingeln könnte, würde niemand bemerken, dass ich da sei. Und dann würde ich den Job gleich wieder verlieren und könnte nachmittags nicht mit ihr Eis essen gehen.«
»Das hat sie geglaubt?«
»Sie ist meine Tochter. Natürlich hat sie es nicht geglaubt, aber sie liebt Geschichten. Ich werde sie irgendwann mal mitbringen, damit du sie kennenlernst. Apropos Mitbringsel – das hier ist von meiner Mutter.« Sie reichte mir das Alupäckchen. »Kennst du Baklava? Obwohl ich damit aufgewachsen bin, könnte ich immer noch dafür sterben.«
»Blätterteig, Pistazien, Butter und Zuckersirup«, zählte ich blitzschnell auf. »Himmlisch.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt.« Nachdem ich das Päckchen geöffnet hatte, schob ich mir eines der kleinen Teilchen in den Mund.
»Die machen beim ersten Bissen süchtig«, sagte sie.
»Ich weiß.« Ich schob ein zweites Baklava direkt hinterher.
»Du musst nur einen Ton sagen, dann bringe ich Nachschub mit. Meine Mutter beherrscht ein unendliches Repertoire an türkischen Süßigkeiten. Und sie freut sich, wenn sich der Kreis der Abnehmer erweitert – quasi als Gegengewicht zu Leberkäse und Schweinebraten.«
»Türkisch-bayerisches Gleichgewicht?«
»Mein Vorname ist der beste Beweis. Eigentlich sollte ich Johanna heißen, meine Mutter hat Funda durchgesetzt. Der Name bedeutet auf Türkisch Bergblumenwiese. Das war meiner Mutter bayerisch genug. Aber ich höre jetzt mal besser auf, von meiner Familie zu erzählen. Du willst mir bestimmt jede Menge erklären.«
Ich stand auf und winkte sie zum Sofa. »Magst du einen Kaffee?«
Nachdem eine knappe Stunde lang ausschließlich ich geredet hatte, meldete Funda sich wieder zu Wort.
»Wie hältst du es eigentlich aus, nicht ans Telefon zu gehen?«
Kurz hintereinander waren drei Anrufe hereingekommen. Ich hatte sie ausnahmslos dem Anrufbeantworter überlassen. Mit halbem Ohr hatte ich die Nachrichten mitgehört. »Das musst du hier lernen, Funda, sonst kommst du nicht zum Arbeiten und wirst ständig unterbrochen.«
»Aber bei der letzten Anruferin, dieser Frau …«
»Lischka.« Wer immer sie war.
»Ja. Bei der klang es ziemlich dringend.«
»Die meisten, die hier anrufen, lassen es dringend klingen. Aber wir arbeiten hier in erster Linie für die Toten. Was die Erben anbelangt, gebe ich mir Mühe, die Sache so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, aber ich überschlage mich nicht. Warte ein, zwei Wochen, dann wird es dir genauso gehen.«
»Okay, dann fasse ich jetzt mal kurz zusammen, worum es hier geht, ja?«
Ich nickte.
»Also, wenn ich alles richtig verstanden habe, bekommst du deine Aufträge vom Nachlassgericht, und das auch nur dann, wenn die Erben unbekannt sind.«
»Oder wenn jemand in seinem Testament verfügt hat, dass durch das Nachlassgericht ein Testamentsvollstrecker bestellt wird.«
»Okay. Es ist also jemand gestorben. Du wirst mit der Regelung des Nachlasses beauftragt, gehst in die Wohnung oder das Haus, durchsuchst alles nach Wertgegenständen und …«
»Dokumenten.«
Funda nickte und fügte diesen Punkt einer imaginären Liste hinzu. »Und dann erstellst du eine Nachlassbilanz, suchst die Erben und fertig. Was ist, wenn du keine Erben findest?«
»In dem Fall wird das Fiskuserbrecht festgestellt.«
»Das heißt, du machst alles zu Geld, was der Tote hinterlassen hat, und überweist es an die Staatskasse?«
»So ungefähr.«
»Darf ich dich mal was fragen, Kristina?« Ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort. »Die müssen dir ganz schön vertrauen beim Nachlassgericht. Ich meine, du hast vorhin gesagt, jeder Hinz und Kunz könne Nachlassverwalter werden.«
Zwischen den Zeilen lesen konnte sie also auch, vermerkte ich im Stillen. »Ganz so habe ich es nicht ausgedrückt. Fakt ist, dass jeder diese Arbeit machen kann – egal ob Buchhalter, Pfarrer oder Hausfrau. Aber das Nachlassgericht beauftragt natürlich lieber Leute mit Erfahrung, das heißt mit Verhandlungsgeschick, juristischen Grundkenntnissen, mit Ahnung von Erb-, Familien- und Steuerrecht, Kenntnissen in Bank- und Versicherungswesen, Vermögensanlagen und Immobilien.«
»Und das beherrschst du alles?«
»Ich habe monatelang gebüffelt, um zumindest halbwegs eine Ahnung zu bekommen. Und mit jedem Fall lerne ich dazu. Es ist keiner wie der andere.«
»Wie wollen die überhaupt wissen, dass sie dir vertrauen können? Gelegenheit macht Diebe, heißt das nicht so? Ich meine …« Sie wedelte aufgeregt mit den Händen. »Oh mein Gott, wie sich das anhört! So hab ich es gar nicht gemeint. Manchmal sollte ich wirklich eine Sekunde nachdenken, bevor ich den Mund aufmache.«
Ich musste lachen. »Ich habe viel dafür getan, mir in meinem Bereich einen guten Ruf zu verschaffen, und den setze ich ganz bestimmt nicht aufs Spiel.«
»Hast du tatsächlich noch nie damit geliebäugelt, etwas mitzunehmen? Wenn du zum Beispiel weißt, dass es keine Erben gibt und du es niemandem vorenthältst?«
Sekundenlang hatte ich das Gefühl, Funda würde mir auf den Grund meiner Seele blicken. Ich fühlte mich ertappt. »In dem Fall würde ich es nicht einfach mitnehmen, sondern zum Beispiel den Entrümpler fragen, ob ich es abkaufen kann. Aber es ist bisher noch nie vorgekommen. Bei dieser Arbeit hast du es jeden Tag mit all den Dingen zu tun, die ein Mensch während seines Lebens sammelt und hütet und auf die er glaubt, nicht verzichten zu können. Und dann stirbt er, und das meiste landet im Müllcontainer, im Trödelladen oder auf Flohmärkten. Das hat meine Sicht auf die Dinge ziemlich verändert. Mir genügt es, etwas schön zu finden und es zu bewundern, ich muss es nicht besitzen.« Während ich das sagte, schämte ich mich dafür, sie zu belügen. Es ging jedoch niemanden etwas an, dass ich aus Nachlässen ohne Erben Briefe, Tagebücher und persönliche Aufzeichnungen mitnahm. All das in den Müllcontainer zu werfen wäre mir wie ein Verbrechen an den Menschen vorgekommen, die ihr Innerstes diesen Seiten anvertraut hatten. In meinen schlaflosen Nächten las ich darin.
»Machen dich all diese Dinge, die zurückgelassen werden, nicht manchmal traurig?«
»Mich machen Schicksale traurig. Wenn Menschen einsam und verwahrlost sterben. Aber es gibt auch die, die mit fünfundachtzig friedlich einschlafen. Die machen mich froh. Jeder, dem es ähnlich ergeht, darf sich glücklich schätzen. Und jetzt …«
»Warte! Eine Frage habe ich noch. Darf ich eigentlich zu Hause von dem erzählen, was ich hier mache?«
»Darüber, was du generell hier tust, darfst du selbstverständlich erzählen. Die Details unterliegen allerdings der Verschwiegenheitspflicht, davon darf nichts nach außen dringen.« Ich klatschte in die Hände, woraufhin Rosa aufsprang, als habe ich zur Jagd geblasen. »So, jetzt werfen wir einen Blick in die Kammer des Schreckens.«
Funda sah sich in dem Raum um, der über zwei Wände hinweg Regale mit tiefen Brettern und einen Tresorschrank beherbergte. In den Regalen lagerten bis zum Rand gefüllte Kisten und Wäschekörbe. Die beiden vergitterten Fenster waren gekippt, um den Geruch erträglich zu halten.
Mit einer ausladenden Geste deutete ich auf Regalreihen und Tresor. »Hier lagern die Dokumente und Wertsachen, die ich aus den Objekten mitnehme. Die Papiere werden nach Kategorien auf Haufen sortiert – Versicherungen, Bank, Rente, Gläubiger und so weiter. Dann wird noch einmal jeder Haufen in sich chronologisch sortiert und danach ausgewertet. In diesen Dokumenten lassen sich häufig Hinweise auf weiteres Vermögen oder Verwandte finden.«
»Detektivarbeit«, fasste Funda das Ganze aus ihrer Sicht zusammen. »Das wollte ich schon immer mal machen. Was ist denn in dem Tresor?«
Ich schob den Schlüssel ins Schloss und zog die schwere Tür auf. »All das, was besser nicht frei zugänglich herumliegen sollte.«
»Eine Pistole …« Funda klang, als würde sie auf eine alte Bekannte treffen.
Mir wurde heiß. Das verdammte Ding hatte ich völlig vergessen. Noch vor Fundas Dienstantritt hatte ich sie zurück in das Haus in Untermenzing bringen wollen, wo ich sie am Vortag gefunden hatte. Dann hatte Bens Kerze alle Vorsätze zunichtegemacht.
»Ist das deine?«
»Nein, sie stammt aus einem Nachlass. Ich war gestern kurz in dem Haus und habe sie dort gefunden. Eigentlich hätte ich sie gar nicht mitnehmen dürfen, da es verboten ist, eine Waffe ohne Waffenbesitzkarte oder einen Waffenschein zu transportieren. Ich hätte wie immer die Polizei anrufen müssen, damit die sie abholt. Aber ich hatte es so eilig und wollte die Pistole keinesfalls dortlassen, falls eingebrochen würde. Ich bringe sie heute Nachmittag zurück in das Haus und rufe von dort aus die Polizei.« Zu blöd! Wie sollte ich von ihr erwarten, sich akribisch an Vorschriften und Gesetze zu halten, wenn es mir nicht einmal selbst gelang?
Funda griff ins Regal und nahm die Pistole heraus. Mit geübtem Griff ließ sie das Magazin herausfallen. Sie hielt es mir in der geöffneten Hand entgegen. »Das ist eine Walther PP, und sie ist sogar noch geladen.« Sie schob das Magazin zurück und ließ es wieder einrasten.
»Woher weißt du das?«, fragte ich.
»Mein Vater hat sich immer einen Sohn gewünscht, der ihn in den Schützenverein begleitet. Als das mit dem Sohn nicht klappte, hat er eben mich mitgenommen.« Sie legte die Waffe zurück in den Tresor.
»Dann hätte ich mir meinen Vortrag ja sparen können.«
»Kleine Auffrischungen können nie schaden. Warum nennst du diesen Raum eigentlich Kammer des Schreckens? Wegen der Waffen?«
»Deine Vorvorgängerin hat ihn so genannt. Wegen des Geruchs. Die Papiere aus den Nachlässen stinken teilweise ganz erbärmlich. Deshalb sind in diesem Raum meist die Fenster geöffnet.« Ich verschloss den Tresor und unterdrückte ein Gähnen. »Komm, jetzt zeige ich dir noch schnell den Besprechungsraum, und dann machen wir uns an die Arbeit.«
Während im Büro schon wieder der Anrufbeantworter ansprang, öffnete ich im Nebenzimmer Funda den Blick auf den langen Holztisch, um den herum sechs Stühle angeordnet waren. Vier weitere Stühle standen rechts neben der Tür. An den Wänden hingen moderne, reduzierte Fotos von Naturlandschaften. Ein Wald, eine Wiese, ein Flusslauf. Funda blieb vor jedem einzelnen Bild stehen und betrachtete es.
»Die Fotos sollen die Gemüter beruhigen«, erklärte ich ihr. »In diesem Raum halte ich oft Besprechungen mit Erben ab.«
»Und da geht es heiß her, das kann ich mir vorstellen.«
Es sich vorzustellen war eine Sache, es zu erleben eine andere. Aber das würde sie noch früh genug feststellen. Ich gab ihr ein Zeichen, mir zurück ins Büro zu folgen. »Morgen früh gehen wir als Erstes in dieses Haus in Untermenzing. Bring dir dafür alte Klamotten mit und ein Tuch, das du dir um den Kopf binden kannst. Gerüche setzen sich sofort in den Haaren fest. Einmalhandschuhe habe ich kartonweise hier, da kannst du dich bedienen.« Ich setzte mich an meinen Schreibtisch. »Bevor ich dir jetzt das Ordnersystem erkläre – hast du bis hierher noch Fragen?«
Funda schlug ein Bein über das andere und sah sich im Raum um. Ihr Blick wanderte zum Fenster. »Deine Eltern leben auch hier auf dem Hof, oder?«
Ich nickte. »Mein Vater hat den Hof vor acht Jahren von seinem Onkel geerbt. Vor knapp sechs Jahren sind wir dann alle hierhergezogen.«
»Seid ihr eigentlich mit diesem Benjamin Mahlo verwandt, der vor ein paar Jahren verschwunden ist?«, fragte sie vorsichtig.
»Ben ist mein Bruder, er ist der Grund, warum wir hierhergezogen sind. Gleich nachdem mein Vater den Hof geerbt hatte, ist Ben mit seiner WG oben ins Dachgeschoss gezogen. Drei Jungs, alle Studenten. Als mein Bruder dann verschwand und nicht wieder auftauchte, sind die beiden anderen ausgezogen. Meine Eltern hatten bis dahin im Hessischen eine Buchhandlung. Und als klar war, dass sie sich nicht zweiteilen können, sind sie hierhergezogen, um sich ganz auf die Suche nach Ben konzentrieren zu können.«
»Und du?«
»Ich habe zu der Zeit in Berlin studiert und stand gerade vor meinem ersten juristischen Staatsexamen. Unter den Umständen wäre ich mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Also habe ich es aufgeschoben und bin auch hier auf den Hof gezogen.«
»Aber du willst nicht wieder zurück, oder?« Sie klang besorgt, was ihr nicht zu verdenken war, nachdem sie ihren Job gerade erst angetreten hatte.
»In den ersten beiden Jahren wollte ich es noch, aber inzwischen würde es mir schwerfallen, meiner Arbeit hier den Rücken zu kehren. Außerdem lebt auch mein Freund hier. Du wirst ihn noch kennenlernen. Simon wohnt im Nebengebäude und betreibt dort auch seine Weinhandlung.«
»Wie praktisch. Ich meine nicht das mit dem Wein.« Sie lächelte. »Und in der Scheune ist ein Trödelladen, habe ich gesehen.«
»Der gehört Henrike Hoppe. Sie wirst du sicher auch bald treffen. Wenn sie nicht gerade in ihrem Laden steht, entrümpelt sie in meinem Auftrag und auch für andere Haushalte oder arbeitet in ihrer Werkstatt alte Sachen auf. Außerdem schreibt sie an einem Kriminalroman.«
»Über das, was sie beim Entrümpeln so alles entdeckt?«
Als hätte sie den sechsten Sinn, klopfte Henrike in diesem Augenblick an die Fensterscheibe.
»Das kannst du sie gleich selbst fragen«, antwortete ich im Hinausgehen.
»Ich muss mir doch schnell die Neue ansehen«, sagte Henrike lächelnd, nachdem ich ihr die Tür geöffnet hatte. Als sie nach Rosas stürmischer Begrüßung wieder eine Hand frei hatte, hielt sie sie Funda hin. »Henrike.«
Sie war zehn Jahre älter als ich, mit eins sechsundsiebzig genauso groß und hatte schwarzbraune, seitlich gescheitelte Haare, die an diesem Vormittag im Nacken von einer Spange zusammengehalten wurden und so die hauchzarten, fast handtellergroßen Kreolen zur Geltung brachten. Unter einer knallengen Weste aus Anzugstoff trug sie ein verwaschenes, langärmeliges Shirt mit V-Ausschnitt. Dazu eine ebenso eng anliegende Jeans und Boots, die aussahen, als hätte sie mit ihnen mindestens einmal das Land durchquert.
»Funda.« Im Blick meiner neuen Mitarbeiterin spiegelte sich eine Mischung aus Offenheit und Neugier wider.
In Henrikes blaugrauen Augen, die durch die schwarz getuschten langen Wimpern noch betont wurden, lag wie so oft ein Ausdruck von Wachsamkeit, als wolle sie in jedem Moment für die Unberechenbarkeit des Lebens gewappnet sein. Vor ungefähr einem Jahr hatte sie alle anderen Mietinteressenten für die Scheune aus dem Feld geschlagen, als sie sich bei meinem Vater mit den Worten vorstellte: »Ich bin einundvierzig Jahre alt und muss noch einmal ganz von vorne beginnen.«
Das muss in diesem Satz war einem Sesam-öffne-dich gleichgekommen. Es war meinem Vater nur allzu vertraut. Denn nicht nur wir drei hatten neu anfangen müssen – auch Simon war vor vier Jahren hier gelandet, nachdem das Restaurant, in dem er als Kellermeister gearbeitet hatte, pleitegegangen war und er sich von einem Tag auf den anderen eine neue Existenz hatte aufbauen müssen.
Henrike, die aus dem Norden stammte und, was ihre Vergangenheit betraf, nicht viel mehr als vage Andeutungen machte, war mir in den vergangenen elf Monaten zu einer Freundin geworden. Auf gewisse Weise waren wir alle wie Strandgut, das von den Wellen hier angespült worden war.
Henrike betrachtete Funda, als ginge es darum, einen Gegner im Ring auf seine Stärke hin zu taxieren. »Willkommen im Club! Ich habe gehört, dass du dich vor absolut nichts ekelst. Sollte es Kris mal nicht gelingen, dich auszulasten, melde dich bei mir.«
»Und du bist das Multitalent, das nebenher noch einen Krimi schreibt? Solltest du mal Nachhilfeunterricht in Waffenkunde brauchen, du weißt ja, wo du mich findest«, konterte Funda.
»Funda ist im Schützenverein«, warf ich ein.
»Inzwischen bin ich ausgetreten. Wovon handelt dein Krimi?«
»Das verrate ich nicht«, antwortete Henrike.
»Wie lange schreibst du schon daran?«
»Ich hab’s nicht eilig.«
»Und woher nimmst du deine Ideen?«
Ich ließ die beiden allein und ging in die Küche, um Wasser für einen Tee aufzusetzen. Ich kannte Henrikes Antwort auf diese Frage, ich hatte sie ihr selbst schon gestellt. Sie lasse sich vom Leben in all seinen Facetten inspirieren. Ihr persönliches Umfeld spare sie jedoch aus, hatte sie mir versichert. Nur für den Fall, ich hätte Sorge, sie würde das Verschwinden meines Bruders verarbeiten.
»Was ist los mit dir?«, fragte Henrike, die mir in die Küche gefolgt war. »Du siehst mitgenommen aus. Ist etwas passiert?«
Ich goss das heiße Wasser in einen Becher, tat einen Beutel mit losem grünem Tee hinein und reichte ihn ihr. »Wenn ich es dir erzähle, hältst du mich für übergeschnappt.«
»Es muss eine Menge passieren, bevor ich jemanden für übergeschnappt halte«, konterte sie trocken.
»Als ich heute früh über den Hof ging, brannte die Kerze nicht mehr. Sie ist auf unerfindliche Weise ausgegangen.«
»Vorhin brannte sie.«
»Ja klar, ich habe sie wieder angezündet. Mein Vater würde zusammenklappen, wenn er es wüsste.«
»Hast du eine Idee, wie …?«
Ich schüttelte den Kopf. »Eigentlich kann sie nur ausgeblasen worden sein. Erst dachte ich, der Wind wäre es gewesen, aber die Laterne war fest verschlossen.«
»Und wenn dein Vater es selbst war?«
»Das würde er nie tun.«
Sie hob eine Augenbraue. »Er würde es tun, wenn Ben tot wäre.«
2 Nachdem Funda um dreizehn Uhr gegangen war, zog ich mir ein paar Mohrrüben aus dem Gemüsebeet meiner Mutter, wusch sie und dippte sie in Frischkäse. Mein Hunger hielt sich nach zehn Baklava in Grenzen. Ich sah die Geschäftsbriefe des Tages durch und sortierte sie vor. Der unterste und zugleich dickste Umschlag kam vom Nachlassgericht. Er enthielt die Unterlagen zu einer Testamentsvollstreckung und die Bitte um Annahmeerklärung. Die Verstorbene, die einundvierzigjährige Theresa Lenhardt aus Obermenzing, hatte ausdrücklich mich benannt, um ihren letzten Willen auszuführen. Der Name war mir nicht geläufig, aber es war auch nicht ungewöhnlich, von völlig Fremden eingesetzt zu werden. Beim ersten Lesen überflog ich das handschriftlich verfasste Testament, dann las ich es noch einmal Wort für Wort:
Zu meinen Erben bestimme ich zu gleichen Teilen Christoph und Beate Angermeier, Tilman und Rena Velte sowie Nadja Lischka.
Nadja Lischka? Bei ihr musste es sich um die Frau handeln, die mir am Vormittag drei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und mich dringend um Rückruf gebeten hatte. Ich las weiter:
Erbe kann jedoch nur werden, wer folgende Bedingung erfüllt: Er/sie muss von jedem Verdacht der Beteiligung an der Ermordung von Konstantin Lischka befreit sein.
Lässt sich der Verdacht bezüglich eines der genannten Erben nicht ausräumen, so fällt sein Anteil den anderen zu gleichen Teilen zu.
Lässt sich der Verdacht für keinen der fünf ausräumen, fällt das gesamte Erbe an den Tierschutzverein.
Dasselbe gilt für den Fall, dass einer der potenziellen Erben Kristina Mahlo als Testamentsvollstreckerin ablehnt.
Es liegt im Ermessen der Testamentsvollstreckerin, darüber zu befinden, ob im Einzelfall der Verdacht ausgeräumt werden konnte.
Diesem außergewöhnlichen Testament war ein verschlossener, an mich adressierter Brief beigefügt. Ich öffnete ihn und las:
Sehr geehrte Frau Mahlo,
sicher werden Sie sich fragen, warum meine Wahl auf Sie gefallen ist. Ihnen eilt der Ruf voraus, gewissenhaft und unbestechlich zu sein. Diese Eigenschaften werden Sie brauchen, um meinen letzten Willen zu erfüllen. Sollten Sie – aus welchen Gründen auch immer – erwägen, die Testamentsvollstreckung gleich im Vorfeld abzulehnen, bitte ich Sie, Ihre Entscheidung erst zu fällen, nachdem Sie in meiner Wohnung waren. Den Schlüssel verwahrt meine Nachbarin Marianne Moser. Ich zähle auf Sie, Kristina Mahlo. Vielleicht gelingt Ihnen, woran ich gescheitert bin. Theresa Lenhardt
Vorhin erst hatte ich Funda erklärt, bei der Nachlassarbeit sei kein Fall wie der andere. Ein vergleichbares Testament war mir allerdings noch nicht untergekommen. Ich sah mir Theresa Lenhardts Vermögensaufstellung an. Sie hinterließ ein Wochenendhaus am Starnberger See, ein Mietshaus in Nymphenburg, rund sechs Millionen Euro in Wertpapieren sowie zweihunderttausend Euro als Festgeld. Fast automatisch überschlug ich, wie viel Aufwand die Vollstreckung bedeuten würde, und errechnete daraus die mögliche Vergütung. An der Arbeit von schätzungsweise ein bis zwei Jahren würde ich zwischen einhundertachtzigtausend und zweihundertzehntausend Euro netto verdienen können. Ein ungewöhnlich großer Brocken, über den ich mich eigentlich hätte freuen können, wäre da nicht diese absurde Bedingung gewesen, die an das Erbe geknüpft war: Erbe konnte nur werden, wer von jedem Verdacht der Beteiligung an der Ermordung von Konstantin Lischka befreit war.
Nachdem ich mir einen Kaffee geholt hatte, setzte ich mich an meinen Computer, gab »Konstantin Lischka Mord« in die Maske der Suchmaschine ein, drückte die Enter-Taste und arbeitete mich durch die Artikel der Süddeutschen Zeitung, des Münchner Merkurs, der TZ und der Abendzeitung. Allmählich erinnerte ich mich wieder an das, was damals geschehen war. Wie hatte ich es nur vergessen können? Vor sechs Jahren war der neununddreißigjährige Journalist Konstantin Lischka mitten in der Nacht mit mehreren Messerstichen im Treppenhaus vor seiner Wohnung in Schwabing getötet worden. Weder seine Frau, Nadja Lischka, noch seine beiden Kinder hatten etwas davon mitbekommen, sie hatten fest geschlafen und waren in den frühen Morgenstunden vom Schrei einer Nachbarin geweckt worden. Als mutmaßlicher Täter war eine Woche später Lischkas Freund, Doktor Fritz Lenhardt, zum damaligen Zeitpunkt vierzig Jahre alt, verhaftet worden. Zwei Monate später war der bis dahin unbescholtene Gynäkologe, der weder ein Geständnis abgelegt noch Reue gezeigt hatte, des Mordes an seinem Freund für schuldig befunden worden. Sein Motiv sei ein gescheitertes Immobiliengeschäft zwischen beiden Männern gewesen.
Der Fall war wochenlang Gegenstand ausführlichster Medienberichterstattung gewesen. Viele Details aus dem Privatleben der Beteiligten waren ans Licht gezerrt und kommentiert worden. Ein Mord in der besseren Gesellschaft gab etwas her.
Drei Wochen zuvor war Ben verschwunden. Ich war damals sofort von Berlin nach München gekommen, um meine Eltern bei der Suche nach ihm zu unterstützen. Ich hatte in den Zeitungsredaktionen angerufen und um Zeugenaufrufe gebettelt. Wo war Ben zuletzt gesehen worden? Hatte er sich mit jemandem getroffen? Wenn ja, mit wem? Wir wären für den kleinsten Hinweis dankbar gewesen. Aber mit dem Verschwinden eines vierundzwanzigjährigen Homosexuellen hatten sich keine Schlagzeilen machen lassen.
Also hatte ich ein Plakat entworfen und es an unzählige Bäume in und um München geheftet. Ich hatte ein Flugblatt vervielfältigt, das ich in Geschäften und Kneipen ausgelegt hatte. Uns hatten daraufhin sogar zahlreiche Hinweise erreicht, denen wir akribisch nachgegangen waren, nur um festzustellen, dass das Personengedächtnis der meisten Menschen wenig zuverlässig ist.
Ich drängte die Erinnerung zurück und konzentrierte mich wieder auf die Medienberichterstattung über den Fall Konstantin Lischka. Darin tauchte mehrmals der Name Theresa Lenhardt auf. Meine Auftraggeberin über den Tod hinaus war die Ehefrau des verurteilten Mörders gewesen. Wie aus den Artikeln hervorging, hatte sie für seine Rehabilitierung gekämpft. Vergebens. Und jetzt sollte ich diesen Kampf fortsetzen? Weil sie es nicht hatte ertragen können, die Frau eines Mörders zu sein?
Fritz Lenhardts Name ergab ebenfalls zahlreiche Treffer. Gemeinsam mit zwei Kollegen, einem Mann und einer Frau, hatte er in München auf der Fürstenrieder Straße ein Kinderwunschinstitut betrieben, bis das Zuschnappen der Handschellen seiner Arbeit, seinen Ambitionen und seinen Träumen ein Ende gesetzt hatte. Seinem Leben hatte er schließlich selbst ein Ende gesetzt, was von den Medien mehrheitlich als verspätetes Schuldeingeständnis gewertet wurde.
Noch einmal überflog ich die Artikel über die Gerichtsverhandlung und die Urteilsfindung. Der Richter hatte keine Zweifel an Fritz Lenhardts Schuld gehabt. Aber seine Frau hatte das allem Anschein nach nicht akzeptieren können. Ich schaltete den PC aus und lehnte mich zurück. Wäre es mir gelungen? Hätte ich mich damit abfinden können, dass der Mann, für den ich die Hand ins Feuer gelegt hätte, ein Mörder war?
Im Hof war Simon gerade dabei, seinen Transporter mit Weinkisten zu beladen. Rosa lag ein paar Meter von dem Wagen entfernt in der Sonne und ließ ihn nicht aus den Augen. In regelmäßigen Abständen verschwand Simon in seiner Weinhandlung und kam mit der voll beladenen Sackkarre wieder heraus. Er trug schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und darüber einen erdfarbenen Pulli mit V-Ausschnitt, dessen Ärmel er hochgeschoben hatte. Seine dunklen Haare waren vom Wind zerzaust. Ich wusste genau, wie widerborstig sie sich anfühlten und wie gut sie dufteten. Seine Stirn war wie immer in Falten gelegt, und wie üblich sah es aus, als habe er sich seit drei Tagen nicht rasiert, obwohl er es an keinem Morgen vergaß. Er kniff die Augen zusammen, um sie vor der Sonne zu schützen.
Simon war in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Seinem Vater, einem Trinker, war häufig die Hand ausgerutscht, seiner Mutter, einer Egozentrikerin, war ihr perfekter Lidstrich stets wichtiger gewesen als ein blaues Auge ihres Sohnes. Simon hatte beiden mit achtzehn den Rücken gekehrt und sich nie wieder bei ihnen blicken lassen, obwohl sie nicht weit entfernt am Pilsensee lebten. Simon machte nie viele Worte um seine Vergangenheit. Trotz alledem hätte ich die Hand für ihn ins Feuer gelegt. Ich war felsenfest davon überzeugt, er könne niemandem etwas zuleide tun. Eine Überzeugung, die Simon nicht mit mir teilte. Aber das war ein anderes Thema.
Ich beobachtete ihn, wie er die Sackkarre zurückstellte und die Tür von Vini Jacobi verschloss. Gleich würde er ins Auto steigen, um die Weinkisten auszuliefern. Mit ein paar Schritten war ich draußen im Hof und lief ihm entgegen, nicht ohne einen schnellen Blick Richtung Laterne zu werfen. Die Kerze brannte.
»Hey, du Frühaufsteherin«, begrüßte er mich. Simons Stimme war der beste Gradmesser für seine Gefühlslage. Sie klang nicht immer so warm wie in diesem Moment, ihre Klaviatur reichte bis hin zu schneidender Kälte. »Gerade wollte ich bei dir vorbeikommen und deine Schulden eintreiben.« Er zog mich so nah an sich, dass unsere Nasen sich fast berührten. Dann blies er mir eine Strähne aus dem Gesicht.
Ich küsste ihn und ließ mir Zeit dabei. »Es war viel zu früh, um dich zu wecken.«
»Ich hätte mich gerne von dir wecken lassen …«, entgegnete er mir mit einem verschmitzten Lächeln.
»Dann wäre ich aber zu spät ins Büro gekommen.«
»Ich hätte dir eine Entschuldigung geschrieben.« Simons Hände strichen über meinen Rücken.
Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte ich seine Hände zum ersten Mal gespürt. Fast doppelt so lange war es her, dass ich mich Hals über Kopf in ihn verliebt hatte. Aber er war damals nicht allein ins Nebengebäude gezogen, sondern mit seiner langjährigen Freundin, die ihm in jeder freien Minute geholfen hatte, seine Weinhandlung aufzubauen. Um mein Herz zu schonen, war ich ihm konsequent aus dem Weg gegangen, bis mein Vater eines Tages mit der Neuigkeit gekommen war, die beiden hätten sich getrennt. Von da an war ich regelmäßig über den Hof gegangen, um eine Flasche Wein bei ihm zu kaufen. Erst als ich kaum noch wusste, wohin mit all den Flaschen, gab Simon mir zu verstehen, dass ich mein Portemonnaie beim nächsten Mal zu Hause lassen könnte.
Ich nahm seine Hände, hielt sie einen Augenblick lang fest und gab ihm einen schnellen Kuss. »Hast du heute Abend Zeit?«
Er schüttelte den Kopf. »Rotweinprobe beim Kunden.«
»Und danach?«
»Danach stehst du schon fast wieder auf. Wie ist eigentlich die Neue?«
»Sehr sympathisch, schnell im Kopf und alles andere als faul. Wenn sie in dem Tempo weitermacht, ersetzt sie eine Ganztagskraft.«
»Falls sie noch Kapazitäten frei hat …«
»Henrike hat auch schon zart angeklopft.«
»Ich traue Henrike ja einiges zu, aber zart?«
»Ich mag ihre direkte Art.«
»Ich persönlich auch. Aber das Direkte und Unverblümte muss man sich auch leisten können. Es gibt Kunden, die das abschreckt. Ihr Trödelladen könnte bestimmt besser laufen, wenn sie diplomatischer wäre.«
»Hast du nicht mal gesagt, Diplomatie sei etwas für Leute, die sich für keine Seite entscheiden könnten?«
»Solche Aussagen kommen immer auf den Kontext an.« Er unterstrich seine Worte mit einer ausladenden Geste, was Rosa animierte, an ihm hochzuspringen. Er wollte sie gerade streicheln, als seine Hand zurückzuckte. »Oje, das hätte ich beinahe vergessen.«
Sein übertrieben schuldbewusster Gesichtsausdruck brachte mich zum Lachen. Simon und ich hatten oft Diskussionen darüber, dass er Rosa verzog. Wenn sie an ihm hochsprang und er sie streichelte, belohnte er sie für etwas, das sie eigentlich nicht durfte. Aber das störte weder ihn noch Rosa. Er machte Anstalten aufzubrechen, doch ich hielt ihn zurück.
»Simon, erinnerst du dich möglicherweise an einen Mordfall vor sechs Jahren? Damals wurde hier in München ein Journalist umgebracht, Konstantin Lischka. Die Zeitungen waren voll davon. Verurteilt wurde sein Freund, der sich später im Gefängnis umgebracht hat. Seine Frau hat immer an seine Unschuld geglaubt.«
Simon lehnte sich gegen den Transporter und sah in den Himmel, während er nachdachte. »Ja … War der Mörder nicht Arzt? Ich glaube, ich habe darüber gelesen. Wieso interessierst du dich dafür?«
»Die Frau dieses Arztes ist vor Kurzem gestorben und hat mich als Testamentsvollstreckerin eingesetzt. Das Vermögen, das sie hinterlässt, kann sich sehen lassen, aber es gibt da ein Problem …«
Simon unterbrach mich. »Weil ihr Mann ein verurteilter Mörder war? Es ist doch ihr Vermögen, das du verteilen sollst. Du könntest dir endlich ein neues Auto leisten.«
»Ich bin mit der alten Gurke sehr zufrieden.«
»Dein Auto hat nur mit viel Glück die grüne Plakette bekommen.«
»Umweltplaketten hängen nicht von Glück ab, sondern von knallharten Bedingungen, die erfüllt werden müssen.«
»Kris, du bist ein Dickschädel. Dein Golf hat fast zweihunderttausend Kilometer drauf, bald ist Winter und …«
»Theresa Lenhardt erwartet von mir, dass ich beweise, dass keiner ihrer fünf möglichen Erben Konstantin Lischka umgebracht hat. So, wie ich das Testament verstehe, geht sie davon aus, dass die Verurteilung ihres Mannes ein Justizirrtum war und einer der fünf der Mörder sein muss. Meine innere Stimme rät mir, besser die Finger davon zu lassen.«
In diesem Moment fegte Rosa mit lautem Gebell Richtung Garten. Vermutlich hatte sich eine der Nachbarskatzen gerade dort blicken lassen.
»Es wird nicht leicht gewesen sein als Ehefrau und Witwe eines verurteilten Mörders«, sagte Simon. »Die Frau hat sich ihr Leben bestimmt anders vorgestellt und vielleicht mit der Zeit die Realität so sehr verfremdet, dass sie schließlich von der Unschuld ihres Mannes überzeugt war. Das ist menschlich, wenn du mich fragst. Ich möchte nicht wissen, wie vielen Angehörigen von Kriminellen es so geht.«
»Mir würde es vermutlich genauso gehen.«
»Siehst du. Deshalb musst du eigentlich nicht viel mehr tun, als ein paar Gespräche mit den Erben zu führen. Alles Weitere beherrschst du im Schlaf. An deiner Stelle würde ich mir diesen Brocken nicht entgehen lassen.« Simon gab mir einen schnellen Kuss auf den Mundwinkel. »Ich muss los, ich bin ohnehin schon viel zu spät dran.«
Ich stand immer noch an derselben Stelle, als er längst vom Hof gefahren war. Was, wenn Theresa Lenhardt sich die Realität nicht verfremdet hatte? Wenn Fritz Lenhardt tatsächlich zu Unrecht verurteilt worden war? Dann lief Konstantin Lischkas Mörder immer noch frei herum.
Ich hatte die Unterlagen zur Seite gelegt und mich einer anderen Nachlasssache gewidmet, die ich in der kommenden Woche endlich abschließen wollte. Der alte Mann war vor drei Monaten gestorben, hatte achtzehntausend Euro an Erspartem und ein Einzimmerapartment hinterlassen. Sieben Erbberechtigte hatte ich ausfindig gemacht, von denen vier wöchentlich bei mir anriefen, um die Sache voranzutreiben. Auch an diesem Tag hatte einer von ihnen eine dringende Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen.
Nachdem ich die noch anstehende Korrespondenz in diesem Fall und zwei Anrufe erledigt hatte, legte ich die Füße auf den Schreibtisch und nahm noch einmal Theresa Lenhardts Testament zur Hand. Sollten Sie erwägen, die Testamentsvollstreckung gleich im Vorfeld abzulehnen, hatte sie geschrieben, bitte ich Sie, Ihre Entscheidung erst zu fällen, nachdem Sie in meiner Wohnung waren. Den Schlüssel verwahrt meine Nachbarin Marianne Moser. Deren Telefonnummer war in Klammern hinter dem Namen vermerkt.
Ich nahm das Telefon und wählte die achtstellige Nummer. Nach mehrmaligem Klingeln meldete sich die Stimme einer Bayerin, die ich auf Mitte sechzig schätzte. Ich stellte mich ihr vor und fragte, wann ich in Frau Lenhardts Wohnung könnte.
»Am besten jetzt gleich«, lautete die Antwort. »Morgen gehe ich erst noch zum Friseur, und danach fahre ich in den Urlaub.«
Ich versprach ihr, spätestens um Viertel nach vier bei ihr zu sein. Nachdem ich Rosa klargemacht hatte, dass sie mich nicht begleiten durfte, schloss ich die Tür und holte mein Fahrrad, das im Hausflur lehnte. Im Vorbeigehen las ich den gelben Zettel, der am Briefkasten meiner Mutter klebte. »Könntest du mir bitte ein paar Gläser Marmelade mit einkochen?«, hatte mein Vater geschrieben. »Welche Sorte?«, hatte meine Mutter an den Rand gekritzelt. »Himbeere«, murmelte ich vor mich hin. Das war seine Lieblingssorte. Und das wusste auch meine Mutter. Genauso wusste sie, dass sein Vorrat noch für mindestens zwei Jahre reichen würde. Mit einem Lächeln schwang ich mich aufs Rad. Ich konnte meinen Vater verstehen. Vor ein paar Jahren hatte ich Weinflaschen gehortet, um Simon nahe zu sein.
»Sind Sie Kristina Mahlo?«
Eine Frau kam mir vom Tor her entgegen, als ich gerade vom Hof radeln wollte. Die Sonne ließ ihre hellblonden Locken wie einen Strahlenkranz erscheinen. Alles an ihr schien zu fließen, die lange weiße Bluse über der gleichfarbigen weiten Hose ebenso wie ihre Bewegungen. Sie hatte auffallend blaue Augen und einen zarten, blassen Teint. Ihre Körperhaltung erinnerte mich an die einer Balletttänzerin. Ich war mir sicher, sie noch nie gesehen zu haben.
Ich stieg vom Rad. »Ja.«
Sie hielt mir ihre Hand entgegen. »Nadja Lischka. Ich habe Ihnen bereits auf Ihren AB gesprochen, aber Sie haben nicht zurückgerufen.«
Rechtfertige dich niemals, war eine meiner Devisen, die ich mir über die Jahre angeeignet hatte, deshalb sah ich sie nur abwartend an.
»Na ja, vermutlich bin ich nicht die Einzige, die auf Ihren Rückruf wartet.«
Und sie würde noch länger darauf warten müssen. Erst einmal würde ich mir ein Bild machen. »Ich muss los, Frau Lischka, ich habe einen Termin, zu dem ich nicht zu spät kommen möchte. Ich rufe Sie in den nächsten Tagen an.«
»Das brauchen Sie nicht, jetzt bin ich ja hier. Und ich werde mich so kurz wie möglich fassen. Ich kenne den Inhalt von Theresas Testament. Wir alle kennen ihn. Das Nachlassgericht hat uns Kopien geschickt. Sie sind als Testamentsvollstreckerin …«
»Ich kann Ihnen noch nichts zu dieser Testamentsvollstreckung sagen. Ich weiß nicht einmal, ob ich sie überhaupt annehme.«
»Sie müssen annehmen, Theresa wollte es so. Außerdem wird es keine große Sache für Sie werden. Leicht verdientes Geld sozusagen. Der Mord an meinem Mann wurde damals aufgeklärt. Wir alle wissen das. Ich kann für jeden einzelnen der Erben bürgen. In Theresas Testament steht nichts davon, dass das Ergebnis, zu dem Sie kommen, von irgendjemandem kontrolliert werden würde. Sie müssten nur …«
»Bezeugen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, und meine Unterschrift unter die entscheidenden Dokumente setzen? Ich glaube, ich muss die Vorstellung, die Sie allem Anschein nach von meiner Arbeitsweise haben, ein wenig korrigieren. Ich arbeite im Auftrag der Toten und nicht als Geschenketante für ungeduldige Erben. Und wenn ich mich jetzt nicht beeile, komme ich zu spät zu meinem Termin.«
Sie baute sich vor meinem Rad auf. »Frau Mahlo, wie alt sind Sie? Ende zwanzig? Anfang dreißig? Ich tippe mal darauf, dass Sie noch nicht so oft eine Erbschaft in der Größenordnung von Theresas auf dem Tisch hatten. Seien Sie nicht naiv, greifen Sie zu, wenn sich Ihnen eine solche Chance bietet. Wir alle werden Sie nach Kräften unterstützen.«
Fast hätte ich laut gelacht. Ich konnte sie schon längst nicht mehr zählen – all die Erben, die mich nach Kräften unterstützen wollten. »Sie hören entweder vom Nachlassgericht oder von mir. Bis dahin müssen Sie sich ein wenig gedulden.« Ich winkte ihr zu und trat in die Pedale.
Als ich an St. Georg vorbeifuhr, blinzelte ich gegen die Sonne hinauf zur Kirchturmuhr: Es war kurz nach vier. Mir blieb noch genug Zeit, um es rechtzeitig zu meiner Verabredung mit Marianne Moser zu schaffen. Hinter der Kirche mit ihrem kleinen Friedhof bog ich in den Fahrradweg, der ein Stück die Würm entlang verlief.
Mit achtzehn war ich mit dem festen Vorsatz aus dem hessischen Frankenberg weggegangen, mich fortan nur noch inmitten pulsierender Großstädte zu tummeln. Acht Jahre später war ich unfreiwillig in Obermenzing gelandet. Obwohl es zum Münchner Stadtgebiet zählte, war von Großstadtflair keine Spur. Dafür gab es Hähne, die in aller Herrgottsfrühe lautstark den Tag begrüßten. Hier hatte ich gelernt, dass man manchmal versucht, dem Vertrauten zu entkommen, nur um in der Fremde festzustellen, wie vertraut einem manches ist.
Je weiter ich mich der Schleuse näherte, desto lauter wurde das Rauschen der Würm. Ich passierte den Zehentstadel, in dem früher der Dorfälteste die Steuer für die Gutsherren eingesammelt hatte und der heute als Veranstaltungsort diente. Kurz darauf öffnete sich der Blick auf Schloss Blutenburg. Auf der Wiese vor dem Schlossteich spielte eine Handvoll Jungen lautstark Fußball. Ein Stück weiter hatten sich Sonnenanbeter eine Decke ausgebreitet. Die Tische vor der Schlossschänke waren alle besetzt. Als ich wieder auf den Weg vor mir sah, musste ich eine Vollbremsung machen, um nicht einen altersschwachen Dackel zu überfahren. Ich rief der schimpfenden Besitzerin eine Entschuldigung zu und radelte weiter. Das hinter hohen Bäumen verborgene Mönchskloster ließ ich links liegen und bog auf die Straße, die parallel zur Würm verlief. Keine fünf Minuten später erreichte ich die Marsopstraße. Hundert Meter weiter lag das Eckhaus, das offensichtlich acht Parteien beherbergte. Hier wohnte Marianne Moser, und hier hatte auch Theresa Lenhardt bis zu ihrem Tod gewohnt.
Die Marsopstraße mit ihren Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende zählte in Obermenzing zum begehrten Wohngebiet. Das weiß getünchte, moderne Gebäude mit den verglasten Balkonen wirkte jedoch eher durchschnittlich und hätte überall stehen können. Alles in allem würde Theresa Lenhardt ihren Erben vermutlich einen zweistelligen Millionenbetrag hinterlassen. Im Vergleich dazu hatte sie bescheiden gewohnt.
Ich drückte den Knopf neben Marianne Mosers Namen. Es dauerte einen Moment, bis sich ihre Stimme über die Gegensprechanlage meldete und mir den zweiten Stock als Ziel nannte. Als der Summer ertönte, drückte ich die Tür auf. Im Treppenhaus, in dem hintereinander aufgereiht zwei Kinderwagen standen, musste vor Kurzem geputzt worden sein, es roch nach Putzmittel. Die Wohnungstüren, an denen ich vorbeikam, wirkten wie Kontrapunkte zu der äußerlichen Uniformität des Hauses. Vor einer warnte eine Fußmatte vor der desperate housewife, an der nächsten hing ein von Kinderhand bemaltes DIN-A4-Blatt, das einen plastischen Eindruck vom Körpergewicht der jeweiligen Bewohner vermittelte.
Im zweiten Stock stand eine Tür einen Spaltbreit offen. Bevor ich sie aufstieß, vergewisserte ich mich mit einem Blick auf das Klingelschild, dass ich tatsächlich bei Marianne Moser angekommen war. Ich klopfte, aber es tat sich nichts. Also folgte ich dem Duft eines frisch gebackenen Kuchens in die Wohnung, blieb im Flur stehen und sah mich um. An der Wand hingen zwei Setzkästen mit Nippes, gegenüber ein gerahmter Spiegel und ein Ölbild, das zwei Ackergäule zeigte, die einen Pflug zogen. Bei meiner Arbeit hatte ich immer wieder bemerkt, dass sich Wohnungen innerhalb von Altersklassen oft erstaunlich stark ähnelten. Dies hier war die typische Wohnung einer älteren Frau, die ihre Dinge hütete. Ich war mir sicher, dass die Möbel in diesem Haushalt durch geklöppelte Deckchen geschützt wurden und alles blitzblank war.
Marianne Moser kam in weißer Schürze und Kochhandschuhen aus der Küche und dirigierte mich in ihr Wohnzimmer. Sie werde sich jeden Moment zu mir gesellen. Am Telefon hatte ihre Stimme nach einer Mittsechzigerin geklungen, aber sie hatte mit Sicherheit die siebzig überschritten. Ich betrat den Raum, auf den sie gedeutet hatte, und fand noch mehr Ölbilder, hier waren es Gebirgslandschaften. Die Fensterbank stand voller Orchideen, die Gardine aus weißer Lochstickerei war an den Seiten gerafft. Gegenüber der Schrankwand stand ein Sofa mit akkurat aufgereihten Kissen und geknüpften Bezügen. Ein kleiner runder Tisch mit einem weißen Tischtuch war für zwei gedeckt. Das einzige Geräusch im Raum kam von einer aufgeregt tickenden Pendeluhr.
Die alte Dame hatte die Schürze abgelegt und kam mir in einem dunkelblauen, wadenlangen Kleid entgegen, das ihr mindestens eine Nummer zu groß war. Nachdem sie die Kuchenplatte abgestellt hatte, schob sie einen Sessel an den Tisch und forderte mich auf, mich zu setzen. »Ich hatte noch so viele Äpfel, es wäre jammerschade gewesen, sie wegzuwerfen, nur weil ich in den Urlaub fahre. Mögen Sie gedeckten Apfelkuchen? Sie können ordentlich zugreifen, den Rest muss ich ohnehin einfrieren.«
»Sehr gerne«, antwortete ich und dachte an die vielen Baklava, die ich an diesem Tag bereits vertilgt hatte.
Sie schnitt den Kuchen in Stücke und legte ein großes auf jeden Teller. Dann schenkte sie Kaffee ein. Ihre Bewegungen waren langsam und bedacht. Das leise Stöhnen, als sie sich aufs Sofa setzte, ließ auf Gelenkschmerzen schließen.
»Theresa hat gesagt, Sie würden bald nach ihrem Tod kommen.« Marianne Moser rührte Sahne in ihren Kaffee. Ihr Gesicht war voller Falten, die sonnengebräunte Haut mit Altersflecken übersäht. Das schlohweiße Haar hatte sie zu einem dünnen Knoten gesteckt. Ihr Blick war wach und prüfend. »Essen Sie! Sie werden eine Stärkung brauchen, bevor Sie hinübergehen.« Es klang ein wenig so, als würde ich es nebenan mit einem Gruselkabinett zu tun bekommen.
»Kannten Sie Theresa Lenhardt gut?« Ich nahm den Teller auf die Knie und probierte den Kuchen.
»Sie war dreieinhalb Jahre lang meine Mieterin. Mir gehört dieses Haus, müssen Sie wissen. Sie können sich übrigens Zeit lassen mit Theresas Wohnung. Die Miete ist noch für ein Jahr im Voraus bezahlt. Sie wollte, dass ich ausreichend Zeit habe, um nette und angenehme Nachmieter zu finden.«
»Das ist eine sehr ungewöhnliche Regelung. Sie muss sehr großzügig gewesen sein.«
»Sie hatte ein großes Herz.«
»Woran ist sie gestorben? Sie war erst einundvierzig.« Ich sah sie fragend an.
»Sie hatte Krebs und hat ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt. Tragisch, wenn Sie mich fragen, wirklich tragisch. So eine nette junge Frau, verliert erst ihren Mann und wird dann zu allem Übel noch so krank. Ich habe längst aufgehört, mich zu fragen, was für ein Schicksal es ist, das da so grausam zuschlägt.«
Vielleicht musste ich erst in ihr Alter kommen, um damit aufzuhören, mir diese Frage zu stellen.
»Falls Sie zu diskret sein sollten, um mich das zu fragen, Frau Mahlo, ich kenne den Inhalt des Testaments.« Mit einer weißen Stoffserviette wischte sie sich die Kuchenkrümel aus den Mundwinkeln.
»Wie ist Ihre Meinung dazu?«
Sie lehnte sich zurück, nahm eines der Kissen auf den Schoß und zeichnete mit einem Finger die Linien des Musters nach. »Schwer zu sagen. Wenn es jemals einen Menschen gab, für den ich so etwas wie Muttergefühle hätte entwickeln können, dann für Theresa. Ich mochte sie sehr gerne. Und deshalb habe ich ihr immer gewünscht, dass sie ihren Frieden findet. Aber das war nicht möglich, solange sie so fest an der Unschuld ihres Mannes festhielt.«
»Sie glauben, dass er schuldig war?«
»Theresa ist hierhergezogen, als ihr Mann bereits seit zwei Jahren im Gefängnis war. Sie musste das gemeinsame Haus in Obermenzing verkaufen. Ihr Mann hatte mit seinem Institut sehr viel Geld verdient, aber als diese Einnahmequelle ausfiel und all die Anwälte zu bezahlen waren, ging es irgendwann zur Neige. Die Erbschaft ihrer Tante hat sie erst nach dem Tod ihres Mannes gemacht. Aber …«
»Wo in Obermenzing hatten die beiden ihr Haus?«, unterbrach ich sie.