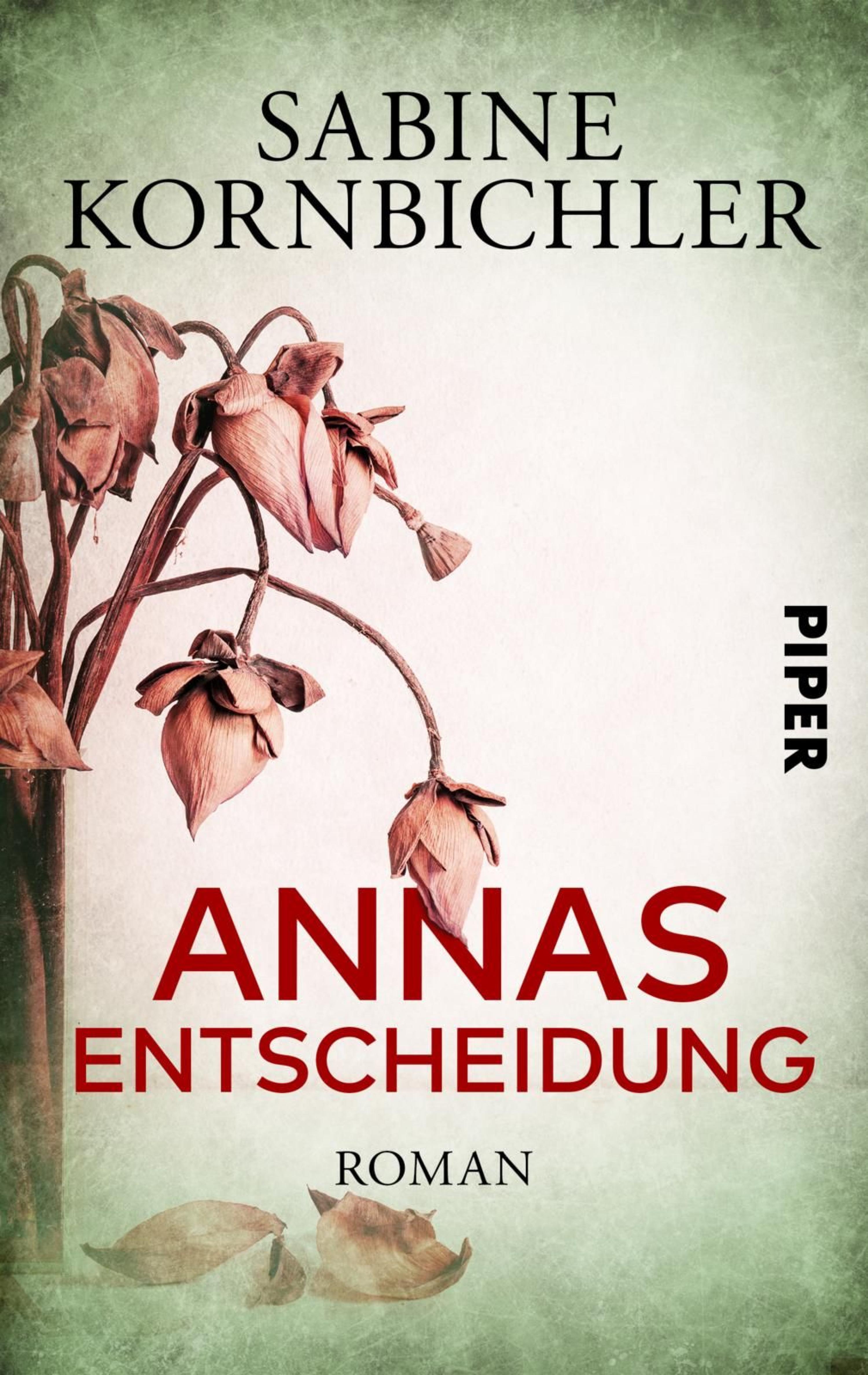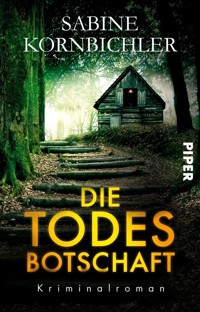9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Als Kristina Mahlo das Haus des verstorbenen Albert Schettler betritt, sind die Zeichen seiner Paranoia unübersehbar. Die Türen sind mehrfach gesichert, alle Fenster vergittert. In einem Brief, den er hinterlassen hat, steht, jemand werde versuchen, an den brisanten Inhalt seines Bankschließfachs zu gelangen. Kristina hält das für Verfolgungswahn, doch dann werden die Unterlagen tatsächlich gestohlen. War Schettlers Angst begründet? Kristinas Recherchen bringen ungeahnte Wahrheiten ans Licht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96613-9
März 2016
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Umschlaggestaltung und –motiv: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll
Vernehmungsbeamter: »Danke, dass Sie gekommen sind, um uns bei der Aufklärung dieses Falles zu helfen. Es wird vielleicht nicht immer einfach für Sie sein. Deshalb sagen Sie bitte, wenn Sie eine Pause machen möchten.«
Zeugin: »Ja.«
Vernehmungsbeamter: »Sind Sie mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen?«
Zeugin: »Das Autofahren muss ich erst wieder lernen. Ich bin so lange nicht gefahren. Meine Tochter hat mich gebracht. Sie wird mich auch wieder abholen.«
Vernehmungsbeamter: »Das ist gut. Haben Sie noch eine Frage, bevor wir beginnen?«
Zeugin: »Nein.«
Vernehmungsbeamter: »Ihre Personalien haben wir ja bereits geklärt. Bevor ich fortfahre, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nicht verpflichtet sind, mir zu antworten, falls Sie sich mit einer Antwort selbst belasten würden. Haben Sie das verstanden?«
Zeugin: »Ja.«
Vernehmungsbeamter: »Dann schlage ich vor, dass wir beginnen. Lassen Sie uns über das Geschehen sprechen, das jetzt vierundzwanzig Jahre zurückliegt. Erzählen Sie mir bitte möglichst genau, woran Sie sich erinnern. Selbst wenn es Details sind, die Ihnen unwichtig erscheinen. Ich möchte mir ein möglichst genaues Bild machen.«
Zeugin: »Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll.«
Vernehmungsbeamter: »Am besten am Anfang.«
Zeugin: »Der Anfang ... der ist so lange her ...«
1 Das schmiedeeiserne Tor quietschte in den Angeln.
Jeder Versuch, sich unbemerkt auf dieses von einer zwei Meter hohen Mauer umgebene Grundstück zu schleichen, würde bereits am Eingang scheitern. Mein Blick wanderte über die Fassade der blassgelben Jugendstilvilla, deren Fenster bis unters Dach vergittert waren. Einen Moment lang meinte ich, die Angst spüren zu können, die hier Regie geführt hatte. Wovor hatte Albert Schettler sich so sehr gefürchtet, dass er in Kauf genommen hatte, sein Leben hinter Gittern zu verbringen?
Er würde mir diese Frage nicht mehr beantworten können. Am dreißigsten März, auf den Tag genau vor fünf Wochen, war er gestorben. Jetzt war es an mir, mich um das zu kümmern, was er hinterlassen hatte.
Gemeinsam mit Funda, meiner Mitarbeiterin, ging ich durch den Vorgarten, der aus nichts anderem als Rasen bestand.
»Sehr übersichtlich«, brachte sie es auf den Punkt.
»Vermutlich hat er genau das bezweckt. Hier hätte sich niemand verstecken oder ihm auflauern können.«
Funda pustete sich eine ihrer dunklen Ponysträhnen aus der Stirn und betrachtete das frisch gestutzte Gras. »Jedenfalls hatte der Mann Freunde. Oder glaubst du, ein Gärtner würde einem Toten den Rasen mähen?«
»Vielleicht aus alter Verbundenheit.«
»Hattest du einen solchen Fall schon mal?«
Ich schüttelte den Kopf und ging auf das Haus zu. Die Tür war mit drei Schlössern gesichert, allerdings nicht abgeschlossen. Lautlos schwang sie auf und gab den Blick frei in einen weiß getünchten Flur. Ich blieb stehen und schloss für einen Moment die Augen, bis ich begriff, was mich irritierte.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Funda.
»Riechst du das?«
Sie ging an mir vorbei und schnupperte. »Riecht nach einem Raucherhaus.«
»Ja, aber nach einem, das in den vergangenen Wochen regelmäßig gelüftet wurde.«
»Vielleicht von demjenigen, der auch den Rasen gemäht hat.« Sie holte Einmalhandschuhe aus ihrer Tasche und begab sich auf Erkundungstour in das Innere des Hauses.
Nachdem ich ebenfalls Handschuhe übergestreift hatte, folgte ich ihr über grün-weiße Jugendstilfliesen in einen spärlich möblierten Wohnraum mit Fischgrätparkett. Darin standen eine Couchgarnitur aus schwarzem, brüchigem Leder, ein kniehoher gläserner Tisch und ein deckenhohes, ehemals weißes Bücherregal, das den typischen gelbbräunlichen Schimmer von Nikotin angenommen hatte. Es war bis obenhin mit Büchern, Zeitschriften und Schuhkartons gefüllt. Auf dem Tisch lagen in Grüppchen geordnet Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und Zigarettenschachteln. Die geöffneten Vorhänge waren aus schwerem, dunkelbraunem Stoff.
Einzig ein weißer Kachelofen und eine Deckenlampe aus Buntglas und Bronze zeugten in diesem Raum noch vom Jugendstil. Altes und Modernes zu kombinieren, konnte reizvoll sein, man musste es allerdings auch können. Hier war jemand am Werk gewesen, der das Alte schlichtweg ignoriert hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass ich bei meiner Arbeit Räume betrat, die von den Möbeln verunstaltet worden waren. Aber es gab auch die anderen Räume, die, über deren Blässe die Möblierung hinwegtäuschte, oder die, in denen jeder einzelne Gegenstand mit den anderen harmonierte. Jeder dieser Räume erzählte von seinen Besitzern. So auch dieser, der Albert Schettler als einen Menschen beschrieb, für den sein Sicherheitsbedürfnis an erster Stelle gestanden hatte, dicht gefolgt von einer Vorliebe für das Funktionale. Und für Ordnung. Hier lag nichts einfach nur herum oder diente allein der Dekoration. Es gab nicht einmal Bilder an den Wänden. Von einer gemütlichen Atmosphäre konnte hier niemand sprechen.
Ich öffnete eines der Doppelfenster und ließ die milde Mailuft herein. Die Gitterstäbe warfen Schatten aufs Parkett. Funda setzte sich seitlich auf die Fensterbank, hielt sich an einer der Gitterstreben fest und wandte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Ich tat es ihr gleich, schloss die Augen und genoss die Wärme, auf die wir in diesem Jahr so lange hatten warten müssen. Der Winter hatte sich bis weit in den April hinein breitgemacht und mit eisigen Temperaturen den Frühling auf Abstand gehalten. Bis die Natur schließlich explodiert war und alles fast gleichzeitig in Farbe getaucht hatte.
Funda gähnte herzhaft. »Leila hat sich heute Nacht zweimal übergeben. Nachdem ich ihr Bett jedes Mal frisch bezogen hatte, ist sie schließlich in unseres gekrochen und hat dort gleich noch mal gekotzt. Joachim hat doch tatsächlich …«
»Weitergeschlafen?«
»Das hätte ich auch gerne«, ertönte hinter uns eine männliche Stimme.
Der Schrecken jagte mir im Bruchteil einer Sekunde Adrenalin durch die Adern. Für einen Moment zerrte mich meine Erinnerung auf eine Zeitreise und katapultierte mich in das Haus in Untermenzing, in dem ich vor nicht ganz acht Monaten auch von einer Stimme überrascht worden war. Diese Überraschung hätte ich damals fast mit dem Leben bezahlt. Ich spürte Fundas Hand auf meinem Arm und schüttelte die Erinnerung ab.
In der Tür stand ein bärtiger Typ Anfang vierzig mit dunklem, schulterlangem Haar, hellblau getönter Nickelbrille und hängenden Schultern. Das T-Shirt, das seine zerschlissene Jeans fast bis zu den Knien bedeckte, war ihm zwei Nummern zu groß. Auf seinen nackten Füßen vor und zurück wippend, ließ er uns nicht aus den Augen.
»Wer sind Sie?«, fuhr ich ihn an.
»Der derzeitige Bewohner dieses Hauses.« Seine Stimme hatte etwas Schleppendes und klang nach morgendlichem Kater. »Und jetzt erklären Sie mir mal, wieso Sie Ihr Sonnenbad ausgerechnet hier nehmen müssen. Und sich noch dazu so laut unterhalten, dass ich davon aufgewacht bin.«
»Soweit ich weiß, hat Albert Schettler allein gelebt.«
»Und das genügt Ihnen als Rechtfertigung, hier einzubrechen?« Er zog seine buschigen Brauen zusammen, vergrub die Fäuste in den Hosentaschen und drückte die Arme durch, wobei sich seine Schultern hoben. Er wirkte hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, uns davonzujagen, und seiner Sorge, dabei zu unterliegen.
»Von Einbrechen kann keine Rede sein«, sagte ich.
»Warum tragen Sie dann Handschuhe?«
Mit einem Mal wurde mir bewusst, wie wir auf ihn wirken mussten. »Ich heiße Kristina Mahlo und bin Nachlassverwalterin. Das Gericht hat mich beauftragt, Albert Schettlers Angelegenheiten zu regeln.« Ich wandte den Kopf kurz zu Funda. »Und das ist Funda Seidl, meine Mitarbeiterin.«
»Funda, die Bergblumenwiese.«
»Ganz genau«, freute sich Funda. »Woher wissen Sie das?«
»Ich hatte mal eine türkische Kollegin, die so hieß.«
»Wenn wir schon bei den Namen sind, könnten Sie uns Ihren vielleicht auch verraten«, bat ich ihn.
»Peter Siebert.«
»Und was tun Sie hier?«
»Wohnen. Vorübergehend. So lange, bis ich eine neue Bleibe gefunden habe. Albert war ein Freund meines Vaters und hat mir Unterschlupf gewährt. Es ist nicht leicht, in München eine bezahlbare Wohnung zu finden. Vor allem, wenn man nicht gerade viel verdient – wie ich in meinem neuen Job.« Er musste meinen fragenden Blick richtig gedeutet haben, denn er schickte gleich hinterher, dass er sich einen Tag frei genommen habe, um ein paar Dinge zu erledigen. »Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Ich mache mir nur schnell einen Kaffee und werde Ihnen ansonsten nicht im Weg stehen. Möchten Sie auch einen?«
Einhellig schüttelten wir die Köpfe. Ich überlegte blitzschnell, was jetzt zu tun war. Bei meiner Arbeit war ich nicht nur den Toten, sondern auch etwaigen Erben verpflichtet. Und die hatten in der Regel wenig Verständnis für derartige Untermieter.
»Könnten wir erst noch ein paar Fragen klären?«, hielt ich Peter Siebert betont freundlich zurück. Sollte sich später herausstellen, dass er einer der Erben war, wollte ich ihm nicht auf verbrannter Erde gegenübertreten müssen.
»Na klar. Fragen Sie!« In seiner Beflissenheit erinnerte er mich an einen Schuljungen.
»Wie sah die Vereinbarung genau aus, die Sie mit Herrn Schettler getroffen haben?«
»Welche Vereinbarung denn?«
»Hat er Ihnen schriftlich zugesichert, dass Sie hier wohnen können?« Hatten die beiden einen Mietvertrag abgeschlossen, würde ich Peter Siebert nicht so ohne Weiteres vor die Tür setzen können.
»Schriftlich zugesichert – das klingt fürchterlich juristisch.« Er bedachte mich mit einem mitleidigen Blick. »Albert hat einfach vorgeschlagen, dass ich bleibe, und ich habe sein Angebot dankbar angenommen.«
»Bis wann genau wollen Sie bleiben?«
»Ich habe eine Einzimmerwohnung in Aussicht. Also, eigentlich bin ich sicher, dass ich sie bekomme. Mein zukünftiger Vermieter hat den Mietvertrag am Freitag abgeschickt. Das heißt, er müsste heute oder spätestens morgen hier eintrudeln. Sobald ich unterschrieben habe, hole ich mir den Wohnungsschlüssel.«
»Wo liegt denn die Wohnung?«
»Ein Stück außerhalb von Gauting, Richtung Starnberg. Ich fahre gerne Rad, und im Würmtal bieten sich dafür unzählige Möglichkeiten.«
»Und ab wann gilt der Mietvertrag?«, fragte ich weiter und ignorierte Fundas missbilligenden Laut.
»Rückwirkend ab dem ersten Mai. Da hat mich der Vermieter ein wenig übervorteilt. Aber ich hatte keine Wahl, hätte ich Nein gesagt, hätte er eben einem anderen den Zuschlag gegeben.« Er sah auf seine rechte Hand, deren Finger er nacheinander ausstreckte. Er schien zu zählen. »Heute ist Montag. Vielleicht könnte ich schon zum Wochenende dort einziehen.«
»Arbeiten Sie auch da draußen?«
»Nein, in der Innenstadt«, antwortete er geduldig. »Ich bin Grafikdesigner und habe einen Job bei einer Münchner Werbeagentur bekommen.«
»Bitte haben Sie Verständnis für all diese Fragen, Herr Siebert. Ich könnte von etwaigen Erben haftbar gemacht werden, falls ich die Situation nicht genau abkläre.«
»Kein Problem. Fragen Sie nur!«
»Wie heißt die Werbeagentur, bei der Sie arbeiten?«
»Kunze & Partner.« Er zuckte die Schultern und lächelte. »Ich weiß, das klingt nicht gerade nach einer Kreativschmiede, aber ich bin froh über den Job.«
»Sie sagten, Albert Schettler sei mit Ihrem Vater befreundet gewesen?«
»Ja, die beiden kannten sich noch aus der Schule und haben es geschafft, den Kontakt über Jahrzehnte hinweg zu halten, obwohl mein Vater inzwischen in Flensburg wohnt.« Peter Siebert wickelte sich eine seiner Haarsträhnen um den Finger. »Er hat nach dem Tod meiner Mutter noch einmal eine neue Lebensgefährtin gefunden. Zum Glück.«
»Haben Sie eigentlich den Rasen gemäht?«, meldete Funda sich zu Wort.
Er lächelte sie an. »So kann ich mich wenigstens ein wenig erkenntlich zeigen, wenn ich schon mietfrei hier wohne.«
»Kannten Sie Albert Schettler gut?«, fragte ich.
»Bevor ich nach München kam, kannte ich ihn nur aus Erzählungen meines Vaters. Und hier hatte ich nicht viel Zeit, ihn kennenzulernen. Ein paar Tage, nachdem ich eingezogen bin, kam er ins Krankenhaus.«
»Wissen Sie, wovor er so große Angst hatte? Die Gitter bis unters Dach sind nicht gerade Standard.«
»Albert litt seit Jahren an Verfolgungswahn. Sein Haus erzählt bis in den letzten Winkel davon. Alles ist entweder mehrfach gesichert oder nicht existent, wie zum Beispiel Handy, PC und Fernseher.«
»Kein Handy?«, fragte Funda, die zu Weihnachten ein iPhone von ihrem Mann geschenkt bekommen hatte, das seitdem auf ihrer Liste der unverzichtbaren Geräte noch vor der Waschmaschine rangierte.
Peter Siebert schüttelte den Kopf. »Nichts, womit man ihn hätte ausspionieren können. Mein Handy hat er in der Toilette hinuntergespült, als ich gerade nicht aufgepasst habe. Aber ich konnte ihm nicht mal böse sein. Er hatte wirklich panische Angst davor.« Unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen. »So, jetzt brauche ich aber dringend einen Kaffee. Sie finden mich in der Küche, sollten Sie noch mehr Fragen haben.«
»Herr Siebert, eine Bitte habe ich noch: Sie haben inzwischen doch sicher ein neues Handy. Würden Sie mir bitte die Nummer geben, damit ich Sie erreichen kann?«
Er diktierte sie mir. »Ich habe es aber tagsüber oft ausgeschaltet. Ich bin nämlich noch in der Probezeit, und ich möchte meine neuen Chefs nicht durch private Telefonate verärgern.«
»Verstehe.«
»Den hast du aber mächtig in die Mangel genommen«, meinte Funda mit einem deutlichen Tadel in der Stimme, nachdem Peter Siebert in die Küche geschlurft war. »An seiner Stelle wäre ich mir wie ein Verbrecher im Kreuzverhör vorgekommen.«
Ich konnte ihr diesen Einwand nicht verübeln. Sie war noch nicht lange genug dabei, um sich mit allen Gegebenheiten auszukennen. Vor allem hatte sie nicht die leiseste Ahnung davon, wie viele Schwierigkeiten uns ein Peter Siebert bereiten konnte. »Was würdest du ihn fragen, wenn du für alles haftest, was mit diesem Haus und dem Inventar geschieht? Würdest du dann nicht auch klären, ob er überhaupt das Recht hat, hier zu sein? Immerhin könnte er die wertvollsten Sachen zusammensuchen und sich damit aus dem Staub machen. Deshalb werden wir auch alles fotografieren, bevor wir gehen. Ich hatte übrigens schon einmal den Fall, dass ein Fremder sich in dem Haus eines Verstorbenen eingenistet hat, um eine Zeit lang mietfrei dort zu wohnen. Und der hat sich dann mit Händen und Füßen dagegen gewehrt auszuziehen.«
»Mit diesem Herrn Siebert werden wir bestimmt keine Schwierigkeiten bekommen«, sagte Funda. »Der macht sich doch eher klein und geht in Deckung, wenn es darauf ankommt.«
»Wollen wir es hoffen!«
Funda begann zu flüstern: »Und Albert Schettlers Nebenkosten scheint er auch zu schonen. Zumindest benutzt er dessen Waschmaschine nicht. Seine Klamotten riechen, als wären sie lange nicht gewaschen worden.«
Ich musste lachen. »Das ist ein ganz spezieller Duft, er heißt Patschuli. Die einen erinnert er an einen ungelüfteten Kleiderschrank, die anderen an einen indischen Markt.«
»Kein Scherz?«
»Kein Scherz. So, und jetzt lass uns loslegen!«
»Wo soll ich anfangen?«
»Ich schlage vor, wir konzentrieren uns erst einmal nur auf Dokumente und Wertsachen und verschieben die gründliche Durchsicht, bis Peter Siebert ausgezogen ist. Vielleicht gibt es ja sogar ein Testament.« Ich sah mich in dem Raum um. »Schau du am besten in die Kartons in den Regalen. Ich mache mich auf die Suche nach dem Arbeitszimmer, falls Albert Schettler eines hatte.«
In der Küche brühte Peter Siebert gerade Kaffee nach traditioneller Art auf, mit Kanne und Filter. Dabei summte er ein Lied.
Ich klopfte an die offen stehende Tür. »Hatte Herr Schettler ein Arbeitszimmer?«
»Es liegt direkt über der Küche, neben seinem Schlafzimmer. Ich logiere unterm Dach.«
»Und wohin geht es da?« Ich deutete zu der Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs.
»In den Keller.«
»Wir werden Sie nicht lange stören«, versprach ich. »Wir brauchen nur die nötigsten Dokumente, um uns einen Überblick zu verschaffen und schon mal das Wichtigste in die Wege zu leiten.«
»Eigentlich finde ich es ganz schön, dass jemand im Haus ist«, meinte er mit einem Lächeln. »Wenn man nicht gerade unter Verfolgungswahn leidet, fühlt man sich hier wie in einem Gefängnis. Ich kann es kaum erwarten auszuziehen.«
»Sie haben es ja bald geschafft.« Ich erwiderte sein Lächeln und ging über die knarrende Holztreppe in den ersten Stock.
Über grauen Teppichboden, der in der Mitte abgetreten war, gelangte ich ins Arbeitszimmer. Auch hier war alles übersichtlich. Ein Holzschreibtisch, ein Aktenschrank, ein Sessel. Alles ein wenig verstaubt. An den Fenstern ähnlich schwere Vorhänge wie im Erdgeschoss. Auf der Fensterbank stand ein Fernglas.
Ich setzte mich an den Schreibtisch und ließ den Blick durch diesen Raum wandern, dem genauso wie dem Wohnzimmer selbst die kleinste anheimelnde Note fehlte. Es gab weder Fotos noch kleine Erinnerungsstücke und Reisemitbringsel, die ich üblicherweise in Wohnungen fand. Dafür hingen an den Wänden zahllose, eng beschriebene Blätter, die mit Reißzwecken dort befestigt worden waren.
Auf dem Schreibtisch entdeckte ich ein antiquarisch anmutendes Telefon mit Wählscheibe. Ich hob den Hörer ab und wartete, bis ich das Freizeichen hörte. Das also war Albert Schettlers Verbindung zur Außenwelt gewesen. Rund um das Telefon stapelten sich jede Menge Bücher. Sie handelten von Überwachungsmethoden, Verschwörungstheorien und Menschen, die auf Nimmerwiedersehen in der Psychiatrie verschwanden. Albert Schettler hatte diese Bücher akribisch durchgearbeitet und auf jeder Seite mit rotem Kugelschreiber seine Kommentare vermerkt. Man musste kein Arzt sein, um zu begreifen, dass er all das in großer seelischer Not geschrieben hatte.
Einmal mehr wurde mir bewusst, wie unterschiedlich das Leben den Menschen gewogen war. Die einen kamen ohne größere Blessuren hindurch, andere hingegen mussten sich fühlen wie auf einer nicht enden wollenden Fahrt mit der Geisterbahn, wo hinter jeder Ecke ein Schrecken lauerte. Zwischen diesen Polen schwamm das große Heer derer, für die sich Glück und Unglück die Waage hielten.
»So jemanden möchtest du nicht zum Nachbarn haben«, riss Funda mich aus meinen Gedanken. »Weißt du, was er in den Kartons aufbewahrt hat? Lauter Beobachtungsprotokolle. Welcher Nachbar wann mit seinem Hund Gassi gegangen ist, wer wie in seine Garage gefahren ist, vorwärts oder rückwärts, wer an welchem Tag mit welchem Fuß zuerst vor die Haustür getreten ist. Welche Beschriftungen die prall oder mäßig gefüllten Einkaufstüten trugen, die die Nachbarn in ihren Häusern verschwinden ließen. Wie oft der Paketbote ihnen Ware geliefert hat. Schettler hat das alles bis ins kleinste Detail aufgeschrieben. Selbst die Uhrzeit, zu der der Nachbar von gegenüber den Rasen gemäht hat, schien ihm wichtig gewesen zu sein. Besonders genau hat er hingesehen, wenn Nachbarn sich miteinander unterhalten und dabei noch einen Blick auf sein Haus geworfen haben. An solchen Tagen ist er nicht vor die Tür gegangen – aus Sorge, sie hätten es auf ihn abgesehen.« Funda warf einen Blick auf die Bücher, die auf dem Schreibtisch lagen. »Oh je, auch das noch!«
»Immer nur Angst zu haben, vor allem und jedem, stelle ich mir unerträglich vor«, sprang ich für den Verstorbenen in die Bresche. »Hast du außer diesen Protokollen noch etwas gefunden?«
»Nichts, was auch nur annähernd nach Dokument aussieht. Und du?«
Ich schüttelte den Kopf. »Lass uns nebenan nachsehen und im Keller. Vielleicht finden wir da etwas.«
Im Schlafzimmer fiel mein Blick auf ein Hochbett, das Albert Schettler sich vermutlich hatte zimmern lassen. Es hatte Übergröße und nahm ein Drittel des Raumes ein. Darunter war eine kleine Küche eingebaut, in deren Regalen sich Konservendosen, Knäckebrot, Trockenobst, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und stangenweise Zigaretten stapelten. Auf dem Boden standen mehrere Kästen mit Wasserflaschen. Hinter der Tür befanden sich eine Toilette, ein Feuerlöscher und zwei Baseballschläger. Die Tür selbst ließ sich von innen mit mehreren Riegeln verbarrikadieren und besaß einen Spion. Albert Schettler hatte sich hier einen geschützten Raum geschaffen, in dem er einige Zeit hätte überleben können – falls es seinen Angreifern überhaupt gelungen wäre, ins Haus einzudringen.
Funda drehte sich um die eigene Achse und schien nicht fassen zu können, was sie sah. Es war einer der seltenen Momente, in denen sie sprachlos war.
Ich stieg die Leiter zum Hochbett hinauf und schaute mir den Teil der Konstruktion an, der sich den Blicken von unten entzog. Entlang der Wand stapelten sich vollgeschriebene Kladden. Ich zog einige heran und blätterte sie durch. Es waren Tagebücher, die mehr als zwanzig Jahre zurückreichten. Darin war viel die Rede von Schuld und tödlichen Gefahren. Von Verrätern, von Gift in den Gartenkräutern und seinem drohenden Tod. An manchen Stellen war seine Schrift kaum leserlich, an anderen hatte er in Druck- und Großbuchstaben geschrieben. Alles garniert mit unzähligen Ausrufezeichen und Unterstreichungen.
Normalerweise fiel es mir schwer, die Finger von Briefen, Tagebüchern und persönlichen Aufzeichnungen der Toten zu lassen, für die sich niemand mehr interessierte und die ein Leben in all seinen Facetten aufschlüsselten. In schlaflosen Nächten tauchte ich in diese Geschichten ein und ließ mich von ihnen davontragen. Ich hatte mir eine Rechtfertigung dafür zurechtgelegt, dass ich solche Unterlagen mitgehen ließ, anstatt sie zu vernichten, wie es eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre, wenn es keine Erben gab: Hätten sie im Papiercontainer landen sollen, hätten die Leute das beizeiten selbst geregelt, redete ich mir ein – wohl wissend, dass der Untergrund, auf dem diese Rechtfertigung stand, sehr wackelig war. Dafür hütete ich die Geschichten wie einen Schatz und verbarg sie vor fremden Blicken.
In Albert Schettlers Fall war ich immun. Seine Kladden würden die Wirklichkeit im besten Fall auf verzerrte Weise wiedergeben, wie Traumgespinste, die sich aus Bruchstücken der Realität zusammensetzten, angereichert mit archaischen Horrorvisionen. Das war nichts, wonach ich suchte, sondern nur etwas, das mein Mitgefühl zu Hochtouren auflaufen ließ.
»Was gibt es denn da oben so Spannendes?«, fragte Funda.
»Schreibhefte voller Wahnideen und … warte!« Ich zog einen Packen ausgeschnittener Zeitungsartikel unter einem Stapel Kladden hervor. »Jede Menge Berichte über ungeklärte Todesfälle.«
»Obermenzing betreffend oder die ganze Welt?«
Ich schaute grinsend zu ihr hinunter. »Die ganze Welt wäre dir lieber, was?«
»Ich möchte mir die Illusion bewahren, dass mein Kind in einer heilen Welt aufwächst.«
»Dann bleib lieber da unten.«
»Irgendwelche wichtigen Unterlagen?«
Ich schaute unter die Matratze. »Nein. Am besten gehen wir runter und fragen Herrn Siebert. Vielleicht weiß er, wo wir die Sachen finden.« Ich kletterte die Leiter hinunter und zog Funda von den Konservendosen fort, die sie magisch anzuziehen schienen.
»Erbseneintopf und Ravioli«, sagte sie im Hinausgehen, »damit könntest du mich jagen.«
Peter Siebert kam uns auf der Treppe entgegen. Inzwischen wirkte er etwas weniger verschlafen. Er drückte sich gegen das Geländer, um uns vorbeizulassen. »Haben Sie alles gefunden?«, fragte er.
»Leider nichts von dem, was wir suchen. Geburtsurkunde, Versicherungs- und Rentenunterlagen, Kontoauszüge, Personalausweis, Pass, Verträge mit den Energieversorgern und Telekommunikationsanbietern … all das. Haben Sie eine Ahnung, wo er diese Sachen aufbewahrt haben könnte?«
»Im hintersten Küchenschrank.« In gemächlichem Tempo lief er uns voraus und öffnete den Schrank. »Fragen Sie mich bloß nicht, warum er seine Dokumente hier aufbewahrt hat. Ich habe sie durch Zufall gefunden, als ich nach Gewürzen gesucht habe. Die es in diesem Haushalt übrigens nicht gibt. Albert hat nichts benutzt, was nicht sofort aufgebraucht werden konnte. Es hätte ihm ja jemand Gift untermischen können.« Er schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Hatte er vor Ihnen eigentlich auch Angst?«, fragte ich.
Er verneinte. »Aber es wäre vermutlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich auch zu einem von denen geworden wäre.« Peter Siebert zog mehrere Schnellhefter aus dem Küchenschrank und legte sie auf den Tisch. Daneben drapierte er eine Herrenuhr der Marke Patek Philippe und eine Geldbörse. »Portemonnaie und Uhr hatte er im Krankenhaus dabei. Ich habe die Sachen mitgenommen und hier aufbewahrt.«
Ich widerstand dem Impuls nachzusehen, ob sich Geld in der Börse befand.
»Es fehlt kein Cent«, sagte er, als habe er meinen Gedanken lesen können. »Allerdings habe ich Alberts Konto ein wenig geschröpft. Irgendjemand musste sich schließlich um seine Beerdigung kümmern. Da mir das nötige Geld dafür derzeit fehlt, habe ich die Leute bei der Bank so lange weich geklopft, bis sie ein Einsehen hatten. Apropos Bank – das hier hätte ich beinahe vergessen.« Er löste eine Klarsichtfolie von der Innenseite der Schranktür und zog ein beschriebenes DIN-A4-Blatt daraus hervor, auf das unverkennbar ein Safeschlüssel geklebt war. »Da Sie die Nachlassverwalterin sind, ist der Brief wohl an Sie gerichtet.«
Ich nahm das Blatt und las.
An den NACHLASSVERWALTER! In meinem Bankschließfach mit der Nummer 396 bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg in Obermenzing befinden sich Unterlagen, die in die Hände von Polizei und Medien gehören. Sie sind der Beweis dafür, dass ich UMGEBRACHT wurde!! Wegen einer alten Schuld, die längst verjährt ist. Aber es gibt einen MÖRDER!, der diese Schuld trotzdem eintreiben will. Er hat seine Hände schon zweimal mit Blut befleckt!!! Ich werde sein nächstes Opfer sein. Deshalb WILL ich, dass er dafür büßen muss. Er ist schlau, aber das bin ich auch. Noch bin ich ihm immer!! einen Schritt voraus. Deshalb liegen die Unterlagen in dreifacher! Ausführung im Safe. Eine Kopie ist für den Spiegel, eine für das Bundeskriminalamt und eine für Sie, den Nachlassverwalter. Da mein Mörder MIT SICHERHEIT versuchen wird, Ihnen die Unterlagen abzujagen, sollten Sie in jeder! Sekunde auf der Hut sein. Verwahren Sie beim Verlassen der Bank eine Kopie IN JEDEM FALL!!! direkt am Körper und halten Sie Ihre Aktentasche gut fest. Der Mörder wird sie Ihnen sonst !rauben! Gehen Sie KEINESFALLS ALLEIN zur Bank!!! Unterschätzen Sie die GEFAHR nicht!
Ich stieß einen Seufzer aus und reichte das Blatt mit dem Safeschlüssel an Funda weiter.
»Du meine Güte«, war alles, was sie dazu sagte.
»Wenn ihn etwas umgebracht hat, dann war es sein Verfolgungswahn«, sagte Peter Siebert voller Mitgefühl.
»Woran ist Herr Schettler eigentlich gestorben?«, fragte ich.
»Er hat einen Schlaganfall erlitten, kurz nachdem ich morgens das Haus verlassen hatte. Die Nachbarin hat ihn schreien hören und den Notarzt gerufen. Im Krankenhaus ist er zwei Wochen später aber leider gestorben.« Peter Siebert sah mich fragend an. »Brauchen Sie mich noch? Ich müsste heute nämlich einiges erledigen.«
»Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden, setze ich ein Gesprächsprotokoll auf, in dem ich festhalte, dass Sie spätestens am siebzehnten Mai ausziehen und den Schlüssel zum Haus abgeben. Das müssten Sie mir bitte unterschreiben.«
»Okay. Ich dusche nur schnell und komme dann wieder herunter.«
Ich nickte und ließ ihn ziehen. »Und wir beide fotografieren in der Zwischenzeit das Haus einmal von oben bis unten ab«, sagte ich zu Funda, die augenblicklich ihr iPhone zückte. »Du hier, ich im ersten Stock.«
Am Nachmittag stattete ich Albert Schettlers Sparkasse einen Besuch ab. Ich legitimierte mich dort als Nachlassverwalterin, ließ die Konten sperren und verschaffte mir einen Überblick über die Kontenbewegungen der vergangenen sechs Wochen. Nach seinem Tod waren lediglich die Bestattungskosten und die laufenden Daueraufträge für die Versorgungsunternehmen abgebucht worden. Die Frage, wieso ich in der Geldbörse des Toten weder EC- noch Kreditkarten gefunden hatte, ließ sich ebenfalls klären. Laut Auskunft der Bankangestellten hatte Albert Schettler Karten entschieden abgelehnt. In seiner Vorstellung hätten sie ein viel zu hohes Sicherheitsrisiko bedeutet.
Schließlich begleitete sie mich zum Tresorraum im Keller, wo sich das Schließfach des Verstorbenen befand. Ich bat sie, als Zeugin zu bleiben, während ich die Kassette öffnete. Darin befanden sich drei braune DIN-A4-Umschläge, die jeweils von Albert Schettler in seiner mir inzwischen vertrauten Art mit Unterstreichungen und Ausrufezeichen beschriftet worden waren. Auf dem Umschlag, der an den Spiegel adressiert war, stand: »Skandalöse Enthüllungen über Dreifachmörder!!!« Dem BKA hatte er hinterlassen: »Es war Mord!!!!« Den Nachlassverwalter hatte er einmal mehr aufgefordert: »Unbedingt direkt! am Körper tragen!! Gefahr!!!«
Ich öffnete einen der Umschläge und zog von Hand beschriebene Blätter daraus hervor. Der einleitende Satz lautete: Wenn Sie dieses Schriftstück in Händen halten, wurde ich umgebracht. Worte wie Mörder, schuldig, hinterhältig, Opfer und verjährt stachen mir ins Auge. Traurige Auswüchse seines Wahns. Bei den Blättern in den anderen beiden Umschlägen handelte es sich um Kopien, so wie er es in seinen Instruktionen für mich beschrieben hatte. Ich verstaute die Umschläge in meiner Tasche und ließ mir von der Bankangestellten den Inhalt des Schließfachs auf einem Formblatt bestätigen.
In diesem Frühjahr hatte ich mich so lange nach Sonne gesehnt, dass ich froh war, den fensterlosen Tresorraum wieder verlassen zu können. Nachdem ich meine Tasche im Fahrradkorb verstaut hatte, trat ich in die Pedale. Mit etwas Glück würde es im Café Ritzinger noch zwei Stücke Käsekuchen geben, eines für Henrike, eines für mich.
Ich hatte gerade die Ampel überquert, um entlang der Verdistraße stadteinwärts zu fahren, als ein Ruck mein Rad ins Schlingern brachte. Hätte ich nicht reflexartig gegengesteuert, wäre ich mit dem Fahrradfahrer zusammengeprallt, der mich überholte und allem Anschein nach touchiert hatte. Ich hielt an und rief ihm ein paar deftige Worte hinterher, von denen Kampfradler noch das freundlichste war. Als Reaktion bekam ich seinen Stinkefinger zu sehen. Während ich ihm verärgert hinterherstarrte, fiel mein Blick auf die Tasche, die er geschultert hatte und die meiner zum Verwechseln ähnlich sah. Ein Blick in meinen Fahrradkorb ließ mich laut fluchen. Er war leer. Voller Wut trat ich so fest in die Pedale, wie es nur ging, aber ich hatte keine Chance, die Entfernung zwischen ihm und mir wurde immer größer. Als er schließlich rechts abbog, hatte ich ihn verloren.
Blitzschnell ging ich im Geiste den Inhalt meiner Tasche durch: Portemonnaie mit Ausweis, Führerschein, Geldkarten und Bargeld, außerdem Terminkalender, Handy, Fotoapparat, Sonnenbrille sowie Albert Schettlers Umschläge.
Anstatt Käsekuchen mit Henrike zu essen, verbrachte ich eine Stunde auf der Polizeiwache in Pasing, erstattete Anzeige gegen unbekannt, beschrieb den Inhalt meiner Tasche und den Dieb, den ich nur von hinten gesehen hatte, als vermutlich männlich, schlank, mittelgroß und sportlich. Er hatte Sportklamotten getragen: eine schwarze, enge Radhose, ein rotes, langärmeliges Shirt und einen bronzefarbenen Fahrradhelm. Der Beamte, der die Anzeige aufnahm, machte mir kaum Hoffnung, meine Sachen je wiederzusehen. Vermutlich würden die nicht verwertbaren Reste in irgendeinem Abfallkorb landen. Na prima! Die Woche fing wirklich gut an.
2 Erst auf dem Heimweg wurde mir bewusst, dass genau das geschehen war, was Albert Schettler prophezeit hatte. Meine Tasche mit seinen Unterlagen war mir gestohlen worden.
»Reiner Zufall«, sagte Henrike, als ich ihr fünf Minuten später in ihrem Trödelladen von dem Zwischenfall erzählte. Sie saß breitbeinig auf einem Schemel und putzte so heftig eine alte Silberkanne, dass sich ihre großen Kreolen in ihren langen, dunklen Haaren verfingen.
Sonnenlicht fiel durch die Fenster in die alte Scheune. Seit Henrike sie vor bald zwei Jahren von meinen Eltern gemietet hatte, war daraus ein Schmuckstück geworden. Davor war sie eher unscheinbar gewesen und gegenüber dem weiß getünchten Haupthaus mit seinen roten Fensterläden in den Hintergrund getreten. Henrike hatte das Rundbogentor passend zu den Fensterläden des Haupthauses gestrichen, die Holzverschalung an der Frontseite in einem dunklen Ton gebeizt und die nachträglich eingebauten Sprossenfenster ausgebessert.
»Und wenn es kein Zufall war?«, gab ich zu bedenken. »Wenn es der Dieb auf Schettlers Unterlagen abgesehen hatte?«
»Wer sollte denn deiner Meinung nach auf die Hirngespinste dieses kranken Mannes aus sein? Vielleicht ein Psychiater im Rahmen seiner streng geheimen Forschungen?« Henrike krauste die Stirn. »Ich kann dir sagen, was passiert ist, Kris. Jemand hat dich beobachtet, als du die Sparkasse betreten hast, hat abgewartet, bis du wieder herausgekommen bist, hat vermutet, dass du Geld abgehoben hast, und deine Tasche für leichte Beute gehalten. Was sie schließlich auch war. Was war denn außer den Umschlägen noch alles darin?«
»Bis auf den Hausschlüssel, den ich in der Hosentasche hatte, alles«, stöhnte ich. »Ich darf gar nicht daran denken, wie viel Zeit es mich kosten wird, die Sachen wiederzubeschaffen.«
»Hast du mal auf deinem Handy angerufen?«
»Ja, es ist ausgeschaltet.«
»Vermutlich hat er die SIM-Karte herausgenommen und weggeworfen.«
»Um mein Handy zu seinem zu machen? Das glaubst du doch selbst nicht. Für das Teil würdest du bei eBay nicht mal mehr einen Euro bekommen.« Ich massierte mir mit den Zeigefingern die Schläfen. »Weißt du, was das Schlimme ist? Normalerweise bin ich supervorsichtig, wenn ich Schließfächer leere, und hänge mir auf dem Rückweg die Tasche um. Heute habe ich das nicht für nötig gehalten, weil der Inhalt des Schließfaches höchstens einen ideellen Wert hatte und den auch nur für diesen Schettler.«
»Das kann dir niemand verübeln, Kris. Ich würde einen Haken hinter die Sache machen.«
»Der Mann hat mir aber ganz genaue Instruktionen hinterlassen, was zu tun ist, wenn ich sein Schließfach leere. Und ich habe mich nicht daran gehalten.«
»Und? Es wird kein Hahn danach krähen, glaub mir.« Henrike machte sich wieder an der Silberkanne zu schaffen. »Selbst wenn du Erben ausfindig machen solltest, werden die ganz sicher keinen Wert auf diese Blätter legen. Sollte mich jedenfalls wundern, wenn ich mich irre.«
»Darum geht es nicht, Henrike. Mir ist es wichtig, den Toten gerecht zu werden. Wenn ich ihre letzten Wünsche nicht ernst nehme, kann ich meinen Job gleich an den Nagel hängen. Aber das ist es nicht allein, es geht mir noch um etwas anderes: Was, wenn es sich bei Schettlers Unterlagen nicht um Hirngespinste, sondern um Tatsachen handelt? Es ist doch nicht gesagt, dass alles, was ein wahnhafter Mensch behauptet, auch tatsächlich diesem Wahn entspringt.«
»Ausschließen kannst du es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon groß. Überleg mal: Wenn es tatsächlich um etwas gegangen wäre, das die Polizei hätte erfahren sollen, hätte er sich selbst darum kümmern können, als er noch lebte. Hat er aber nicht. Angeblich soll es ja schon zwei Morde gegeben haben. Die waren es ihm aber offensichtlich nicht wert, sie anzuzeigen.« Sie bearbeitete eine besonders hartnäckige Stelle der Kanne und sah dann auf. »Kris, es ehrt dich, dass du den Diebstahl dieses Geschreibsels nicht mit einem Schulterzucken abtust, aber lass dich nicht vor den Karren dieses Mannes spannen! Der entführt dich nur in seine Wahnwelt.«
»Auf dem obersten Blatt in diesen Umschlägen stand, dass er umgebracht worden sei, wenn der Nachlassverwalter diese Unterlagen in Händen halte.«
»Hast du nicht gesagt, er sei an einem Schlaganfall gestorben?«
»Zumindest sagt das der Sohn seines Freundes.«
»Na also!«
»Vielleicht ist der Schlaganfall dem Mörder zuvorgekommen.«
Henrike legte die Silberkanne aus der Hand und wischte sich die Hände an ihrer Jeans ab. »Was willst du da auf Teufel komm raus unterstellen? Hm?«
»Ich will gar nichts unterstellen«, brauste ich auf. »Ich wiederhole nur, was in diesen Instruktionen stand. Da war von Morden die Rede, einer Schuld, die verjährt ist, und dass dieser Mörder in jedem Fall versuchen würde, mir die Unterlagen abzujagen. Tatsache ist: Die Unterlagen wurden mir abgejagt.«
»Deine Tasche wurde gestohlen«, korrigierte Henrike mich trocken. »Das ist auch schon alles.« Sie zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief.
»Kann es sein, dass du dich nur deshalb so bockig gibst, weil du dich als Polizistin hast beurlauben lassen und nun nichts mehr von Mördern und Verschwörungen wissen willst?« Außer mir wusste auf dem Hof niemand von ihrer Vergangenheit als verdeckte Ermittlerin. Vor allem Arne, Henrikes Freund, durfte nichts davon erfahren. Die Polizei war für ihn ein rotes Tuch.
»Ich habe mich schließlich nicht ohne Grund beurlauben lassen«, sagte sie. »Ich will in Ruhe herausfinden, ob das Leben mehr zu bieten hat als Kriminalität.«
»Und deshalb schreibst du in deiner Freizeit auch an einem Krimi«, konterte ich.
»Im Augenblick ruht das Manuskript. Selbst dazu kann ich mich nicht aufraffen. Außerdem ist mir bewusst geworden, dass es mittlerweile genügend Krimi schreibende Kollegen gibt. Der Buchmarkt braucht mich nicht.«
»Aber ich brauche deine Hilfe, Henrike.«
»Wenn es etwas zum Entrümpeln oder zum Aufarbeiten gibt, jederzeit. Bei der Konstruktion eines Kriminalfalls, der von einem Toten mit Verfolgungswahn handelt, musst du allerdings auf mich verzichten.«
»Letztes Jahr warst du in dieser Hinsicht weit weniger ablehnend.«
»Letztes Jahr ging es auch nicht um Hirngespinste, sondern um deinen Bruder.«
Bens Verschwinden im April vor sieben Jahren hatte auf einen Schlag alles geändert. Meine Eltern hatten ihre Buchhandlung in Freudenberg aufgegeben, ich mein Jurastudium in Berlin, und wir waren auf die Hofanlage in Obermenzing gezogen, die mein Vater Jahre zuvor von einem Onkel geerbt hatte. Dort hatte Ben zuletzt gelebt. Und von dort aus starteten wir unsere über lange Zeit hinweg erfolglose Suche nach ihm.
Meine Eltern hatte die Sorge um ihren Sohn entzweit, sie hatten getrennte Wohnungen in der linken Hälfte des alten Haupthauses bezogen. Im rechten Teil hatte ich mir Büro und Wohnung eingerichtet. Ins Nebengebäude schräg gegenüber war vor bald fünf Jahren Simon gezogen. Auch er hatte sich für Arbeiten und Wohnen unter einem Dach entschieden und betrieb dort einen Weinhandel, das Vini Jacobi. Seit drei Jahren waren wir nun ein Paar.
»Und ich kann dich nicht umstimmen?«, fragte ich Henrike. »Immerhin liegt dein ermittlerisches Geschick und all das, was du in deiner beruflichen Laufbahn gelernt hast, inzwischen völlig brach. Das ist doch eine zum Himmel schreiende Verschwendung.«
»Was das angeht, ist der Himmel über mir taub.« Ihrem Tonfall nach zu urteilen, war das ihr letztes Wort.
Vor Müdigkeit fielen mir fast die Augen zu, als ich mich am Schreibtisch in meinem Büro durch Albert Schettlers Dokumente arbeitete. Er war nicht älter als siebenundsechzig geworden, war nie verheiratet gewesen und hinterließ keine Kinder. Auch nahe Verwandte schien es nicht zu geben, aber das würde ich noch genauer prüfen müssen. Zwischen Versicherungs-, Bank- und Rentenunterlagen fand ich ein Testament, das kurz vor seinem Tod aufgesetzt worden war. Demnach gingen all seine Besitztümer an die Freiwillige Feuerwehr Obermenzing. Den Wert des Hauses und seine Bankguthaben zusammengerechnet, würde sich die Feuerwehr freuen können. Vorausgesetzt, es tauchte nicht noch ein weiteres Testament mit anderem Inhalt auf, was nicht ungewöhnlich wäre. Menschen änderten ihren letzten Willen hin und wieder.
Bevor ich für diesen Tag Schluss machte, durchforstete ich noch Schettlers Adressbuch. Den Namen Siebert fand ich allerdings nirgends, weder unter S noch sonst wo. Da alle Einträge Vor- und Nachnamen enthielten, konnte es höchstens sein, dass Peter Sieberts Vater einen anderen Familiennamen trug als sein Sohn. Das würde ich bei nächster Gelegenheit mit Schettlers Untermieter klären.
Als die Glocke von St. Georg sieben Mal schlug, klappte ich die Akte Schettler zu und verließ das Büro. Auf dem Weg in meine Wohnung kam ich an den Briefkästen vorbei, die meinen Eltern lange Zeit als eine Art Schwarzes Brett gedient hatten, an dem sie auf gelben Haftzetteln Nachrichten austauschten. Oft war das über Wochen hinweg die einzige Form ihrer Kommunikation gewesen. Inzwischen redeten sie wieder miteinander, und ich entdeckte nur noch hin und wieder einen Haftzettel. Heute stammte er von meiner Mutter. Ich hätte Lust, mal wieder griechisch essen zu gehen. Du auch?, hatte sie geschrieben. Seine Antwort war irritierend: Den Griechen um die Ecke kann ich dir nur empfehlen, ich war vor zwei Tagen erst dort. Kein Wunderbar! Ich bin dabei. Oder Sag wann, ich hole dich ab. Normalerweise wäre er auf eine solche Anbahnung sofort angesprungen, da es ihn oft quälte, dass meine Mutter sehr zurückhaltend war, was gemeinsame Aktivitäten mit ihm betraf.
Ich lief die Treppe hinauf und klopfte an seine Wohnungstür, die meiner gegenüber lag. Es dauerte, bis er öffnete und mich mit einem fahrigen Blick begrüßte.
»Ist es dringend, Kris? Ich bin nämlich in Eile!«
Er knöpfte sich gerade sein blütenweißes Hemd zu, das er über einer dunkelblauen, allem Anschein nach neuen Jeans trug. Er hatte seinem grauen Haar einen frischen Schnitt verpassen lassen und duftete nach einem Aftershave, das ich noch nicht kannte. Also hatte er die Essenseinladung meiner Mutter doch angenommen.
»Mama wird sich freuen, wenn sie dich so sieht.«
»Ist sie unten? Ich dachte, sie hätte Spätdienst im Hotel.«
»Du gehst nicht mit ihr essen?«
»Nein.«
Mein Vater brachte älteren Semestern an der Volkshochschule den Umgang mit Computern nahe und gab hin und wieder auch Privatunterricht. Für einen Abendtermin mit einer seiner Kundinnen würde er sich jedoch ganz bestimmt nicht so herausputzen. »Was hast du vor?«, fragte ich neugierig.
»Ich bin verabredet. Weswegen hast du denn überhaupt geklopft?«
»Um mich zu vergewissern, dass mit dir alles okay ist.«
»Es ging mir nie besser.« Es war lange her, dass seine Augen so geleuchtet hatten.
»Das freut mich!« Ich drückte ihm einen Kuss auf die Wange und machte auf dem Absatz kehrt. Als ich seine Tür nicht ins Schloss fallen hörte, drehte ich mich noch einmal um.
Er stand immer noch in der geöffneten Tür. »Aber sag deiner Mutter nichts, ja?«
»Keine Silbe.«
Selbst als ich meine Tür längst geschlossen hatte, dachte ich noch über meinen Vater nach. Es war noch nicht lange her, da hatte ihn die Sorge umgetrieben, meine Mutter könne einen neuen Partner finden. Und jetzt war er derjenige, der drauf und dran war, aus ihrer mehr als ungewöhnlichen Ehe auszubrechen. Und sei es nur vorübergehend. Ich spürte einen Stich, der gleich darauf von einem anderen Gefühl überlagert wurde. Er sollte endlich wieder froh sein können, und sei es nur für eine paar kostbare Momente. Die Trauer um seinen ermordeten Sohn würde ihn ohnehin immer wieder einholen.
Das Telefon klingelte, als ich gerade unter der Dusche stand. Mit halbem Ohr hörte ich der Stimme auf meinem Anrufbeantworter zu. Als die Worte Polizei und Tasche fielen, drehte ich das Wasser ab und rannte nass, wie ich war, ins Wohnzimmer. Es dauerte einige weitere Sekunden, bis ich das Mobilteil endlich gefunden hatte. Außer Atem meldete ich mich. Der Polizeibeamte am anderen Ende der Leitung freute sich, dass meine Tasche dank einer ehrlichen Finderin wieder aufgetaucht war. Ich könne sie auf dem Revier in Pasing abholen.
Zwanzig Minuten später stand ich vor ihm und konnte mein Glück kaum fassen. Bis auf mein Geld war alles noch da: Albert Schettlers Umschläge, meine Papiere, Geldkarten, Terminkalender, Fotoapparat, Sonnenbrille und Handy. Der Polizist sagte, eine alte Dame habe meine Tasche auf einer Parkbank entdeckt und sie auf dem Revier abgegeben. Ihren Namen und ihre Adresse konnte mir der Beamte nicht geben, da sie anonym hatte bleiben wollen. So schickte ich ihr in Gedanken ein dickes Dankeschön.
Zurück auf dem Hof ging ich als Erstes ins Büro und verstaute die Umschläge des Verstorbenen im Tresor. Ich wollte die schwere Tür gerade schließen, als ich beschloss, mir die Unterlagen vorher genauer anzusehen. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie mir noch einmal entwendet wurden. Ich zog die Blätter heraus und begann zu lesen. Gleich bei den ersten Worten stockte ich irritiert. Hatte der Dieb die Blätter aus dem Umschlag genommen, sie durchgesehen und dabei die Reihenfolge vertauscht? Ich vermisste Schettlers ersten Satz: Wenn Sie dieses Schriftstück in Händen halten, wurde ich umgebracht. Dieser Satz hatte auf dem obersten Blatt gestanden. Ich sah Seite für Seite durch, fand ihn jedoch nicht. Obwohl offensichtlich war, was geschehen sein musste, weigerte ich mich im ersten Moment, es zu glauben. Der Dieb hatte nicht etwa die Reihenfolge der Blätter vertauscht, er hatte die Seiten komplett ausgetauscht. Es konnte nur so gewesen sein. Was da vor mir lag, glich den Beobachtungsprotokollen, die Funda in den Schuhkartons in Schettlers Wohnzimmer gefunden hatte.
Der Diebstahl meiner Tasche war also doch kein Zufall gewesen! Hätte ich in der Bank nicht nur den ersten Satz von Schettlers Nachricht an die Nachwelt gelesen, wüsste ich nun, worum es hier ging.
Es war kurz vor neun, als ich das Vini Jacobi betrat. Kaum hatte ich die Tür aufgestoßen, kam Rosa, Simons Mischlingshündin, freudig auf mich zugelaufen. Ich ging in die Knie und begrüßte sie ausgiebig, bevor ich endlich Simon einen Kuss gab.
»Schlechte Laune?«, fragte er und hielt mich ein Stück von sich weg, um mich besser betrachten zu können.
»Ziemlich! War dein Tag wenigstens gut?« Ich setzte mich auf ein Holzfass.
»Hätte nicht besser sein können. Einer meiner Stammkunden hat mir zwei neue Kunden gebracht, die gleich richtig zugeschlagen haben.« Simon entkorkte eine Flasche Rosé und goss mir ein Glas ein. »Probier mal! Das ist der Domaine Richeaume, den ich neu gelistet habe. Ich hab dir davon erzählt. Erinnerst du dich? Der ist schön fruchtig und macht garantiert gute Laune.«
»Hast du auch ein Stück Brot? Ich habe seit heute Mittag nichts mehr gegessen.«
Simon holte einen kleinen Korb mit Baguettescheiben und stellte ihn neben mein Glas. Nachdem ich die Hälfte des Brotes verschlungen hatte, probierte ich den Wein. »Mhm, schmeckt gut!« Über das Glas hinweg betrachtete ich Simon, dessen Begeisterung für seine Neuentdeckung selbst nach einem Zwölfstundentag noch ungebrochen war.
»Was war denn so schlimm heute?«, fragte er mit seiner tiefen, warmen Stimme und setzte sich auf eines der Holzfässer mir gegenüber.
»Mir wurde heute Nachmittag meine Tasche geklaut. Eine alte Dame hat sie ein paar Stunden später auf einer Parkbank gefunden und bei der Polizei abgegeben.«
»Und was fehlt?«
»Knapp fünfzig Euro aus meinem Portemonnaie und Unterlagen aus einer Nachlasssache. Ich hatte sie gerade aus einem Bankschließfach geholt.«
»Demnach waren es wichtige Unterlagen?«
»Zumindest waren sie es für den Mann, der sie hinterlassen hat. Er war davon überzeugt, dass er umgebracht werden sollte, und hat in seinem Haus Instruktionen für den Nachlassverwalter deponiert, die Unterlagen aus dem Schließfach nach seinem Tod an Polizei und Medien zu verteilen. Angeblich ging es um eine längst verjährte Schuld und um einen Mehrfachmörder, der ihm ans Leder wollte und der nicht ungestraft davonkommen sollte.«
Simon hob eine Augenbraue. »Du meinst damit aber nicht, dass der Mann tatsächlich umgebracht wurde, oder?« Nicht schon wieder Mord, schien sein Blick zu sagen.
»Er ist im Krankenhaus an einem Schlaganfall gestorben. Das ist zwar nur Hörensagen, aber bestünden Zweifel an einer natürlichen Todesursache, dann wäre die Kripo eingeschaltet worden.«
Simon forschte in meinem Gesicht und sah darin seine Befürchtung bestätigt. »Und jetzt glaubst du, dass der Handtaschendieb es auf diese Unterlagen abgesehen hatte.«
»Ja, das glaube ich. Albert Schettler, so hieß der Tote, hat mich nämlich genau davor gewarnt. In seinen Instruktionen hat er geschrieben, der Mörder würde versuchen, mir beim Verlassen der Bank die Unterlagen abzujagen.«
»Und da lässt er dich ins offene Messer laufen? Nach dem Motto Nach mir die Sintflut? Dir hätte wer weiß was passieren können!« Simon fuhr sich durch seine widerborstigen dunklen Haare und rieb sich seinen Dreitagebart. »Und du lässt dich auch noch darauf ein! Hat dir die Erfahrung im letzten Jahr nicht gereicht?«
»Mir ist ja nichts passiert«, versuchte ich, ihn zu beschwichtigen.
»Du hast doch aber hoffentlich nicht vor, deine Nase tiefer als unbedingt nötig in diese Sache zu stecken. Oder etwa doch?«
»Albert Schettler hat vermutlich seit vielen Jahren unter Verfolgungswahn gelitten.«
Augenblicklich entspannte sich Simons Miene. »Warum sagst du das nicht gleich?«
»Ich habe mal gelesen, dass Wahnvorstellungen sehr wohl einen wahren Kern haben können.«
»Wer behauptet denn so etwas?«
»In dem Fall war es ein Psychiater.«
Simons Miene sprach Bände.
»Wenn an Albert Schettlers Geschichte etwas Wahres dran ist, könnte ich mir das nicht verzeihen.«
»Was könntest du dir nicht verzeihen?«
»Ich habe genauso reagiert wie du. Wie vermutlich jeder andere auch. Von dem Moment an, als ich wusste, dass er unter Wahnvorstellungen gelitten hat, habe ich dieser Tatsache alles andere untergeordnet und ihn nicht mehr für voll genommen.«
»Es gibt größere Sünden.«
»Simon, nimm mich bitte ernst.«
»Das tue ich. Und deshalb habe ich Sorge, dass du dich wieder auf brüchiges Eis begibst. Die letzte derartige Erfahrung hätte dich fast das Leben gekostet.«
»Hätte ich die Vollstreckung von Theresa Lenhardts Testament etwa ablehnen sollen?« Ich hatte ihm diese Frage in den vergangenen Monaten schon etliche Male gestellt.
»Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen«, sagte Simon und bemühte sich, ruhig zu bleiben, »sie hat mit ihrem Erbe ein Kopfgeld auf einen Mörder ausgesetzt und dich damit beauftragt, ihn zu stellen. Sie konnte sich sicher sein, dass du ihren Auftrag annehmen würdest, weil du gar nicht anders konntest. Und genau das werfe ich dieser Frau vor. Sie hat dich aus egoistischen Motiven einer unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt.«
»Der habe ich mich selbst ausgesetzt«, verteidigte ich Theresa Lenhardt. »Und hätte ich mich nicht darauf eingelassen, wüssten wir bis heute nicht, was mit Ben geschehen ist.«
»Das ist immer das Totschlagargument, gegen das nichts einzuwenden ist.« Er schüttelte genervt den Kopf. »Und trotzdem kann ich dich nur bitten, einen Bogen um diese neue Sache zu machen! Dieses Mal geht es nicht um deinen Bruder.«
»Aber es geht um einen Toten, dessen letzten Wunsch ich vermasselt habe.«
»Und wird irgendein Hahn danach krähen?«
»Vermutlich nicht«, gab ich mich nach außen hin geschlagen. Es war zwecklos, mit Simon weiterzuargumentieren. Ich kannte seinen Standpunkt zur Genüge. Er sah ausschließlich die Gefahren, ich die Chancen wie im Fall von Theresa Lenhardt, oder meine Versäumnisse wie in Albert Schettlers Fall. Keiner von uns konnte aus seiner Haut.
Meine Nacht war um halb fünf zu Ende. Leise schlich ich mich aus Simons Bett, strich Rosa über den Kopf und lief die ersten Meter im Dunkeln Richtung Haupthaus. Dann schaltete sich der Bewegungsmelder ein, den mein Vater vor ein paar Monaten installiert hatte, und tauchte das Hofgelände in helles Licht. Neben dem Hauseingang brannte mit ruhiger Flamme Bens Kerze in der Laterne. Jahrelang hatte mein Vater dieses Licht gehütet, als könne es meinen Bruder nach seinem Verschwinden beschützen und zurückbringen. Inzwischen war es zu einem Licht der Erinnerung geworden.
Entgegen meiner Gewohnheit ging ich an diesem Morgen direkt ins Büro, machte mir einen heißen Kakao und breitete alles um mich herum aus, was Funda und ich aus Schettlers Haus und seinem Briefkasten mitgenommen hatten. Die Rechnungen des Krankenhauses, in dem er gestorben war, würde ich später prüfen und in den nächsten Tagen die fälligen Beträge überweisen.
Noch einmal las ich die mit Ausrufezeichen gespickten Instruktionen für das Leeren des Bankschließfaches, ohne jedoch auch nur einen Deut schlauer daraus zu werden. Um was es bei dieser verjährten Schuld gegangen war und in wessen Blut der Mörder angeblich seine Hände getaucht hatte, blieb unklar. Auch in Schettlers Dokumenten fand ich keinen einzigen Hinweis.
Ich holte mir das Bild des Fahrradfahrers, der mir die Unterlagen gestohlen hatte, vor mein inneres Auge. Er war sehr schlank gewesen und durchtrainiert. Und ich war mir nach wie vor sicher, dass es sich um einen Mann gehandelt hatte. Auf der Polizei war ich gefragt worden, ob ich sein Alter schätzen konnte. Spontan hatte ich gesagt, dass es sich um einen jüngeren Mann handeln musste, aber es gab auch ältere Männer mit sehr sportlichen Bewegungsabläufen. Sein Fahrrad hatte schmale Reifen gehabt und mich an die schnellen Räder der Stadtkuriere erinnert. All das brachte mich jedoch im Moment nicht weiter.
Der Dieb musste mich bis zur Bank verfolgt haben, ohne dass ich etwas davon bemerkt hatte. Und er musste irgendwie an die Unterlagen gekommen sein, die sich jetzt in den Umschlägen befanden. Entweder, er hatte sie aus der Papiertonne geklaubt, falls Albert Schettler sie dort hineingeworfen hatte. Oder aber, er hatte sie direkt von ihm bekommen oder im Haus gestohlen. Vielleicht würde mir Peter Siebert etwas über die Kontakte des Verstorbenen erzählen können. Ich sah auf die Uhr, es war erst kurz nach sechs, zu früh, um Menschen ohne Schlafstörungen anzurufen.
Während sich vor dem Fenster ein sonniger, wolkenloser Tag ankündigte, durchsuchte ich Schettlers Dokumente nach Hinweisen auf seine Erkrankung. Er war privat versichert gewesen, hatte seiner Krankenkasse also die Arztrechnungen einreichen müssen. Ordentlich, wie er gewesen war, hatte er alle Unterlagen aufbewahrt. Die Tatsache, dass es nicht viele waren, zeugte davon, dass er Ärzte eher gemieden hatte, denn krank war er zweifellos gewesen.
Der Frage, was es mit seinen Wahnvorstellungen auf sich hatte, kam ich durch die Kopie eines Arztbriefes näher. Der Brief war zwölf Jahre alt und stammte von einem Münchner Psychiater. Unter Diagnose stand AWS. Ich gab den Namen des Arztes in eine Suchmaschine ein und erfuhr durch ein paar Klicks, dass er seine Praxis vor drei Jahren aufgegeben hatte. Einen Nachfolger gab es allem Anschein nach nicht. Seine private Adresse war nirgends vermerkt. Den Unterlagen nach zu schließen, war er der einzige Psychiater gewesen, den Schettler konsultiert hatte.
Anschließend tippte ich AWS in die Suchmaske ein und bekam eine Vorstellung von dem, was den Verstorbenen über Jahre geplagt haben musste. Hinter AWS verbarg sich, so erfuhr ich, eine anhaltende wahnhafte Störung, früher Paranoia genannt und klar abzugrenzen gegenüber einer Schizophrenie, die mit der AWS nur den Wahn gemeinsam habe. Wobei der schizophrene Wahn sehr viel bizarrer sei als der im Rahmen einer AWS. Das Charakteristische dieser Erkrankung sei zum einen der (manchmal ein Leben) lang anhaltende Wahn, zum Beispiel Eifersuchts-, Verfolgungs- oder Liebeswahn. Der Betroffene fühle sich betrogen, verfolgt, verleumdet, vergiftet, ausspioniert oder fürchte um sein Leben – und dies ohne reale Ursache. Theoretisch sei das, was sich der Betroffene einbilde, in der Realität aber möglich und vorstellbar. Während das Wahnthema bei einer Schizophrenie zu bizarr sei, um es zu verstehen, sei es bei einem Menschen mit AWS durchaus nachvollziehbar. Als Beispiele wurden hier Aktivitäten von Außerirdischen denen von Geheimdienst und Mafia gegenübergestellt. Es sei allerdings schon vorgekommen, dass reale Bedrohungen als Wahnvorstellung abgetan worden waren.
Da die intellektuellen Fähigkeiten von Menschen mit AWS nicht eingeschränkt seien, würden sie häufig relativ unauffällig ihrem Beruf nachgehen können. Gravierender seien die Auswirkungen auf partnerschaftlicher, familiärer oder auch nachbarschaftlicher Ebene. Durch nachlassende Lebensfreude und eingeschränkte zwischenmenschliche Beziehungen würde mancher Weg in die Isolation führen. Als problematisch für eine Behandlung wurde die üblicherweise fehlende Krankheitseinsicht der Betroffenen genannt.
Über die Ursachen von AWS war noch wenig bekannt. An einigen Stellen las ich von einem möglichen Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen. Aber auch da war man sich nicht sicher.
Ich ließ mir all das durch den Kopf gehen und glich es mit dem Wenigen ab, was ich bisher über Albert Schettler wusste. Keine Frage, um welche Art des Wahns es sich bei ihm gehandelt haben musste. Die Sicherungsmaßnahmen in seinem Haus erzählten ausführlich von seinen Verfolgungsängsten. Aber da war etwas, über das ich beim ersten Lesen hinweggegangen war. Es sei vorgekommen, dass reale Bedrohungen als Wahn abgetan worden waren, las ich noch einmal. Was, wenn genau das bei Albert Schettler der Fall gewesen war? Während ich über diese Frage nachdachte, wurde mir bewusst, dass ich selbst in diese Falle getappt war. Anstatt seine Instruktionen ernst zu nehmen, hatte ich sie unter Verfolgungswahn verbucht.
Um kurz nach sieben griff ich zum Telefon. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme meldete. »Siebert«, hörte ich ihn verschlafen murmeln.
»Kristina Mahlo«, meldete ich mich. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie so früh störe, ich wollte Sie in jedem Fall noch erreichen, bevor Sie zur Arbeit fahren.«
»Was gibt es denn so Dringendes?«
»Können Sie mir etwas über Albert Schettlers Kontakte sagen? Wer ihn besuchte, wer anrief, mit wem er sich traf?«
»Deswegen rufen Sie mich mitten in der Nacht an? Hätte das nicht auch noch ein paar Stunden Zeit gehabt?«
»Sie haben gesagt, dass Sie während Ihrer Arbeitszeit Ihr Handy meist ausgeschaltet haben. Und da ich nicht weiß, wann Sie in Ihrer Agentur morgens beginnen …«
»Nicht vor neun«, unterbrach er mich pampig. »Und Kontakte hatte Albert keine.«
»Es ist nie jemand vorbeigekommen?«
»Nicht, während ich bei ihm gewohnt habe. Und davor war es vermutlich auch nicht anders.« Er klang immer noch ungehalten, was ich ihm in Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn geweckt hatte, nicht verübeln konnte.
»Wissen Sie, ob außer Ihnen noch jemand einen Schlüssel zum Haus hat, vielleicht jemand aus der Nachbarschaft oder eine Putzhilfe?«
»Ein Schlüssel in fremden Händen wäre für Albert der reinste Horror gewesen. Und geputzt hat er selber. War’s das dann, Frau Mahlo? Ich brauche jetzt einen Kaffee.«
»Eine Frage habe ich noch. Beim Durchforsten von Herrn Schettlers Adressbuch ist mir aufgefallen, dass Ihr Vater darin nicht vermerkt ist. Hat er vielleicht einen anderen Familiennamen als Sie?«
»Mein Vater trägt denselben Familiennamen wie ich, in Alberts Adressbuch werden Sie ihn jedoch nicht finden«, antwortete Siebert genervt. »Das Ding ist eine Finte. Albert war sehr stolz darauf, dass er alle möglichen Namen, Adressen und Telefonnummern im Kopf hatte. Das Adressbuch hat er ausschließlich für seine Verfolger geschrieben. Um sie auf falsche Fährten zu locken, sollte er doch einmal bei einem seiner Freunde untertauchen müssen. Eines habe ich in der kurzen Zeit mit Albert gelernt: Jemand, der unter Verfolgungswahn leidet, kommt auf überaus kreative Ideen, um seinen Verfolgern zu entgehen.«
»Apropos Verfolger – hat Herr Schettler Ihnen eigentlich irgendetwas über die Unterlagen in seinem Bankschließfach verraten oder zumindest angedeutet?«
»Nein, er hat ein großes Geheimnis daraus gemacht und behauptet, das sei zu meinem Schutz. Würde er mich einweihen, sei auch mein Leben in Gefahr. Er war ein bemitleidenswerter Kerl, Frau Mahlo, und ich glaube, dass der Tod eine Erlösung für ihn war.«
Es klang paradox in meinen Ohren, dass der Tod als Erlösung zu jemandem gekommen sein sollte, der ihn so sehr gefürchtet hatte. »Sie erinnern sich doch sicher noch, was Herr Schettler in seinen Instruktionen geschrieben hatte. Als ich gestern mit den Unterlagen aus der Bank kam, wurden sie mir gestohlen, genau, wie er es prophezeit hatte. Ich hätte auf ihn hören und eine Kopie am Körper tragen sollen.«
»Nicht Ihr Ernst, oder?« Seine Stimme klang unentschieden zwischen Lachen und Unglauben. »Und jetzt vermuten Sie, dass es jemand ausgerechnet darauf abgesehen hatte? Allein die Wahrscheinlichkeit spricht doch für einen Zufall.«
»Mir reicht es nicht, mich an Wahrscheinlichkeiten auszurichten.«
»Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber ich stelle mir gerade vor, wie der Dieb sich über Alberts Unterlagen hermacht und dann begreift, woraus seine Beute besteht.«
»Ich wünschte, ich könnte mich Ihrer Überzeugung anschließen.«
»Vielleicht können Sie es nur deshalb nicht, weil Sie Alberts Instruktionen nicht ernst genommen und eine der Kopien am Körper getragen haben. Das hätte aber auch kein anderer getan. Niemand hätte Albert in dieser Hinsicht für voll genommen. Das hätte nämlich bedeutet, auch all die anderen Auswüchse seines Wahns ernst nehmen zu müssen. Am besten machen Sie einen Haken dahinter. Ach, und fast hätte ich es vergessen: Mein Mietvertrag ist angekommen. Ich werde hier gleich zusammenpacken und meine Zelte abbrechen. Das war die letzte Nacht, die ich hinter Gittern verbracht habe.« Er klang erleichtert. »Kann ich den Hausschlüssel einfach in der Küche liegen lassen?«
»Kein Problem, ich komme mittags ins Haus und schließe dann ab. Ich rufe Sie an, sollte ich noch Fragen haben.«
Drei Stunden später inspizierte ich gemeinsam mit Funda ein zweites Mal die Jugendstilvilla und leistete Peter Siebert in Gedanken Abbitte. Alles war so, wie wir es fotografiert hatten, er hatte nichts mitgehen lassen. Das Zimmer, das er unterm Dach bewohnt hatte, war aufgeräumt und das Bett abgezogen. Bezüge und Handtücher fand ich fertig geschleudert in der Waschmaschine. Auch die Küche sah picobello aus, Siebert hatte alles abgespült und zurück in die Geschirrschränke gestellt. Seine Schludrigkeit bezog sich ganz offensichtlich nur auf sein eigenes Erscheinungsbild.
»Nun ist ja doch noch alles gut ausgegangen«, sagte Funda, nachdem sie das Inventar mit den Fotos auf ihrem iPhone verglichen hatte. »Und er ist sogar früher raus als gedacht. An seiner Stelle hätte ich hier aber auch keine Minute länger als nötig verbracht. Ist schon irgendwie gruselig, findest du nicht?«
»Das liegt nur an den Gittern.«
»Vergiss bitte nicht die Beobachtungsprotokolle. Die Nachbarn können sich glücklich schätzen, dass sie nichts davon wissen. Sollten wir die nicht mal als Erstes wegschaffen?«
»Wenn wir es genau nehmen, gehören auch die Protokolle den Erben«, hörte ich mich sagen und dachte dabei an all die Schätze, die sich in meiner Bettschublade verbargen und mir durch schlaflose Nächte hindurchhalfen.
»So genau wirst du es aber in dem Fall hoffentlich nicht nehmen, Kris, oder?« Fundas Oder klang wie eine Kampfansage.
Ich musste lachen. »In diesem Fall setzen wir uns selbstverständlich darüber hinweg und feilen ein wenig am Andenken des Toten. Es reicht, wenn die Nachbarn ihn als Sonderling in Erinnerung behalten.«
3 Dank Albert Schettlers spärlicher Möblierung hatten wir zwei Stunden später den Inhalt jeder Schublade und jedes Schranks unter die Lupe genommen. Wertsachen förderten wir dabei so gut wie keine zutage. Unsere Ausbeute an Beobachtungsprotokollen, Tagebüchern sowie kommentierten Zeitungsartikeln über Kriminalitäts- und Psychiatrieopfer füllten hingegen fünf Wäschekörbe bis zum Rand. Funda schlug vor, alles auf dem Recyclinghof im Papiercontainer verschwinden zu lassen, aber etwas in mir sträubte sich dagegen. Vielleicht ließen sich darin doch noch verwertbare Hinweise finden. Deshalb beschloss ich, das Material vorübergehend in meinem Büro aufzubewahren.
Um kurz nach eins drehten wir eine letzte Runde durchs Haus. In Schettlers Arbeitszimmer blieb Funda stehen und wunderte sich einmal mehr darüber, wie der Verstorbene ohne Handy, PC und Fernseher ausgekommen war. Und das auch noch freiwillig. Kopfschüttelnd griff sie nach den Staubkörnchen, die im Sonnenlicht tanzten.
Ganz so freiwillig würde es nicht gewesen sein, dachte ich. Sein Verfolgungswahn würde die alles beherrschende Maxime gewesen sein. Einen bemitleidenswerten Kerl hatte Peter Siebert ihn genannt. Ich schloss mich seiner Meinung an. Nicht etwa, weil ich glaubte, dass man nicht ohne Fernseher leben konnte. Meiner war seit ewigen Zeiten defekt, und ich hatte es immer noch nicht geschafft, ihn reparieren zu lassen. Aber ich konnte mich frei entscheiden und war kein Opfer meiner Angst.