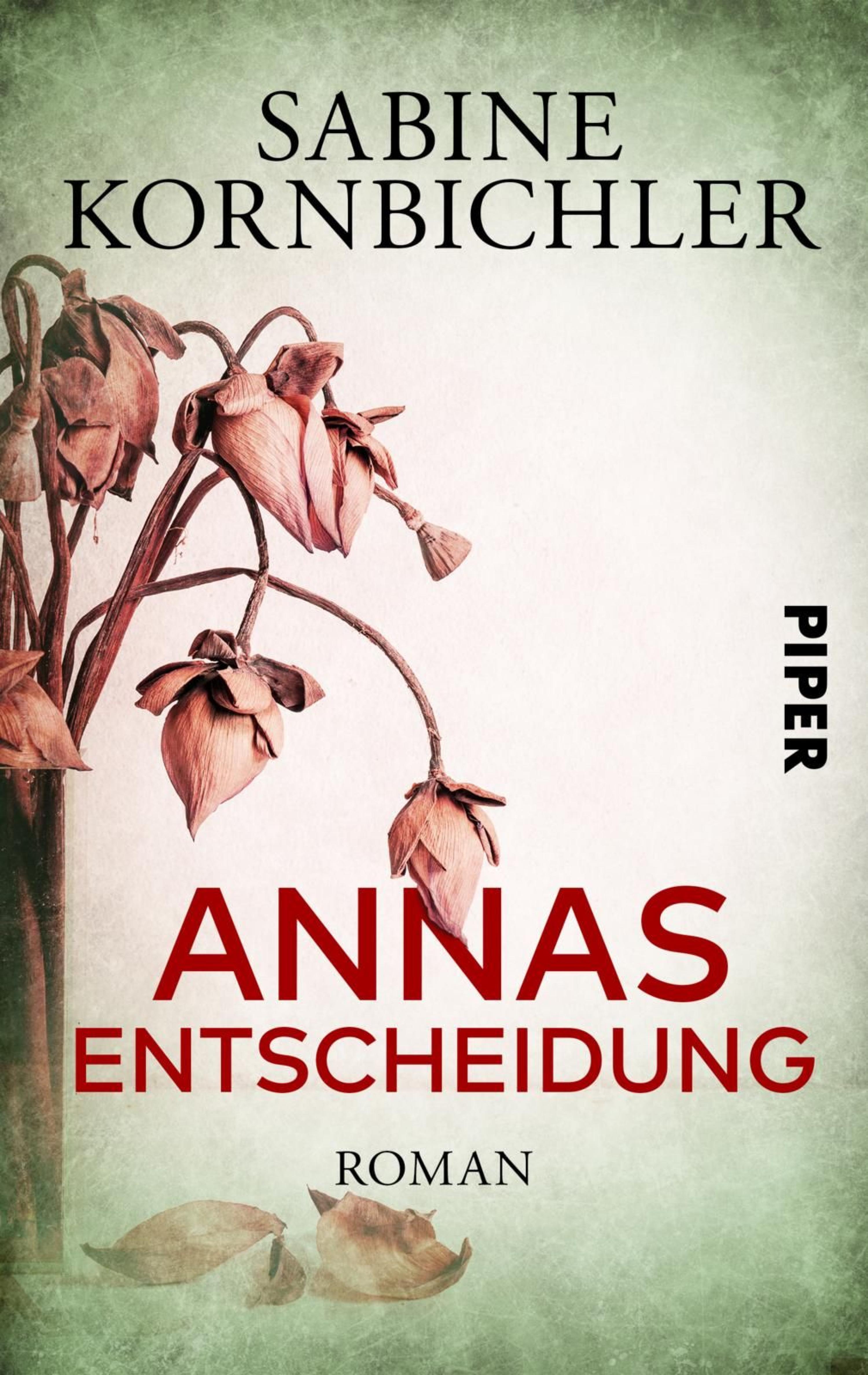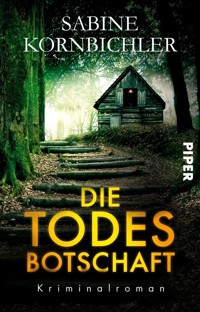
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mann stirbt bei einem Verkehrsunfall, eine Bergsteigerin verunglückt, und eine Frau wird von einem Einbrecher überrascht und getötet – auf den ersten Blick drei Todesfälle ohne Zusammenhang. Doch nicht für die junge Künstlerin Finja, denn sie ist mit allen Opfern befreundet oder auf die eine oder andere Weise verwandt. Sie reist aus Berlin in ihre Heimat am Tegernsee und stellt entsetzt fest, dass jemand die vermeintlichen Unfälle in Todesanzeigen angekündigt hatte. Eine gefährliche Entdeckung, die Finja ins Visier von Menschen rückt, denen Geld und Macht über alles gehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Für Anke Vogel
© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Yolande de Kort/Trevillion Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prolog
Wir werden Ihnen helfen, die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Damit Sie irgendwann aufhören können, sich in Träume zu flüchten. Ganz kleine Schritte genügen. Jeder davon wird ein großer Erfolg sein. Sie haben Zeit. Innerhalb dieser Mauern drängt Sie niemand. Hier sind Sie geschützt. Und Sie geben das Tempo vor.«
Gesa versuchte, sich durch den Nebel zu kämpfen, um Doktor Radolf klar sehen zu können. Sein Gesicht hob sich vom Weiß des Kittels ab. Es war ein freundliches Gesicht, eines, dem selbst die Schatten unter den Augen nichts von seiner Helligkeit nehmen konnten. Sie versuchte, sein Alter zu schätzen. Wenn es ihr gelang, war das doch ein Zeichen, oder? Ein Zeichen dafür, dass ihr Kopf wieder funktionierte. Sie strengte sich an, damit ihr nichts entging, nicht die kleinste Falte, die ihr einen Hinweis liefern konnte. Schließlich atmete sie mit einem leisen Stöhnen aus und wagte sich an eine Einschätzung. Ihr Arzt sah älter aus als Alexander. War er vierzig? Oder doch eher fünfundvierzig? Gesa traute sich nicht, ihn zu fragen. Sie musste richtigliegen, ihm beweisen, dass es ihr besserging. Sie durfte es nicht verderben.
»Worüber möchten Sie heute sprechen, Gesa?« Seine Stimme war voller Wärme, als gebe es tief in ihm ein unerschöpfliches Kraftwerk.
»Wie erinnert man sich?«, fragte sie.
»Indem man die Angst überwindet. Die Angst vor dem, was geschehen ist.«
Gesa sah auf ihre Nägel, die brüchig geworden waren vom vielen Kauen. Vor dem, was geschehen ist, wiederholte sie seine Worte in Gedanken und sehnte sich das Spiel aus Kindertagen herbei. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Warum konnte er ihr nicht wenigstens einen kleinen Hinweis geben? Dann hätte sie eine Chance. Sie hob den Blick von ihren Fingern und sah an ihm vorbei durch das Fenster in seinem Rücken. Der Wind fuhr in die Blätter der ausladenden Buche. Sie stellte sich vor, wie sie raschelten.
»Gesa?«, holte Doktor Radolf sie in sein Zimmer zurück.
Sie versuchte, aufrecht zu sitzen, sich nicht hängenzu lassen. »Wie überwindet man die Angst?«
»Indem man sich ihr langsam nähert. Auf Umwegen.«
Sie runzelte die Stirn und versuchte, sich einen solchen Umweg auszumalen. Aber es wollte ihr nicht gelingen. Sie hatte noch nie einen Umweg eingeschlagen.
»Manchmal hilft es, einen großen Bogen zu machen, auf einen Hochsitz zu steigen und durch ein Fernglas zu schauen. Vielleicht zeigt sich dann in weiter Ferne die Angst auf einer Lichtung. Man kann sie betrachten, ohne Gefahr zu laufen, von ihr gepackt zu werden.« Er neigte den Kopf ein wenig und betrachtete sie. Sein Blick schien sie einzuladen, ihn auf diesen Ausflug zu begleiten. »Wenn Sie mögen, Gesa, leiste ich Ihnen auf diesem Hochsitz Gesellschaft.«
»Man braucht viel Geduld, um dort zu sitzen und zu warten«, meinte sie leise. »Es könnte sein, dass sich auf der Lichtung nichts bewegt.«
»Vielleicht nicht beim ersten und möglicherweise auch nicht beim zweiten Mal. Aber irgendwann wird sich dort etwas bewegen. Ganz sicher, Gesa.« Sein Lächeln war voller Zuversicht und Wärme.
Sie hätte diese Wärme gerne in jedem Moment gespürt, wäre ihm am liebsten wie ein Schatten durch seinen Tag gefolgt. Solange bis die Schwester ihr die Tablette gab, die sie ins Nichts gleiten ließ. In dieses Nichts, das dem Grübeln für kurze Zeit ein Ende setzte.
1
Unten im Hof hielten die Spatzen ein Palaver ab, als gelte es, einen Lautstärkerekord zu brechen – und das ausgerechnet um Viertel vor sieben am Samstagmorgen. Eigentlich liebte ich diese gefiederten Spitzbuben. Nach einer durchtanzten Nacht wünschte ich mir hingegen nur, der Kater aus dem Erdgeschoss würde sich kurz im Hof blicken lassen. Aber vermutlich lag er faul auf der Fensterbank und erholte sich von seinen nächtlichen Streifzügen.
Genervt schlug ich die Decke zurück und setzte mich auf. Fast augenblicklich begann es, in meinem Kopf zu hämmern. Während ich mich mit einem Stöhnen vorsichtig zurücksinken ließ, bereute ich jeden einzelnen Cocktail, den ich getrunken hatte. Sie hatten fruchtig ausgesehen und auch so geschmeckt. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie viele ich getrunken hatte, gab es jedoch schnell auf. Der Schmerz in meinem Kopf machte selbst simpelste Additionen unmöglich.
Ich ließ ein paar Minuten verstreichen und versuchte dann noch einmal, mich aufzusetzen. Langsamer diesmal. Als meine Füße den Boden berührten, hatte das Hämmern bereits wieder meine Schläfen erreicht. Im Schneckentempo bewegte ich mich durchs Zimmer. Das Knarren der Holzdielen schien so laut wie noch nie, es tat mir in den Ohren weh. Im Flur nahm ich meine Sonnenbrille aus dem Bücherregal und setzte sie auf, bevor ich mich in die lichtdurchflutete Küche wagte, um zwei Kopfschmerztabletten aufzulösen. Mit dem Glas in der Hand schlich ich zurück ins Schlafzimmer, schloss das Fenster und kroch unter die Decke.
In kleinen Schlucken trank ich die nach Orangen schmeckende Flüssigkeit und wünschte mir nichts sehnlicher, als dass sie Turboteilchen enthielt, die mit dem Schmerz kurzen Prozess machten. Während ich noch darüber nachdachte, musste ich eingeschlafen sein, denn als ich das nächste Mal auf den Wecker schaute, war es kurz nach eins. Die Sonnenbrille war von meiner Nase gerutscht und lag neben mir auf dem Kopfkissen. Vorsichtig reckte ich die Arme hinter den Kopf und gähnte. Dann stand ich auf, öffnete die dunkelblauen Vorhänge einen Spalt und blinzelte in den Hochsommerhimmel.
Über Nacht war der Juli in den August übergegangen, und ich hatte beschlossen, mir eine kreative Auszeit zu gönnen, nachdem ich im vergangenen Dreivierteljahr fast ohne Pause gearbeitet hatte. Und das nicht etwa im eigenen Atelier wie viele meiner Künstlerkollegen. Im Gegensatz zu ihnen ging ich zu den Menschen nach Hause oder in ihre Büros und malte meine Motive auf die Innenwände. Diese fremden Wände inspirierten mich weit mehr, als es einer Leinwand je gelingen würde.
Jetzt würde ich mich zwei Monate lang durch die Tage treiben lassen, ohne ihnen eine Struktur oder eine Richtung vorzugeben. Allein die Vorstellung tat gut. Mit ausgebreiteten Armen ließ ich mich zurück aufs Bett fallen. Mein Blick wanderte über die Decke zu den Wänden. Es faszinierte mich, den Einfluss von Licht auf Farben zu studieren. Die Wand am Kopfende meines Bettes war nicht einfach nur dunkelrot, sie hatte viele Nuancen – je nachdem, wie das Licht im Raum beschaffen war. Das Gleiche galt für die gegenüberliegende Wand, die ein früherer Kommilitone von der Kunsthochschule für mich mit einer Unterwasserlandschaft bemalt hatte. Auf dem Meeresgrund, umgeben von Seegras, waren ein alter orangefarbener VW-Käfer zu sehen, ein Eisenbahnwaggon, über und über mit Graffiti bemalt, und ein verrostetes Fahrrad, das an einem Schiffscontainer lehnte. Dazwischen schwammen Fische und Seeschlangen.
Die meisten, denen ich das Bild gezeigt hatte, fanden es bedrückend. Aber das war es nicht nur, denn die Meerestiere wussten, den Müll zu nutzen. Die Mikroorganismen, die sich darauf angesiedelt hatten, dienten als Nahrungsquelle, die Hohlräume als Schutz. Für mich war es Sinnbild für das Überleben unter widrigen Umständen.
Mit einem Gähnen stand ich auf, trottete ins Bad und stellte mich minutenlang unter die Dusche. Erst als der gesamte Raum von heißem Dampf erfüllt und der Spiegel beschlagen war, drehte ich den Temperaturregler in die entgegengesetzte Richtung. Das kalte Wasser vertrieb den letzten Rest von Müdigkeit. Einen Song von Amy Macdonald summend trocknete ich mich ab, zog ein leichtes Sommerkleid an und schlang ein Handtuch um den Kopf.
Schließlich machte ich mir einen Kaffee, öffnete beide Flügel des Küchenfensters und lehnte mich in den Rahmen. Es war völlig windstill an diesem Tag, die Mittagshitze hatte längst den Innenhof erobert und eine Sonnenanbeterin aus dem Vorderhaus angelockt. In einem verwitterten Liegestuhl vor sich hin dösend verscheuchte sie halbherzig eine Fliege. Während ich das Handtuch vom Kopf zog und meine noch feuchten schulterlangen Haare schüttelte, begann mein Magen zu knurren.
Ich schnappte mir Portemonnaie, Flip-Flops und Schlüssel, zog die Wohnungstür hinter mir ins Schloss und lief barfuß die ausgetretenen Holzstufen hinunter. Im Treppenhaus begegnete mir der Student, der seit kurzem über mir wohnte. In jeder Hand einen Bierkasten prophezeite er mir eine ebenso lautstarke wie lange Nacht und meinte, es kämen auch einige seiner Hetero-Freunde, für die eine so hübsche Blondine wie ich sicherlich das Highlight des Abends bedeutete. Ob ich nicht auch kommen wolle? Ich schüttelte den Kopf und antwortete lachend, dass ich als vierunddreißigjährige Dunkelblonde mit braunen Augen nicht unbedingt in dieses Raster passte.
Am Fuß der Treppe schlüpfte ich in die Flip-Flops und lief über den kühlen Steinfußboden, dem die Jahrzehnte so manche Welle abgefordert hatten. Als ich den Hof durchquerte, winkte ich im Vorbeigehen der Sonnenanbeterin zu.
Durch den Flur des Vorderhauses gelangte ich schließlich auf die Straße, die fast menschenleer dalag. Einen Moment lang hielt ich inne und ließ meinen Blick über die Häuserfassaden mit ihren bunt bepflanzten, schmiedeeisernen Balkonen wandern. Es war ein friedlicher Anblick.
Hundert Meter von meinem Haus entfernt bog ich an der Kreuzung nach links, bis ich auf die Bergmannstraße stieß. Diese trubelige Straße mit ihren vielen kleinen Läden, den Straßencafés und der Markthalle hatte es nicht nur mir angetan. Nicht selten bewarben sich vierzig Leute um eine Wohnung. Deshalb empfand ich meine jeden Tag aufs Neue als ein großes Glück. Hinterhaus, vierter Stock ohne Aufzug, zwei Zimmer, eines davon mit einem kleinen Balkon, Küche, Bad, hohe Decken, altes Fischgrätparkett. Und das mitten in Kreuzberg. Mein Vater hatte mir dieses Glück zum Geschenk gemacht – als Vorschuss auf mein Erbe.
Schräg gegenüber der Markthalle ergatterte ich vor dem Barcomi’s einen freien Platz. Ich bestellte Milchkaffee und Muffins und beobachtete die Menschen um mich herum. Einige schienen genau wie ich gerade erst aufgestanden zu sein, andere hatten Einkaufstüten und Kinderwagen abgestellt und gönnten sich eine Pause.
Nachdem ich den ersten Muffin verdrückt hatte, schaltete ich mein Handy ein, um die Nachrichten abzuhören. Am vergangenen Montag hatte mir ein Richard Stahmer auf die Mailbox gesprochen und um Rückruf gebeten. Er sei durch Zufall auf meiner Homepage gelandet, und meine Bilder hätten ihn auf ganz unerwartete Weise gefangen genommen. Sie würden ihn einfach nicht mehr loslassen. Jetzt wolle er mich engagieren, um eine seiner Wände zu bemalen. Ich hatte ihn gleich am nächsten Tag angerufen und ihm gesagt, seine Wand würde sich mindestens ein halbes Jahr lang gedulden müssen, da ich bis ins kommende Jahr hinein ausgebucht sei. Ob ich sein Bild nicht vorziehen könne? Er brauche dringend einen Lichtblick. Ich hatte abgelehnt. Aber so standhaft ich war, als so hartnäckig erwies er sich. Tagtäglich waren weitere Nachrichten von ihm eingetrudelt, die ich jedoch nicht mehr beantwortet hatte. Ob er eine Vorstellung davon hatte, wie häufig Interessenten sich auf genau diese Weise vorzudrängeln versuchten?
Mit seiner neuesten Nachricht erlangte er allerdings eine Alleinstellung. Von sechzehn bis siebzehn Uhr würde er auf der Bank gegenüber dem Eissalon tanne B. an der Markthalle in Kreuzberg sitzen und auf mich warten. Sein Erkennungszeichen sei eine türkisfarbene Sonnenbrille, deren Fassung an die Form eines Schmetterlings erinnere. Wenn ich ein Herz hätte, würde ich ihn nicht unnötig lange in diesem lächerlichen Aufzug dort ausharren lassen.
Von mir aus hätte er im Kostüm eines Zitronenfalters dort sitzen können, ohne mein Mitleid zu erregen. Was mich bewog, trotzdem dorthin zu gehen, war eine Mischung aus Neugier und dem Wunsch, das Gesicht zu dieser klangvollen Stimme zu sehen.
Bereits um kurz vor vier bezog ich Posten vor dem Eissalon, der lediglich aus einer Theke in der Außenmauer der Markthalle und einem Sammelsurium von Stühlen für Groß und Klein bestand. Für meinen Geschmack gab es in ganz Berlin kein besseres Eis als das von tanne B. Ich hatte meine Sonnenbrille aufgesetzt, löffelte Mangoeis aus einem Becher und hörte Coldplay über den iPod. Dabei ließ ich meinen Blick immer wieder unauffällig zu der Bank gegenüber wandern. Bisher saß dort nur eine junge Mutter, die es sichtlich genoss, ihr Eis in Ruhe essen zu können, während ihr Kind im Buggy schlief.
Ich war so versunken in diesen Anblick, dass ich zusammenzuckte und herumfuhr, als mir jemand auf die Schulter tippte. Ich zog die Stöpsel des iPods aus den Ohren und sah den Mann fragend an.
»Würden Sie kurz darauf aufpassen?« Er zeigte auf einen Laptop auf dem Stuhl hinter mir. Ohne meine Antwort abzuwarten, reihte er sich in die Schlange vor der Theke.
Die junge Mutter hatte inzwischen Gesellschaft bekommen. Zwei Teenager hatten sich neben ihr breitgemacht und schienen für nichts anderes Augen zu haben als für ihre Handys. Ich sah auf die Uhr: kurz nach vier – von Richard Stahmer mit Schmetterlingsbrille war weit und breit nichts zu sehen.
»Hier, bitte«, sagte der Laptopbesitzer und hielt mir eine Waffel mit einer Kugel Eis hin. »Cherry Mania, ich hoffe, Sie mögen es.«
Cherry Mania war neben Mango meine Lieblingssorte. Mit einem Lächeln nahm ich die Waffel entgegen und betrachtete den Mann, der sich neben mir niederließ, etwas genauer. Er trug Jeans und T-Shirt, war gut einen Kopf größer als ich, kräftig gebaut und sonnengebräunt. Seine blonden Haare waren streichholzkurz geschnitten, die untere Gesichtshälfte von einem Dreitagebart überzogen und seine Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Leider nicht einmal annäherungsweise in Form eines Schmetterlings.
»Meine Augen sind blau mit bernsteinfarbenen Sprenkeln. Und Ihre?«
»Braun. Ohne Sprenkel.«
»Und was haben Sie da gerade gehört?« Mit dem Eislöffel zeigte er auf den iPod.
»Coldplay. Zufrieden?«
Er lachte. »Erst wenn ich Ihre Telefonnummer bekommen habe.«
Ich ließ einen Moment verstreichen, bevor ich darauf einging. »Wenn ich mich nicht täusche, haben Sie die bereits. Sie sind doch Richard Stahmer, oder etwa nicht?«
Er lehnte sich zurück, legte lachend den Kopf in den Nacken und sah gleich darauf wieder zu mir. »Was hat mich verraten?«
»Ihre Stimme. Genauer gesagt dieser Hauch eines norddeutschen Dialekts.« Ich biss ein Stück von der Waffel ab.
»Und ich dachte, den hätte ich längst abgelegt.«
»Sie dachten auch, ich stünde auf türkisfarbene Schmetterlingsbrillen.«
Er schüttelte den Kopf. »Eigentlich war es eher der Versuch, Sie neugierig zu machen. Und allem Anschein nach ist mir das gelungen.«
»Wie haben Sie mich erkannt?«, fragte ich.
»Das Foto auf Ihrer Homepage.« Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie und sein Kinn auf die gefalteten Hände. »Was muss ich tun, um Sie für meine Wand zu begeistern?«
»Abwarten«, antwortete ich. Das leichte Bedauern, das ich dabei empfand, versuchte ich, aus meinem Tonfall herauszuhalten.
»Das geht nicht. Ein halbes Jahr ist viel zu lang.«
»Und ich habe Zusagen gegeben, die ich erst einmal erfüllen muss. Außerdem habe ich gerade Urlaub.«
»Fahren Sie weg?«
Kaum hatte ich nein gesagt, wusste ich, dass es besser gewesen wäre zu flunkern.
»Wunderbar!« Er setzte sich wieder aufrecht hin. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kommen nächste Woche bei mir vorbei, werfen einen ausgiebigen Blick auf meine Wand und lassen sich von ihr inspirieren.« Anstatt weiterzureden sah er mich an, als habe er die Relativitätstheorie widerlegt und könne deshalb mit Fug und Recht auf meinen Begeisterungssturm zählen. Als der ausblieb, legte er nach. »Oder ich lade Sie am Montag zum Frühstück zu mir ein, Sie bringen ganz unverbindlich Ihre Farben mit und …«
Er stockte. »Sie sind ein harter Brocken, Finja Benthien, habe ich recht?«
Ich nickte.
»Möchten Sie noch ein Eis? Oder soll ich mir tatsächlich so eine Sonnenbrille kaufen, um Ihnen zu beweisen, wie sehr ich mir ein Bild von Ihnen wünsche?«
»Wenn Sie es sich so sehr wünschen, warum können Sie dann nicht darauf warten?«
Während er in den Himmel sah, atmete er tief durch. »Wegen des Lichts. In einem halben Jahr wird es ein völlig anderes sein.«
Konzentriert zeichnete ich mit dem Bleistift Planquadrate auf Richard Stahmers drei Meter fünfzig hohe Esszimmerwand. Diese Einteilungen würden mir später helfen, die Skizze, die er ausgesucht hatte, auf die große Fläche zu übertragen.
Noch in der Eisdiele hatte ich ihm spontan zugesagt. Der Frage, welcher Teufel mich dabei geritten hatte, wollte ich lieber nicht so genau auf den Grund gehen. Im Augenblick zählte nur, dass ich es bisher keine Sekunde lang bereut hatte, meine geplante Auszeit kurzerhand halbiert zu haben. Und das lag sicher nur vordergründig an der Atmosphäre dieses lichtdurchfluteten, minimalistisch eingerichteten Raumes, der Teil einer Kreuzberger Wohnung war – ungefähr einen Kilometer Luftlinie von meiner entfernt.
Dominiert wurde das Zimmer von einem antiken Refektoriumstisch, an dem locker zehn Leute essen konnten. Allerdings hätte Richard Stahmer dann für die Bücher und Zeitschriften, die sich darauf stapelten, einen anderen Platz finden müssen.
Bevor ich mit meiner Arbeit begonnen hatte, hatte ich einen schnellen Blick auf die Bücher geworfen, eine bunte Mischung aus Klassikern, zeitgenössischer Literatur, Bildbänden und Kunstausstellungskatalogen. Er hatte meinen Blick bemerkt und mir erklärt, seine Bücherregale im Arbeitszimmer würden aus allen Nähten platzen und der Tisch diene quasi als Ausweichquartier, bis er ein neues Regal angeschafft habe.
Während ich auf der Leiter balancierend Linien mit dem Bleistift zog, saß mein neuer Auftraggeber auf einem Stuhl, den er sich ans Fenster gezogen hatte, und sah mir von dort aus zu.
»Warum haben Sie sich ausgerechnet für diese Skizze entschieden?« Diese Frage stellte ich jedem, der sich aus meiner Skizzenmappe ein Motiv auswählte. In seinem Fall interessierte mich die Antwort ganz besonders.
»Weil es einen mit den eigenen voyeuristischen Anteilen konfrontiert«, antwortete er nach kurzem Zögern.
Richard Stahmer hatte es die makellose Fassade eines Jahrhundertwendehauses mit seinen neun Fenstern angetan. Eines davon war mit dunklen Gardinen verhangen und verwehrte dem Betrachter den Blick in das dahinterliegende Zimmer. In alle anderen Fenster konnte man mehr oder weniger gut hineinsehen. Manche Räume waren bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet, andere lagen im Dämmerlicht. Nicht immer waren es die Bewohner, die ihre Geschichten erzählten, manchmal waren es einfach nur die Möbel, die eine einsame, beängstigende oder in Routine erstarrte Welt zeigten. Anblicke, die den Betrachter wie elektrisiert zurückweichen ließen, oder bei denen er sich wünschte, in das Bild hineinkriechen zu können und sich dort für immer einzurichten.
Richard Stahmer hatte die Skizze zur Hand genommen und betrachtete sie. »Ich glaube, jeder Mensch, der abends im Dunkeln durch die Straßen läuft, wirft gerne einen Blick in die erleuchteten Fenster. Sie haben etwas Anheimelndes, zumindest geht es mir immer so. Gleichzeitig frage ich mich bei solchen Gelegenheiten, wo die Grenze zum Voyeurismus verläuft.«
»Vielleicht an dem Punkt, an dem man stehen bleibt, um genauer hinzusehen.«
Er stand auf, öffnete die Balkontür und setzte sich wieder. »Was hat Sie zu diesem Motiv inspiriert?«
»Das Thema Voyeurismus auf der einen Seite. Auf der anderen die Überzeugung, dass sich hinter einer schönen Fassade so ziemlich alles verbergen kann – von der heilen Welt bis zur Hölle.«
»Gibt es überhaupt so etwas wie eine heile Welt?« Richard Stahmer neigte den Kopf zur Seite und sah mich skeptisch an.
Ich setzte mich auf die oberste Stufe der Leiter. »Heil im Sinne von ungetrübt sicher nicht. Aber heil im Sinne von ausgeglichen ganz bestimmt.«
»Wenn sich die guten und die schwierigen Phasen die Waage halten«, meinte er mit einem Lächeln.
»Das ist eine Menge, finden Sie nicht?«
Er sah mich an und ließ sich Zeit mit seiner nächsten Frage. »Wie alt sind Sie?«
»Vierunddreißig«, antwortete ich. »Und Sie?«
»Neununddreißig. Hält sich die Waage bei Ihnen im Gleichgewicht?«
»Ich glaube schon.«
»Warum sind Sie dann Künstlerin geworden? Heißt es nicht, der Weg in die Kunst beschreibe einen Selbstheilungsversuch?«
Ich musste lachen. »Mein Weg in die Kunst beschreibt eher einen Durchsetzungsprozess. Meine Eltern waren damals nicht gerade begeistert von meinen Plänen. Sie hätten es lieber gesehen, wenn ich mich für so etwas Solides wie Jura interessiert hätte. Zum Glück hat meine Schwester diesen Weg eingeschlagen und die Familienehre gerettet.«
»Entschuldigen Sie meine Neugier. Aber als ich Sie gegoogelt habe, bin ich auch immer wieder über den Namen Alexander Benthien gestolpert. Sind Sie zufällig mit ihm verwandt?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»In Ihrer Biographie steht, dass Sie vom Tegernsee stammen. Und über ihn weiß ich, dass er dort wohnt.« Als er meinen irritierten Blick sah, setzte er zu einer Erklärung an. »Ich bin freier Wirtschaftsjournalist und habe vor Jahren einmal etwas über BGS&R geschrieben. Alexander Benthien ist einer der vier Partner dieser Detektei. Ich hätte damals gerne ein Interview mit ihm geführt, es hat sich jedoch leider nicht ergeben. Hin oder her …« Er gestikulierte mit beiden Händen und zog eine Grimasse, als mache er sich über sich selbst lustig. »Da ich immer wieder feststelle, wie klein die Welt ist, dachte ich, es wäre doch durchaus möglich, dass Sie …«
»Er ist mein Vater«, unterbrach ich ihn. »Und er warnt mich immer wieder vor Journalisten.« Ich ersparte ihm die ausführliche Version, die von scheinbar harmlosen Ködern handelte, mit denen Enthüllungsjournalisten angeblich versuchten, an Informationen zu gelangen. Wenn ich meinem Vater Glauben schenkte, war ihnen ausschließlich an skandalträchtigem Material gelegen. Und so etwas werde er keinesfalls unterstützen. Da er jeglichen Kontakt mit diesen Leuten ablehne, sei nicht auszuschließen, dass sie irgendwann versuchen würden, über Familienmitglieder an ihn heranzukommen. Ich hielt das eher für eine berufsbedingte Paranoia.
»Ich bin Wirtschaftsjournalist und kein Enthüllungsjournalist«, betonte Richard Stahmer. »Außerdem gibt es günstigere Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen, als ein Bild in Auftrag zu geben.«
Wieder nahm er meine Skizze zur Hand und betrachtete sie eine Weile, bis er zu mir aufsah. »Was hätten Sie getan, wenn es Ihnen nicht gelungen wäre, sich mit Ihren Bildern durchzusetzen?«
»Ich hätte mich darauf konzentriert, Kunst zu unterrichten. Haben Sie eine Ahnung, wie leicht sich die Kreativität von Kindern zuschütten lässt mit so blödsinnigen Vorgaben, wie nach landläufiger Meinung eine Zitrone auszusehen hat oder ein Esel? Dabei ist es so wichtig, sie experimentieren und ihre eigene Ausdrucksform finden zu lassen.«
»Hat man Ihnen diese Freiheit gelassen?«, fragte er.
Ich musste nicht lange über eine Antwort nachdenken und nickte. »Ja.« Dass es eher aus Desinteresse denn aus Überzeugung geschehen war, verschwieg ich. Meine Eltern hatten mit meinen Ambitionen nichts anzufangen gewusst. Nur Elly, meine Kinderfrau, hatte dafür gesorgt, dass ich alle Utensilien bekam, um malen zu können.
Er stand auf und legte die Skizze auf den Tisch. »Mögen Sie auch einen Kaffee?«
»Gerne.« Als ich ihn gleich darauf in der Küche hantieren hörte, kramte ich eine Zigarette aus meiner Tasche und trat hinaus auf den kleinen Balkon. Während ich den Rauch inhalierte, wanderte mein Blick über die Fassaden des Innenhofes, die bisher noch nicht saniert worden waren und sich dadurch einen morbiden Charme bewahrt hatten. Ich blinzelte gegen die Sonne an, der auch an diesem Vormittag keine einzige Wolke am Himmel Gesellschaft leistete. Es war erst halb elf, aber bereits so warm, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Asphalt auf den Straßen glühte.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Richard Stahmer noch in der Küche war, spiegelte ich mich einen Moment lang in der Scheibe der Balkontür. Ich hatte meine Haare zu Zöpfen geflochten, trug ein weißes Blusentop zu einer schwarzen Caprihose und lilafarbene Ballerinas. Dieses Outfit war das Ergebnis von fast zehnminütiger Unschlüssigkeit. Normalerweise griff ich mir etwas aus dem Schrank und verließ mich darauf, dass es passte. An diesem Morgen hatte jedoch einfach nichts passen wollen. Ich schnitt mir selbst eine Grimasse und fragte mich im selben Moment, worauf die Arbeit bei Richard Stahmer hinauslaufen würde.
»Hier … bitte.«
Ich hatte ihn nicht kommen hören und fühlte mich unsinnigerweise ertappt. Zum Glück wurde ich nicht auch noch rot.
In jeder Hand einen Becher blieb er im Rahmen der Balkontür stehen. Einen Moment lang sah er mich regungslos an, dann kam er zwei Schritte näher und reichte mir einen der Becher.
»Danke.« Ich versuchte, an dem Kaffee zu nippen, aber er war noch zu heiß. »Wie lange wohnen Sie schon hier?«, fragte ich.
»Ewigkeiten.« Er rechnete nach. »Acht Jahre.«
»Unsere Wohnungen sind gar nicht so weit voneinander entfernt«, meinte ich, »und trotzdem sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen.«
Sein Lachen wirkte fröhlich, fast übermütig. »Vielleicht sind wir das und haben es nur nicht bemerkt.«
Ich sah ihm in die Augen. Diese bernsteinfarbenen Sprenkel gab es darin tatsächlich. Und sie hatten die Kraft, mich in ihren Bann zu ziehen. Ich wandte mich ab und gab vor, das Graffiti an einer der Hauswände in Augenschein zu nehmen.
Von einer Sekunde auf die andere wurde er wieder ernst, als er mich fragte, ob ich mir des Risikos bewusst sei, auf das ich mich bei meiner Arbeit einließe.
»Weil ich zu fremden Menschen in ihre Wohnungen gehe?« Ich schüttelte den Kopf. »Bisher hat es nicht einmal den Hauch einer brenzligen Situation gegeben.«
»Das macht das Ganze nicht ungefährlicher.«
»Haben Sie vor, mir etwas anzutun?«
»Womit bekäme ich es dann zu tun? Mit Judo, Pfefferspray oder mit Ihrem Vater?«
Ich nahm einen Schluck Kaffee. »Sie haben die Wahl.«
»Sie beherrschen tatsächlich Judo?«
»Beherrschen ist ein bisschen hoch gegriffen, aber ich kann mich ganz gut selbst verteidigen.« Da es mir in der Sonne zu heiß wurde, schlug ich vor, wieder hineinzugehen. Während ich mir einen der Esszimmerstühle heranzog, stapelte er ein paar Bildbände aufeinander und setzte sich auf die frei gewordene Fläche auf dem Esstisch.
»Hätte ich mir eigentlich auch denken können«, meinte er, während er wie ein Kind die Beine baumeln ließ und an mir vorbeisah, als müsse er seine Gedanken ordnen. »Wissen Sie, was ich mich schon damals gefragt habe, als ich über BGS&R geschrieben habe, und was ich Ihren Vater gerne gefragt hätte? Was macht eigentlich einen richtig guten Detektiv aus?«
»Oje«, seufzte ich. »Das lässt sich nicht mit zwei Sätzen beantworten.« Ich stellte den Kaffeebecher in eine Lücke zwischen zwei Bücherstapel und richtete meinen Blick nach innen.
»Ein guter Detektiv sollte eine hohe soziale Kompetenz besitzen. Und er muss ein wirklich guter Schauspieler sein, um sich in jedem sozialen Gefüge selbstverständlich bewegen zu können.«
»Sie meinen, er muss den Mitarbeiter aus der Poststelle genauso gut mimen können wie den Geschäftsmann auf dem Golfplatz?«
Ich nickte. »Haben Sie eine Vorstellung davon, wie schnell jemand als Fremdkörper auffällt, wenn er ein bestimmtes Umfeld nicht absolut verinnerlicht hat und es nach außen verkörpert? Menschen haben gute Sensoren dafür, wenn etwas nicht stimmt. Ganz besonders, wenn sie misstrauisch sind. Dann überprüfen sie nämlich auch gerne mal die Legende, die ihnen ein Detektiv auftischt.«
»Das heißt, wenn er da nicht akribisch ist und das Ganze bis ins letzte Detail durchdacht hat, fliegt er auf.« Richard Stahmer schnippte mit den Fingern und sah einem imaginären Etwas hinterher, das sich in Staub aufgelöst zu haben schien. »Ich vermute mal, es gehört auch ein gutes psychologisches Gespür dazu.«
»Wenn nötig, muss so jemand ein Vertrauensverhältnis zu dem Menschen aufbauen, den er ausspionieren soll. Da geht es dann nicht zuletzt darum, dessen wunden Punkt herauszufinden. Angeblich vergessen Menschen, wenn man diesen Punkt berührt, ihre Vorsicht und tappen in Fallen.« In einem Anflug von Frösteln zog ich die Schultern hoch. Ich fragte mich, wie leicht ich über meine wunden Punkte zu manipulieren war. »Na ja, so viel dazu. Und dann gibt es da natürlich noch das weite Feld der Observationen und Recherchen im Hintergrund.«
»Tun sich Ihr Vater und seine Partner eigentlich schwer mit dem Ruf dieser Branche? Ich meine, da tummeln sich jede Menge schwarzer Schafe, die sich keinen Deut um Gesetze scheren und die davon überzeugt sind, dass Moral etwas sei, das der Auftraggeber zu verantworten habe. Ihre Aufgabe sei es lediglich, Kriminelle zu überführen – Betrüger, Diebe, Wirtschaftsspione, Schwarzarbeiter.«
»Schwarze Schafe finden Sie überall. In Ihrem Metier ist das sicher nicht anders. Mein Vater ist Realist, und als solcher ist er sich bewusst, womit Kollegen in der Branche zum Teil ihr Geld verdienen. Aber ihm und seinen Partnern ist es gelungen, die Schatten, die so etwas wirft, von BGS&R fernzuhalten. Die Detektei genießt einen hervorragenden Ruf«, sagte ich mit unverhohlenem Stolz in der Stimme, während ich mit dem Zeigefinger über den Rand eines Ausstellungskatalogs strich. »Was beweist, dass sich auch mit einer weißen Weste Geld verdienen lässt.«
Er hob die Augenbrauen. »Viel Geld?«
Ich hätte nicht sagen können, wie er das machte, aber er brachte mich mit einer Frage zum Lachen, mit der andere mich in die Flucht getrieben hätten. Vielleicht lag es daran, dass ich dahinter ganz andere Fragen vermutete. Solche, auf die ich gerne eine Antwort gefunden hätte. Ich schmunzelte. »Viel Geld.«
Richard Stahmer forschte in meinem Gesicht, als versuche er, unter hunderten imaginärer Sommersprossen eine ganz bestimmte zu finden. »Und da hat es Sie nicht gereizt, in seine Fußstapfen zu treten?«
Ich hielt seinem Blick stand und schüttelte den Kopf. »Ich finde es viel spannender, eigene Spuren zu hinterlassen.«
Er sah auf seine Füße. Einen Augenblick lang schien er völlig in ihren Anblick versunken zu sein. »In Ihrer Wohnung … haben Sie da die Wände auch selbst bemalt?«
»Das wäre langweilig. Ich habe einen ehemaligen Kommilitonen gebeten, sich auf einer meiner Wände zu verewigen.«
»Und teilen Sie Ihre Wände mit jemandem?« Die Frage klang ganz beiläufig. Er sah mich dabei nicht an. Als ich nicht antwortete, löste er den Blick von seinen Schuhen. »Die Frage war zu persönlich, verstehe.« Er legte eine Hand aufs Herz und machte eine winzige Verbeugung, als wolle er um Entschuldigung bitten. Dann neigte er den Kopf und grinste. »Es hilft nichts. Vielleicht ist es eine Berufskrankheit, mag sein, aber ich bin einfach neugierig. Leben Sie allein?«
»Und Sie?«
Er atmete hörbar aus. »Wie gut, dass wir das geklärt haben. Haben Sie eine Idee, wie es jetzt weitergeht?«
Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl herum. Schließlich stand ich auf. »Mir ist klar, dass dies der völlig falsche Moment ist, aber …« Ich schluckte. »Ich muss mal.«
»Das hast du tatsächlich gesagt?«, fragte meine Freundin wenige Stunden später, während sie sich mit einem Fächer Luft zufächelte. »Ich muss mal??« Eva-Marias Augen waren hinter einer Sonnenbrille verborgen, das Zucken ihrer Lippen sprach jedoch Bände.
Wir saßen im Schatten eines Baumes in einer kleinen, verborgenen Bucht an der Krummen Lanke. Das Ufer des Sees war an diesem heißen Spätnachmittag immer noch so stark frequentiert, dass unser abgeschiedener Platz einem Glücksfall gleichkam. Das laute Stimmengewirr hielt sich hier im Hintergrund. Als Eva-Maria einen glucksenden Laut von sich gab, war es um mich geschehen, und ich prustete los.
»Wie hat er reagiert?«, fragte sie, als wir uns beide wieder gefangen hatten.
»Na wie wohl? Er hat mir den Weg beschrieben. Als ich von der Toilette zurückkam, hat er zum Glück telefoniert.« Mit vorsichtigen Bewegungen vertrieb ich eine Wespe, die vor meinem Gesicht herumschwirrte. »Irgendwie ist mir dieser Mann ein Rätsel. Zeitweise hatte ich das Gefühl, er flirtet mit mir. Und dann wieder wirkte er eher verschlossen.«
»Vielleicht hat ihn sein Interesse an dir selbst überrascht. Sollte er eine Freundin haben, würde das sein zwiespältiges Verhalten erklären.«
Ich zog die Knie an und legte das Kinn darauf. »So etwas ist mir lange nicht mehr passiert«, meinte ich versonnen. »Er hat irgendetwas, das mich …«
»Anmacht?«
»Das auch«, antwortete ich lachend.
Eva-Maria ließ sich auf ihre Decke zurückfallen und streckte die Beine aus. »Beneidenswert.« Ihr Seufzer sprach Bände. Ihre letzte Beziehung lag zwei Jahre zurück.
Meine war vor einem halben Jahr in die Brüche gegangen, da ich ständig das Gefühl gehabt hatte, das Tempo drosseln zu müssen, während es ihm nicht schnell genug hatte gehen können. Als wir uns trennten, waren wir beide erleichtert gewesen.
Ich verscheuchte diese Erinnerung und betrachtete Eva-Maria. Ihr perlmuttfarbenes Lipgloss passte wunderbar zu den mit Henna gefärbten kurzen Locken und ihrer elfenbeinfarbenen Haut – dem Ergebnis konsequenter Aufenthalte im Schatten. Sie war Mitte vierzig und der festen Überzeugung, in ihrem Alter jedes Sonnenbad mit unzähligen Runzeln bezahlen zu müssen. Außerdem falle es ihr leichter, auf ein Sonnenbad als auf Schokolade zu verzichten. Wenn sie sich schon mit Größe vierzig abfinden müsse, wolle sie dieses Schlankheitsdefizit wenigstens mit vornehmer Blässe ausgleichen. Das war Eva-Marias unverwechselbare Art, mit ihrer Attraktivität zu kokettieren.
Als wir uns vor acht Jahren kennenlernten, gehörte sie längst zu den Gutverdienern unter den Restauratoren, während ich gerade am Anfang meiner künstlerischen Karriere stand. Nachdem sie eines meiner Bilder in einer kleinen Berliner Galerie entdeckt hatte, hatte sie mich angerufen und damit beauftragt, eine Wand ihres Arbeitszimmers zu bemalen. Während meiner mehrwöchigen Arbeit in ihrer Wohnung hatten wir uns angefreundet.
Ich zupfte ein paar Grashalme aus und ließ sie auf meine nackten Füße rieseln. »Weißt du noch, als ich damals das Bild für dich gemalt habe? Du hast mich tagelang beobachtet. Dabei hast du immer so getan, als würdest du dich völlig auf deine Arbeit konzentrieren, hast schnell weggesehen, wenn ich mich umgedreht habe. Irgendetwas an der Art von diesem Richard Stahmer hat mich heute daran erinnert.«
Sie setzte sich auf und zog die Brauen zusammen, so dass über der Nasenwurzel eine Falte entstand.
»Nein, nicht was du jetzt denkst«, winkte ich ab. »Der hat mich nicht heimlich beobachtet. Das war schon alles ganz offen. Aber genau wie bei dir hatte ich das Gefühl, dass er etwas über mich herausfinden wollte.«
»Ich wollte damals einfach wissen, wen ich da in meine vier Wände lasse. Ich kannte dich schließlich nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur vorsichtig.«
Unschlüssig hob ich die Schultern und ließ sie wieder fallen. »Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihm darum ging. Er machte sich eher Sorgen um mich. Er meinte, ich würde bei meiner Arbeit ein ziemliches Risiko eingehen.«
»Das tust du ja auch. Wenn du dich wenigstens vorher über die Leute informieren würdest.«
»Etwa mit Hilfe von Google?«, fragte ich spöttisch. Eva-Maria verabscheute dieses Unternehmen und bezeichnete es als gefährlichen Datenkraken.
Aber sie ließ sich nicht provozieren, ihr Ton blieb völlig gelassen. »Es gibt genügend Suchmaschinen, die nicht alles über dich speichern, was ihnen in die Finger gerät, und die aus deinen Suchbefehlen kein Profil anlegen, bei dem dir gelinde gesagt Hören und Sehen vergehen würde, wenn du es denn überhaupt jemals zu Gesicht bekämst.«
Bei diesem Thema drifteten unsere Meinungen regelmäßig auseinander. »Die Menschen haben die Wahl. Du bist doch das beste Beispiel dafür, dass man sich all dem verweigern kann, wenn einem daran gelegen ist. Wenn ich Eva-Maria Toberg in eine Suchmaschine eingebe, erfahre ich lediglich, dass du fünfundvierzig bist, in Berlin lebst und dir als Restauratorin alter Meister einen Namen gemacht hast. Es existiert nicht einmal ein Foto von dir im Netz.«
»Gut so«, meinte sie zufrieden. »Ich glaube, ich werde nie begreifen, wie Leute im Internet ihr Innerstes nach außen kehren und die Überzeugung vertreten, sie hätten schließlich nichts zu verbergen. Dabei geht es gar nicht darum, etwas zu verbergen, sondern darum, etwas zu schützen, nämlich die Privatsphäre.«
»Wenn es nach dir ginge, würde die wie Fort Knox gesichert.«
»Ganz genau«, meinte sie mit einem schelmischen Grinsen, zog die Beine an und stand mit einem Schwung auf den Füßen. »Kommst du mit ins Wasser?«
Ich nickte und folgte ihr zum Seeufer. Während Eva-Maria mit kräftigen Zügen losschwamm, machte ich nur ein paar halbherzige Schwimmzüge, bis ich mich auf den Rücken drehte und aus halb geschlossenen Augen das Getümmel um uns herum betrachtete. An einem Tag wie diesem würde es noch Stunden dauern, bis sich die Wasseroberfläche glättete und Ruhe einkehrte.
Meine Gedanken drifteten zum Tegernsee, an dem ich aufgewachsen war. Von dem Grundstück, auf dem mein Elternhaus stand, führte ein Bootssteg ein gutes Stück in den See hinein. Meine Schwester Amelie und ich hatten mit unseren Freunden ganze Sommer dort verbracht.
Amelie war drei Jahre jünger als ich und seit einem Jahr mit Adrian verheiratet. Sie hatte sozusagen innerhalb der Familie geheiratet, womit ich sie hin und wieder aufzog. Adrian war ein Sohn von Carl Graszhoff, einem der drei Partner meines Vaters. Anstatt sich in die Welt aufzumachen, war Amelie lieber gar nicht erst fortgegangen, sondern hatte in München studiert und dort auch ihren ersten Job angenommen. Ich hingegen hatte direkt nach dem Abitur die Koffer gepackt.
An diesem Morgen hatte Amelie mir eine Mail geschickt, dass sie eine Überraschung für mich habe. Sie wollte mich am Abend anrufen.
»Hey, wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Etwa wieder bei diesem Richard Stahmer?«, fragte Eva-Maria, die Anstalten machte, ans Ufer zurückzuschwimmen.
»Nein, bei Amelie. Ich glaube, sie ist schwanger.«
»Freust du dich nicht?«
»Doch, natürlich, sie hat sich ja nichts sehnlicher gewünscht. Aber irgendwie bin ich immer davon ausgegangen, dass ihre Ehe mit Adrian eher etwas Vorübergehendes ist. Sie ist in dieser Beziehung der Motor, und ich weiß nicht, ob sie sich damit auf Dauer zufriedengeben wird. Adrian kann meinem Vater einfach nicht das Wasser reichen.« Kaum war der Satz heraus, hätte ich mir am liebsten die Hand vor den Mund geschlagen. »Oh Gott, Eva, das war nicht ich, die das gesagt hat, oder?« Wir waren am Ufer angekommen und trockneten uns ab. Ich musste über mich selbst lachen. »Solltest du jemals bereit sein, mich an den Tegernsee zu begleiten, werde ich dir meinen Vater endlich mal vorstellen. Dann wirst du wissen, was ich meine.«
Sie stimmte in mein Lachen ein. »Ich und Berlin verlassen? Vergiss es. Nicht einmal für den großen Alexander Benthien.«
»Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass er nur eins siebzig groß ist?«
»Hast du. Du hast aber auch gesagt, dass das vergessen ist, sobald er den Raum betritt.«
Doktor Radolf stellte immer wieder die gleichen Fragen. Nur waren sie jedes Mal ein wenig anders verpackt. Wenn Gesa das erkannte, atmete sie innerlich auf. Sie nahm es als Beweis, dass Teile ihres Gehirns funktionierten. Und sie begriff, dass ihr Arzt sie keinesfalls zu Antworten drängen wollte. Er nahm sich Zeit für sie. Und er ließ ihr Zeit.
Sie spürte, dass es ihm wichtig war, ihr die Angst zu nehmen und ihr Vertrauen zu gewinnen. In ihren Augen war er wie ein gütiger Vater. Wenn ihr aus Verzweiflung die Tränen übers Gesicht liefen, versicherte er ihr geduldig, dass die Antworten auf seine Fragen nicht verloren seien. Sie schlummerten lediglich unter einer Oberfläche, die sie im Augenblick noch nicht durchdringen konnte. Aber irgendwann würde diese Oberfläche nachgeben und durchlässiger werden. Und dann würden Erinnerungsfetzen auftauchen.
»Wo ist meine Erinnerung jetzt?«, fragte Gesa.
»In Ihrem Unterbewusstsein«, antwortete er mit ruhiger Stimme. »Es hält sie zurück, um Sie zu beschützen.« Sein Lächeln umhüllte sie mit Wärme und mit einer Gewissheit, an der er sie ganz offensichtlich gerne hätte teilhaben lassen. »Ihr Unterbewusstsein ist klug, Gesa. Es weiß, dass es noch zu früh für Sie ist, sich den Tatsachen zu stellen. Für den Moment wären Sie damit vermutlich überfordert. Und damit wäre nichts gewonnen.«
»Aber wenn die Antworten in mir drin sind«, insistierte Gesa ein ums andere Mal, »dann müsste ich doch etwas von ihnen spüren. Wenn das, was geschehen ist, so beängstigend ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, warum fühle ich das nicht wenigstens? Wie einen Traum, den ich nicht mehr greifen kann, von dem ich aber weiß, dass er da war.«
»Sie fühlen ja etwas, Gesa, Sie fühlen die Angst.«
Die Angst vor dem, was sie hierhergebracht hatte. Ja, die spürte sie. In jeder Minute, in jeder Sekunde.
Ihr Arzt lehnte sich zurück, als könne er ihr damit etwas von seiner Gelassenheit abgeben. »Ihr Unterbewusstsein verschont Sie so lange, bis Sie stark genug sind.«
Einen Moment lang ließ sie seine Worte im Raum stehen, bis sie sich an die Frage herantraute, die ihr unter den Nägeln brannte. »Wenn ich stark genug bin, Doktor Radolf, darf ich dann mein Kind wiedersehen?«
Er beugte sich vor und stützte die Unterarme auf dem Tisch ab. »Was fühlen Sie, wenn Sie an Ihr Kind denken, Gesa?« Seine Miene verriet ihr nicht, was er von ihr hören wollte.
Sie knetete ihre Finger, um dem Schmerz in ihrer Brust etwas entgegenzusetzen. »Ich vermisse sie so sehr. Sie ist noch so klein, so verletzlich. Wie soll sie begreifen, dass ich plötzlich nicht mehr für sie da bin? Sie braucht doch ihre Mutter. Können Sie das verstehen?« Sie forschte in seinem Gesicht nach einer Antwort.
»Sorgen Sie sich nicht, Gesa. Ihr Baby befindet sich in guter Obhut. Es wird ihm nichts geschehen.«
Ihr Blick wanderte zum Fenster hinaus. Sie sah die Blätter in den Bäumen. Sie gehörten zu einem anderen Leben. »Haben Sie Kinder, Doktor Radolf?«
Er nickte. »Ich habe einen Sohn.«
2
Es war weit nach Mitternacht, als ich nach Hause kam. Amelie hatte mehrere Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen, alle mit dem gleichen Wortlaut: Ich solle sie in jedem Fall noch zurückrufen, egal, wie spät es sei. Sie müsse mir dringend etwas erzählen. Ihre Stimme klang eher bedrückt, überhaupt nicht so, als sei sie schwanger und würde sich wie verrückt freuen. Also hatte ich mich getäuscht. Der Gedanke versetzte mir einen Stich.
Einen Moment lang war ich versucht, ihre Nummer zu wählen, beschloss dann jedoch, bis zum Morgen zu warten. Amelie und Adrian würden längst schlafen. Um neun Uhr war ich mit Richard Stahmer verabredet, der mich in seine Wohnung lassen würde, um sich dann zu einem Termin aufzumachen. Auch wenn wir uns nur kurz sehen würden, wollte ich ihm ohne Augenringe und Grauschleier auf der Haut gegenübertreten.
Als ich nach einer ausgiebigen Gesichtspflege endlich im Bett lag, ging ich in Gedanken meinen Kleiderschrank durch und versuchte, für den nächsten Morgen eine Vorauswahl zu treffen. Diese Überlegungen waren ähnlich effektiv wie das Schäfchenzählen, ich schlief augenblicklich ein.
Bis mich das Klingeln des Telefons aus dem Tiefschlaf riss. In der nächtlichen Stille hatte es etwas Bedrohliches. Ich setzte mich auf, schaltete das Licht ein und sah auf den Wecker. Zehn nach drei. Der Anrufbeantworter sprang an. »Finja, wo bist du denn nur?«, hörte ich die Stimme meiner Schwester aus dem Nebenzimmer. »Warum meldest du dich nicht?« Amelie weinte ganz offensichtlich.
Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett und lief auf der Suche nach dem Mobilteil ins Wohnzimmer. Mein Blick irrte umher, bis ich es am Boden neben dem Sitzsack entdeckte. »Amelie?«, rief ich in den Hörer.
»Oh, Finja, endlich! Es ist so entsetzlich. Es …« Das Schluchzen hinderte sie daran weiterzusprechen.
Nach diesem Kaltstart machte mein Kreislauf schlapp. Ich ließ mich in den Sitzsack fallen und versuchte, gleichmäßig ein- und auszuatmen und mich gleichzeitig auf die Geräusche zu konzentrieren, die durchs Telefon zu mir drangen. Ich konnte mich nicht erinnern, wann Amelie zuletzt so geweint hatte. »Was ist so entsetzlich?«, fragte ich mit einem bangen Gefühl. Meine Schwester neigte nicht zu Übertreibungen.
»Es geht um Hubert und Cornelia.« Sie schneuzte sich die Nase.
Hubert war Adrians jüngerer Bruder, Cornelia die Mutter der beiden. Trotz der schwülen Hitze, die selbst in der Nacht nicht weichen wollte, überzog eine Gänsehaut meine Arme. »Was ist mit den beiden?«, fragte ich.
»Sie hatten heute Nachmittag einen Unfall. Sie sind beide tot, Finja. Verstehst du? Carl hat uns benachrichtigt. Wir sind gleich zu ihm gefahren. Wenn du ihn im Augenblick sehen könntest, würdest du Adrians Vater nicht wiedererkennen. Er sitzt nur da, hält Fotos der beiden an sich gepresst und starrt vor sich hin. Er sieht aus, als sei alles Leben aus ihm gewichen.« Ihr Schluchzen war in ein leises Wimmern übergegangen.
Etwas in mir weigerte sich zu glauben, dass diese beiden Menschen nicht mehr da sein sollten. Hubert war erst einunddreißig, seine Mutter war im April sechzig geworden. Sie hatte mich zu ihrem Fest eingeladen, aber ich hatte abgesagt. Ich war in der Endphase eines Bildes gewesen und hatte meine Arbeit nicht für mehrere Tage unterbrechen wollen. »Wie ist das nur passiert?«, fragte ich erschüttert.
»Ihr Wagen wurde aus einer Kurve getragen und ist frontal gegen einen Baum geprallt.«
Meiner Phantasie reichten diese paar Stichworte, um in Bruchteilen von Sekunden vor meinem inneren Auge ein beklemmendes Szenario auferstehen zu lassen. Ich sah ein Knäuel aus verformten Blechteilen und zerquetschten Körpern, während der Baum nur ein paar tiefe Kerben abbekommen hatte.
»Finja, bist du noch dran?«, fragte Amelie.
Ich zog die Knie an und senkte den Kopf darauf. »Ja, ich bin noch dran«, antwortete ich tief in Gedanken. Hubert war ein bedachtsamer, fast gemütlicher Fahrer gewesen. So jemand fuhr doch nicht gegen einen Baum. Selbst wenn ihm ein Reifen geplatzt wäre oder die Bremsen versagt hätten, hätte er seinen Wagen ohne größere Schäden zum Stehen bringen können. »Ich begreife das nicht«, sagte ich leise.
»Ein Bauer, der auf dem Feld an der Straße beim Heumachen war, soll einen Wagen gesehen haben, der die beiden rasend schnell überholt und dann geschnitten hat.« Ihrer Stimme war das viele Weinen anzuhören. Sie klang rauh und mitgenommen. »Gleich darauf seien sie gegen den Baum geprallt. Und der Raser habe sich einfach aus dem Staub gemacht.«
»Fahrerflucht?« Ich schloss die Augen. Die Tränen fanden trotzdem ihren Weg.
Einen Moment lang war es völlig still in der Leitung, bis Amelie weitersprach. »Hätte Hubert am Steuer gesessen, hätten die beiden ein solches Manöver vielleicht schadlos überstanden. Aber Cornelia ist gefahren. Hubert hatte wegen des Föhns starke Kopfschmerzen, wollte aber trotzdem unbedingt in München einen Termin wahrnehmen.« Sie stockte. »Cornelia wäre sich selbst untreu geworden, hätte sie ihren Sohn in diesem Zustand ans Steuer gelassen. Du kennst sie, Finja, sie ist … ich meine, sie war …«
Eine der liebevollsten Glucken, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Für ihre Söhne und ihren Mann hätte sie alles getan. Aufopferungsvoll hatte ich sie einmal genannt. Und sie hatte mir geantwortet, diese drei Männer seien ihr ganzes Glück. Sie werde alles tun, damit dieses Glück nicht getrübt werde.
»Steht schon fest, wann die Beerdigung sein wird?«, fragte ich.
»Am Freitag um elf Uhr. Die beiden werden im Familiengrab auf dem Bergfriedhof beigesetzt.« Einen Moment lang war nur ihr Atmen zu hören. »Adrian und ich haben Cornelia und Carl am Samstag besucht und ihnen erzählt, dass sie Großeltern werden. Carl hat rumgebrummelt, das werde ja auch Zeit. Und Cornelia hat gestrahlt und uns abwechselnd abgeküsst. Und einen Tag später ist sie tot und wird ihr Enkelkind nie zu Gesicht bekommen.«
Also hatte ich mich doch nicht getäuscht. Das war es gewesen, was sie mir hatte erzählen wollen, bevor die schlimme Nachricht die freudige überholt hatte. »Es ist der völlig falsche Moment«, sagte ich leise, »aber ich freue mich für dich. Und für Adrian natürlich auch. In welchem Monat bist du?«
»Zwölfte Woche. Ich wollte erst sicher sein, dass es auch bleibt.«
Im Stillen betete ich, dass dieses kleine Wesen ähnlich stabil wie seine Mutter war und es in den nächsten Monaten tatsächlich dort blieb, wo es war.
»Mit dem Baby ist alles in Ordnung«, sagte sie, als hätte ich meine Gedanken laut ausgesprochen. Ein wenig klang der Satz wie eine Beschwörungsformel. »Zur Beerdigung wirst du doch kommen, Finja, oder?«, wechselte Amelie schnell das Thema. »Ich meine, nachdem du an Cornelias Geburtstag schon etwas Besseres vorhattest. Sie hätte sich so gefreut, dich zu sehen.«
Ich musste tief durchatmen und mich beherrschen, um nicht einen Streit vom Zaun zu brechen. Amelie, der Sonnenschein der Familie, konnte hin und wieder Pfeile abschießen, die genau ins Ziel trafen. Sie war nicht bewusst boshaft. Vielmehr lag es daran, dass unsere Mutter sie maßlos verwöhnt und ihr die Zickenallüren nie ausgetrieben hatte. Als sie Adrian heiratete, war mir der Gedanke gekommen, sie wolle einfach nur ihre Beute nicht loslassen, da sie ihn bereits als Kind fest im Griff gehabt hatte. Der Tag, an dem ich das angedeutet hatte, war mir noch gut in Erinnerung. Als Retourkutsche hatte sie mir vorgehalten, ich sei nur eifersüchtig, da ich nicht bei ihm hätte landen können. Aber das sei auch kein Wunder, schließlich habe Adrian ein Faible für selbstbewusste Frauen.
Was die Vorlieben meines Schwagers betraf, hatte Amelie sich getäuscht. Sie waren längst nicht so einseitig, wie sie glaubte. Aber mit meinem Selbstbewusstsein hatte sie richtiggelegen. Es war erst mit den Jahren gewachsen, während sie ihres bereits mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Im Gegensatz zu mir war sie stets die kleine Prinzessin gewesen, die die Augen unserer Mutter zum Leuchten bringen konnte. Mir war das nur bei unserem Vater gelungen. Er hatte keinen Unterschied zwischen seinen Töchtern gemacht. Unsere Mutter hingegen konnte noch immer die Temperatur ihres Blicks in der Geschwindigkeit wechseln, in der sie zwischen ihren Töchtern hin- und hersah.
Lange Zeit war ich mir wie ein Kuckuckskind vorgekommen, wie ein Wesen, das dieser Mutter im wahrsten Sinne des Wortes fremd war. Aber Amelies und mein Spiegelbild hatten solche Überlegungen Lügen gestraft. Wir sahen uns viel zu ähnlich, um aus verschiedenen Nestern zu stammen. Die dunkelblonden Haare hatten wir von unserer Mutter, die braunen Augen von unserem Vater. Außerdem bildeten sich in unseren Wangen die gleichen Grübchen, wenn wir lachten.
Trotz alledem hatte ich immer das Gefühl gehabt, sie würde mich im Grunde ihres Herzens ablehnen und mir dies auf ganz subtile Weise zu verstehen geben – mit materieller Großzügigkeit und einer als Toleranz verpackten Gleichgültigkeit. Wann immer ich ihr das vorgeworfen hatte, war ich auf völliges Unverständnis gestoßen. Ich hätte doch alles bekommen, weit mehr als andere Kinder. Wie ich da überhaupt von mangelnder Zuneigung reden könne?
Ohne meinen Vater und meine Kinderfrau wäre es ziemlich traurig um mich bestellt gewesen. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte ich Amelie für die Liebe, die sie von unserer Mutter im Überfluss bekam, gehasst. Und so hatte ich versucht, ihr an anderer Stelle etwas zu nehmen. Indem ich mit ihren jeweiligen Freunden schlief. Auch mit Adrian. Es war ein Geheimnis, das er nie preisgegeben hatte, und das Hubert, der uns damals erwischt hatte, jetzt mit in sein Grab nehmen würde.
Auch ich hatte geschwiegen. Irgendetwas hatte mich immer davor zurückschrecken lassen, ihr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Ob es nun aus Sorge war, dadurch könne zwischen uns etwas unwiederbringlich zu Bruch gehen, oder aus einem Gefühl von Macht, das aus dem heimlichen Hintergehen erwuchs, hätte ich immer noch nicht zu sagen gewusst. Vielleicht war es weder das eine noch das andere, sondern eine Mischung aus beidem.
Amelie und ich hatten unser Telefonat längst beendet, als mich diese Gedanken umtrieben. Im Nachhinein kam es mir vor, als hätte ich mich deshalb so sehr darauf konzentriert, um den Unfall auf Distanz zu halten. Aber das war unmöglich. Er entwickelte eine Kraft, der ich mich schließlich nicht mehr widersetzen konnte.
Hubert und Cornelia hatten zu meinem Leben gehört, sie waren Teil meiner Kindheit und Jugend. Als ich Cornelias Geburtstagseinladung abgesagt hatte, hatte ich mir fest vorgenommen, stattdessen zu ihrem Siebzigsten zu fahren. Es war diese Gewissheit, noch viel Zeit zu haben – zahllose Gelegenheiten, um zusammenkommen zu können. Nicht nur diese Gewissheit hatte der Tod der beiden zerstört.
Nachdem ich mir einen Flug Berlin – München gebucht hatte, war ich zurück ins Bett gegangen. Erst hatte ich geglaubt, kein Auge zutun zu können, gegen Morgen war ich jedoch so fest eingeschlafen, dass ich den Wecker überhörte. Um halb neun schreckte ich hoch und war von einer Sekunde auf die andere hellwach. Ich stand auf, setzte einen Kaffee auf und ging unter die Dusche. Egal, was ich tat – immer wieder stiegen mir Tränen in die Augen.
In ein großes Badetuch gewickelt rief ich Richard Stahmer an und sagte unsere Verabredung ab. Ich müsse zu einer Beerdigung an den Tegernsee und wisse noch nicht genau, wann ich zurück sei. Ich würde mich bei ihm melden. Er klang sehr mitfühlend und meinte, ich solle mir keine Sorgen wegen meiner Arbeit machen. Seine Wand werde mir nicht davonlaufen.
Mein nächster Anruf galt Eva-Maria. Als ich ihr erzählte, was geschehen war, bot sie sofort ihre Hilfe an. Sie versprach, meine Blumen zu gießen und nach meiner Post zu sehen. Und wenn ich jemanden zum Reden bräuchte, solle ich sie anrufen – egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
Nachdem ich aufgelegt hatte, zog ich mich an, packte für die nächsten Tage eine Tasche, goss die Pflanzen in der Küche und auf dem Balkon und legte den Postkastenschlüssel für Eva-Maria auf den Küchentisch. Schließlich suchte ich in den Bücherregalen im Flur nach einem Buch, mit dem ich mich auf der Reise würde ablenken können. Bis mir bewusst wurde, dass es Unsinn war. So lud ich mir aus dem Internet Songs von Bob Dylan auf meinen iPod. Cornelia hatte ihn verehrt.
Als ich drei Stunden später im Flugzeug saß und unter mir die Alpen dahinglitten, dachte ich an die vielen Bergwanderungen, an denen auch Hubert und seine Mutter teilgenommen hatten. BGS&R – diese vier Buchstaben bedeuteten nicht nur eine Partnerschaft der Männer in der Detektei. Zumindest die ersten drei standen auch für eine Freundschaft zwischen den Müttern, die sich bei den Kindern fortgesetzt hatte. Der vierte der Partner, Tobias Rech, hatte keine Familie. Nichtsdestotrotz gehörte er dazu und wurde ganz selbstverständlich zu allen Festen eingeladen. Er machte sich jedoch häufig rar, was ihm aber niemand übelzunehmen schien. Wer ihn kannte, wusste, dass er ein ausgemachter Einzelgänger war.
Beim Landeanflug auf München sah ich aus dem Fenster. Meine Augen waren blind vor Tränen. Die Frau auf dem Nebenplatz drückte meine Hand und meinte, ich solle keine Angst haben, wir würden ganz bestimmt sicher landen. Dieser wunderbar sonnige Tag sei doch viel zu schön, um zu sterben.
Am Tag zuvor hatte die Sonne auch geschienen, aber sie hatte weder Hubert noch seine Mutter beschützen können. Ich nickte der Frau zu, trocknete meine Tränen und gab vor, erleichtert zu sein, als die Räder hart aufsetzten und der Pilot die Maschine abbremste.
Nachdem ich mir einen Leihwagen gemietet hatte, machte ich mich auf den Weg zum Tegernsee. Amelie hatte mir eine SMS geschickt, dass sie und Adrian vorübergehend zu seinem Vater gezogen seien, damit er nicht allein sei. Außerdem wollten sie ihm bei den Beerdigungsvorbereitungen helfen. Ich simste zurück, dass ich am Nachmittag dort vorbeikommen würde.
So blieb mir genügend Zeit für einen Abstecher nach Osterwarngau, wo Elly, meine ehemalige Kinderfrau, mit ihrem Mann lebte. Ich verließ die Autobahn an der Ausfahrt Holzkirchen und fädelte mich in den dichten Verkehr ein. Die Hauptstraße, die zum Tegernsee führte, war ein Nadelöhr, das die Autokolonnen häufig zum Stehen brachte. Aber ich hatte Glück und kam bis zum Abzweig nach Osterwarngau einigermaßen zügig voran. Von da an begegneten mir nur noch wenige Autos. Ich fuhr langsam und ließ meinen Blick über die hügelige Landschaft gleiten, an deren Horizont sich die Berge erhoben. Die Kühe auf den Weiden links und rechts der kleinen Landstraße hatten sich schattige Plätze unter den Bäumen gesucht und dösten in der drückenden Hitze vor sich hin.
Als ich ein paar Minuten später in die von Birken gesäumte Straße bog, hoffte ich, Elly würde zu Hause sein. Telefonisch hatte ich sie nicht erreichen können. Im Sommer verbrachte sie die meiste Zeit in ihrem Garten, der ihr ganzer Stolz war. Kurz bevor die Straße in einen Forstweg überging, wendete ich und parkte in der Einfahrt. Anstatt eines Zauns hatte Elly zur Straße hin Büsche gepflanzt, die in allen erdenklichen Farben blühten und dem alten Holzhaus mit seinen grünen Fensterläden genau den richtigen Rahmen verliehen.
Ich öffnete das hüfthohe Tor, wandte mich nach rechts und folgte einem schmalen Weg durch den Vorgarten hinters Haus. Dort hielt ich nach Elly Ausschau, bis ich sie völlig verschwitzt neben einem Rhododendron entdeckte. Sie war gerade dabei, verwelkte Blütenstände abzuknipsen.
»Elly«, rief ich aus ein paar Metern Entfernung, um sie nicht zu erschrecken.
Als sie sich aufrichtete, fasste sie sich kurz ins Kreuz, um ihren Rücken zu stützen. »Finja …« Mit dem Zeigefinger strich sie sich eine feuchte Strähne aus dem Gesicht und sah mich so beiläufig an, als käme ich jeden Nachmittag um diese Zeit vorbei. Schließlich zog sie ein Taschentuch unter ihrer Dirndl-Schürze hervor und tupfte sich damit den Schweiß aus dem Dekolleté.
In meinen Augen gab es niemanden, dem ein Dirndl so gut stand wie Elly. Sie wiederum war der Überzeugung, nichts kleide eine Frau besser. Deshalb fiel der Blick, mit dem sie mein Outfit unter die Lupe nahm, auch eher missbilligend aus.
»In einem Dirndl würde ich in Berlin viel zu sehr auffallen«, sagte ich mit einem entwaffnenden Lächeln.
»Und hier macht dir das Auffällige nichts?« Sie schwang ihren Zeigefinger in Richtung meines Baumwollunterkleids mit Lochspitzenborte, zu dem ich Römersandalen trug. »Du siehst aus, als hättest du dich in den verstaubten Truhen meiner Großmutter bedient. Und dazu diese Schuhe …«
Ich ging zu ihr, legte meine Arme um ihren verschwitzten Hals und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich freue mich riesig, dich zu sehen, Elly. Ich habe dich vermisst.«
Sie drückte mich fest an sich. »Ich dich auch, meine Kleine. Ich dich auch. Von Weihnachten bis jetzt war viel zu lang.« Sie schob mich zur Gartenbank und drückte mich hinein. »Warte einen Moment, ich hole uns etwas zu trinken.«
Während sie im Haus verschwand, betrachtete ich das Blütenmeer, das Elly mit Sicherheit mehrere Stunden Zeit am Tag und Unmengen von Wasser kostete. Es war eine Pracht. Genau das sagte ich ihr, als sie mit einer Karaffe Eistee und Gläsern um die Hausecke kam.
Sie blieb stehen und deutete mit dem Kopf hinauf zu den Balkonkästen. »Aber Petunien tue ich mir im nächsten Jahr nicht mehr an. Die sind mir zu schwierig.«
»Dabei magst du doch die schwierigen Fälle.«
Sie stellte die Gläser auf den Tisch und füllte sie. Dann ließ sie sich mit einem leisen Stöhnen neben mir auf der Bank nieder. Elly war fünfundsechzig und bis auf ihre leidigen Rückenbeschwerden ziemlich fit für ihr Alter. Sie war noch echt blond, hatte ihre Haut über Jahre der Sonne ausgesetzt, um im Gegenzug unzählige Falten zu ernten, und hielt ihr Gewicht mit eiserner Disziplin. Diese Disziplin reichte sogar für ihren sieben Jahre älteren Mann Ingo, der ohne ihr wachsames Auge und ihren Daumen auf Brotkasten und Kühlschrank inzwischen mit Sicherheit aus dem Leim gegangen wäre.
»Wo ist dein Mann?«, fragte ich.
»Er ist mit dem Hund der Nachbarn hinauf in den Wald. Die Bewegung tut ihm gut.« Sie lehnte sich zurück und betrachtete mich in aller Seelenruhe. Obwohl ihr die Sonne direkt ins Gesicht schien, musste sie nicht einmal blinzeln. »Müde schaust du aus«, stellte sie fest.
»Ich hab nicht viel geschlafen heute Nacht.«
Elly nickte. »Schreckliche Sache, ich hab davon gehört. Traurig! Für den Carl Graszhoff wird es nicht einfach werden. Männer in seinem Alter tun sich schwer ohne ihre Frauen. Der Ingo käme ohne mich gar nicht zurecht. Hat deine Schwester erzählt, wie es passiert ist?«
»Cornelia hat wohl die Kontrolle über den Wagen verloren, als sie von einem anderen Fahrzeug überholt wurden, das sie geschnitten hat.«
Sie blies Luft durch die Nase. »In der Haut des Fahrers möchte ich jetzt nicht stecken.«
»Er ist einfach weitergefahren.«
Elly schüttelte den Kopf und machte ein Gesicht, als hätte sie einen üblen Geschmack auf der Zunge. »Diese Raserei hat so überhandgenommen. Manchmal denke ich, es ist ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert. Die Leute fahren so rücksichtslos. Womöglich war der Fahrer auch noch betrunken. Das sind mir die Schlimmsten. Reden sich hinterher auf Alkohol raus. Als wäre der ganz gegen ihren Willen in sie hineingeflossen.«
Ellys Stimme war Balsam für mich. Sie war tief und warm und hatte etwas Beruhigendes, gleichgültig, was sie sagte. Ich lehnte den Kopf gegen die von der Sonne aufgeheizte Hauswand und schloss die Augen. Nach einer Weile öffnete ich sie wieder und sagte: »Amelie ist schwanger.«
»Auch das noch!«, kam Ellys Reaktion prompt.
Das Haus der Graszhoffs lag in Holz, einem am Hang gelegenen Ortsteil von Bad Wiessee. Eine meterhohe, dichte Fichtenhecke verbarg das Anwesen vor den Augen neugieriger Passanten.
Ich parkte meinen Wagen am Straßenrand und lief die paar Meter bis zum Tor. Kaum hatte ich geklingelt, nahmen mich zwei Kameras ins Visier. Dieses Procedere war mir von meinem Elternhaus nur allzu vertraut. Und dennoch hatte ich mich nie daran gewöhnen können.