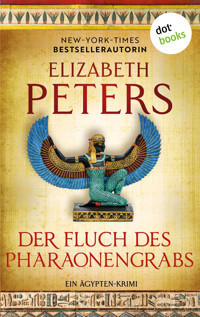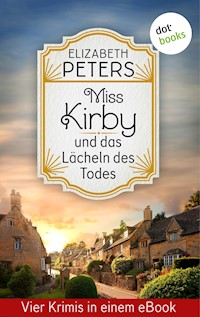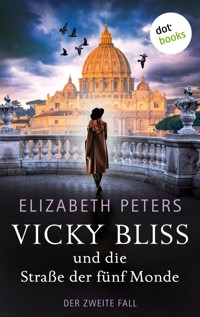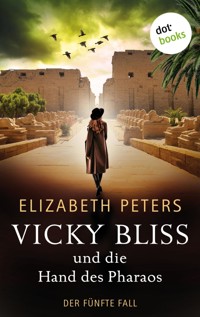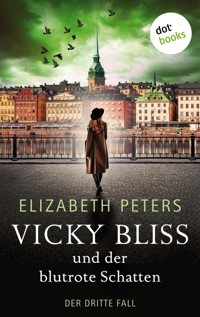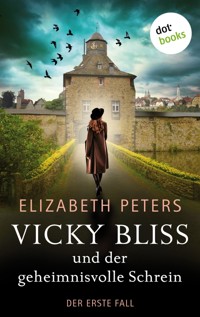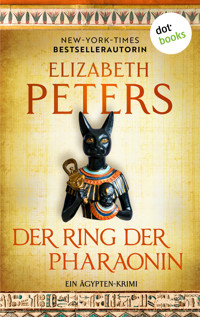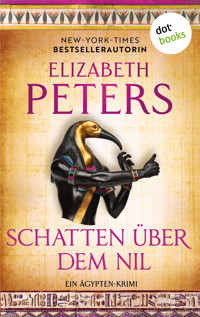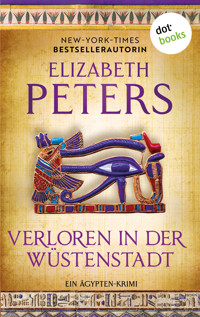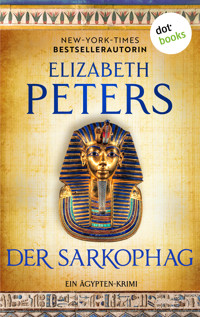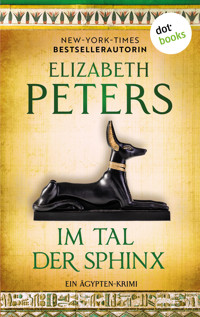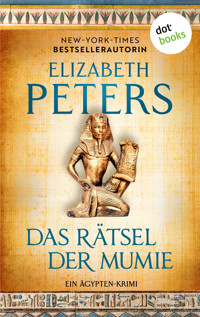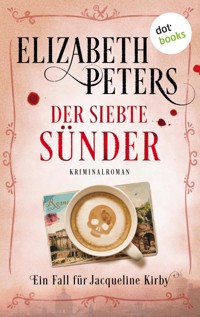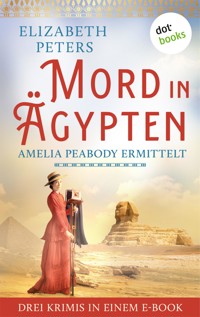
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Geheimnisse und Verbrecherjagden im des 19. Jahrhunderts DAS RÄTSEL DER MUMIE: England im 19. Jahrhundert: Amelia Peabody – unverheiratet, kinderlos und reich – ist der ungebetenen Aufmerksamkeit lästiger Heiratsanwärter überdrüssig und sie entschließt sich zur Flucht. Ihre Reise führt sie nach Ägypten, wo sie mysteriösen Mumien begegnet, die nachts nichts in ihrem Sarkophag zu halten scheint! Die zuständigen Wissenschaftler wollen sich aber Partout nicht helfen lassen. Doch da haben sie nicht mit Amelia Peabody gerechnet … DER FLUCH DES PHARAONENGRABS: Als Frau eines Wissenschaftlers und Mutter des kleinen Ramses bleibt Amelia Peabody keine Zeit für aufregende Exkursionen. Doch als Lady Baskerville sie bittet, im mysteriösen Tod ihres Mannes zu ermitteln, kann sie nicht nein sagen. Kaum im Tal der Könige angekommen, häufen sich die rätselhaften Todesfälle. Sucht der Fluch des Pharaos sie heim – oder ist ein ruchloser Mörder am Werk? IM TAL DER SPHYNX: Ägypten 1895: Gute Nachrichten für Amelia Peabody und ihren Mann: Die Grabkammer der Schwarzen Pyramide steht ihnen für Ausgrabungen zur Verfügung! Doch kaum sind sie in Kairo angekommen, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ein berüchtigter Grabräuber, scheint bei der Expedition sein Unwesen zu treiben – und entführt Amelias kleinen Sohn Ramses! Doch wenn es um die Sicherheit ihrer Familie geht, ist mit der toughen Archäologin nicht zu spaßen! »Amelia Peabody ist eine Mischung aus Miss Marple und Indiana Jones mit einem feministischen Touch. Großartige Unterhaltung!« Der Guardian Die ersten drei Fälle der historischen Ägypten-Krimireihe rund um die schlagfertige Archäologin und Hobby-Ermittlerin Amelia Peabody – für alle Fans von M.C. Beaton.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
DAS RÄTSEL DER MUMIE: England im 19. Jahrhundert: Amelia Peabody – unverheiratet, kinderlos und reich – ist der ungebetenen Aufmerksamkeit lästiger Heiratsanwärter überdrüssig und sie entschließt sich zur Flucht. Ihre Reise führt sie nach Ägypten, wo sie mysteriösen Mumien begegnet, die nachts nichts in ihrem Sarkophag zu halten scheint! Die zuständigen Wissenschaftler wollen sich aber Partout nicht helfen lassen. Doch da haben sie nicht mit Amelia Peabody gerechnet …
DER FLUCH DES PHARAONENGRABS: Als Frau eines Wissenschaftlers und Mutter des kleinen Ramses bleibt Amelia Peabody keine Zeit für aufregende Exkursionen. Doch als Lady Baskerville sie bittet, im mysteriösen Tod ihres Mannes zu ermitteln, kann sie nicht nein sagen. Kaum im Tal der Könige angekommen, häufen sich die rätselhaften Todesfälle. Sucht der Fluch des Pharaos sie heim – oder ist ein ruchloser Mörder am Werk?
IM TAL DER SPHYNX: Ägypten 1895: Gute Nachrichten für Amelia Peabody und ihren Mann: Die Grabkammer der Schwarzen Pyramide steht ihnen für Ausgrabungen zur Verfügung! Doch kaum sind sie in Kairo angekommen, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ein berüchtigter Grabräuber, scheint bei der Expedition sein Unwesen zu treiben – und entführt Amelias kleinen Sohn Ramses! Doch wenn es um die Sicherheit ihrer Familie geht, ist mit der toughen Archäologin nicht zu spaßen!
Sammelband-Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Alex Anton, Ana Lo, Dan Thornberg, Vom Baty
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-69076-782-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Mord in Ägypten: Amelia Peabody ermittelt
Drei Krimis in einem eBook: »Das Rätsel der Mumie«, »Der Fluch des Pharaonengrabs« & »Im Tal der Sphinx«
Das Rätsel der Mumie
Ein Ägypten-Krimi. Amelia Peabody 1
Aus dem Amerikanischen von Leni Sobez
England im 19. Jahrhundert: Amelia Peabody ist unverheiratet, kinderlos und – seit dem überraschenden Erbe ihres verschrobenen Wissenschaftlervaters – verdammt reich. Eine äußerst seltene Position für eine Frau im viktorianischen England, die ihr eine Flut von Heiratsanträgen und lästige Aufmerksamkeit entfernter Verwandter einbringt. Überdrüssig von dieser neuen Realität entscheidet Amelia, alles hinter sich zu lassen:
Ihre Reise führt sie nach Ägypten, wo sie mysteriösen Mumien begegnet, die nachts nichts in ihrem Sarkophag zu halten scheint! Die zuständigen Wissenschaftler vor Ort sind am Ende ihres Lateins – wollen sich aber Partout nicht helfen lassen. Doch da haben sie nicht mit Amelia Peabody gerechnet …
Kapitel 1
Evelyn Barton-Forbes sah ich zum ersten Mal in Rom. Unser Zusammentreffen war Zufall, wenn auch ein sehr glücklicher. Ich hatte ja immer genug Energie für zwei.
An jenem Morgen hatte ich ziemlich gereizt mein Hotel verlassen. Alle meine Pläne waren schiefgegangen, und das bin ich nun einmal nicht gewöhnt. Mein kleiner italienischer Führer spürte meine schlechte Laune und trottete schweigend hinter mir drein. Sonst redete er ununterbrochen. Aus einer ganzen Schar von Jungen, die sich Fremden als Führer und Dolmetscher anboten, hatte ich ihn deshalb ausgewählt, weil er etwas weniger schurkisch aussah als die anderen.
Ich kannte diese Burschen genau, die ihre Arbeitgeber bedenkenlos ausnützten und betrogen, doch ich dachte nicht daran, auch deren Opfer zu werden. Das hatte ich Piero bald klargemacht. Ich kaufte Seide und handelte so erbarmungslos mit dem Ladenbesitzer, daß Pieros Provision auf ein Minimum zusammenschmolz. Darüber beklagte er sich in seiner Muttersprache bei dem Kaufmann und äußerte sich dabei abfällig über meine Manieren und mein Aussehen. Ich ließ ihn eine Weile reden und machte dann eine Bemerkung über seine Manieren. Ich spreche und verstehe Italienisch nämlich ganz gut. Danach kam ich mit Piero wunderbar zurecht. Ich beschäftigte ihn ja nicht, weil ich einen Dolmetscher brauchte, sondern damit er Botengänge für mich erledigte und meine Pakete trug.
Meine Sprachkenntnisse und die Mittel für Auslandsreisen stammten von meinem Vater, der Wissenschaftler war und ein Antiquariat hatte. In der kleinen Provinzstadt, in der er zu leben vorzog, gab es wenig Abwechslung, und so studierte er immer weiter. Ich habe einiges Talent für Sprachen, egal ob tot oder lebendig. Papa mochte sie lieber tot. Die Vergangenheit war seine Leidenschaft, und gelegentlich tauchte er daraus auch für kurze Zeit auf. Dann blinzelte er und stellte fest, daß ich, seit er mich zum letzten Mal bemerkt habe, ein ganzes Stück gewachsen sei.
Wir kamen wunderbar miteinander zurecht. Meine sechs älteren Brüder hatten nichts übrig für Vaters Studien. Sie waren erfolgreich als Kaufleute und in anderen Berufen, und so war eben ich die kleine Sonne der letzten Jahre meines Vaters. Mir gefiel dieses Leben, denn es gab mir Gelegenheit, meine wissenschaftlichen Neigungen zu entwickeln. Da mein Vater nichts übrig hatte für die praktischen Seiten des Lebens, blieben sie mir überlassen, und ich schacherte recht erfolgreich mit dem Bäcker und dem Fleischer. Nach Mr. Hodgkins, dem Fleischer, hatte ich mit Piero keine große Mühe.
Später starb mein Vater; um genau zu sein: er schrumpfte immer mehr zusammen und vertrocknete völlig. Ein naseweises Hausmädchen behauptete, er sei schon volle zwei Tage tot gewesen, ehe es jemand bemerkte, doch das ist eine schamlose Übertreibung. Richtig ist, daß er irgendwann im Laufe der fünf Stunden, die ich in seinem Studierzimmer verbrachte, sanft entschlafen ist. Er saß in seinem Ohrenbackensessel und schien nachzudenken, doch als ich, einer Ahnung folgend, zu ihm trat, schauten mich seine Augen mit genau dem gleichen fragenden Blick an wie immer. Ich meine, das ist eine sehr gemütliche und schöne Art, zu sterben.
Niemand war erstaunt, daß er seinen Besitz mir vermachte, denn ich war das einzige seiner Kinder ohne eigenes Einkommen. Meine Brüder hatten nichts dagegen einzuwenden, wie sie auch die treuen Dienste akzeptiert hatten, die ich meinem Vater leistete. Sie explodierten auch nicht, als sie erfuhren, daß dieses Vermögen eine halbe Million Pfund betrug. Sie waren eben dem Irrtum unterlegen, daß ein Gelehrter unbedingt auch ein Narr sei. An Debatten mit dem Fleischer war mein Vater zwar nie interessiert, umso mehr aber an guten Geldanlagen, und da war er ebenso beharrlich wie in seinen Studien. Also starb er zur allgemeinen Überraschung als reicher Mann.
Als dies dann bekannt wurde, drohte mein ältester Bruder James zwar damit, daß er das Testament anfechten werde, doch das redete ihm Papas Anwalt, der ausgezeichnete Mr. Fletcher, ziemlich leicht aus. Dann kamen unzählige Nichten und Neffen, die in den Jahren vorher durch Abwesenheit geglänzt hatten; sie luden mich ein, doch bei ihnen zu wohnen, und warnten mich vor Mitgiftjägern.
Warnungen waren unnötig. Mit meinen damals zweiunddreißig Jahren hatte ich noch nie einen Heiratsantrag erhalten und war eine alte Jungfer. Das wußte ich, doch es machte mir nichts aus. Auch über mein Aussehen machte ich mir noch nie Illusionen, ich bin ja schließlich kein Dummkopf.
Gewisse Gentlemen und meine Verwandten ermunterte ich sogar noch zu Besuchen, weil sie mich amüsierten – bis ich bemerkte, daß ich zynisch wurde. Deshalb beschloß ich, auf Reisen zu gehen, denn das wollte ich schon immer tun, und vor allem jene Länder besuchen, mit denen sich Vater beschäftigt hatte, wie Griechenland, Rom, Babylon und das hunderttorige Theben.
Als ich meinen Entschluß gefaßt hatte, brauchte ich nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitungen. Mr. Fletcher machte mir schnell noch einen Heiratsantrag, den ich genauso humorig ablehnte, wie er vorgetragen worden war. »Ich dachte, es sei einen Versuch wert«, meinte er dazu trocken. »Miß Amelia«, fügte er hinzu, »ich frage Sie jetzt als Ihr Anwalt: Haben Sie die Absicht, jemals zu heiraten?«
»Nein«, antwortete ich. »Grundsätzlich habe ich einiges gegen die Ehe. Für einige Frauen mag sie recht gut sein, denn was sollten diese armen Dinger sonst tun? Warum sollte sich aber eine unabhängige und intelligente Frauensperson den Launen eines tyrannischen Ehemannes unterwerfen? Ich versichere Ihnen, ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der so vernünftig gewesen wäre wie ich selbst.«
»Das kann ich Ihnen durchaus glauben«, meinte er. Und dann platzte er heraus: »Warum ziehen Sie sich aber so entsetzlich an? Um Bewerber abzuschrecken?«
»Aber, Mr. Fletcher!« protestierte ich. »Meine Kleider passen genau für das Leben, das ich führe. Die gegenwärtige Mode ist für eine aktive Person völlig ungeeignet. Diese engen Humpelröcke und die Schnürmieder, in denen man nicht einmal atmen kann ... Und die Turnüre! Die ist doch völlig idiotisch! Ich trage sie nur deshalb, weil man ein Kleid ohne Turnüre heutzutage nicht gemacht bekommt. Ich kann aber wenigstens auf dezenten Stoffen und einem Minimum an Kinkerlitzchen bestehen. In roter Seide mit Spitzchen und Rüschchen und Troddelchen käme ich mir närrisch vor.«
»Trotzdem dachte ich immer, Sie würden in roter Seide mit Spitzchen und Rüschchen recht hübsch aussehen«, antwortete Mr. Fletcher lächelnd.
Meine gute Laune war gerettet, doch ich schüttelte den Kopf. »Geben Sie’s auf, Mr. Fletcher. Mir können Sie nicht schmeicheln, denn ich kenne die Liste meiner Fehler viel zu genau. An einigen Stellen bin ich zu mager, an anderen zu füllig, meine Nase ist zu lang, mein Mund zu groß, mein Kinn ist zu männlich. Blasse Haut und rabenschwarzes Haar sind im Moment unmodern, und meine grauen Augen unter den dichten Brauen jagen den Leuten Angst und Schrecken ein, denn vor Güte strahlen sie selten. Können wir jetzt zu den Geschäften übergehen?«
Ich folgte seinem Rat und machte mein Testament, wenn ich auch noch lange nicht die Absicht hatte, zu sterben; es ist jedoch immer mit einem gewissen Risiko verbunden, in ungesunde Gegenden zu reisen. Mein ganzes Vermögen vermachte ich dem Britischen Museum, in dem Papa so viele glückliche Stunden verbracht hatte.
Schließlich suchte ich mir noch eine Reisegefährtin, weil ich einsam war, nicht weil ich es unschicklich gefunden hätte, allein zu reisen. Immer hatte ich für Papa gesorgt, und ich brauchte auch jetzt einen Menschen, für den ich sorgen konnte. Miß Pritchett war ein paar Jahre älter als ich, kleidete und benahm sich jedoch so, als sei sie wesentlich jünger. Allerdings sahen die Rüschchen und Spitzchen an ihrem Knochengerüst recht grotesk aus, und ihre Stimme klang sehr schrill. Sie war ungeschickt, einfältig und neigte zu Ohnmachts- und Schwächeanfällen, oder sie gefiel sich darin, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergab. Ich hatte ganz schön zu tun, wenn ich sie durch die Straßen Kairos und die Wüsten Palästinas schleifen wollte.
Kaum hatten wir jedoch Rom erreicht, als sie an einem Typhusfieber erkrankte. Sie kam zwar durch, aber ich mußte meine Reise nach Kairo um zwei Wochen verschieben. Da sie eine lange Erholungszeit benötigte, schickte ich sie nach England zurück und übergab sie der Obhut eines Geistlichen und seiner Frau, die gerade Rom verließen. Ihr Gehalt wollte ich ihr bezahlen, bis sie einen neuen Posten fände. Sie versuchte, als sie sich verabschiedete, weinend meine Hand zu küssen.
Meine Pläne waren also durchkreuzt, und ich fühlte mich schlechter Laune. Meine ganzen Vorbereitungen hatten zwei Personen gegolten. Sollte ich mir eine neue Gefährtin suchen oder die Reise einsam antreten? Darüber dachte ich nach, als ich der trostlosen Kuhweide einen Besuch abstattete, die einstmals das historische Forum von Rom gewesen war.
Es war ein unfreundlicher Dezembernachmittag. Piero sah trotz der von mir gekauften Jacke wie ein frierender, geschorener Pudel aus. Die umgestürzten Säulen waren von braunem, dürrem Unkraut überwuchert. Ich las ein paar gemeißelte Inschriften und stellte den Ort fest, wo Cäsar überfallen wurde; damit war ich zufrieden und setzte mich zu kurzer Rast auf einen Säulenstumpf.
Von Piero ließ ich mir den heißen Tee geben, den die Hotelküche zusammen mit einem kleinen Imbiß für mich vorbereitet hatte. Während ich meinen Tee trank und Piero im Korb nach etwas Besserem kramte, bemerkte ich in der Nähe einen Menschenauflauf und schickte Piero zum Nachschauen, was es dort gebe. Viele Fremde, berichtete er wenig später, seien um eine junge englische Dame versammelt, die am Boden liege. Was konnte eine solche junge Dame auch anderes sein als Engländerin? Und sie sei ganz gewiß tot, weil sie sich nicht rühre.
Nun, Engländerin oder nicht, ich zweifelte, daß sie tot sei. Piero liebte als Römer das Dramatische ein wenig zu sehr, und von den vielen Fremden schien niemand etwas für die junge Dame zu tun. Also ging ich hin, schob energisch mit meinem kräftigen Sonnenschirm einige Gentlemen zur Seite und stand endlich neben der jungen Dame. Sie sah erbarmenswert aus, und niemand hatte auch nur einen Finger für sie gerührt.
Ich kniete neben ihr nieder, setzte mich auf die Fersen und bettete den Kopf des Mädchens auf meine Knie. Es tat mir unendlich leid, daß ich keinen Mantel oder Umhang trug, doch das ließ sich leicht ändern.
»Ich brauche Ihren Mantel, Sir«, sagte ich zum nächsten Herrn. Er war dick, rundgesichtig und hatte viele Lagen Fett, die ihn warmhielten. Vorher hatte er mit seinem Goldgriffspazierstock nach dem Mädchen gestochert, um zu sehen, ob sich das arme Ding noch rühre. Das mußte er mir jetzt büßen.
»Was wollen Sie von mir?« knurrte er.
»Ihren Mantel, Sir«, erwiderte ich ungeduldig. »Sofort ziehen Sie ihn aus. Aber schnell!« Das sagte ich nicht sehr leise; sein Gesicht wurde immer röter, als er seinen Mantel langsam auszog. Das Mädchen war, wovon ich mich überzeugt hatte, nicht tot, sondern nur ohnmächtig. Nun hüllte ich das arme Ding in den warmen Mantel ein und musterte es dabei. Da ich selbst recht unscheinbar bin, liebe ich Schönheit über alles, und dieses Mädchen konnte ich nur bewundern.
Natürlich konnte sie nur Engländerin sein, denn so makellose weiße Haut und so blaßgoldenes Haar sind bei keiner anderen Nation zu finden. Ihre Wimpern waren einige Schattierungen dunkler als ihr Haar und ungewöhnlich lang. Für die winterliche Kälte war sie mit einem Sommerkleid und einem dünnen Mantel sehr dürftig gekleidet. Alles sah recht abgetragen aus, mußte früher aber ziemlich teuer gewesen sein und zeugte von bestem Geschmack. Die Handschuhe an ihren zarten Händen waren sauber gestopft. Das Mädchen bot einen armseligen Anblick, schien jedoch von bester Abkunft zu sein und mußte wohl unter Hunger und Kälte leiden.
Da flatterten plötzlich die dunklen Wimpern, die Lider hoben sich und enthüllten Augen von einem sehr dunklen, wundervollen Blau. Als sie mich erfaßten, kam etwas Rot in ihre Wangen, und das Mädchen versuchte, sich aufzusetzen. »Bleiben Sie ruhig liegen«, mahnte ich und drückte sie zurück. »Sie waren ohnmächtig und sind noch schwach. Ich habe einen Imbiß bei mir. Wenn Sie etwas zu sich genommen haben, sehen wir weiter.«
Sie versuchte zu protestieren, und die starrenden Gaffer machten sie sehr verlegen. Ich befahl den Leuten also zu verschwinden. Von dem Herrn, dessen Mantel ich gefordert hatte, ließ ich mir seine Hoteladresse geben. Ich versprach ihm, den Mantel bis zum Abend zurückzuschicken. »Eine Person von Ihrem Umfang sollte auf keinen Fall so schwere Kleidungsstücke tragen«, mahnte ich ihn noch.
Die Dame neben ihm, die auch so dick war, empörte sich. »Wie können Sie es wagen, so etwas zu sagen! Das ist unerhört!«
»Sicher ist das unerhört«, gab ich ihr recht. »Ich verspreche Ihnen jedoch, Madam, keinen Versuch zu machen, Ihnen christliche Gefühle beizubringen, denn das wäre vergeblich. Am besten ist es also, wenn Sie mit diesem dicken Mann hier schnellstens verschwinden.«
Ich hatte inzwischen dem Mädchen ein paar Happen aus dem Korb zu essen gegeben. Sie hatte Hunger, das sah man, doch sie aß sehr langsam und wohlerzogen. Also war sie eine Dame, wie ich vermutet hatte. Sie trank den Rest des Tees und aß ein Stück Brot, und nun konnte ich sie mit Pieros Hilfe in einen Wagen setzen, der uns zu meinem Hotel brachte. Der herbeigerufene Arzt bestätigte meine Diagnose. Die junge Dame leide an keiner Krankheit, sondern an Hunger und Kälte, erhole sich aber schnell.
In meinem Kopf formte sich schon ein Plan, und ich kam auch bald zu einem Entschluß. Das Mädchen sah wohl sehr zierlich aus, dennoch mußte es von sehr kräftiger Konstitution sein. Sie schien weder Freunde noch Verwandte zu haben, die sie vor einem so desolaten Zustand hätten bewahren können, doch dem konnte man ja schließlich abhelfen. Ich sagte ihr also, was ich zu tun gedachte.
Sie saß im Bett. Travers, meine Dienerin, gab ihr Suppe ein. Beiden schien dies keinen Spaß zu machen. Travers ist eine rundliche Person mit einem freundlichen Gesicht und der Seele einer vertrockneten alten Jungfer. Da ich es nicht dulde, wenn sich jemand über das, was ich tue, beklagt, trug sie eine gekränkte Miene zur Schau. Nur so konnte sie ihre Gefühle ausdrücken.
»Das genügt jetzt, Travers«, sagte ich. »Du kannst gehen. Aber mach die Tür ordentlich hinter dir zu.«
Als wir allein waren, musterte ich meinen Schützling und war mit dem, was ich sah, durchaus zufrieden. Das Flanellnachthemd war viel zu groß für das zierliche Persönchen. Sie brauchte Kleider, und es mußten hübsche, nette Sachen sein, also von der Art, die ich nie hatte tragen können. In Blaßgrün, Rosa und Lavendel mußte sie entzückend aussehen. Wie hatte dieses Mädchen nur in einen so trostlosen Zustand geraten können? Sie bemerkte, daß ich sie musterte und senkte die Augen, doch dann sprach sie; ihre Stimme klang wie die einer wohlerzogenen jungen Dame, und die Worte verstand sie ausgezeichnet zu wählen.
»Ich bin Ihnen zu unbeschreiblichem Dank verpflichtet, aber seien Sie versichert, Ma’am, daß ich Ihr gutes Herz nicht ausnützen werde. Ich habe mich jetzt erholt. Wenn Sie Ihre Magd anweisen, mir meine Kleider zu bringen, werde ich Sie sofort von meiner Anwesenheit befreien.«
»Ihre Kleider ließ ich wegwerfen«, antwortete ich. »Die Mühe des Waschens und Bügelns lohnte sich nicht mehr. Sie müssen sowieso bis morgen im Bett bleiben. Morgen lasse ich eine Näherin kommen. Am nächsten Freitag geht ein Schiff nach Alexandria. Eine Woche müßte genügen. Sie werden einiges einkaufen müssen. Wenn Sie mir sagen, wo Sie wohnen, lasse ich Ihre Sachen holen.«
Ihr Gesicht drückte die verschiedensten Gefühle aus; erst Empörung, dann Mißtrauen, schließlich Entsetzen. Da sie mich nur offenen Mundes anstarrte, fuhr ich ziemlich ungeduldig fort: »Ich nehme Sie als Reisegefährtin mit nach Ägypten. Miß Pritchett wurde krank. Ihr wollte ich zehn Pfund jährlich bezahlen. Natürlich werde ich Sie für die Reise ausstatten. In einem Flanellnachthemd können Sie schließlich nicht auf Reisen gehen.«
»Nein«, gab das Mädchen zu, »aber ...«
»Ich bin Amelia Peabody, eine alte Jungfer, unabhängig und reise zu meinem Vergnügen. Wollen Sie sonst noch etwas – wissen?«
»Nein, ich weiß alles«, antwortete das Mädchen ruhig. »Ich war nicht ganz ohnmächtig, als Sie zu meiner Rettung kamen, und erkenne Herzensgüte auf den ersten Blick. Aber, meine liebe Miß Peabody, Sie wissen nichts über mich. Ich könnte ja vielleicht ... kriminell oder haltlos sein.«
»Nein, nein«, wehrte ich ab. »Ich treffe zwar meine Entschlüsse sehr rasch, doch niemand kann mir Dummheit vorwerfen. Ich denke nur schneller und gründlicher als die meisten Leute und habe Menschenkenntnis.«
Der Mund des Mädchens zitterte, und an einem Mundwinkel erschien ein Grübchen. »Ich bin nicht das, was Sie denken«, sagte sie leise, »doch ich bin Ihnen meine Geschichte schuldig. Habe ich sie erzählt, so werden Sie alles Recht haben, mich hinauszuwerfen.«
»Na, dann fangen Sie an. Ich werde sie dann schon beurteilen.«
Das Mädchen begann zu sprechen:
»Ich bin Evelyn Barton-Forbes. Ich war noch ein kleines Kind, als meine Eltern starben, und aufgezogen wurde ich von meinem Großvater, dem Earl of Ellesmere. Sie scheinen den Namen zu kennen. Er ist alt und ehrenhaft. Mein Großvater wird von vielen als geizig gescholten, obwohl er sehr reich ist. Menschenfreund war er nie, doch mich behandelte er gütig. Er nannte mich immer sein Lämmchen. Vielleicht war ich das einzige menschliche Wesen, zu dem er je freundlich war. Er verzieh mir sogar, daß ich ein Mädchen und nicht der ersehnte männliche Erbe bin.
Ich bin das einzige Kind des ältesten Sohnes meines Großvaters, kann aber Titel und Besitz nicht erben, weil ich ein Mädchen bin. Als mein Vater starb, war mein Vetter Lucas Hayes der nächste männliche Verwandte.
Ich hatte Lucas immer gern, und er tat mir leid, weil Großvater immer so unfair zu ihm war. Er sagte, er möge Lucas wegen seiner ausschweifenden und zügellosen Gewohnheiten nicht, doch ich denke, hier handelt es sich vorwiegend um Gerüchte. Aber mein Vetter ist eben seines Vaters Sohn, und deshalb mag er ihn nicht. Großvaters älteste Tochter ging nämlich mit einem Italiener durch. Mein Großvater ist jedoch ein Brite bis auf die Knochen und mag besonders die romanischen Völker nicht. Er hält sie für gerissen, betrügerisch und falsch. Meine Tante ließ sich also vom Conte d’Imbroglio d’Annunciata entführen. Großvater enterbte sie und tilgte ihren Namen aus der Familienbibel. Noch auf ihrem Totenbett wartete sie vergeblich auf ein Wort des Trostes und der Verzeihung. Er sagte, der Conte sei kein Edelmann, sondern ein Betrüger und Mitgiftjäger, doch ich bin überzeugt, daß dies nicht zutrifft. Sicher hatte der Conte wenig Geld, doch sein Titel war echt. Lucas hielt es, als er volljährig wurde, für klug, seinen Namen zu ändern. Er nennt sich jetzt Lucas Elliot Hayes und gab den italienischen Titel auf.
Eine Zeitlang ging es ganz gut, und ich glaubte sogar, mein Großvater dachte an eine Heirat. Lucas würde ja den Titel und den Grundbesitz erben, doch ohne das Privatvermögen meines Großvaters war der Besitz nur eine Last. Großvater ließ keinen Zweifel daran aufkommen, daß sein Vermögen ich erben würde. Es kam jedoch nicht soweit.
Großvater warf Lucas hinaus, als er von dessen bösen Streichen erfuhr, und ich war darüber erleichtert, da ich Lucas nicht liebte, obwohl ich ihn gern hatte. Ich war nämlich sentimental und der Meinung, eine Heirat ohne Liebe sei ein Unding. Und zu meinem Unglück verliebte ich mich.
Meinem Großvater gefielen meine Zeichnungen, und auch Lucas hatte sie immer sehr gelobt. Deshalb hielt mein Großvater nach einem Zeichenlehrer Ausschau. So kam Alberto in mein Leben.
Damals erschien mir sein Gesicht engelhaft, heute kommt es mir eher wie das eines Teufels vor. Er sprach mit ungemein weicher Stimme ein ziemlich fehlerhaftes Englisch. Kurz gesagt, er verführte mich und überredete mich zur Flucht mit ihm. Ich verließ also den alten Mann, der mich liebevoll erzogen hatte, gab meine moralischen Grundsätze und meine ganze Zuneigung für meinen Großvater auf. Ich kann jetzt von Alberto nur voll Verachtung reden, doch noch mehr Vorwürfe mache ich mir selbst. Ich verdiente mein elendes Los.
Das Ende der Geschichte ist schnell erzählt. Ich nahm meine wenigen Schmuckstücke mit, die mir mein Großvater geschenkt hatte. Der Erlös daraus reichte nicht sehr lange. Alberto bestand darauf, daß wir in einem Stil reisten, der meinem Stand entsprach. Als wir jedoch in Rom ankamen, war die Unterkunft, die wir da bezogen, sicher in keiner Weise standesgemäß, denn mein Geld war zu Ende. Alberto wich mir aus, wenn ich fragte, was er zu tun gedächte, und wegen unserer Heirat fand er auch immer Ausreden. Als guter Katholik könne er sich nicht mit einer Ziviltrauung abfinden, sagte er, und ich war ja nicht katholisch. Oh, wie naiv ich doch war!
Vor einer Woche brach dann meine Welt vollends zusammen. Alberto war die meiste Zeit des Tages weg, und kam er nach Hause, war er betrunken und mißlaunig. Eines Morgens fand ich mich dann in einer ärmlichen, kalten Dachkammer allein. Er hatte alles mitgenommen, was irgendwie von Wert war. Mir hatte er nur einen Brief zurückgelassen. Die schlechte, fehlerhafte Schrift war fast noch schlimmer als die Gemeinheiten, die er enthielt. Er habe sich nur an mich herangemacht, weil ich eine reiche Erbin sei, aber nun habe mich mein Großvater aus seinem Testament gestrichen, wie er im britischen Konsulat von Rom erfahren habe; und außerdem habe der alte Mann, wie er ihn nannte, einen Schlaganfall erlitten. Es sei ihm gerade noch gelungen, mich in einem neuen Testament völlig zu enterben, doch danach sei er in ein Koma gefallen, das nur zum Tod führen könnte. Damit sei ich für ihn wertlos. Er habe viel angenehmere Aussichten.
Sie können sich meinen Zustand vorstellen, Amelia. Ich war einige Tage krank. Die alte Frau, der das Haus gehörte, entdeckte bald, daß ich völlig mittellos war und warf mich heute hinaus. Ich wäre am liebsten gestorben, denn was sollte ich anfangen? Ich hatte meinem Großvater sehr viel angetan, und er würde mich wohl nicht zurücknehmen wollen. Nur Ihre Herzensgüte rettete mich dann vor dem Tod. Aber ich kann nicht länger bleiben. Ich muß Sie anekeln, wenn Sie es mir auch nicht zeigen. Sprechen Sie, Amelia, ich bitte Sie! Ich will demütig Ihre Vorwürfe hinnehmen, denn ich habe sie verdient.« Evelyns blaue Augen waren von Tränen verschleiert, als sie geendet hatte, doch sie war ruhig geblieben. Ich schwieg lange, denn ich mußte nachdenken. Mein Schweigen schmerzte das Mädchen, und sie duckte sich zusammen, als erwarte sie einen Schlag. Ich war so verwirrt, daß ich schließlich etwas ganz anderes fragte, als ich hätte fragen wollen.
»Sagen Sie, Evelyn – wie ist es? Ist es angenehm?«
Evelyn war so verblüfft, daß sie mich nur wortlos anstarrte. Ich fuhr deshalb fort: »Sie müssen mir verzeihen, wenn ich Sie ausfrage, doch dazu bot sich mir nie eine Gelegenheit. Man hört so widersprüchliche Dinge. Meine Schwägerinnen flüstern miteinander und sprechen von dem Kreuz, das eine Frau zu tragen habe, aber ich habe auch die Dorfmädchen mit ihren Liebsten gesehen, und sie scheinen kein Kreuz zu tragen. Du lieber Himmel! Ich scheine ja nicht einmal die richtigen Worte zu finden. Verstehen Sie, was ich meine?«
Evelyn starrte mich noch immer an, dann schnitt sie eine merkwürdige Grimasse und schlug die Hände vor das Gesicht. Ihre schmalen Schultern bebten.
»Sie müssen entschuldigen«, bat ich. »Natürlich wollte ich nicht ... Und nun werde ich es nie erfahren ...«
Aber da ließ Evelyn die Hände fallen. Ihr Gesicht war rot und noch tränenfeucht – aber sie lachte! Ich glaubte an einen hysterischen Anfall und hob die Hand.
»Nein, nein, ich bin nicht hysterisch«, wehrte sie ab. »Aber Amelia, Sie sind ... Ist das alles, was Sie mich nach einer solchen Geschichte fragen können?«
Ich überlegte. »Nun, viel zu fragen gibt es da nicht. Ihr alter Großvater und der Schurke von einem Liebhaber verdienen keine Fragen. Und Ihre übrigen Verwandten müssen ebenso hartherzig sein, sonst hätten Sie sich an diese wenden können.«
»Und mein verdorbener Charakter stößt Sie nicht ab?«
»Ich halte ihn nicht für verdorben. Diese böse Erfahrung dürfte ihn eher gestärkt haben. Wissen Sie, ich hielte es für besser, Sie würden sich davon überzeugen, daß die Ihnen von mir gebotene Stellung dem entspricht, was ich sagte. Ich kann Ihnen Referenzen geben ...«
»Nein, das ist überflüssig«, wehrte sie ab. »Nur eines möchte ich wissen, Amelia. Warum sagten Sie: ›Nun werde ich es nie erfahren ...‹?«
»Nun, es ist unwahrscheinlich, daß ich persönlich derartige Erfahrungen mache. Ich bin ja mit dem Gebrauch von Spiegel und Kalender vertraut. Ich bin schließlich zweiunddreißig Jahre alt und unansehnlich. Ich schmeichle mir nicht. Und die in unserer Gesellschaft erforderliche Schwachheit des Weibes ist mir auch nicht eigen. Ich könnte weder einen Mann ertragen, der sich von mir beherrschen läßt, noch einen, der mich zu beherrschen versucht. Ich bin jedoch neugierig und dachte ... Nun, meine Brüder versichern mir ständig, ich dächte und redete unpassend.« »Ich habe Ihre Frage noch nicht beantwortet«, sagte Evelyn. »Es ist schwierig, eine richtige Antwort zu geben. Im Moment schüttelt es mich vor Grauen, wenn ich an die Stunden in ... Albertos Armen denke, aber damals ... damals ...« Ihre Augen glänzten. »Oh, Amelia, unter den richtigen Umständen ist es ein herrliches, ein großartiges Erlebnis!«
»Ah, genau das dachte ich mir. Nun, meine liebe Evelyn, ich bin Ihnen für diese Information sehr dankbar. Wenn Sie jetzt also die von mir angebotenen Referenzen ...«
Sie schüttelte ihre goldenen Locken. »Ich brauche keine Referenzen. Amelia, ich komme gerne mit als Ihre Reisegefährtin. Ich denke, wir werden gut miteinander zurechtkommen.«
Da küßte sie mich auf die Wange. Das erstaunte mich so, daß ich etwas murmelte und aus dem Zimmer ging. Ich hatte ja nie eine Schwester gehabt, doch jetzt war mir, als hätte ich eine gefunden. Ich kann, ohne meine Energie ungebührlich zu unterstreichen, von mir behaupten, daß ich einen einmal gefaßten Entschluß sehr schnell in die Tat umsetze. In der folgenden Woche knackte und krachte die lethargische Stadt der Päpste unter meinen Schritten.
Auch einige Überraschungen erlebte ich. Evelyn wollte ich anziehen und ausstaffieren wie eine schöne lebende Puppe, für die ich all die hübschen unpraktischen Kleider und Sächelchen zu kaufen gedachte, die ich selbst nicht tragen konnte. Das gelang mir nicht, obwohl sie mir niemals widersprach. Zum Schluß hatte sie eine entzückende, sehr geschmackvolle und erstaunlich billige Garderobe, und ich selbst hatte ganz gegen meine Absicht auch ein halbes Dutzend Kleider gekauft. Ein Abendkleid, das ich ganz bestimmt niemals anziehen wollte, war aus karmesinroter Seide mit einem so tiefen Ausschnitt, wie ich ihn noch niemals getragen hatte. Die Röcke waren über eine gewaltige Turnüre drapiert und ließen einen mit Ziermünzen bestickten Unterrock ahnen. Evelyn wählte die Stoffe aus und trieb die Schneiderin auf ihre sanfte Art viel nachdrücklicher an als ich auf meine energische. Wenn Evelyn zu mir sagte: »Dieses Kleid kannst du tragen«, dann trug ich es auch. Sie entdeckte auch meine Schwäche für bestickten Batist, und die feinen für sie gedachten Unterkleider und Nachthemden entstanden nach meinen Maßen.
Diese Woche verbrachte ich in einem Zustand halber Betäubung. Ich hatte das Gefühl, ein winziges, armseliges Kätzchen vor dem Ertrinken aus einem Teich gefischt zu haben, das sich innerhalb weniger Tage zu einem richtigen Tiger auswuchs. Soviel Verstand blieb mir gerade noch, daß ich einige praktische Schritte unternehmen konnte.
Ich bin keine Männerfeindin, wenn ich auch dem anderen Geschlecht gegenüber immer mißtrauisch blieb. Dieses Mißtrauen schien Evelyns Geschichte zu bestätigen, doch die Sache mit ihrem Großvater bedurfte einiger Nachforschungen. Ich ging also zu unserem Konsul in Rom.
Alberto hatte, sehr zu meiner Enttäuschung übrigens, die Wahrheit gesagt. Der Konsul kannte den Earl of Ellesmere persönlich, und er sorgte sich um die Gesundheit eines so wichtigen Mannes. Tot war er noch nicht, doch erwartete man sein Hinscheiden täglich.
Ich erzählte dem Konsul auch von Evelyn, der schon einigen Klatsch darüber gehört hatte. Ich hatte zwei Gründe, mit ihm über Evelyn zu sprechen: erstens den, um zu erfahren, ob ihre Verwandten nach ihr geforscht hatten, und zweitens sollte jemand über ihren Verbleib unterrichtet sein, falls man solche Nachforschungen anstellte. Der Diplomat hatte keine Anfragen vorliegen, erwartete auch offensichtlich keine, denn er kannte den alten Earl zu gut. Ich versorgte ihn also mit meiner Kontaktadresse in Kairo und überließ ihn im Übrigen seinem Kopfschütteln und seinen gemurmelten Protesten, da er meine Handlungsweise mißbilligte.
Am achtundzwanzigsten gingen wir in Brindisi an Bord des Schiffes nach Alexandria.
Kapitel 2
Ich will meinen verehrten Lesern die Beschreibung der Seereise und des Schmutzes von Alexandria ersparen. Jeder europäische Reisende, der seinen Namen schreiben kann, fühlt sich zur Abfassung seiner Memoiren verpflichtet, und das ist mehr als genug. Wir kamen jedenfalls ohne Zwischenfall in Kairo an und nahmen Aufenthalt im Shepheard’s Hotel.
Jeder, der auf sich hält, wohnt bei Shepheard’s. Früher oder später trifft man dort mit Sicherheit Bekannte, und das orientalische Leben kann man bei einer Limonade von der Terrasse aus genießen. Steife Engländer reiten auf Eselchen vorüber, die so klein sind, daß die Männer ihre Füße im Straßenstaub schleifen lassen; ihnen folgen Janitscharen in prächtigen, goldgestickten Uniformen, und sie sind bis an die Zähne bewaffnet; denen folgen wiederum Eingeborenenfrauen in wallenden schwarzen und stolze Araber in wehenden blauen und weißen Gewändern, Derwische mit fantasievollem Kopfputz, Süßigkeitenverkäufer und Wasserhändler, also eine endlose, faszinierende Prozession.
Die Kämpfe im Sudan hatten viele englische Reisende vergrämt, denn der verrückte Mahdi belagerte noch immer den ritterlichen Gordon in Khartum. Sir Garnet Wolseleys Entsatztruppe hatte Wadi Halfa erreicht und würde wohl bald den tapferen Gordon aus der Umklammerung der barbarischen Armee befreien. Man hielt es daher bei Shepheard’s nicht für gefährlich, nach Süden in Richtung Assuan zu reisen.
Ich hegte zwar da gewisse Zweifel, doch ich wollte reisen, und das tat ich auch. Die einzige bequeme Methode, Ägypten kennenzulernen, ist die Reise auf dem Strom, denn alle bemerkenswerten Altertümer sind in dessen unmittelbarer Nähe zu finden. Ich hatte schon gehört, wie vergnüglich eine Fahrt mit einer Dahabije sei, also wollte ich sie ausprobieren. Man kann diese Boote mit allem erdenklichen Luxus ausstaffieren, soweit man ihn bezahlen kann, und bedient wird man wie ein König.
Aber die Auswahl einer Dahabije sei ein sehr heikles und mühsames Geschäft, versicherte man mir, und man lachte schallend über meine Zuversicht, in ein paar Tagen segeln zu können. Die Ägypter, verriet man mir, seien eine faule Gesellschaft, die sich zu nichts drängen ließe.
Ich behielt meine Meinung für mich, da mir Evelyn einen bedeutsamen Blick zuwarf. Dieses Mädchen wirkte ungemein erstaunlich auf mich; ich fürchtete, mit der Zeit könne ich sogar noch sehr sanft und mild werden. Wir waren uns darüber einig gewesen, daß sie nur als Evelyn Forbes, nicht aber unter ihrem vollständigen Namen auftreten sollte, da er zu vielen Engländern zu gut bekannt war. Wurde jemand neugierig, schützte ich regelmäßig Müdigkeit vor.
Natürlich war Evelyn manchmal bedrückt, wenn sie an die Vergangenheit dachte, doch sie verstand es auch, die Schönheiten des Landes zu genießen. Von unseren Zimmern aus konnten wir den Hotelgarten überschauen. Die hohen Palmen waren schwarze Schattenbilder im herandämmernden Morgen, wenn sich der dunkle Himmel mit durchsichtigem Licht und blaßrosa Perlenschimmer füllte. Die Kuppeln und Minarette der Moscheen überragten malerisch die Baumwipfel, und die Luft war von köstlicher, kühler Frische.
Es war gut, daß wir den Tag mit dem Anblick solcher Schönheit begonnen hatten, als wir nach dem Frühstück zur Werft von Boulaq gingen, um eine Dahabije zu mieten. Hunderte von Booten lagen dort vor Anker, und der Lärm war unbeschreiblich.
Die Boote unterscheiden sich eigentlich nur in der Größe. Die Kabinen liegen im Heck, und ihr Dach ist gleichzeitig ein Oberdeck, das sich mit Möbeln und Markisen ausstatten und so zu einem herrlichen Freiluftsalon machen läßt. Die Mannschaft bewohnt das untere Deck. Dort gibt es eine Küche, einen Verschlag mit einem Holzkohlenofen und eine Sammlung von Pfannen und Töpfen. Die Dahabijes sind Boote mit flachem Kiel und zwei Masten, und wenn die Segel sich im leichten Wind blähen, sind sie ein sehr malerischer Anblick.
Welches Boot sollten wir wählen? Nun, die Wahl war nicht allzu schwierig, denn die meisten Boote strotzten vor Schmutz. Natürlich durfte man keine englischen Maßstäbe anlegen, wenn auch die primitivsten hygienischen Einrichtungen vorhanden sein mußten. Selbstverständlich waren die größeren Boote in einem besseren Zustand als die kleinen. Es ging mir nicht um die höhere Ausgabe, sondern es kam mir lächerlich vor, für uns beide und eine Magd zehn Einzelkabinen und zwei Salons zu haben.
Evelyn bestand darauf, daß wir uns einen Dragoman nehmen sollten. Ich dachte, das sei nicht nötig, weil ich schon auf der Seereise ein bißchen Arabisch gelernt hatte, doch ich gab nach. Unser Mann war ein Kopte namens Michael Bedawee, ein dicklicher, kaffeebrauner Bursche mit weißem Turban und abenteuerlichem, schwarzem Bart; allerdings paßt diese Beschreibung auf die meisten Ägypter. Was unseren Michael auszeichnete, war sein freundliches Lächeln und die Ehrlichkeit seiner weichen, braunen Augen. Wir entschieden uns sofort für ihn, und er mochte uns offensichtlich bald sehr gern.
Michael half uns bei der Auswahl des Bootes. Die Philae war von mittlerer Größe und ungewöhnlich sauber. Der Reis, wie man den Kapitän nannte, war uns auch sympathisch. Er hieß Hassan und stammte aus Luxor. Mir gefiel sein ruhiger Blick und eine Andeutung von Humor, wenn ich meine paar arabischen Worte anbrachte, sooft es ging. Mein Akzent muß fürchterlich gewesen sein, doch Reis Hassan beglückwünschte mich zu meinen Sprachkenntnissen. Infolgedessen war der Handel bald abgeschlossen.
Wir waren stolz auf unser Schiff, das nun vier Monate lang unsere Wohnung sein sollte. Es hatte vier Kabinen, je zwei zu beiden Seiten eines schmalen Ganges. Sogar ein Badezimmer hatten wir. Am Ende des Ganges öffnete sich die Tür in einen halbrunden Salon, der das ganze Schiffsheck einnahm; ein langer Diwan folgte der geschwungenen Wand, und acht hohe Fenster ließen viel Licht ein. Den Boden bedeckten Brüsseler Teppiche, und die Wandvertäfelung in Weiß mit Goldrand erweckte den Eindruck großer, luftiger Weite. Die scharlachroten Vorhänge paßten herrlich zu den prunkvollen, goldgerahmten Spiegeln, und ein sehr hübscher Eßtisch mit passenden Stühlen vervollständigte die Einrichtung.
Schränke und Regale gab es genug, und wir hatten das Zeug, sie zu füllen. Ich hatte vor allem meines Vaters Bücher über Ägypten dabei und hoffte, noch mehr kaufen zu können. Ein Klavier wollten wir haben. Ich bin zwar völlig unmusikalisch, aber Evelyn spielte und sang sehr schön.
Das Boot war gerade von einer Reise zurückgekehrt, und Reis Hassan sagte, er brauche ein paar Tage zur Überholung verschiedener Geräte, ehe wir abreisen könnten; seine Leute wollten auch noch ihre Familien besuchen, und so legten wir, als ich bezahlte, den Reisetag auf eine Woche später fest.
Ein passendes Klavier zu finden, erwies sich als nicht leicht.
Ich wollte andere Vorhänge für den Salon, weil das Scharlachrot nicht zu meinem Abendkleid paßte. Evelyn meinte, es eile nicht so schrecklich, doch ich wußte, wie sehr sie fürchtete, im Speisesaal des Hotels Bekannte zu treffen. Die Wartezeit nützten wir gut. Die Basare in Kairo sind faszinierend. Hier gibt es keine richtigen Läden; es sind eher große, vorne offene Schränke, vor denen die Kaufleute auf gekreuzten Beinen sitzen und ihre Kunden erwarten. Bei den Teppichhändlern wurde ich schwach und kaufte etliche Stücke für unseren Salon, wahre Schönheiten aus Persien und Syrien. Ich wollte auch für Evelyn ein paar Kleinigkeiten besorgen, doch sie nahm nur ein Paar Samtpantoffeln an.
Wir besuchten auch Moscheen und die Zitadelle, und ich interessierte mich besonders für die alte Kultur; deshalb sahen wir für einen Tag unseren ersten Besuch in Gizeh vor. Wenn ich gewußt hätte, was uns da bevorstand!
Die Pyramiden besucht jeder Reisende, denn seit dem Bau der Nilbrücke braucht man vom Hotel aus nur eineinhalb Stunden Fahrzeit. Wir brachen am frühen Morgen auf, damit wir den ganzen Tag vor uns hatten.
Selbstverständlich hatte ich Bilder gesehen, doch die Wirklichkeit der Pyramiden ist überwältigend. Die glatten, steilen Steinflanken führen hoch hinauf zur Plattform. Und die Farben! Der ägyptische Kalkstein wirkt in der hellen Sonne vor dem tiefblauen Himmel so, als sei er aus mattem Gold. Die ganze ebene Fläche, auf der die drei großen Pyramiden stehen, sind mit Gräbern, kleineren und zerfallenen Pyramiden und sandgefüllten Löchern durchsetzt, und in einer großen Sandmulde erhebt sich der majestätische Kopf der Sphinx. Der Körper dieses herrlichen Werkes muß immer wieder vom Sand befreit werden. Ein solches Meisterwerk aus Menschenhand gibt es kein zweites Mal.
Wir machten uns zur größten der drei Pyramiden auf, zum Grab des Khufu. Erst in ziemlich geringer Entfernung erkannten wir die riesigen Steinblöcke, und wir überlegten uns, wie wir in den langen und ziemlich engen Röcken diese Stufen erklettern sollten.
Es gelang uns mit Hilfe von je drei Arabern. Je einer stützte uns links und rechts, ein dritter schob von hinten an, und so standen wir bald auf der Gipfelplattform. Evelyn erschien mir ein bißchen blaß, doch mich nahm die großartige Aussicht völlig gefangen. Diese Plattform hat eine Größe von etwa dreißig Fuß im Quadrat, und einige Steinblöcke, die von der abgetragenen Spitze übrig waren, dienten als Sitze. Mir tränten vom angestrengten Schauen bald die Augen.
Es war ein unvergleichlicher Anblick: im Hintergrund die Minarette und Kuppeln der Märchenstadt Kairo, im Vordergrund der grüne Streifen des fruchtbaren Niltales. Im Westen und Süden schimmerten golden die Wüsten. Am Horizont waren noch ein paar kleinere Pyramiden zu erkennen, die von Abusir, Sakkarah und Dahshoor.
Evelyn zupfte mich am Ärmel und riß mich aus meiner staunenden Begeisterung. »Könnten wir nicht absteigen?« bat sie. »Ich glaube, ich bekomme einen Sonnenbrand.« Ihre Nase war trotz des breitrandigen Sonnenhutes schon dunkelrosa, und so ließen wir uns von unseren fröhlichen Führern wieder nach unten bringen. In das Innere der Pyramide mochte Evelyn nicht mitkommen. Ich ließ sie also bei einigen Damen zurück, raffte meine Röcke und folgte den Männern in die schwarze Tiefe.
Ah, es war schrecklich! Die Luft war kaum zu atmen, am Boden lag überall Schutt, und das Licht der flackernden Kerzen wirkte unheimlich. Die Gänge sind so niedrig und steil, daß man nur geduckt kriechen kann und von den Führern gestützt werden muß, wenn man nicht zurückrutschen will. Natürlich gab es auch Fledermäuse. Doch schließlich standen wir in der Königskammer aus schwarzem Basalt, in der nur der schwarze, massive Sarg stand, in den Khufu vor gut viertausend Jahren zur letzten Ruhe gebettet worden war. Oh, es war ein ungeheuer erhebendes Gefühl, das etwa jenem glich, das ich einmal als Kind erlebt hatte. Mein Bruder William hatte behauptet, ich würde es nicht wagen, auf den Apfelbaum in unserem Garten zu klettern. Ich bewies es ihm, daß ich es wagte, und schaute vom höchsten Ast aus zu, wie er von einem der unteren Äste fiel und sich dabei den Arm brach.
Trotz meiner begeisterten Schilderung weigerte sich Evelyn standhaft, die Pyramide zu betreten.
Wir waren damals etwa eine Woche lang in Kairo, und ich hatte die begründete Hoffnung, in ungefähr zwei Wochen absegeln zu können. Ich war einige Male in Boulaq, um Reis Hassan ein wenig anzutreiben, doch nach dem Besuch von Gizeh ließ ich ihn in Ruhe. Ich hatte nämlich in mir eine gewisse Vorliebe für Pyramiden entdeckt und besuchte deshalb auch die beiden anderen Pyramiden von Gizeh und später auch die Stufenpyramide von Sakkarah. Von den kleineren Pyramiden in Sakkarah hat man die massiven Steinblöcke abgetragen und sie für andere Bauten verwendet; die Reste sind deshalb eigentlich nur noch Schutthaufen. Das war mir jedoch egal, denn Pyramiden in jeder Form waren nun meine Leidenschaft.
Ich war fest entschlossen gewesen, wenigstens eine der Grabkammern zu besuchen, die mit herrlichen Wandmalereien und Hieroglyphen-Inschriften geschmückt sind; wegen Evelyn verzichtete ich darauf, als sie das enge, dunkle Loch sah, in das ich an einem Seil hinabgelassen hätte werden müssen. Sie wurde totenblaß und drohte mir zu folgen. Da ließ ich es lieber sein.
Auch Travers mißbilligte meine Pyramidenausflüge. Etliche meiner Kleider ließen sich nicht mehr reparieren, und die anderen machten ihr sehr große Mühe. Besonders ekelte sie sich vor dem Fledermauskot, den ich gelegentlich und ohne es zu wissen mitbrachte. Einmal schlug ich einen Ausflug nach Dashoor vor, wo es einige hervorragende Pyramiden gibt, doch Evelyn weigerte sich energisch und wollte lieber das Museum von Boulaq besuchen. Das taten wir, denn nach dem Museumsbesuch konnte ich zu Hassan gehen.
Auf M. Maspero, den französischen Abteilungsleiter für Altertümer, freute ich mich. Mein Vater hatte mit ihm korrespondiert, und so durfte ich hoffen, daß mein Name ihm vertraut sei. Er war es, und wir fanden M. Maspero im Museum. Meistens ist er nämlich zu Ausgrabungen weg.
Seinen Assistenten Emil Brugsch kannte ich nur seinem Ruf nach, denn er hatte vor wenigen Jahren das Versteck berühmter königlicher Mumien entdeckt. Während wir auf M. Maspero warteten, erzählte uns Herr Brugsch die Geschichte des Fundes. Gute zehn Jahre früher hatte eine Räuberfamilie aus Theben das Versteck der Mumie gefunden, weil der sehr zwielichtige Abd er-Rasool Ahmed in den Felsen am Rand seines Dorfes namens Gurnah eine Ziege suchte. Die Ziege war in eine Felsspalte gefallen, und da machte er seinen erstaunlichen Fund – die Mumien der großen Pharaonen, die nach der Ausplünderung ihrer Gräber hier versteckt worden waren.
Brugsch hatte von Sammlern Fotos von Gegenständen erhalten, die königliche Namen trugen, und ihm war sofort klar gewesen, daß diese Dinge aus Gräbern stammen mußten. Die meisten dieser Gräber befanden sich, wie er wußte, in Theben, und so bat er die Polizei, solche Leute zu beobachten, die plötzlich mehr Geld ausgaben, als sie offiziell hatten. Der Verdacht konzentrierte sich auf die Familie Abd er-Rasool, die sich inzwischen wegen der Aufteilung der Beute zerstritten hatte; einer verriet das Geheimnis an Brugsch.
Mir lag an diesem Herrn jedoch nichts; er steht seit langem im Dienst von M. Maspero und seinem Vorgänger M. Mariette, und sein Bruder ist ein sehr bekannter Wissenschaftler. Mir gefällt seine harte Art nicht, in der er die Foltern beschrieb, welchen die Diebe ausgesetzt wurden, um ihre Geständnisse zu erzwingen. Ihm war es auch zu verdanken, daß die königlichen Toten sofort in Sicherheit gebracht wurden. Innerhalb von acht Tagen waren sie auf einer Barke nach dem Norden unterwegs. Zahllose Klageweiber hatten die Flußufer gesäumt, um die alten Könige zu beweinen.
Endlich kam M. Maspero. Er war ein stämmiger, ungemein liebenswürdiger Mann mit einem kurzgestutzten, schwarzen Bart. Als artiger Franzose beugte er sich über meine Hand und begrüßte Evelyn voll Bewunderung. Von meinem Vater sprach er in Worten höchster Verehrung. Er bat uns um Entschuldigung, weil er uns nicht persönlich im Museum herumführen konnte, versprach jedoch, später wieder zu uns zu stoßen.
Ich war froh, daß er nicht bei uns war, denn ich hätte ihm sonst sicher gesagt, was ich von seinem Museum hielt. Es enthielt selbstverständlich eine ganze Menge der interessantesten Dinge, aber der Staub und das Durcheinander! Meine hausfraulichen Instinkte fühlten sich herausgefordert.
»Vielleicht bist du jetzt nicht ganz fair«, hielt mir Evelyn in ihrer sanften Art vor. »Es gibt so unendlich viele Gegenstände, täglich kommen neue dazu, und das Museum ist trotz der kürzlichen Vergrößerung viel zu klein. Wie soll man da immer Ordnung halten und Staub wischen können?«
»Umso mehr Grund, Ordnung zu halten«, erwiderte ich. »Früher wurde alles, was die europäischen Abenteurer fanden, außer Landes geschleppt. Nun besteht doch ein Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich, das den Franzosen die Aufsicht über alle Altertümer einräumt, während unser Staat Finanzen, Bildungs- und Gesundheitswesen, Außenpolitik und so weiter überwacht. Ich glaube, englischer Ordnungssinn wäre hier eher angebracht als französische Lässigkeit.«
Wir waren inzwischen in einem abgelegenen Raum angelangt, der mit unzähligen Gegenständen wie Vasen, Perlketten, winzigen Figuren und anderen Dingen angefüllt war, die in den vorderen Räumen keinen Platz gefunden hatten. »Schau dir doch das hier an!« sagte ich zu Evelyn, nahm ein Figürchen und rieb mit meinem Taschentuch den Schmutz ab. »Sie könnten doch ...«
Da erschütterte ein fast tierisches Heulen den kleinen Raum. Ehe ich noch nach dessen Quelle Umschau halten konnte, entriß mir eine kräftige, sonnenbraune Hand die Statuette und brüllte mir ins Ohr: »Madam! Tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie die unersetzlichen Kostbarkeiten in Ruhe! Schlimm genug, daß dieser unfähige Esel Maspero sie so miserabel behandelt, und jetzt wollen Sie in Ihrer Idiotie auch noch das vernichten, was er übrig läßt!«
Ich nahm meine ganze Würde zusammen und drehte mich zu diesem Kannibalen um. Er war sehr groß, hatte Schultern wie ein Stier und einen nach der Art assyrischer Könige geschnittenen schwarzen Bart. Sein Gesicht war dunkel wie das eines gewöhnlichen Ägypters, doch daraus funkelten mich wütende grellblaue Augen an. Die Stimme kannte ich ja schon, sie war ein tiefer, dröhnender Baß; dem Akzent nach schien er ein Gentleman zu sein, den Gefühlen nach war er es nicht.
Ich maß ihn von oben bis unten. »Sir, ich kenne Sie ja gar nicht.«
»Aber ich kenne Ihre Art, Madam! Diese britischen Weiber sind doch von allen die dümmsten und arrogantesten! Oh, ihr Götter! Diese Brut ist so unnütz und aufdringlich wie ein Moskitoschwarm, und kein Fleck der ganzen Erde ist vor ihnen sicher. Zum Verrücktwerden ist das!« Jetzt mußte er dringend einmal Atem holen. Diese Pause nützte ich aus. »Und Sie, Sir, sind der überheblichste Brite mit den schlechtesten Manieren. Nun, wir britischen Frauen müssen den von den boshaften Männern verursachten schlechten Ruf reparieren, so gut es geht. Randalieren, von der eigenen Überlegenheit überzeugt sein ... «
Vorsichtshalber trat ich ein paar Schritte zurück und griff fester um den Knauf meines Sonnenschirms. Ich bin nicht klein und ängstlich, aber dieser Mann überragte mich wie ein Turm, und er machte den Eindruck, als wolle er mich mit seinen sehr großen und sehr weißen Zähnen zerfleischen.
Ich schaute auf und sah Evelyn mit einem kleineren, schmäleren, bartlosen Ebenbild meines Gegners sprechen; er war dunkelhaarig, blauäugig und groß, wenn auch nicht so bullig wie der andere, und der Bartlose legte dem Bärtigen eine Hand auf die Schulter.
»Radcliffe, du ängstigst ja diese Dame«, sagte er. »Ich bitte dich ...«
»Mich kann er nicht ängstigen«, erwiderte ich ruhig. »Aber Ihr Freund scheint einem Schlagfluß nahe zu sein. Leidet er sonst auch unter Gehirnschwäche?«
Der jüngere Mann schien nicht sehr besorgt zu sein, denn er lachte breit, und das gefiel mir. Aus Evelyns Miene schloß ich, daß wir uns da einig waren.
»Das ist mein Bruder, Madam«, erklärte der junge Mann fröhlich. »Sie müssen ihm verzeihen. Und du, Radcliffe, beruhigst dich jetzt wieder. Wissen Sie«, wandte er sich wieder an mich, »das Museum wirkt immer so auf ihn. Sie trifft keine Schuld an seiner Erregung.«
»Ganz sicher nicht!« rief ich. »Eine so unentschuldbare Unhöflichkeit ...«
»Amelia!« Evelyn versuchte mich am Arm wegzuziehen, weil der bartumrahmte Mund ein Wutgeheul ausstieß. »Wir wollen uns doch nicht weiter Grobheiten an den Kopf werfen.«
»Das liegt mir fern«, erwiderte ich kühl. Evelyn und der junge Mann tauschten Blicke, und wie auf Verabredung zerrte der junge Mann seinen aufgebrachten Bruder mit sich, während Evelyn etwas sanfter meinen Arm packte. Die anderen Museumsbesucher hatten uns voll atemloser Neugier beobachtet, gingen aber nun weiter, als rasche Schritte die Ankunft von M. Maspero ankündigten. Als er uns sah, lachte er breit.
»Ah, c’est le bon Emerson! Das hätte ich wissen können. Sie kennen einander schon?«
»Wir kennen einander nicht!« brüllte der Mann, der Emerson hieß. »Und wenn Sie, Maspero, einen Versuch dazu machen, dann schlage ich Sie mit einem Hieb zu Boden!« M. Maspero lachte schallend. »Dann versuch ich es lieber nicht ... Kommen Sie, meine Damen. Das hier ist unwichtiges Kleinzeug, ich zeige Ihnen die feineren Sachen.«
»Sie sind sehr interessant«, warf Evelyn mit ihrer sanften Stimme ein. »Ich bewundere die schönen Farben dieser Ketten.«
»Sie sind aber nicht wertvoll. Wir finden diese Ketten zu Hunderten. Es sind ganz gewöhnliche Fayencen.«
»Dann sind diese herrlichen Korallen und Türkise gar keine echten Steine?«
»Mais non, Mademoiselle, das alles sind nur Imitationen von Korallen, Türkisen, Lapislazulisteinen und dergleichen und bestehen aus einer farbigen Paste, die im alten Ägypten viel verwendet wurde.«
»Sie sind trotzdem sehr hübsch«, bemerkte ich. »Und schon das Alter dieser Gegenstände ist bewundernswert. Wenn man bedenkt, daß diese wunderschönen Perlen vor tausend Jahren um den Hals ...«
Der Schwarzbärtige wirbelte herum. »Dreitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung«, korrigierte er mich wütend. Maspero lächelte nur, nahm eine Kette aus winzigen blauen und korallenfarbenen Perlen und überreichte sie mit einer höflichen Verbeugung Evelyn. »Behalten Sie das bitte als Erinnerung an Ihren Besuch hier. Wie schade, daß ich nichts Schöneres für eine so entzückende junge Dame habe ... Und das ist für Sie, Mademoiselle Peabody.« Auch mir drückte er eine Kette in die Hand. »Tun Sie mir die Ehre, sie zu behalten, meine Damen – außer Sie fürchten den Fluch der ägyptischen Rachegeister ...«
»Ganz gewiß nicht«, versicherte ich ihm.
»Nun, und der Fluch des Mister Emerson?« fuhr er fort. »Sehen Sie, er ist schon wieder dabei, unfreundliche Dinge zu mir zu sagen.«
»Keine Angst, ich gehe schon«, knurrte Emerson. »In Ihrem Horrorhaus kann ich es sowieso nur ein paar Minuten aushalten. In aller Götter Namen, warum katalogisieren Sie nicht endlich diese ganzen Töpfe und Vasen?« Damit stürmte er hinaus und zog seinen Bruder mit sich, der aber noch einmal umschaute und Evelyn nicht aus den Augen ließ, bis sie seinen Blicken entzogen war.
»Er hat ein sehr aufbrausendes Temperament«, bemerkte M. Maspero voll Bewunderung. »Die Großartigkeit seiner Wutausbrüche nötigt einem Respekt ab.«
»Da kann ich Ihnen nicht beipflichten«, widersprach ich ihm. »Wer ist dieser Bursche eigentlich?«
»Ein Landsmann von Ihnen, Madam, der sich für die Altertümer dieses Landes interessiert. Er hat wundervolle Ausgrabungen gemacht, aber ich fürchte, für uns hat er nicht viel übrig. Nicht ein Archäologe in ganz Ägypten entgeht seiner beißenden Kritik.«
»Wir halten Ihr Museum für faszinierend«, warf Evelyn taktvoll ein.
Wir verbrachten noch ein paar Stunden dort. Nicht um die Welt hätte ich das in der Öffentlichkeit gesagt, aber ich fand Emersons Kritik mehr als berechtigt. Die Ausstellungsstücke waren unmethodisch aufgereiht, und überall lag Staub.
Evelyn war dann zu müde, um noch zum Boot zu gehen, und sie war auch sehr schweigsam und nachdenklich. »Mr. Emersons jüngerer Bruder hat nicht das heftige Familientemperament, glaube ich«, bemerkte ich während der Rückfahrt. »Hast du zufällig seinen Namen gehört?«
»Walter«, erwiderte sie und errötete.
Ich tat, als bemerkte ich nichts. »Ah, ich fand ihn sehr angenehm. Vielleicht begegnen wir ihm im Hotel.«
»Nein, sie wohnen nicht im Shepheard’s. Walt ... Mr. Walter Emerson sagt, ihr ganzes Geld werde für die Ausgrabungen ausgegeben. Sein Bruder erhält einen Zuschuß von einem Museum oder irgendeiner Institution. Sein jährliches Einkommen ist nicht sehr groß, und sein Bruder Walter sagt, wenn er alle Reichtümer Indiens hätte, so würden sie ihm für seine Arbeit auch noch nicht genügen.«
»In der kurzen Zeit hast du aber sehr viel erfahren«, stellte ich amüsiert fest und beobachtete Evelyn aus den Augenwinkeln heraus. »Wie schade, daß wir die Bekanntschaft nicht nur mit dem jüngeren Bruder fortsetzen können und dem Wahnsinnigen ...«
»Wir werden einander kaum mehr begegnen«, warf Evelyn leise ein, doch da hegte ich recht deutliche Zweifel. Nach einer kurzen Mittagspause besorgten wir die Medikamente, die unser Reiseführer für unerläßlich hielt. Südlich von Kairo gibt es noch immer kaum einen Arzt. Ich hätte, wäre ich ein Mann gewesen, allzu gerne Medizin studiert, denn ich habe dafür eine natürliche Begabung. Ich falle beim Anblick von Wunden nicht in Ohnmacht, wie viele meiner männlichen Bekannten. Selbstverständlich hatte ich auf meiner Liste auch einige chirurgische Instrumente und war durchaus bereit, im Notfall auch Gliedmaßen, mindestens einen Finger oder eine Zehe, zu amputieren.
Michael, unser Dragoman, begleitete uns. Blaue Pillen, grüne Pillen, Chinin, Rhabarberpillen, verschiedene Puder, Desinfektionsmittel, Laudanum und vieles andere, vor allem reichlich Verbandmaterial wurden nacheinander abgehakt. Michael erschien mir die ganze Zeit hindurch ungewöhnlich still, und als Evelyn ihn schließlich nach dem Grund dafür fragte, erklärte er uns, sein Kind sei krank, wenn es auch nur eine Tochter sei.
Nun, weil wir gerade die medizinische Seite unserer Reise vorbereiteten, hielten wir es für angebracht, anschließend nach diesem Kind zu sehen, denn Michael war ehrlich bekümmert.
Es war ein altes, schmales Haus mit holzgeschnitzten Balkonen von sehr schöner Arbeit; sie sind typisch für Kairo. Es erschien mir schmutzig, wenn auch nicht ganz so verwahrlost wie die Umgebung, doch das Zimmer, in dem das kranke Kind lag, sah trostlos aus. Die Holzläden lagen vor den geschlossenen Fenstern, es war stockdunkel und stank fürchterlich. Im fahlen Licht einer rauchenden, übelriechenden Öllampe sah ich auf einem primitiven Lager ein süßes kleines Ding mit großen schwarzen Augen. Die plärrende Verwandtschaft jagte ich gleich davon und ließ nur die Mutter des Mädchens bleiben, die auch kaum älter als fünfzehn Jahre sein konnte.
Evelyn kniete bereits neben dem Mädchen, schob die wirren schwarzen Locken aus dem Gesicht und verscheuchte einen lästigen Fliegenschwarm. Die Mutter wagte aus Angst vor uns nicht zu protestieren, denn Fliegen sind dort ein notwendiges Übel, das man hinnehmen muß. Deshalb sind auch sehr viele Menschen dort blind, und die Kindersterblichkeit ist überaus hoch. Von fünf Kindern sterben drei sehr jung ...
Ich sah den unglücklichen Michael an und beschloß, daß dieses Kind nicht sterben werde, wenn ich es irgendwie verhindern konnte. Wofür hatte ich so viele Medikamente gekauft?
Die Krankheitsursache war leicht zu entdecken. Das Mädchen hatte sich bei einem Sturz verletzt, und die Wunde war nicht desinfiziert worden. Sie hatte sich entzündet, und der kleine Arm war dick geschwollen. Mit einem desinfizierten Messer schnitt ich die Schwellung auf, und eine übelriechende Masse quoll heraus. Ich reinigte die Wunde und verband sie und unterwies auch die Eltern, wie sie das Kind nun zu pflegen hatten. Evelyn war mir eine große Hilfe. Übel wurde ihr erst, als wir im Hotel waren, aber da gründlich. Michael schickte ich sofort wieder nach Hause, damit er die jammernden Verwandten hinauswerfen konnte.
Abends fühlte sich Evelyn wieder einigermaßen wohl, und deshalb bestand ich darauf, daß wir unten speisten. Sie machte sich große Sorgen um ihren Großvater und quälte sich mit dem Gedanken ab, daß er allein sterben müsse. Deshalb wurde sie manchmal fast menschenscheu, was ich jedoch nicht zuließ.
In ihrem staubrosa Abendkleid mit den breiten Spitzenrüschen an den Ärmeln und dem gerafften Unterkleid sah Evelyn bezaubernd aus. Ich schlüpfte in meine karmesinrote Seide, wenn ich mich darin auch nicht ganz wohl fühlte. Wir erregten einiges Aufsehen, und etliche Gentlemen folgten uns nach dem Dinner in die Halle, hauptsächlich zu dem Zweck, von Evelyn ein Lächeln zu erhaschen. Plötzlich sah ich sie tief erröten. Ich folgte ihrem Blick und bemerkte unter der Tür den jungen Emerson, der im Abendanzug großartig wirkte. Er hatte nur Augen für Evelyn und schritt so schnell durch die Halle, daß er um ein Haar über einen niederen Tisch gestürzt wäre.
Er hatte auch seinen Bruder mitgebracht, und da mußte ich wirklich ein Lachen unterdrücken. Sein Abendanzug sah aus, als habe er ihn vor langer Zeit in eine Reisetasche gestopft und ihn jetzt wieder ausgegraben, jedoch vergessen, ihn bügeln zu lassen. Er sah wie ein riesiger schwarzer Bär aus, tappte unbeholfen hinter seinem Bruder drein und warf den elegant gekleideten Gästen mißtrauische Blicke zu. Walter begrüßte mich hastig und beschäftigte sich anschließend ausschließlich mit Evelyn. Und mir blieb der wütende Emerson, der mich voll Widerwillen musterte.
»Ich bin da, mich zu entschuldigen«, knurrte er.
»Angenommen«, antwortete ich. »Setzen Sie sich, Mr. Emerson. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Wie ich hörte, ist das gesellschaftliche Leben nicht nach Ihrem Geschmack.«
»Es war ja auch Walters Idee«, platzte er heraus, setzte sich und rückte so weit wie möglich von mir weg. »Ich hasse Dinge wie Hotels, Menschen, die ..., kurz, all dies hier.« Mit einer verächtlichen Handbewegung schloß er die großartige Halle und alle Gäste in seine Abneigung ein.
»Wo wären Sie dann lieber?« fragte ich.
»Irgendwo in Ägypten, am liebsten bei meinen Ausgrabungen.«
»In der heißen, staubigen Wüste, weit weg von jeder Zivilisation und allein mit unwissenden Arabern ...«
»Unwissend mögen sie sein, aber auf die Heuchelei der Zivilisation kann ich verzichten. Ah, wie überheblich sind besonders die englischen Touristen! Bei den Ägyptern gibt es, wie überall, auch gute und schlechte, freundliche, fröhliche und treue Menschen, auch intelligente, wenn man sie unterweist ... Jahrhundertelang wurden sie von Despoten unterdrückt, sie sind mit Krankheit, Armut und Unwissenheit geschlagen, aber das ist nicht ihre eigene Schuld.«
Mich rührte es irgendwie, daß er so nachdrücklich für die unterdrückte einheimische Bevölkerung eintrat, aber sonst mochte ich ihn noch immer nicht.
»Sie müßten dann aber zu schätzen wissen, was die Briten für dieses Land tun. Die Finanzen zum Beispiel ...«