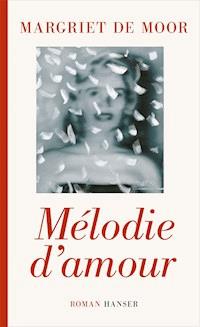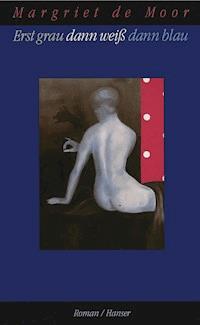Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum erschlug die achtzehnjährige Elsje, gerade erst nach Amsterdam gekommen, ihre Zimmerwirtin mit einem Beil? Und warum hat sie nicht bereut? Dann hätte man ihren Leichnam begraben und nicht zur Abschreckung öffentlich ausgestellt. Und was veranlasste den Maler Rembrandt, dessen Name nicht genannt wird, sich zu dem Leichnam zu begeben und ihn mit wenigen Strichen für immer festzuhalten? Margriet de Moor schreibt einen großen Roman über die Malerei, die Liebe und den Tod im Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Wie eine Malerin wechselt sie in diesem Krimi zwischen Hell und Dunkel und verschränkt die gegensätzlichen Geschichten zu einer spannenden, ergreifenden Erzählung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margriet de Moor
Der Maler und das Mädchen
Roman
Aus dem Niederländischen
von Helga van Beuningen
Carl Hanser Verlag
Die niederländische Originalausgabe erschien 2010
unter dem Titel De schilder en het meisje bei De Bezige Bij in Amsterdam.
ISBN 978-3-446-23698-1
© Margriet de Moor 2010
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2011
Satz: Gaby Michel, Hamburg
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.margriet-de-moor.de
Mein junges Leben hat ein End …
Jan Pieterszoon Sweelinck, Bearb. Louis Andriessen
Doch die Judenbraut – welch ein intimes, welch ein unendlich sympathisches Bild …
Vincent van Gogh
Inhalt
1 Damals, hier 7
2 Kranke, blinde, fehlende Augen 12
3 Die auf dem Kopf stehende Stadt 21
4 Das Glück machte ihre Persönlichkeit aus 33
5 Elsje Christiaens 38
6 Im Geschäft 48
7 Sonnenlicht, Stubenlicht 60
8 Komm du auch 72
9 Geh nicht so leicht in diese gute Nacht hinaus 84
10 Wegen eines Talers! 93
11 Anfall von Heftigkeit 107
12 Leise treiben die Schneeflocken 117
13 Wenn eine Frau will (1) 130
14 Spiegel und Testamente 139
15 Rot 150
16 Der Aufschub 170
17 Sie und die Ochsen 179
18 Unter Kollegen 191
19 Das cremeweiße Tribunal 201
20 Das Beil 213
21 Wie es zuging. Wie es kam 218
22 Das Beil, noch immer 225
23 Die schöne und gewinnbringende Reue 237
24 Töten, morden 248
25 Ich hab’s gesehen 256
26 Die Häßlichkeit 267
27 Die Trauergondel 277
28 Wenn eine Frau will (2) 285
29 Noch nicht 295
1 Damals, hier
An dem Tag, an dem das Mädchen erdrosselt werden sollte, war der Maler schon morgens in die Stadt gegangen. Normalerweise wäre er zu dieser Stunde bei der Arbeit, jetzt ging er die Rozengracht entlang. Nach zehn Uhr und sehr schönes Wetter. Seine Stimmung, die die ganze Woche über bedrückt gewesen war, entspannte sich. Die ersten Maitage sind von Natur aus fröhlich, an den Sommer mit seiner brütenden Hitze denkt man noch nicht. Im Morgenlicht bestehen die Häuserfassaden aus Grau- und Brauntönen, Schwarz braucht man dafür nicht, und der Himmel darüber ist von einem nicht zu benennenden Blau. Er überquerte die Straße. Seine Stirn mit den vielen waagrechten Falten verlieh ihm das Erscheinungsbild eines Denkers, der er auch war. Maler pflegen mit den Händen zu denken.
Wo die Rozengracht die Prinsengracht kreuzte, fiel ihm auf, wie voll es war. Alles zog in Richtung der Brücke über den Nieuwezijds Achterburgwal. Was wollten die alle dahinten, beim Rathaus? Denn wer hier ging, war in Richtung Dam unterwegs. In der Biegung, ein paar Schritte weiter, blieb er stehen und bückte sich, um sich zu erkundigen. Am Fuße der kleinen Treppe zu einem Dienstboteneingang war eine Frau gerade dabei, die Haustür mit beiden Händen zuzudrücken.
»Was geht hier vor?«
Die Dienerin blickte über die Schulter. Sie sah einen älteren Herrn mit durchdringendem Blick, der nicht wußte, was ihrer Meinung nach die ganze Stadt schon seit Tagen wußte. Sie stieg die Stufen hinauf.
»Wissen Sie das denn nicht?!«
Heute sei Gerichtstag.
Er reagierte nicht.
Es gebe eine Hinrichtung auf dem Dam.
Aha, sagte er mit einem Kopfnicken und wollte schon weitergehen, doch die Frau starrte ihn immer noch eindringlich an. Das Besondere kam also noch. Er sah, wie sich ihre Wangen und ihr Mund kurz verzerrten, in den Augen blitzte Neugier auf, brennend wie ein starkes Verlangen.
»Eine Frau«, sagte sie. »Ein Mädchen. Erst achtzehn.«
Sie machte einen Schritt zur Seite, um ihn vorbeizulassen.
»Es findet um elf Uhr statt«, sagte sie noch.
Als er weiterging, war er im Prinzip noch immer auf dem Weg in die Warmoesstraat, um bei einem seiner Lieferanten Material für ein Gemälde einzukaufen, ein im Werden begriffenes Werk, das zu diesem Zeitpunkt bereits weit an seinem Verstand und auch an seinen Gedanken vorbeigestrebt war und daher wie ein Magnet an ihm zog. Ein Liebespaar, zwei Personen in Gold und Rot, in einen dunklen Raum gesetzt. Ausnahmsweise war das Bild nicht unmittelbar für einen Käufer bestimmt, bis zu dem Moment, da er dringend Geld benötigte, gehörte das, was es darstellte, ihm. Doch was er soeben erfahren hatte, hatte sich bereits in sein Herz geschlichen und würde dort, Beachtung fordernd, bleiben. Hinrichtungen gab es in der Stadt natürlich regelmäßig. Einige sahen sich das an, das heißt, mindestens ein paar hundert Leute, und wenn der Fall die Phantasie ansprach, waren es mitunter mehr als tausend, andere taten es nie.
Als Kind, in Leiden, hatte er natürlich Hinrichtungen durch Erhängen gesehen. Durch Erdrosseln nie. War das weiblichen Kriminellen vorbehalten? Sitzend. Fand man das vielleicht schicklicher?
Im Ohr noch die paar Worte, die ihm berichtet hatten, was hier bevorstand, bereits im Begriff war, im Leben eines erst achtzehnjährigen Mädchens zu geschehen, erreichte er die Brücke in dem Moment, als die Glocken zu läuten begannen. Zunächst etwas weiter weg, dumpf, träge, schon bald übertönt vom schweren Dröhnen der Westerkerk genau über seinem Kopf.
Die übertreiben, dachte er.
Tatsächlich machten die Kirchen heute mehr Tumult als üblich, und das war verständlich. In dieser Stadt war schon seit langem keine Frau mehr vom Leben zum Tode gebracht worden, genau gesagt, seit einundzwanzig Jahren. Männer dagegen regelmäßig. Diebe, Gewalttäter, Rückfällige, irgendwann war man das Theater leid und band sie aufs Rad oder hängte sie auf.
Obwohl der Dam auf seinem Weg lag, bewirkte der Trubel, daß der Maler, jetzt auf andere Weise, zwingend, in die Menge aufgenommen, dorthin gezogen wurde. Es ging ihm auf die Nerven. Vor kurzem hatte er in einem Buch die Darstellung eines Götzenbilds gesehen. Es hatte den gehörnten Kopf eines Büffels und vier gekrümmte Menschenarme. An bestimmten Tagen, so hatte er mit Interesse gelesen, wurde im Inneren der Figur ein loderndes Feuer entzündet, und das Volk erhielt die Gelegenheit, den Gott dadurch gnädig zu stimmen, daß man ein Opfer in seine glühenden Arme legte, Früchte, lebende Vögel, Säugetiere, einen Sklaven, einen Gefangenen oder, was die Gottheit am meisten schätzte, ein Kind.
Das eigene Kind opfern, nach reiflicher Überlegung, nachdem man ihm zuvor wie einem Stück Federvieh die Füße zusammengebunden hat. Damit überschreitet man doch eine Grenze. Haben diese Wilden in einem Idiom, das wahnsinnig erscheint, es aber möglicherweise nicht ist, die Sprache ihres Gottes entdeckt?
Er überlegte, ob er nicht besser nach links abbiegen sollte. Ihm war nicht nach Hinrichtungen, weder nach denen der Menschen noch nach denen Gottes. Vor nicht mal einem Jahr war seine Frau gestorben. Über eine der Brücken beim Nieuwe Dijk kam man genausogut auf die andere Seite des Damrak. Inzwischen sah er bereits riesengroß, gelblich-weiß, in Bodennähe schlammiggrau verfärbt, die Rückseite des Rathauses aufragen, das die gesamte Umgebung völlig erschlug. Dort, rechts, in einer der unterirdischen Zellen, saß also dieses Kind, und darüber erhob sich eines der mächtigsten Bauwerke Europas, ein Spektakel von perfekt aufeinander abgestimmten Längen und Höhen, allesamt exakt berechnet und mit hochmütigem Willen vom Bauleiter bis hin zum Maurer strikt befolgt, das eine einzige Botschaft ausstrahlte.
Dies ist Amsterdam, dies ist die Welt.
Er faltete die Hände auf dem Rücken, ging langsamer. Das Gebäude, in dem er oft genug gewesen war, öffnete sich vor seinem geistigen Auge wie ein Kartenhaus. Treppen, Galerien, Amtsräume, alles um den funkelnden Saal herum gruppiert, der das Eigentum der Stadtbevölkerung war, der moralische Besitz der Bürger, die das vollste Recht besaßen, wann immer sie Lust dazu verspürten hier einzutreten, sich umzusehen, Geschäfte abzuwickeln und in ihren Schlupfschuhen über die in den Marmorfußboden eingelegten Kreise mit den Himmels- und Weltkarten zu gehen.
Von einer Idee übermannt blieb er stehen. Solche blitzartigen Einfälle mußte man ernst nehmen. Ein Mann mit einem Hündchen im Arm prallte gegen ihn. Die beiden sahen sich auf kaum eine Handbreit Abstand an, nicht länger als eine Sekunde, in der der eine dachte: Warum sollte ich zwei so vollkommene Kreise nicht mal übereinandersetzen als Hintergrund für ein Männerporträt? Und in der der andere gar nichts dachte, weil sein Kopf voll war vom Glockengeläut, dem dröhnenden Aufruf, der zweifellos bis tief ins Gebäude hinein zu vernehmen war.
Sie würden jetzt gleich mit der jungen Verbrecherin beten.
Danach würden sie sie ein letztes Mal fragen, ob sie bereue.
Das halsstarrige Ding würde nein sagen.
2 Kranke, blinde, fehlende Augen
Er bog links ab, nach einem verärgerten Blick auf das Bauwerk, das einen unnahbaren Blick zurückwarf, und zwar vollkommen zu Recht. Wunder haben immer recht. Der Erbauer dieses Wunders hier, ein trunksüchtiger Streithammel, aber doch einer, der seinen Vitruv kannte, hätte einige eiserne Argumente seines heidnischen Kollegen bedingungslos unterschrieben. Jawohl! Grandios denken heißt kurz denken. Mit sehr klarem Kopf hatte er sich an den Zeichentisch gesetzt.
Das Bauwerk der Schöpfung ist vollkommen dank seiner vollkommenen Proportionen. Die Schöpfung, sprich: Gott, denkt symmetrisch. Dessen dem gesamten Universum auferlegte arithmetische und geometrische Maße gelten selbstverständlich auch Seinem Produkt Nummer eins. Uns. Soll ein Gebäude die Vollkommenheit der Schöpfung widerspiegeln, konzipiert man es deshalb tunlichst analog zu unserem Menschenkörper.
So kommt es, daß dem Amsterdamer, wenn er am Rathaus vorbeigeht oder es betritt, ein paar kolossale, noch aus der Zeit vor dem Jahr Null stammende Weisheiten verabreicht werden. Verstehen muß er sie nicht. Er braucht sich lediglich die Maße der Fassade und die Plazierung der Fenster, Kapitelle und Frontispize anzusehen, und seine Erkenntnis entrollt sich wie eine Fahne. Auch du, Vorbeigehender, bist nach dem arithmetischen und geometrischen Ebenbild Gottes erschaffen. Strecke deine Arme schräg nach oben, spreize die Beine, nimm Bleistift und Lineal und ziehe von Fuß zu Fuß und von Hand zu Hand ein Quadrat. Es wird gleich Seinem Quadrat mit den Eckpunkten genau in Seinen Kreis passen!
Ein großes Mirakel, nachweislich wahr.
Das junge Weltwunder ruht auf einem Skelett aus Tausenden von Kiefernstämmen. Sie wurden von Amsterdamer Arbeitern singend und brüllend durch den Sumpfboden in den festen Sand in zwölf Meter Tiefe gerammt. Grobe, unsichtbare, selbstentäußernde Arbeit. Doch wer das Gebäude betritt, sieht sofort, daß Zupacken in dieser Stadt auch unerhört grandios, schamlos selbstgefällig sein darf. Künstler müssen sich selbst großartig finden. Nur ein bißchen gut reicht nicht. Die Skulpturen, Fenster, Leuchter, Gemälde, Reliefs und Mosaiken des Interieurs sind denn auch samt und sonders meisterhaft entworfen und ausgeführt. Wir Bürger, Eigentümer dieser glänzenden Schau, stellen fest, daß die Welt mit ein paar kundigen Händen gestaltbar ist.
Ausländer schweigen meist eine Weile fassungslos.
Dann: »Ähm … der Petersdom ist größer.«
»Na schön, aber das ist ein kirchliches Bauwerk.«
»Soweit ich weiß, ist der Dogenpalast in Venedig mindestens so groß und ganz sicher genauso schön.«
»Den darf man als normaler Bürger aber nicht so einfach betreten.«
»Die Uffizien in Florenz …«
»Das gleiche, mein Herr, genau das gleiche, da kommt man auch nicht so einfach hinein!«
Auch der Maler war mit seinen Gedanken noch im Rathaus. Auf dem Weg zur zweiten Brücke am Nieuwe Dijk, nicht zu der ersten, die lag ihm etwas zu nah bei dem bevorstehenden gewaltsamen Tod, ging er den Nieuwezijds Achterburgwal entlang, war in Wirklichkeit aber noch dort.
Erster Stock. Zeit der Handlung: vor einem Jahr und neun Monaten. Auf einer der Galerien des Bürgersaals hängt in sieben Meter Höhe das größte und gewagteste Werk, das er je malen sollte, ein Historienbild, die Demütigung seines Lebens.
Sie hatten zu fünft dagestanden und nach oben geblickt, er und die vier Mitglieder des Kunstausschusses, der aus einem Holzhändler, einem Schiffsmagnaten und zweien der vier Bürgermeister der Stadt bestand, alles sehr reiche und feine Leute. Der August war naß in dem Jahr. Draußen strömte der Regen, drinnen brannten Kerzen und Fackeln, aber es blieb eher düster. Alle fünf hatten das Bild bereits gesehen, dennoch waren sie, einer wie der andere, von neuem überwältigt, auch der Maler selbst. Die einschüchternde Wirkung des Gemäldes lief darauf hinaus, daß die reale Welt – Treppen, Wände, Beleuchtung, fünf echte Männer – ohne nennenswerte Begrenzung in eine sechs Meter breite und mehr als fünf Meter hohe Doppelwelt überging, in der das Licht heller war, der Raum geräumiger und die Männergruppe an dem langen Tisch wesentlich wirklicher als die Männer, die sie in diesem Moment betrachteten. Die dominierende Gestalt der Tafelrunde war ein grobschlächtiger Hüne, Typ Banditenkönig, aber mit einer Art Tiara auf dem Kopf, also eigentlich ein Papst. Stiernacken. Das Schwert gezückt in der Faust. Als wären sie irgendeiner Höllenschmiede entstiegen, saßen sie in einem glühenden Rampenlicht beisammen.
Der Maler hatte abgewartet und dem schweren Atmen um sich herum gelauscht. Manchmal benötigt Wut eine Weile, um sich warmzulaufen. Ein Mensch wird böse, weiß aber nicht immer gleich, warum.
»So geht das nicht«, hörte er murmeln.
Der Holzhändler.
Mit seinen hohen Wänden, Bögen und der Treppe hatte das Interieur in dem Gemälde viel Ähnlichkeit mit dem des Rathauses, allerdings war es höhlenartiger, gefährlicher. Durch die unverschämt steile Perspektive schaute man gleichsam wie aus einer Erdgrube zu der Männergruppe empor, die eindeutig irgendeinen Plan schmiedete – du bist tot, die da leben.
»Nein, so geht das nicht.«
Der Schiffsmagnat.
Sie hatten ihre Betrachtung fortgesetzt – das Bild strahlte Ernst, Freiheit, Alkohol und Blut aus, das sind Dinge, die locken –, und danach hatten die vier Regenten noch einmal genauer hingeschaut: Es strahlte, an diesem säkularen Ort in der kalvinistischen Republik, auch eine Art unangebrachter Heiligkeit aus. Die gezückten Schwerter, die Gesichter, das Tafelgeschirr, der Gefolgsmann, der, als hinge sein Leben davon ab, einen Kelch anbetet – ein übrigens meisterhaft gemaltes Glas, das sahen sie durchaus, in den Farbtönen, die auf einer Palette schlammig und rotzartig aussehen mögen, sich auf einer Leinwand jedoch äußerst hell und licht zeigen.
Der Maler wartete ab, als gehöre er nicht dazu. Was wollten sie? Er konnte keine Gesichter lesen, nicht im wahren Leben, nicht ohne den Geruch von Harz und Leinöl, ein Stück Holzkohle genügte auch. Also, was wollten sie? Ein paar Anpassungen, nicht zu weitgehend, hätte er natürlich jederzeit vornehmen können. Da räusperte sich der Holzhändler, den Blick noch immer auf den riesenhaften Barbaren gerichtet, den Anführer, der auftragsgemäß den allerersten niederländischen Widerstandskämpfer hätte darstellen sollen, wie er in einem nächtlichen Wald eine Verschwörung gegen die Römer anzettelt.
Die Stimme klang leise, aber empört, als habe der Mann nur mit Mühe sein »gottverdammt noch mal« hinuntergeschluckt.
»Sieht aus wie irgend so eine heidnische Version von Jesus beim Letzten Abendmahl.«
Daraufhin hatte der Maler gespürt, wie sie sich entspannten. Wie den anderen klar wurde, daß sie also richtig gesehen hatten. Alle vier schauten jetzt vom Gemälde zu ihm, doch er sagte nichts, nickte nur unbestimmt. Die Demütigung nahte, war aber noch abstrakt. Hatte noch nicht die Gestalt eines normalerweise für den Transport von Bier verwendeten Pritschenwagens angenommen, der mit viel Lärm die Rozengracht entlanggerollt kommt und vor Haus Nummer 184 anhält. Das würde erst einige Tage später geschehen.
Noch bevor an die Tür geklopft wurde, würde seine Frau sie öffnen.
»Ach, du meine Güte! Sie haben es schon gebracht!«
Er und sie würden sich auf halber Treppe entgegenlaufen, er vom ersten Stock, wo er am Arbeiten war, sie von der offenen Haustür, durch die man auf der Straße das Pferd sehen konnte, den leeren Bock und ein Stück der peinlichen, bis zur Deichsel nach vorn geschobenen Ladung, ein nachlässig gerolltes fahlgraues Ding, zusammengeklappt zu ein paar Metern Durchmesser.
Noch nicht. Stand noch nicht mal zur Debatte. Die fahlgraue Rolle hing in diesem Moment noch prächtig ausgebreitet, sämtliche Farben nach außen, an einem der ehrenvollsten Orte, an denen sie nur hängen konnte. Eigentlich zweite Wahl, stimmt, aber trotzdem. Unterdessen brachte die Kommission kritische Bemerkungen über den wüsten Stil des Werks vor, Argumente, die ganz gewiß relevant waren, seinem Schöpfer jedoch nur ein Lächeln entlockten – dies ist, verflixt noch mal, meine beste Gruppe, besser noch als die Schützen, die jetzt doch schon an die zwanzig Jahre ohne nennenswertes Genörgel in De Doelen hängen!
Sein Lächeln wirkte irritierend.
»Ein Pinsel ist kein Hackebeil«, tönte es böse.
»Manchmal schon«, sagte der Maler.
»Das ist einfach so hingeschludert.«
Der Maler verneigte sich.
Einer der Bürgermeister öffnete nun eine blaßgrüne Mappe, nahm eine Zeichnung heraus und wollte ihm die reichen. Doch der Maler rührte keinen Finger.
Er kannte den Entwurf, das wußten sie doch.
Als das Rathaus acht Gemälde benötigte, um lauthals zu verkünden, wir, die Bataver, hätten seinerzeit Cäsar glatt besiegt, ging der Auftrag an einen seiner ehemaligen Schüler. Ein außerordentlich geschickter Bursche und, wenn es nach den Amsterdamern ging, zu diesem Zeitpunkt genauso berühmt wie der Grieche Apelles, der Maler aller Maler, von dem niemand je ein Werk gesehen hatte oder je sehen würde, sie bestanden lediglich in Worten. Doch welches Talent ist einer solchen Herausforderung gewachsen: acht Gemälde zu malen, die einem, zusammengenommen, die Möglichkeit eines grandiosen Lebenswerks vorgaukeln, ein für allemal? Und tatsächlich, die vorbereitenden Skizzen waren noch nicht fertig, da starb der Glücksvogel, unklar, woran genau, vielleicht aber doch an mangelndem Talent.
Die Demütigung, nun sehr nahe, war unvermeidlich geworden, als die Diskussion sich dem Auge, dem fehlenden Auge des batavischen Widerstandskämpfers zuwandte.
»So ein abscheulicher Spalt«, murrte einer.
»Ja, so eine Verstümmelung, mitten im Gesicht!«
Der Blick des Malers wurde lebhafter. Wenn er an irgend etwas mit faszinierter Zufriedenheit denken konnte, dann an diese leeren Augenhöhlen, die Blinden und Einäugigen, die seine Leinwände und Holztafeln und Kupferplatten fast zwanghaft schmückten.
»Dieses Auge, ja …«
Zustimmend blickte er noch einmal hinauf zu der breiten, doppelten Kruste eines zugenähten Augenlids.
»Scheint er verloren zu haben. Ich nehme an, Sie wissen das, Tacitus ist da sehr deutlich.«
Sie nickten, hielten ihm die Skizze seines ehemaligen Schülers unter die Nase und sagten, ein sachkundiger Maler verfüge über andere, eigene Möglichkeiten. Er starrte sie abwesend, leicht schwindlig im Kopf an. Gerade waren ihm zwei glänzende Fälle von Blendung in den Sinn gekommen, Themen, denen er bereits einige sehr gelungene Bilder gewidmet hatte. Die Begleitumstände jener beiden alttestamentarischen Vorfälle, erkannte er nun plötzlich, waren auf höchst verabscheuungswürdige Weise miteinander verwandt. Als dem schlafenden Simson das Ende eines glühenden Stabs in die Augen gedrückt wurde, erst in das eine, dann in das andere, träumte er gerade, er läge noch immer mit dem Kopf im Schoß der Frau, in die er heftig verliebt war. Als der rechtschaffene Tobit eine Ladung Spatzendreck abbekam, lag er mit offenen Augen unter einem Baum und dachte an Gott.
»Hier, bitte«, sagten sie, den Zeigefinger auf der Skizze. »Ein Mann, der große Entscheidungen trifft, muß ganz besonders gut sehen können. Das hat Ihr verstorbener Kollege trefflich verstanden. Man kann einen Anführer mit einer Augenverletzung auch im Profil darstellen.«
Er hatte höflich die geschlossene mandelförmige Linie eines starrenden Auges betrachtet.
»Schade. Das geht so nicht.«
Die Regenten wechselten Blicke und entschieden. Die Demütigung war beschlossene Sache. Er war unterdessen in Gedanken bei seinem Vater, der in den letzten Jahren vor seinem Tod erblindet war.
Die Erinnerung stammte von einem Wintertag, als er mitten am Vormittag seine Pinsel abgewischt und seine Hauspantoffeln gegen ein Paar Schuhe gewechselt hatte, weil er plötzlich meinte, er sollte seinen alten Vater jetzt, da es noch möglich war, häufiger besuchen. Er war Anfang zwanzig, wohnte und arbeitete aber bereits in einer eigenen Wohnung. An jenem Tag wehte ein eisiger Wind. Leiden ist eine dicht bebaute Festungsstadt, doch an jenem Vormittag schien der Wind in einer einzigen, nicht abreißenden Bö geradewegs vom Pol durch alle acht Tore zugleich zu blasen. Über dem Galgewater flogen wie immer unzählige kreischende Möwen. Weiße Raubtiere, auf der Jagd nach Nahrung, egal, ob lebend oder tot. Er sah sie hart über die eingefrorenen Schuten schießen. Beim Haus im Weddesteeg angelangt, gelang es ihm erst durch einen Stoß, die klemmende Haustür zu öffnen. Da ertönte, gleichzeitig mit dem Kreischen des Holzes, ein Schrei aus dem Dunkel. Im nächsten Moment sah er seinen Vater, aufrecht in der lediglich vom Herdfeuer erleuchteten Küche, mit tastenden Armen auf sich zukommen. Die Augen in dem vom Feuer abgewandten Gesicht waren schwarz. Sie waren flehend, ratlos genau neben die Stelle gerichtet, an der er stand.
Die Fackeln flackerten. Der Vorsitzende der Kommission, einer der Bürgermeister, hatte ihm mitgeteilt, was sie zu ihrem Bedauern nicht umhingekommen waren zu beschließen. Drei von ihnen hatten ihn daraufhin mit einer Handbewegung gegrüßt und sich über die Galerie von dannen gemacht. Der vierte leistete ihm, von einem Hustenanfall festgehalten, noch kurz Gesellschaft, eifrig mit seinem Taschentuch hantierend.
Das irritierte ihn.
»Einen Schluck Bier bekommt man da unten!«
Der Mann nickte, drehte ihm jedoch lediglich den Rücken zu und gab seine Tränen und Atembeklemmung voll dem Gemälde preis.
Folglich nahm der Maler nicht weiter von ihm Notiz, schüttelte den Kopf und ging, ohne sich noch ein einziges Mal nach der perspektivisch vollkommenen Komposition umzusehen. Die echte Wand und der echte Fußboden darunter waren nichts weiter als Stichwortgeber für eine andere Architektur. Was in dieser anderen Architektur geschah, ein viele Jahrhunderte zurückliegendes Ereignis aus der nationalen Geschichte, fand aus einem blendenden Helldunkel subtil und ganz von selbst den Weg ins Hier und Jetzt: Niederländer sind treu, zuverlässig, fromm, unternehmungslustig, offen, geradeheraus, ehrlich, rebellisch, kaltblütig, unbeugsam und erschreckend kampflustig.
3 Die auf dem Kopf stehende Stadt
Verstimmt durch das Glockengeläut und nicht willens, sich auch nur in Gedanken damit zu befassen, ging er den Nieuwezijds Achterburgwal entlang, ein Straßenname, der einige Jahrhunderte später vom Stadtplan verschwunden sein würde, jetzt aber noch für eine breite Wohngracht mit einer Uferbefestigung bis zum Hafen stand. Wie überall in der Stadt wurde hier wieder einmal gegraben und Schlamm weggekarrt. Arbeiter waren dabei, mittelgroße Pfähle in den Boden zu rammen, sie taten das mit Hilfe einer Marie, eines Pfahls mit einem Hohlraum, den sie quer auf das obere Ende eines senkrechten Exemplars setzten und an den sie sich dann mit sechs Mann hängten und zogen. Wegen des Lärms der Glocken verrichteten sie ihre Arbeit mürrisch und schweigend, normalerweise hätten sie, um im Rhythmus zu bleiben, in allen möglichen Variationen ein Lied gesungen, das mit den Worten begann: Runter! Runter! Runter, Marie!
Vor dem Geschäft, in dem er Stammkunde war, blieb er gewohnheitsgemäß stehen und spähte eine Weile ins Schaufenster. Waffen, Skulpturen, zu Stein gewordene Tiere, die als Art schon seit Jahrtausenden nicht mehr existierten, toter als tot, die man aber trotzdem in die Hand nehmen, betrachten und, wenn man bei Kasse war, als Besitz erwerben konnte. Sein Blick blieb an ein paar Büchern auf einem Tisch direkt hinter dem Fenster hängen. Hebräische, portugiesische und lateinische Titel. Handelten alle von Gott. Nach den Worten seines Sohnes war vor einer Weile ein gelehrter Jude in dieser Stadt herumgelaufen, der mit guten Argumenten behauptete, Gott sei die Summe all dessen, was existiert und geschieht.
»Also einschließlich meiner Zahnschmerzen?« hatte er verdrießlich gefragt, denn das Thema war zu einem Zeitpunkt zur Sprache gekommen, als es in seinem Kiefer zu pochen begann, wahnsinnig vor Schmerzen würde er erst einige Stunden später werden.
Sein Sohn, schnell von Begriff, schnell von Gefühl, hatte ihn erschrocken angesehen. Sie kannten einander. Sie kannten einander so gut, daß, wenn der Vater seine Zahnschmerzen erwähnte, sie sich beide sofort darüber im klaren waren, daß Zahnschmerzen Zahnschmerzen sind, aber auch etwas Skandalöses, etwas Unerträgliches, das zu den Dingen gehört, die es in einer ordentlichen Schöpfung nicht hätte zu geben brauchen. Der Sohn sah seinen Vater düster an. Der schwere Tod, den seine Stiefmutter gestorben war, voller Protest, sie wollte nicht sterben, lag da erst wenige Monate zurück.
Die beiden hatten ihr Gespräch im Stehen in der Küche begonnen, an einem unfreundlichen Herbstabend gegen elf.
»Einschließlich deiner Zahnschmerzen.«
Der Sohn, der die zweite Frau seines Vaters bedingungslos geliebt hatte, stellte eine Flasche Korn auf den Tisch.
»Probier den mal.«
Der Maler und sein Sohn hatten sich einander gegenüber an den Tisch gesetzt. Es war sehr still im Haus gewesen, der Regen hatte für den Moment aufgehört, das Töchterchen und das Dienstmädchen waren bereits im Bett. Der Sohn, vor einer Viertelstunde nach Hause gekommen und noch immer in seinen Mantel gehüllt, hatte mit hochgezogenen Schultern weiter von dem geheimnisvollen Gespräch erzählt, in das er in einer Kneipe am Zeedijk geraten war.
»Diese Kneipe gleich um die Ecke? Zum Storchen?«
Ein stechender Schmerz. Der Maler warf den Kopf zurück und kippte den Schnaps hinunter.
»Ja. Geht’s?«
Als Antwort wischte sich der Maler mit dem Handrücken über den Mund. »Halleluja!« fluchte er zwischen den Zähnen und mit zugekniffenen Augen. Nach einer Pause beugte er sich über den Tisch und sah seinen Sohn interessiert an.
»Mit wem hast du denn da gesessen?«
»Mit zwei Männern, Stammgästen. Sie haben anschreiben lassen.«
Sein Sohn schenkte ihm noch einmal ein.
»Und einer von denen war dieser gelehrte Jude?«
»Nein, sie erzählten, daß der zur Zeit in Rijnsburg wohnt. Aber sie hatten ihn erst vor kurzem getroffen, hier in der Stadt, bei irgendeinem ehemaligen Jesuiten, einem Familienvater, der jetzt fünf Kinder hat, und sie wußten noch ziemlich genau, was er alles gesagt hat.«
Der Maler fragte, um zu fragen. Der Schmerz begann sich zu mäßigen, wie ein Hund, der sich in seine Hütte verkriecht, doch darauf verlassen konnte man sich nicht.
»Was denn?«
Während er sich berichten ließ, was die Stammgäste von den Worten des Juden weitergegeben hatten, hörte er, wie draußen Wind und Regen wieder zunahmen. Die Bibel sei keine Quelle exakten Wissens, sondern eine Sammlung von zweitausend Jahre alten Geschichten. Er nahm die Flasche, meinte: »Gut gesagt!« und hob den Kopf. Irgendwo klopfte es. An der hinteren Hauswand, rechts, mochte sich ein Stück der Regenrinne verschoben haben, falls dem so war, hatte sich jetzt das Fallrohr gelöst.
»… und er hat auch behauptet, sagten sie, daß man alles, wonach sich ein Mensch im Leben sehnen kann, mit einer ganz einfachen kleinen Zeichnung darstellen kann, einer der banalsten geometrischen Formen, die es gibt, dem gleichseitigen Dreieck. Die drei Linien, hatte er gesagt, sind die drei größten menschlichen Leidenschaften. Während er diese Linien in die Luft malte, hatte er die Leidenschaften auch genau benannt, aber sie hatten wegen des Alkohols nur eine behalten, die Basis. Nun ja, das war aber auch die wichtigste.«
Aus dem Klopfen war ein Reiben von Holz an Stein geworden. Der Maler war aufgestanden, hatte die Zwischentür geöffnet und war zum Fenster in dem kalten, dunklen Hinterzimmer gegangen, wo die zum Verkauf bestimmten Gemälde standen oder hingen.
»Und welche wäre das?« hatte er geflüstert, während er mit dem Arm über die beschlagene Scheibe fuhr. Ein Wasserstrahl war fröhlich plätschernd auf dem Weg zu den Ritzen im Blechdach, unter dem das Brennholz für den kommenden Monat lagerte.
Bevor sein Sohn in der Küche antwortete, langsam, mit so einer Stimme, wie wenn man Selbstgespräche führt, war er schon zu dem dreieckigen Stuhl gegangen, auf dem die Katze tagsüber schlief.
»Daß jedes Wesen, so elend es ihm auch ergehen mag, immer alles daransetzen wird, am Leben zu bleiben. Nur das. Dasein und dableiben.«
Er hatte das Kissen weggeschleudert, das Ding bei den Beinen gepackt und über seinen Kopf gehoben. Anstatt es mit aller Kraft gegen die Fensterscheibe zu schleudern, war er einige Augenblicke so stehen geblieben und hatte es dann ganz behutsam wieder abgestellt.
Er hatte ihre letzte Stunde nicht mit ansehen können.
Eine sechsunddreißigjährige Frau, eine Woche zuvor noch blond und blühend, die vom Bett aus mit glitzernden, blutroten Tieraugen um sich blickte auf der Suche nach Rettung. Als sie ihn entdeckte, war er bereits an der Tür. Das letzte, was er noch bemerkt hatte, bevor er aus dem Sterbezimmer floh, war, daß sein Sohn auf den Stuhl neben ihrem Bett kroch, sich dicht zu ihr beugte, sehr gefährlich, am Rande des Selbstmords, und ihr etwas ins Ohr zu flüstern begann.
Er liebte Spitznamen. Seine erste Frau hatte er die Kleine Rote genannt (sie war nicht klein gewesen und rothaarig nur bei einer bestimmten Beleuchtung), diese nannte er meist Ricky, manchmal aber auch Maerti, was eigentlich nur ihre Funktionsbezeichnung gewesen war, als sie vor Jahren in sein Haus kam. Sie hatte nach dem Tod ihres Vaters ein Jahr lang bei einem Bauern in ihrem Dorf im Achterhoek gedient. Eine Dorfbewohnerin hatte ihr von einer guten Stelle in Amsterdam erzählt, wo ihr Bruder bereits wohnte. Sie zögerte einen Monat lang. Danach, ermutigt vom Bruder, der Torwächter des Anthonies-Tors war, Trompeter im Rathaus und gelegentlich natürlich auch Erdarbeiter, tauschte das damals zwanzigjährige Mädchen den Blick der dumpf auf die Stallwand starrenden Kuh gegen den scharfen Blick des Malers ein, der, wie sie fand, durchaus kein lästiger Kerl mit miesen Launen war. Absolut nicht! Wohlgemut erlebte sie die Luftveränderung von Mist und Milch zu Teer, Öl, Leim, Harz, Kohle und Kreide, bis sich zuletzt der Geruch der Pest näherte. Maerti bedeutet im Achterhoeker Dialekt, der wie das Westfriesische einen singenden, gutmütigen Tonfall hat, Magd, Dienstmagd, schwer schuftende Frau.
Er ging weiter den Achterburgwal hinunter, die Gedanken sowohl bei seinem abgelehnten Gemälde als auch bei seiner toten Frau. Er bog in den Korte Kolksteeg, steuerte an dessen Ende die Brücke an und überquerte den Nieuwezijds Voorburgwal. Natürlich hatte sie nicht sterben wollen. Darin hatte sie hundertprozentig recht gehabt. Optimismus ist eine Nebenwirkung der Arglosigkeit. Sogar als es zu Sommerbeginn hier in der Stadt nach der abscheulichen Pest zu riechen begann, hatte sie das nicht sofort bemerkt. Wer selbst nicht auf Fäulnis eingestellt ist, hat nicht die beste Nase für Fäulnis in seiner Umgebung. Sie war gut, schön, ihr Körper sehr weich. Ihr Körper war wie sie. Falls je im Leihhaus oder auf einer Versteigerung eine Frauenbüste mit ihrem Hals, ihren Schultern und Brüsten angeboten würde, so ein schönes Stück sahniger Dolomitenalabaster, dessen Oberfläche sich an den Fingern weich wie Puder anfühlt, dann würde er sie sofort kaufen und zu Hause ein weißes Pelzchen darumlegen. Im übrigen riecht die Pest anfangs oft keineswegs nach Pest, nicht schwer und eklig wie ein altes, in die Gracht geworfenes Stück gekochten Fleisches, sondern aromatisch wie eine Seebrise.
Es waren noch immer viele Leute auf der Straße, die, meist recht eilig, in entgegengesetzter Richtung dem Dam zustrebten. Einen Platz in einer der vorderen Reihen würden sie vermutlich nicht mehr bekommen. Da war der Nieuwe Dijk und rechts um die Ecke die Brücke über den Damrak.
Der Maler, eine bekannte Figur in der Stadt, starrte dumpf in die Ferne, weil ihm nicht danach war, bei einem Gruß seine Gedanken mit denen anderer zu kreuzen.
… Wie sie, mit beiden Armen das zusammengerollte Trumm umfassend, zu ihm aufgeblickt hatte.
»Hast du’s?« hatte er gefragt.
Tief vorgebeugt im Treppenhaus sah er sie kurz kichern, mit hochgezogenen Schultern. Gleich darauf preßte sie wieder die Lippen zusammen, eine kleine Falte über der Nase, denn die Arbeit war natürlich nicht schön.
»Und rauf!«
Es kam ihnen äußerst ungelegen, daß das Rathaus die Leinwand so unerwartet prompt zurückgeschickt hatte. Der bei ihnen wohnende Lehrling war für ein paar Tage bei Verwandten in Alphen, das Dienstmädchen hatte Rückenschmerzen. Sie hatten sie zu dritt schleppen müssen.
Ja! Ja! Ja! Ruckweise hatten sie das Ding Stufe um Stufe höher gehievt. Ganz unten hatte sein Sohn das Ende wie ein Sargträger auf die Schulter genommen.
An dem Tag hatte sich keine Möglichkeit mehr ergeben, auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, was jetzt weiter mit dem Desaster geschehen sollte. Das Desaster nahm Besitz vom Atelier, alles andere hatten sie auf die Seite gerückt. Es war Abend geworden. Der Maler hatte sich in der Küche eine Pfeife angezündet, seine Frau briet eine Ente. Sie hatten zu fünft gegessen, er, sein Sohn, seine Frau, Töchterchen Neelie und das Dienstmädchen, dem es eigentlich schon wieder ganz gut ging. Neelie hatte von ihrer Mutter einen Entenfuß zum Spielen bekommen, die Sehne hing noch wie eine Schnur heraus. Wenn sie daran zog, schloß der Fuß seine Zehen und Schwimmhäute, ließ sie los, schwamm er sozusagen wieder fröhlich davon.
Gleich als es am nächsten Tag hell wurde, war der Maler ins Atelier gegangen. Sein Schlaf war schwer und warm gewesen, die Körpertemperatur seiner Frau war höher als seine eigene, er war an ihre trockene, leicht glühende Haut gewöhnt, sie schwitzte nie. Ob es nun von dem Volkslied kam, das sie im Schlaf gesungen hatte – Es regnete sehr, un ich wurd’ naß –, oder vom violettblauen Himmel an diesem sehr frühen Morgen, freundliche Dinge alle beide, ohne Verzweiflung, jedenfalls bekam er Lust, auf der Stelle das Problem dort auf dem Fußboden anzupacken.
»Es ist zwar noch nicht November …« hob er an, als seine Frau erschien. Sie stellte einen Teller Anisbrötchen für ihn auf die Fensterbank und nahm selbst eins. »Ähm, aber du hast deinem Vater doch im Schlachtmonat immer geholfen?«
Ihr Vater, Jäger auf Schloß Bredevoort, hatte auch stets beim Schlachtfest mit Hand angelegt.
»Stimmt«, sagte sie mit vollem Mund. Sie setzte sich auf die Fensterbank und beschrieb ihm, wie ihr Vater es fertigbrachte, mit einem einzigen genau berechneten Schnitt das Gekröse eines Rehs ordentlich vor den aufgeschlitzten Bauch gleiten zu lassen. Im letzten Jahr, erzählte sie, als er bereits krank war, hatte sie ihm manchmal geholfen, so ein Tier danach am Firstbalken der Scheune festzuzurren, damit es abhängen konnte.
Überflüssig, zu erzählen, daß sie verstand, was ihr Mann meinte, sie hatte ihn immer in allem verstanden. Als der Sohn gegen acht nach unten kam, sah er seine Stiefmutter, die im Begriff war, an den Backsteinen des äußeren Fenstersimses zwei Fleischmesser zu wetzen, ein kurzes, breites mit einer Blutrinne, mit dem man auch Knorpel zerschneiden konnte, und ein ungefähr sechs Daumen langes und eineinhalb Daumen breites zum Filetieren. Sie lachte ihn durch die Scheibe an.
Die Arbeit sollte den ganzen Vormittag und einen Teil des Nachmittags in Anspruch nehmen. Nachdem sie die Leinwand zu dritt auf dem Boden ausgerollt hatten, brauchte der Maler nur wenige Minuten, um sich das Kinn reibend einen Entschluß zu fassen und danach eine kleine Zeichnung auf ein Stück Papier zu werfen. Ein Kinderspiel – dies weg, das weg, das Übrige kann sehr gut bleiben – die eigentliche Arbeit war das Verstümmeln. »Gib her«, sagte er zu seiner Frau und streckte die Hand aus. Sie gab ihm das lange Messer, das das leichtere war. Er sank auf die Knie, drückte sich gegen die Wand unter der Fensterbank und begann mit einer Reihe fester Schnitte, den Vorplatz und die Treppen wegzuschneiden. Daß er dabei seufzte und stöhnte, hatte nicht viel zu bedeuten, das hatte er auch getan, als er mit Hilfe zweier Lehrlinge ebendiesen Vorplatz und die Treppen auf die Leinwand brachte, und es war fast zu erwarten, daß er auch jetzt wieder, getreu seiner Gewohnheit während des Pinselns, Putzens und Hauens, von Zeit zu Zeit murmeln würde: »Sehr gut, meine Herren, so macht man das!« Als er aufblickte, um seinem Sohn zu bedeuten, er solle auf der anderen Seite beginnen, sah er, daß der Junge schon bereitstand, das schwere, kurze Messer in der Hand, das an seinem Bein herabbaumelte.
Und so verschwanden auch die Ränder, Wände, Bäume, einige menschliche Gestalten, bis schließlich, so um die Essenszeit, Vater und Sohn den gesamten oberen Teil entfernten, der mit seiner räumlichen Grandeur nicht nur den Geist dieses einen Bildes geatmet hatte, sondern auch den der Gemälde einer Reihe anderer großer Meister – Leonardo, Tizian, Rubens, Velázquez –, denn Kunstwerke sprechen, wie Menschen, unaufhörlich miteinander und verstummen, wie Menschen, wenn sie mit Metzgermessern bearbeitet worden sind.
Er stand auf der Oude Brug. Unbemerkt war er dort gelandet, und jetzt blieb er stehen, um gedankenverloren auf das Wasser des Damrak zu blicken. Das blickte einige Minuten lang mit einem kalten, grauschwarzen Auge zurück, bis es, wie es sich gehört, zu spiegeln begann und ihm eine auf dem Kopf stehende Stadtansicht zeigte. Links lag eine Reihe von Tjalken aus Hindelopen, fest vertäut am Steg entlang der Rückseite der Warmoesstraat. Im Hintergrund das unvermeidliche Rathaus mit einem Teil der Stadtwaage. Dann, rechts, mit nach Südost flatternden Wimpeln, eine weitere Reihe größerer Schiffe, die einen Liegeplatz am Ufer des Damrak gefunden hatten, der mit Buden, Schenken und Herbergen vollgebaut war.
Aus einer dieser Herbergen war vor einer Woche das Mädchen gestürmt, dem der Maler an diesem Tag begegnen sollte. Eine Begegnung, die wie alle Begegnungen vor langer Zeit vorbereitet worden war und im Grunde auch schon begonnen hatte. Sie hatte einen ockerbraunen Rock, eine blutbefleckte grüne Jacke und kurze Rentierlederstiefel getragen. Sie war außer sich gewesen. Wie ein tollwütiger Hund stieß sie einen Tisch mit Aalen um, schlug einem Passanten, der sie festhalten wollte, kräftig ins Gesicht, schaute sich ein paarmal um und rannte weiter. Als sie sah, daß sie nicht die geringste Chance hatte, ihren Verfolgern zu entkommen, war sie in den Damrak gesprungen.
Sie konnte nicht schwimmen. Das Wasser zog sie wie ein Mahlstrom sofort hinunter. Ihr Rock bauschte sich auf, die Stiefel sogen sich voll, das durch die Nase eingeatmete Wasser bescherte ihr einen Hustenanfall, sie holte tief Luft, holte tief Wasser-Luft und fuhrwerkte wie eine Rasende mit Armen und Beinen herum, denn sie wollte auf keinen Fall sterben. Kein Geschöpf will das, und sie wollte es schon gar nicht. Es gibt Mädchen, die unbewußt und insgeheim wissen, daß sie fürs Glück geboren sind. So eine war sie. Und darin hatte das Leben sie auch rundheraus bestätigt. Welches Mädchen, das bereits sehr früh den Vater verloren hat, trifft es so gut mit ihrer Stieffamilie, einem Vater, einer älteren Schwester und einem Bruder? Und welches Mädchen, dessen Mutter in dieser zweiten Ehe nur noch kurze Zeit leben sollte, knapp drei Jahre, wird daraufhin so von dieser älteren Schwester verhätschelt, daß sie die Wärme der Mutter völlig mit der der Schwester verwechselt? Sie tauchte tatsächlich kurz auf, breitete die Arme aus, verschwand aber würgend erneut in dem ekelhaft schmeckenden Wasser, in dem sich lediglich der kadaverfressende Aal wohl fühlt. Als sie das zweite Mal an die Oberfläche kam, waren da plötzlich zwei Pranken.
Der Schiffer von der Anna Lien packte sie an den Haaren und am Rückenteil ihrer Jacke und zerrte sie brummend an Deck.
Er und das Mädchen sahen einander einen Augenblick lang keuchend an.
»Laß los!« rief sie, denn sie spürte noch immer die Pranke im Haar.
»Immer mitter Ruh, Meechen«, sagte der Schiffer im Dialekt des Dorfes Zwaagdijk in der Nähe des westfriesischen Enkhuizen.
4 Das Glück machte ihre Persönlichkeit aus
Zum Beispiel das eine Mal, als sie die Leiter zum Dachboden hinaufgestiegen war, blaß, miesepeterig seit dem Tag, an dem ihre Schwester Sarah-Dina ohne ein Wort verschwunden war, und als sie die Matratze hochgenommen hatte, um sie aufzuschütteln und umzudrehen, und dabei die fünf Taler fand. Es war ein nebliger Morgen Anfang Dezember. Ihre Schwester war schon drei Wochen fort, hatte sich eingeschifft, um von Jütland nach Amsterdam zu fahren und nie mehr zurückzukehren. Das wußte sie, ohne daß jemand es ihr hatte sagen müssen.
»Die Stadt ist der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, Kleine.«
Immer öfter und immer sehnsüchtiger gesagt. Zuletzt mit solch entschlossenem Blick, daß man hätte meinen können, sie wisse ganz genau, wovon sie sprach, weil sie schon oft genug da gewesen war.
»Auf den zwölf Stadttoren stehen abends Trompeter und blasen. Die Schiffe fahren vom Meer direkt bis zum Marktplatz, auf dem ein sehr großer Palast steht, in dem kein König wohnt.«
»Wer wohnt dann da?«
Das wußte Sarah-Dina offensichtlich nicht. Ungeduldige Handbewegung. Und warum stöhnte sie auf einmal? Nachts verriet ihr Reden im Schlaf der jungen Schwester, daß mit allen diesen Brücken, Mühlen, Märkten, Geschäften, den Fremden, den hohen Häusern direkt am Wasser in Wirklichkeit ein Bootsmann gemeint war. Ein Holländer, ein sehr schweigsamer Bursche, der von Sarah-Dinas Bruder ein paarmal zum Mittagessen mitgebracht worden war, als das Schiff, auf dem die beiden fuhren, im Hafen von Aarhus auf Ladung wartete. Das war Anfang Mai gewesen. Während des Essens sprach er kein Wort, aber danach pfiff er, wenn man ihn darum bat. Kunstvolle Triller kamen aus seinem Mund, während seine Augen taten, als gehörten sie nicht dazu. Sarah-Dina und er müssen sich in bezug auf ihre Spaziergänge schon bald einig gewesen sein. Zuerst gingen sie immer in die Scheune, in der die Daunen, die Federn und ein paar für den Markt bestimmte Matratzen aufbewahrt wurden, ziemlich lange danach spazierten sie dann gemächlich den kleinen Weg hinunter Richtung Hafen. Und wie lebhaft er dann sprach, dieser Bootsmann, während seine Gefährtin lauschte und zu Boden blickte! Wie er während ihrer Spaziergänge argumentierte, mit krummem Rücken, breit gestikulierend, auf holländisch, was hier jeder ein wenig verstand und meist auch radebrechend sprach.
Sie, die hereingeschneite kleine Schwester, hieß Elisabeth oder Elsebet oder Else, nach einer der dänischen Königinnen, die Holland so sehr geliebt hatte, daß ihr Mann eine ganze Reihe Bauernfamilien aus diesem Wasserland geholt hatte, damit sie, auf schönen Äckern arbeitend, seine Küche mit Möhren und Zwiebeln versorgten. Drei aus Edam importierte Familien bekamen eine hübsche, winzig kleine Insel geschenkt und mußten als einzige Gegenleistung dem Königspaar sechs Tonnen Aal im Jahr liefern. Ach, und dann war ausgerechnet aus diesem Supervolk die gewissenlose Sientje aufgetaucht, um der Königin das Herz ihres Gemahls abspenstig zu machen!
Else Christians – auch ihr Vatername war also ein königlicher Name – ließ die Taler von der einen Hand in die andere gleiten und zählte sie mit nachdenklich zusammengezogenen Augenbrauen immer wieder, Zählen ist Nachdenken. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, das im kommenden März achtzehn werden würde. Ein Fisch also, mit einer starken Lebenslinie, noch keinen Tag krank gewesen, ungeborene Kinder und Enkelkinder streckten die Hände bereits nach ihr. Das Hübscheste an ihr waren ihre jungen, ehrlichen Augen, die mal grau, mal milchblau wirkten.
Fünf Taler waren eine Menge Geld. Und eine wichtige Botschaft von Sarah-Dina, die sie vorerst nicht verstand. Sie starrte weiter darauf, während sich draußen der Nebel lichtete und sich unten in der Küche ihr Stiefvater fragte, wo sie bloß blieb.
»Else!«
Diese Stimme, laut wie die aller Halbtauben, war in der letzten Zeit ihres Hierseins von Sarah-Dina des öfteren herzlos mit einem Lied übertönt worden. Böser Neyder Zungen, Vater, hab’n gesungen von Eurem jungen Weyb …