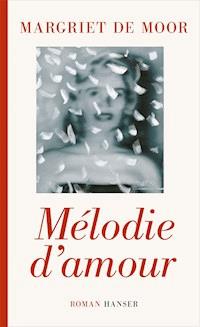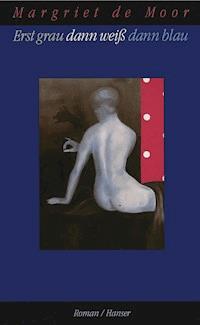Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der blinde Musikkritiker van Vlooten eines Tages eine junge Geigerin trifft, ist er sofort von ihr fasziniert. Auch sie verliebt sich, sie heiraten. Aber van Vlooten wird von Eifersucht zerfressen. Als er sicher glaubt, sie habe ein Verhältnis, fasst er einen mörderischen Plan. Kreutzersonate ist ein Roman über Musik und Liebe, voll innerer Spannung und Leidenschaft, wie nur de Moor ihn schreiben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Seit einer verhängnisvoll verlaufenen Beziehung in jungen Jahren hat der blinde Musikkritiker Marius van Vlooten nie mehr wirklich geliebt. Viele Jahre später reist er zu einem Meisterkurs in Bordeaux in der zufälligen Gesellschaft eines junden Musikologen, der ihm ein lebendiges Porträt der Geigerin Suzanna Flier zeichnet und die beiden miteinander bekannt macht. Als van Vlooten sie den Part der ersten Geige in Janáček Streichquartett »Kreutzersonate« spielen hört, wird er, ohne es zu wollen, zu einer Gestalt aus einer Tragödie, die auf ihr eigenes, unausweichliches Ende zustrebt.
Musik und Gefühl, die beiden Pole der Geschichte, die einander bedingen und kommentieren, verwebt Magriet de Moor in einem dichten, musikalischen Text. Mit Kreutzersonate nimmt sie nicht nur auf Janáčeks Streichquartett Beszug, sondern auf dem Wege über dieses auch auf Tolstois berühmte Novelle, die ihrerseits wieder von Beethovens Sonate inspiriert war. Mit diesem kleinen mitreißenden Roman gibt sie dem Gespräch der Meister über Liebe, Leidenschaft und Eifersucht eine Wendung.
Margriet de Moor
Kreutzersonate
Eine Liebesgeschichte
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Carl Hanser Verlag
Hanser E-Book
Die Pflicht zur Keuschheit hat große Bedeutung. Wollen wir, daß unsere Frauen ihre Willigkeit bezähmen?
Ich sehe keine Ehen schneller im Nebel verschwinden und scheitern als jene, die auf Schönheit und amourösem Verlangen beruhen. Es bedarf festerer und beständigerer Fundamente sowie eines besonnenen Blicks; all das Ungestüm führt zu nichts.
Michel de Montaigne
1
ZEHN JAHRE SPÄTER begegnete ich dem blinden Kritiker, dem Patriziersohn Marius van Vlooten, der sich als Student einer unglücklichen Liebe wegen eine Kugel in den Kopf gejagt hatte, erneut. Er stand als letzter in der Schlange vor einem der Abfertigungsschalter auf dem Flughafen Schiphol, und weil seine riesige, gebeugte Gestalt etwas Wütendes ausstrahlte, erkannte ich ihn sofort. Sein Schädel glänzte. Gehüllt in einen dunkelblauen Regenmantel, den er trotz des schönen Sommerwetters trug, rückte er, mit dem Blindenstock tickend, zusammen mit der Schlange schlurfend auf. Ich erinnerte mich, daß ich mich damals darüber gewundert hatte, wie unbeholfen er oft beim Gehen den Boden mit seinem Stock abtastete, als habe er es versäumt, zu Beginn seiner Blindheit, in deren Jugend, dieses spezielle Sinnesorgan zu trainieren und ihm die richtigen Gepflogenheiten beizubringen. Ich schloß mich hinter ihm der Schlange an. Da ich annahm, daß er, wie ich, auf dem Weg zu den Salzburger Festspielen war, entschloß ich mich, ihn anzusprechen.
Ich räusperte mich. »Mijnheer van Vlooten . . . « Dann legte ich kurz meine Finger auf seinen Arm. Ich wußte noch, daß für einen Blinden die Menschen durch ihre Stimme und ihre Berührungen plötzlich aus dem Nichts auftauchen.
Ich nannte meinen Namen. »Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an mich, aber wir sind uns einmal begegnet . . . «
Er drehte sich abrupt zu mir um und gebot mir mit einer Handbewegung, zu schweigen. Ich sah ihm voll ins Gesicht. Erschrocken bemerkte ich, wie es sich verändert hatte, und mochte kaum glauben, daß nur die Zeit diese Verwüstungen angerichtet haben sollte. Unter seinen Augen lagen schwarze Ringe, und ein kräftiger Muskel zog den einen Mundwinkel herab. Die Mulde, die der Revolverschuß seinerzeit über seinem Ohr hinterlassen hatte, kannte ich bereits, sie rief kein Erschrecken wach, sondern lediglich eine rasche Erinnerung an Sommerabende, an erlesene Mahle unter Kronleuchtern und an den kleinen Kanon von Violine und Cello zum Motiv cis d cis h cis fis-d cis h: die Umstände unserer ersten Begegnung.
»Natürlich erinnere ich mich an Sie!« unterbrach er meine Klangvision, und ich erkannte seine heisere arrogante Stimme. »Sie sind der junge Mann, in dessen Gesellschaft ich mal nach Bordeaux geflogen bin.«
»Ja«, sagte ich sofort. »Wir hatten einen langen Zwischenstopp in Brüssel.«
Er streckte den Kopf vor.
»Und ob ich mich an Sie erinnere, an Sie und Ihresgleichen!« Sein Gesicht lief rot an. »Clever, interessiert an viel zu vielem zur gleichen Zeit und daher ohne wahre Leidenschaft. Studium am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Amsterdam. Stipendium, kleiner Job nebenbei, kein Pfennig von zu Hause, Abschlußarbeit über Schönberg.«
Unwillkürlich nickte ich.
»Eine Reihe flüchtiger Liebschaften, die ihr Beziehungen nennt, mit Frauen, die ihr Freundinnen nennt. Zum Schluß heiratet ihr eine von ihnen, nachdem ihr euch selbst logisch und mit gut fundierten Argumenten dargelegt habt, warum sie die Wahre ist, und nehmt eine Hypothek in euer beider Namen auf. Ich frage Sie: Wozu das alles?«
Er sprach mit schamlos zunehmendem Zorn. In der Schlange sah man sich um. Die Wut, der ungehaltene Unmut an ihm, die mir damals bereits aufgefallen waren und die ich unbesehen und voller Verständnis mit seiner Jugendtorheit in Beziehung brachte, hatte sich offensichtlich zu Raserei entwickelt. Ich betrachtete ihn schweigend, bis er sich mit einem deutlich vernehmbaren Knurren von mir abwandte. Ohne jeden Übergang, als wäre ich in ein Buch vertieft, dachte ich: Die Tat selbst ist nicht ausschlaggebend, was zählt, ist das, wozu einen die Folgen treiben.
Es war halb sechs Uhr nachmittags. Durch die Fenster der Abflughalle fiel die Augustsonne herein. Die Schlange kam nur langsam voran. Am Schalter wurde nicht nur für Salzburg, sondern auch für Bukarest abgefertigt, was lange und zähe Verhandlungen über die sonderbarsten Gepäckstücke mit sich brachte. Ich hatte reichlich Zeit, an das Drama zu denken, das er, van Vlooten, vor zehn Jahren als seine Liebestorheit bezeichnet hatte, als er mir den Sachverhalt ausführlich, aber nicht auf Tragik bedacht, erzählte, nachdem wir auf dem Brüsseler Flughafen gestrandet waren.
Auch damals war es Sommer. Der Sommer ist die Zeit der Musikfestivals, der Wettbewerbe und der Meisterkurse. Ich war auf dem Weg nach Bordeaux, wo im Château Mähler-Bresse ein Meisterkurs für Streichquartette gegeben wurde. Nach langem inständigem Bitten war es gelungen, auch Eugene Lehner, den früheren Bratschisten des legendären Kolisch Quartetts, als Lehrer zu gewinnen. Im Interesse einer Studie, an der ich gerade arbeitete, hoffte ich, den Musiker zwischen seinen Aktivitäten sprechen zu können. Daß er noch lebte und von mir zu befragen war, schien mir unerhört. Nicht aufgrund seines Alters, er wird an die Siebzig gewesen sein, sondern weil er eine bestimmte Achtsamkeit, eine bestimmte, vom Gehör gesteuerte Hingabe, die zu einer dunklen, eigentlich bereits verschwundenen Zeit gehörte, noch lebendig in sich trug.
Warum ich mich entschlossen hatte, zu fliegen, weiß ich nicht mehr. Ich liebe Zugreisen, auch heute noch, denn auch wenn der moderne TGV ein richtiger Angeberzug ist mit einem Schnellbüfett, mit Sitzlehnen, die man nicht hochklappen kann, und mit einem Bordbegleiter, der sich einem über die Sprechanlage in drei Sprachen mit Vor- und Zunamen vorstellt, einem seine persönlichen Dienste verspricht und sich dann auf der gesamten Strecke kein einziges Mal blicken läßt, gibt es ja immer noch die Bahnhöfe. Überdachungen, Signalmasten, Weichen, durch das Abteilfenster starrt man auf die langsam entschwindende Salle d’Attente Première Classe: Eine schaukelnde, sanft ruckelnde Welt mit Bänken, auf denen Reisende, sich einander zubeugend, von ihrem Leben erzählen, liegt noch zum Greifen nah.
Als ich die Maschine nach Brüssel betrat, saß van Vlooten bereits am Gang auf dem Platz neben dem meinen. Ich kannte ihn, wenn auch nicht persönlich. Er galt und gilt immer noch als brillanter Kritiker, unabhän-gig, der mit geschliffener Feder beispielsweise aufzeigen kann, wann die Exzentrizität der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts ein Zweck ist, eine Ausflucht, und wann das unvermeidbare Resultat eines Geistes, der einen bestimmten Standpunkt vertritt. Daß er Economy reiste, wunderte mich nicht. Es war bekannt, daß er, aus welchen Gründen auch immer, seinen materiellen Reichtum vor der Welt zu verbergen wünschte, eine Eigentümlichkeit, zu der ich einmal jemanden hatte bemerken hören: »Wie eine Orientalin ihr schönes Gesicht.«
Ich entschuldigte mich. Er erhob sich. Ich schob mich an ihm vorbei. Die Maschine startete mit lediglich einer halben Stunde Verspätung, was für meinen Anschlußflug nach Bordeaux nicht weiter problematisch sein würde. Während des fünfundzwanzigminütigen Fluges aßen mein Reisegefährte und ich ein Croissant, tranken eine Tasse Kaffee, und dabei blieb es. Ins Gespräch kamen wir erst, als van Vlooten in der Halle des Brüsseler Flughafens trotz des Gefuchtels mit seinem Blindenstock gegen eine Marmorsäule prallte.
Er tat einen Schritt zurück.
»Verdammt noch mal!«
Schon hatte ich, dicht hinter ihm gehend, ihn am Arm gepackt.
»Haben Sie sich verletzt?«
Der Vorfall ereignete sich, kurz nachdem wir vernommen hatten, daß sich der Flug nach Bordeaux auf unbestimmte Zeit verzögerte. Was wir noch nicht wußten, im Laufe des Nachmittags aber bruchstückweise mitbekommen sollten, war, daß die Boeing 737, die uns nach Bordeaux hatte bringen sollen, unter noch ungeklärten Umständen mit einhundertfünfzig Passagieren an Bord in Heathrow verunglückt war.
»Verletzt, ach wo! Diese Säule steht mindestens einen halben Meter zu weit vor. Aber wissen Sie was, kommen Sie mit, gehen wir in die Bar. Ich lade Sie zu einem Whisky ein.«
Obwohl ich keine Ahnung hatte, wo sich hier, zwischen den Kiosken und Schaltern, die Bar befand, faßte ich ihn hilfsbereit am Ellbogen. Bereits nach wenigen Schritten merkte ich, daß er wußte, wohin wir uns wenden mußten, und verließ mich auf seinen Orientierungssinn. Während wir den restlichen Teil der Halle durchquerten, sagte er kein Wort. Während wir eine etwa vierzig Meter lange Ladenpassage durchschritten, vermittelte er mir den Eindruck, den Atem anzuhalten. Gerade als ich ihn mit sanftem Händedruck umleiten wollte, weil ein großer Gepäckwagen mitten im Weg stand, schwenkte er nach rechts. Erst als wir an dem Fahrzeug vorbeigingen, tickte er es kurz mit seinem Stock an, wie es schien, zur Kontrolle, und tatsächlich, da stand es. Ich musterte ihn von der Seite, sah sein zufriedenes Gesicht, verstand aber erst viel später, was es mit seinem Kunststück auf sich hatte, nachdem ich gehört hatte, daß manche Blinde eine besondere Art der Wahrnehmung, ein überaus subtiles System entwickeln, um Hindernisse zu orten, um Bäume, Laternenpfähle, Müllcontainer, Glassammelbehälter, Fahrradständer, die ihnen den Weg versperren, auf zwei Meter Entfernung zu erspüren, sie als Festkörper zu lokalisieren, als Gegenwart im Dunkel, die ein Signal aussendet, schwach, für normale menschliche Sinnesorgane nicht aufzufangen; sie ist auch sehr störanfällig, diese Frequenz der Nacht, im Prinzip nur in einer sehr ruhigen Umgebung verläßlich, aber gelegentlich kommt es vor, in Notsituationen oder in einem Moment äußerster Willensanstrengung, daß es dem Blinden selbst bei Lärm gelingt, dieses erstaunliche Instrument einzusetzen, das wie ein akustisches Netz über der Haut von Stirn, Nase und Wangen liegt und bei leichtem Druck eine Wahrnehmung ermöglicht, die man früher durchaus als Sehen bezeichnete, nicht mit den Augen, sondern mit dem ganzen Gesicht.
Wir erreichten das mit roten Leuchtbuchstaben ausgewiesene Charley’s, und van Vlooten bewegte sich wieder so, wie er mir in Erinnerung bleiben sollte: herumtapsend wie ein angeschlagener Riese. Ich sah, daß vor dem Spiegel an der Seitenwand der Bar ein Tisch frei war. Mein Freund legte gefügig seine Fingerspitzen auf meine Schulter und folgte mir zu den Stühlen, von denen wir uns vorläufig nicht mehr erheben sollten. Wir nahmen uns unseren ersten Whisky vor. Und wir hörten die erste Durchsage aus dem Lautsprecher über unseren Köpfen, derzufolge sich der Flug nach Bordeaux erneut verschob. Als ich irgendwann ziemlich schamlos seine Stirn betrachtete und feststellte, daß der Zusammenstoß mit der Säule alles andere als sanft gewesen war, hatte van Vlooten mein Interesse gleich spitz.
Er lachte verärgert.
»Ja, ja, sehen Sie sich nur in aller Ruhe meine Torheit an!«
Ich spürte, daß ich die Farbe wechselte.
»Es tut mir leid.«
Und ich wandte den Blick von der glänzenden Beule ab, die sich über seiner rechten Augenbraue wölbte. Kurz darauf kam unser Gespräch auf jene andere, frühere Torheit in seinem Leben, und ich konnte meine Augen partout nicht davon abhalten, zu der weißlichen Mulde schräg oberhalb seines Ohrs abzuschweifen, was mir im übrigen nur über den Spiegel gelang.
2
»SIND SIE SICHER, daß Sie es hören wollen?«
Sie war drei Jahre älter als er. Eine Anthropologiestudentin kurz vor dem Abschluß — »ja, dieses Mädchen, sie hieß Ines, war resolut« —, die ihm bereits nach ihrer zweiten oder dritten Liebesbegegnung eröffnet hatte, ihre Verbindung würde eine zeitlich begrenzte sein, da sie vorhabe, sofort nach ihrem Examen mit den Forschungsarbeiten für ihre Dissertation zu beginnen, und das Gebiet, wo das geschehen werde, das Hochland im Osten Venezuelas, in dem das Indianervolk der Yanomami lebe, existiere schon seit sehr langer Zeit als rein private Wirklichkeit in ihrem Kopf. »An sie zu denken«, sagte van Vlooten zu mir, »heißt, sie zu sehen«, und er begann mit der Beschreibung eines Fensters.
Ein Bogenfenster, ein hellblau gestrichener Rahmen, und dahinter ein Stadtgarten an einem Wintertag. Auf einem schwarzen Ast hockte ein regloser Vogel, ein schneeweißes Tier, und auf der Fensterbank saß Ines und kramte nervös in ihrer Tasche, weil sie dachte, sie hätte ihren Hausschlüssel vergessen. Sie war im Begriff zu gehen. Er sagte einfältig: »Vielleicht in deiner Manteltasche« und blickte, ohne es zu sich durchdringen zu lassen, auf das Fortgehensmotiv vor seinen Augen. Sie sprang auf und sah sich forschend im Zimmer um. Es war ein komfortables, großes Zimmer in einem von einer Studentenverbindung geführten herrschaftlichen Haus in der Breestraat in Leiden. Dunkelrote abgewetzte Sessel für ausgewachsene Männer, ein mit gelbem Wachstuch bedeckter Tisch, solche Dinge, er war zweiundzwanzig. In dem Bett an der vertäfelten Wand hatte er mit seiner Liebsten die Nacht verbracht, sie hatten dort auch gefrühstückt und, unbeholfen auf die Ellbogen gestützt, die Zeitung gelesen, die er, in Morgenmantel und Pantoffeln, zwei Treppen tiefer vom Fußabtreter aufgehoben hatte, ohne auch nur eine Sekunde lang daran zu denken, daß sie da oben bereits ihre eigenen Pläne für ihr Leben hatte. Jetzt sah sie ihn kurz an, als hätte er sie nie von unten nach oben geküßt. Sie hatte ihren Mantel gefunden, den Schlüssel aus einer der Taschen geangelt, langgedehnt gegähnt. Keine fünf Sekunden später — »also dann tschüs!« — war sie fort.
Er studierte Jura, ja, wie sein Vater und sein Großvater, was dem einen einen Ministerposten eingetragen hatte, während der andere, Großvater, es in Wilhelminas Ära bis zum Hofmarschall gebracht hatte. Er, Marius, war ein begabtes und in Reichtum aufgewachsenes Kind gewesen. Wie seine Eltern, die viele ausländische Freunde hatten und oft verreisten, sprach er fließend seine drei Fremdsprachen und war zu Hause in den Theatern und Konzertsälen von London, Paris, Wien und Berlin. Daß er ein bedeutender Mann werden würde, daran zweifelten weder er noch seine Eltern. Daß er sich im Hinblick auf diese abstrakte Berufung und ohne Rücksicht auf irgendein in ihm schlummerndes Talent als Student der Rechte immatrikulieren mußte und selbstverständlich in Leiden, schien ihm eine hinnehmbare, notwendige, mysteriöse Pflicht. Zwei Jahre lang war er, ohne sich um deren Sinn Gedanken zu machen, Student. Dann, eines Wintermorgens nach einem Fest, entdeckte er den Mittelpunkt seines Lebens. Ines hatte ihm nach langem Umherwandern im Nebel Kaffee und ein Omelett mit Speck angeboten. Das Studentenwohnheim lag am Rande der Stadt. Von dort blickte man auf Wiesen und Weiden. Mit hypnotisierender Trägheit schob sich der Lift ins oberste Stockwerk. Als er später an jenem Tag nach Hause kam, setzte er sich an den mit Wachstuch bekleideten Tisch, spannte einen Bogen Papier in seine Schreibmaschine und begann zu tippen: Die Welt . . .
Von diesem Tag an sehnte er sich nach ihrem Gesicht, ihrem Blick, ihren Gesten, ihrer Art zu gehen, ihrer Art sich umzudrehen, ihrer Art, ganz hinten in dem vollen Lokal, in dem sie sich verabredet hatten, in ihrem roten Mantel auf ihn zu warten. Sie war lieb zu ihm. Daß er nichts merkte von dieser anderen Spannung in ihr, daß er völlig blind war für die Vorzeichen ihres Fortgehens, kam durch seine Begierde.
Die er, wenn er allein war, unter Kontrolle zu haben glaubte. Wenn er allein war, glaubte er, nicht an Ines zu denken, sondern ein Skript über zwingendes und nachgiebiges Recht, in der akkuraten Schrift eines Freundes, stark gekürzt abzuschreiben. Aber siehe da, sobald er zur vereinbarten Zeit die schwere Eingangstür des herrschaftlichen Hauses sich öffnen und wieder ins Schloß fallen, Ines besaß einen Schlüssel, und ihre zielstrebigen Schritte Stufe um Stufe zu sich heraufkommen hörte, gab es wieder nichts anderes und nichts Beruhigenderes auf dieser Welt als seine Begierde, die, obwohl sie sich fast täglich sahen, in fast schon neurotischer Weise heftiger wurde und, zugegebenermaßen, das war vielleicht noch das Verschleierndste, von ihr uneingeschränkt erwidert wurde. »Und dann erschien dort auf der Schwelle diese Frauengestalt, mit dem Fahrrad gekommen und wegen der Kälte so von Kopf bis Fuß eingemummt, daß sie einem Garderobenständer mit Kleidern glich.«
Van Vlooten verstummte.
»Ja?« sagte ich.
»Moment mal.«
Auch das Stimmengewirr um uns herum war dabei, sich zu legen. Dann begann der Lautsprecher über unseren Köpfen zu rauschen, und ich merkte, daß alle in der mittlerweile vollgepackten Bar mit ernster, aufmerksamer Miene der uns betreffenden Durchsage lauschten, mit der wir uns schon von vornherein abgefunden hatten. Der Flug nach Bordeaux verzögerte sich weiterhin.
Der Kellner brachte uns noch einen Whisky. Wir nahmen einen Schluck und schwiegen. Ich war überzeugt, van Vlooten fühle, wie ich, den Herzschlag der Gefahr, über die an allen Tischen ringsum gesprochen wurde. Mein Blick kreuzte den eines Herrn, der gerade De Morgen zusammenfaltete. Als hätte ich ihn etwas gefragt, stand er auf, aber als er an unseren Tisch trat, faßte er den Ärmel meines Reisegefährten.
»Das Fahrwerk klemmte«, sagte er zu van Vlooten. »Ich habe gehört, daß der Pilot noch versucht hat, durchzustarten.«
Wonach er, ohne unseren Kommentar abzuwarten, mit seiner Aktentasche durch die Schiebetür verschwand.
Als van Vlooten mit seiner Geschichte fortfuhr, ergriff mich Unruhe. Ich wußte, wie sie ausging. Ich spürte den düsteren Vorfall mit jedem seiner Worte näher kommen und spürte ihn zugleich, als Fait accompli, bereits in der ganzen Atmosphäre um mich. Sie begann sich zu verspäten. Sie begann ihre Verabredungen ohne viel Federlesens abzusagen. Das war im Sommer, als sie bereits an den Wochenenden zu ihm nach Hause nach Wassenaar kam. Es konnte passieren, daß er und seine Eltern wartend auf den Verandastufen saßen, ungezwungen, zu Beginn des Sonntagnachmittags, wenn die Schatten der Kastanien auf die Ställe zukrochen und alles von Natur aus Zeit hatte. Und tja, dann klingelte das Telefon. Wie es nur möglich sei, daß er sich um diese Dinge damals kaum Gedanken machte?
Ich antwortete nicht. Ich hatte ihn nicht gefragt. Ich erinnere mich heute noch an mein Gefühl des Unbehagens, als das Gesicht mir gegenüber beim Reden mit einemmal nach der typischen Art der Blinden die Muskeln anspannte in dem Versuch, ein Lächeln, einen Reflex aus einem früheren Dasein zu reproduzieren. Ich lächelte nicht zurück. Es war möglich, vernahm ich, weil Ines weiterhin mit ihm schlief, weil Ines weiterhin feurig und mit dem größten persönlichen Interesse seiner Verliebtheit Nahrung gab.
Seine Stimme wurde spöttisch. »Und was das bedeutete, damals, davon habt ihr heutzutage kaum noch eine Ahnung!«