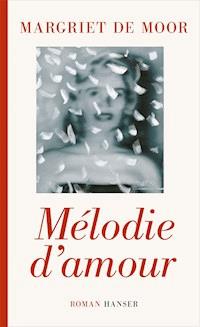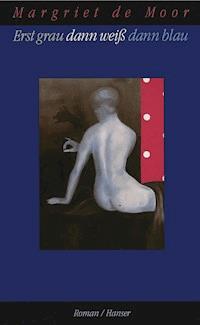Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Hanser, CarlHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand hätte gedacht, dass sie bleiben würde. Nachdem passiert war, was alle nur das Unglück nannten: der Schuss im Chicorée-Treibhaus. Sie blieb, aber sie wollte nicht wie eine Nonne leben. Deshalb gab sie eine Anzeige auf, unmissverständlich. Die Begegnungen mit den unbekannten Männern verliefen stets nach demselben Muster: kennenlernen, erzählen, eine gemeinsame Nacht. Dabei ließ sie die Erinnerung an ihren toten Mann jahrelang nicht los. Und immer wieder die Frage: Warum hatte er es getan? – Bis zu jenem eiskalten Tag und jener schlaflosen Nacht. Margriet de Moor erzählt in ihrem unverkennbaren Ton eine schmerzliche Liebesgeschichte, von Abschied und Tod, Wut und Eifersucht und von der Möglichkeit eines Neubeginns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Niemand hätte gedacht, dass sie hierbleiben würde, nachdem ihr Mann tot war. Nachdem passiert war, was alle nur das Unglück nannten: der Schuss im Chicoréetreibhaus. Sie blieb auf dem Land, aber sie wollte auch in der Provinz nicht wie eine Nonne leben. Deshalb gab sie eine Anzeige auf, unmissverständlich. Die Begegnungen mit den unbekannten Männern verliefen stets nach demselben Muster: kennenlernen, erzählen, eine gemeinsame Nacht. Dabei ließ die Erinnerung an ihren toten Mann sie jahrelang nicht los. Warum hatte er es getan? Bis zu jenem eiskalten Tag und jener schlaflosen Nacht, von der diese meisterhafte Novelle erzählt und in der vielleicht alles anders wird.
Hanser E-Book
MARGRIET DE MOOR
Schlaflose Nacht
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Carl Hanser Verlag
Diese Novelle wurde von der Autorin neu bearbeitet. Sie erschien in einer früheren Fassung 1989 unter dem Titel Op het eerste gezicht in der niederländischen Originalausgabe Dubbelportret. Drie novellen bei Contact in Amsterdam; 1994 auf Deutsch unter dem Titel Auf den ersten Blick in der Übersetzung von Rotraut Keller in Doppelporträt. Drei Novellen bei dtv in München.
ISBN 978-3-446-25405-3
© Margriet de Moor 1989/2016
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
© Frédéric Cirou/Photoalto/laif
Satz: Gaby Michel, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Dies ist wieder eine dieser Nächte, die ich schlaflos durchlebe.
Seit Jahren schon pflege ich dann aufzustehen. Als Anfängerin tat ich das nicht. Ich blieb im Bett, warf mich von einer Seite auf die andere und lauschte den Schlägen der Uhr. Was natürlich merkwürdig ist. Du willst in die unzählbaren Stunden eintreten, in den immensen Raum, in dem das Messen von Zeit allenfalls als Scherz vorkommt, aber was machst du, du murmelst: »Eins, zwei, verdammt noch mal, schon drei«, und hörst bei Ostwind wenige Sekunden später das Urteil bestätigt. Den dünnen Schlag vom Turm der Dorfkirche. Nicht den Klang einer Uhr, sondern den einer Glocke. Oft lauschte ich auch den Zügen. Und mir fiel auf, dass sich die Schöpfung zwar reglos verhalten mochte, die nächtlichen Transporte aber ohne Unterbrechung weitergingen. Ergeben oder von Panik erfüllt spürte ich, wie sich das Vibrieren, früher noch als das Dröhnen der Räder, näherte, sich über Wassergräben und Felder hinweg verstärkte, um schließlich den Spiegel auf der Kommode zu erreichen, der auf unerträgliche Weise mitzuklirren begann. Was musste so verstohlen durch das totenstille Land transportiert werden?
Ich stehe auf und gehe barfuß, ohne Licht zu machen, die Treppe hinunter. Der Schäferhundmischling Anatole hört mich kommen und weiß, wie spät es ist. Wenn ich die Küche betrete und das Licht anknipse, steht das Tier da und streckt sich steifbeinig. Ich nehme das Mehl, die Eier, den Handmixer, die große und die kleine Rührschüssel und fange ohne zu zögern an. Nie brauche ich darüber nachzudenken, was ich machen werde. Ich weiß es einfach. Herrnhuter Sandküchlein. Apfelkuchen. Bretonische Schinkenquiche.
Ich kann meinem Mann nur dankbar dafür sein, dass er den Backofen damals in Kopfhöhe eingebaut hat. In meiner Kopfhöhe. So wie er auch, aus Höflichkeit, die Küchenzeile auf meine Körpergröße abgestimmt hat und nicht auf seine, die, wie ich aus gegebenem Anlass weiß, eins vierundachtzig betrug.
Wenn ich nach einer gewissen Zeit die Quicheform oder das Backblech in den vorgeheizten Backofen geschoben habe, stelle ich den Küchenwecker. Das ist unbedingt notwendig. Denn im dunklen Wohnzimmer, in das ich mich jetzt in Gesellschaft von Anatole begebe, verliere ich jedes Gefühl für Temperatur, Duft und die für eine goldblonde Kruste erforderliche Backzeit. Ich höre das Plumpsgeräusch, mit dem sich der Hund in eine Ecke fallen lässt, und fange an zu wandern.
Ich kann meinem Mann nur dankbar sein für diesen weichen Holzfußboden. Er hat ihn selbst gelegt. Ich weiß, dass er die Eichendielen bei einem Abbruchunternehmen aufgetrieben hat. Ich weiß sogar, dass die Partie aus dem Heidehotel stammte. Damit ich über diesen Fußboden gehen darf, muss einmal viel Geld geflossen sein. Während er im Wohnzimmer arbeitete – ich höre das kräftige, kurze Hämmern –, strich ich mit einem abgeknickten Flachpinsel die Ränder des Türpfostens an der Kellertreppe. Ich erinnere mich, wie zufrieden ich mit der Farbe war, dem Graugrün, das jetzt, fast fünfzehn Jahre später, noch immer sehr ordentlich aussieht, und ich erinnere mich an das steife Gefühl in meinen Fingern, als die am Pinsel heruntergetropfte Farbe zu trocknen begann. Viel Platz zum Arbeiten hatte ich nicht. Sehr deutlich sehe ich, wie der Schwung meiner stümperhaften Pinselstriche von einem Stapel alter Stühle und Kartons mit Hochzeitsgeschenken gebremst wurde. Während ich die chinesischen Schalen, das Tischtuch mit den Schwertlilien, den Cocktailshaker und was nicht noch alles nach wie vor besitze und fast täglich vor Augen habe, ist Ton, mein junger Ehemann, restlos verschwunden. Wie hat er geschaut? Welche Bemerkungen wurden aus dem Wohnzimmer heraus gemacht?
»Klarlack ist vielleicht doch am schönsten.«
»Tee oder Bier?«
»Weißt du, wen ich heute Morgen getroffen habe?«
»Ich habe schon mehr als die Hälfte fertig.«
»Ja. Aber nicht, was du denkst.«
Derlei Dinge. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass dabei eine kleine Melodie gepfiffen oder dass gelacht wurde. Ich kann mir die Finger in die Ohren stecken und die Bemerkungen heraufbeschwören. Aber es sind Worte ohne Intonation, ausgesprochen von einem Mund voller Sand. Ich habe es versäumt, meinen Mann, während er mit dieser Arbeit beschäftigt war, wahrzunehmen.
Dieses Umherwandern im dunklen Wohnzimmer bringt mich zur Ruhe. Etwas anderes steckt nicht dahinter. Ich schlafwandele über die Eichenholzbahn, die meiner Meinung nach im Laufe der Jahre durch die Reibung meiner Füße immer wärmer geworden ist. Und es besteht kein Zweifel, ich erziele damit ein Resultat, das der Wirkung von Träumen recht nahe kommt. Das Gefühl, mit den verborgenen, verdrängten Dingen zu verschmelzen.
Wenn ich am Spiegel vorbeikomme, werfe ich meist einen Blick hinein. Ist es eine helle Nacht, so begegne ich den – seltsam verwilderten – Augen, und manchmal kann ich die Konturen des am Kinn gerade abgeschnittenen braunschwarzen Haars erkennen. Am Fenster widme ich dem Land ein paar Augenblicke. Meinem Land. Ich habe es geerbt. Es steigt ziemlich steil an – noch immer muss ich an eine Flutwelle aus dem Meer denken, je nach Jahreszeit ist eine Wand aus Getreide, aus niedergebranntem Kraut, aus nackter schwarzer Erde im Begriff, den Bauernhof hinwegzufegen – und bildet dann einen eigenen, vorzeitigen Horizont, hinter dem die jetzt für mein Auge unsichtbaren Äcker wieder bis zum Dorf abfallen.
Dass ich heute Nacht keinen Schlaf finden kann, ist ungewöhnlich. Es wird eine Stunde her sein, dass ich seinen schweren Arm von mir heruntergehoben habe. Wie viel wiegt ein Arm, fragte ich mich, während ich den Körperteil taxierend bewegte, sechs, sieben Kilo? Er schlief weiter, einen freundlichen Ausdruck auf dem Gesicht. So fest in einem fremden Bett zu schlafen. Ich habe schon lange aufgehört, mich darüber zu wundern, es ist bei allen so. Nachdem ich den Ellbogen angewinkelt und die Faust neben die Wange gelegt hatte, rückte ich von ihm weg. »Butterkuchen mit Zimt«, ging mir durch den Kopf, als ich die Treppe hinunterstieg.
Ich komme beim Fenster an, drücke die Stirn an die Scheibe und schaue hinaus. Deutlicher denn je ragt heute Nacht das Meer vor mir auf. Ein eisbleiches, mondbeschienenes Meer. Wir haben hier eine merkwürdige Woche hinter uns. Zuerst wurden die Äcker unter einem Meter Schnee begraben, einen Tag darauf fiel lauer Regen, der alles zwar schmelzen ließ, aber nicht zum Verschwinden bringen konnte, bevor der Wind aufkam. Da sank das Thermometer auf zwölf Grad unter null. Über den Weg vor meinem Haus hat sich eine Brandung aus gefrorenem Schnee geschoben. Es kostet mich wirklich nicht viel Mühe, mich daran zu erinnern, wie meine Füße durch den lauwarmen gelben Schaum stapften, ich bin an der Küste zu Hause, als Kind jagte mir der Gestank von Bauernhöfen Angst ein.
Alle hier hatten erwartet, dass ich nach der Beerdigung weggehen würde. Zurück in den Hintergrund, aus dem ich erst vor kurzem gekommen war. Was hatte ich auf diesem Land noch zu suchen? Dieser beschämende Tod verlieh meinem Status keinerlei Glanz, keinen Schimmer trauriger Glorie.
»Du musst bleiben«, hatte Lucia gesagt. »Einfach bleiben.«
Sie saß auf der Fensterbank in der Küche, und ich erinnere mich, dass ich mir Sorgen machte, sie könnte sich mit der Hand auf die Waage stützen. Es war ein unglaublich feines, empfindliches Instrument, mit dem sich Mehl oder Salz bis auf ein halbes Gramm genau abwiegen ließen. Die Schwester meines Mannes wusste nicht, dass es schon seit der ersten durchwachten Nacht für mich feststand, dass ich von hier nicht weggehen konnte. Es war nicht einmal ein Entschluss. Ich bleibe in diesem Haus. Das Land werde ich an meine Nachbarn abgeben, Braams und Pepping.
Es war Samstagnachmittag, der erste nach all dem Trubel und dem Beerdigungsbrimborium. Außer Lucia hatte kein Mensch mich an dem Tag besucht. Ich war nicht bemitleidet, nicht ausgefragt worden. Aus irgendeinem Grund war der Postbote nicht gekommen. Das Telefon hatte kein einziges Mal geklingelt. Mein Instinkt sagte mir, dass dies der Anfang der tiefen Stille war, die mich in Zukunft umgeben würde. Man hatte mich wohlüberlegt mit ihr alleingelassen, wie mit einem fremden Tier, das bei mir eingedrungen war, eine Schlange oder ein junges, wildes Pferd, ich war nicht geschickt genug gewesen, es auszusperren, und niemand käme auf die Idee, mir bei seiner Versorgung zu helfen. Bereits an jenem Samstag begann ich zu begreifen, dass ich mich dieser Stille nach eigenem Ermessen würde nähern, dass ich sie würde zähmen und aufziehen müssen.
»Und wenn sie es nicht kaufen können, dann werden Braams und Pepping das Land nur zu gern dazupachten«, setzte meine Schwägerin mit Entschiedenheit hinzu.
Aus Höflichkeit und Freundschaft sah ich sie an. Die Augen zugekniffen, matt nickend, muss ich den Eindruck gemacht haben, intensiv über ihre Worte nachzudenken. Mit einem Mal fragte ich mich, ob sie Ähnlichkeit mit ihrem Bruder hatte. Darauf hatte ich nie geachtet. So zart gebaut war er natürlich nicht gewesen. Sein Haar war sicherlich auch weniger rot und bestimmt nicht so dick und glänzend. Aber dieser Blick. Sie hat eine schreckliche Woche hinter sich, ihre Bluse ist schmutzig, gestern oder vorgestern muss ihr sehr heiß gewesen sein, ich sehe die eingetrockneten Schweißringe, aber sie blickt mich gelassen an. Was mich bei Rothaarigen so amüsiert, sind die Wimpern. Vogelwimpern, sehr dicht. Ich fand, sie hatte den Blick eines Menschen, der keinen Unsinn mag und schon gar kein Selbstmitleid.
»Das ist vielleicht eine Idee«, murmelte ich.
Im Laufe der Jahre hat sich das Dorf damit abgefunden, dass ich geblieben bin.
Der Wecker klingelt. Sogar durch zwei geschlossene Türen hindurch erschreckt mich das unangenehme Geräusch jedes Mal wieder. Der Hund erhebt sich. Wir gehen in die Küche. Ich nehme das Blech aus dem Backofen. Mit größter Sorgfalt schneide ich den prächtigen Kuchen in sechs mal sechs Zentimeter große Quadrate. Wenn ich alles abgewaschen und die Arbeitsplatte sauber gewischt habe, gebe ich Anatole zu trinken. Ich weiß, die Nacht ist noch nicht zur Hälfte vorbei. Obwohl der Teig eine Stunde gehen muss, reicht die Zeit für einen Russischen Napfkuchen. Da fällt mir ein, dass wir nach dem Essen die Wodkaflasche mit nach oben genommen haben. Wie ein erfahrenes Ehepaar, das einen schönen Abend gebührend beschließt, haben wir uns gegen elf vom Tisch erhoben. Hinter ihm bin ich mit zwei schönen, schmalen Gläsern die Treppe hinaufgegangen.
Den Schnaps brauche ich jetzt für den Kuchen, den ich backen will.
Die Flasche in der Hand, bleibe ich neben dem Bett stehen. Im Schlaf hat er sich das Laken halb über den Kopf gezogen. Das Licht der Leselampe bescheint die Falten von der Seite her. Als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass sie sich sanft heben und senken. Sie heben und senken sich im Rhythmus hörbarer Atemzüge, unverkennbar der Schlaf eines Mannes nach einem Tag schwerer Arbeit.
Ich kenne das. Meist bin auch ich sehr müde. Es lässt sich kaum in Worte fassen, wie anstrengend es ist, einen Tag mit einem Unbekannten zu verbringen. Oft genug hatte ich Mühe, die Augen offen zu halten, bis das gleichmäßige Geräusch einsetzte, das sichere Zeichen, dass auch ich mich auf die Seite drehen konnte.
Es ist ein gutes System. Ich habe es vor Jahren gemeinsam mit Lucia entwickelt. Damals passierten beunruhigende Dinge mit mir. Wenn ich zum Beispiel morgens aufstand, konnte ich meine Hände nicht bewegen. Dann blieben sie wie Heurechen gespreizt, eine Viertel-, manchmal sogar eine ganze Stunde lang. Schlimmer noch war, dass sich mein Gesicht verfärbte und anschwoll. Die Vertiefungen füllten sich. Die Augenhöhlen, die Mulde zwischen Unterkiefer und Hals, genau die Stellen, die den Charakter eines Gesichts bestimmen, viel mehr als die Augenfarbe, viel mehr als die Lippenform, verschwanden unter einer straff gespannten Haut. Wenn ich die Finger darauf legte und sanft drückte, dann spürte ich die dicke Materie darunter, weh tat es nicht.
»Du verkriechst dich in einer Höhle und kommst nicht heraus. Nicht mal für kurze Zeit. Das ist eine Beleidigung für deine Sinnlichkeit! Für deine elementaren Bedürfnisse!«, sagte Lucia.