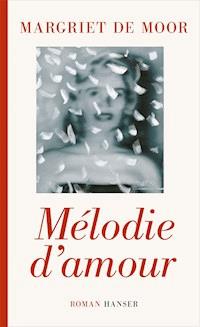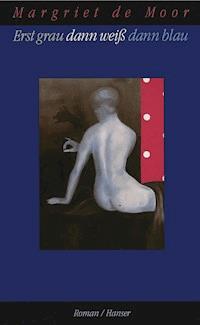Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge verheiratete Contessa Carlotta reist für eine Opernsaison nach Neapel und verliebt sich leidenschaftlich in den Sänger Gasparo Conti. Sie gewinnt die Zuneigung des hinreißend schönen Kastraten, der mit seiner Sopranstimme die Zuhörer vollkommen verzaubert. Einen Sommer lang begleitet sie ihn und erlebt rauschhafte Wochen der Musik, der Verführung und des erotischen Raffinements. »Ich bewundere die Holländerin Margriet de Moor ... 'Der Virtuose' ist ein Preislied auf die Lust und die Wollust.« Marcel Reich-Ranicki, STERN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Rausch der Liebe, der Rausch der Musik — wer einmal außer sich gewesen ist vor Glück und zugleich ganz bei sich, wenn die Farben einer Stimme und die Körperlichkeit dieser Stimme einmal die Sinne verzaubert haben, der lebt von da an anders. Für eine Opernsaison nach Neapel!, hat die junge Contessa Carlotta mit ihrem (manchmal den Knaben zuneigenden) Mann ausgemacht, die die Koffer gepackt und ist mit klopfendem Herzen in die Stadt de Belcanto gefahren. Abends sitzt sie in der Loge der Oper und gibt sich, aller Erdenschwere wie entrückt, einer die Zuhörer vollkommen verzaubernden Stimme hin. Es ist die Stimme Gasparo Contis, eines Jungen aus ihrem Dorf, die Sopranstimme eines inzwischen hinreißend schönen Kastraten.
Carlotta gewinnt die Zuneigung des Sängers und wird »schwach vor Begehren«, seine Begleiterin, verführt den in den Dingen der Liebe ein wenig Trägen nach Strich und Faden und reibt sich in diesen rauschhaften Wochen der Musik, Verführung und des erotischen Raffinements immer wieder die Augen, ob das alles denn auch wirklcih wahr sei. Die Erinnerung, sagt sie, die über die Künste ebenso wie über die Ideen der Aufklärung gelehrt Konversation machen kann, ist unser größtes Geschenk.Ein Glück ist ein Glück ist ein Glück, ein Narr, wer es festhalten will. Es ist wie die Musik: Es ist da und bald wieder fort — und also da.
Margriet de Moors Roman über die Liebe und die Musik und die Liebe zur Musik hat die Leser und die Kritiker hingerissen, wie ihr im Erzählen so unbeschwert gelungen ist, was in ihrer Geschichte Gasparo mit seiner unvergleichlichen Stimme gelicht: »diese mühelose Bewegung, die den so ersehnten Taumel hervorbringt«. Die Musik ist Sprache geworden, das Erzählen Musik.
Margriet de Moor
Der Virtuose
Roman
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Carl Hanser Verlag
Hanser E-Book
Prolog
Eines Tages verschwand ein Junge aus unserem Dorf. Gasparo Conti hatte ein blasses Kindergesicht, er war mollig, aber so graziös wie eine Schilfrispe, und wenn er barfuß mit einem gegabelten Ast in der Hand die kleinen abgelegenen Wege hinter dem Dorf entlangrannte, klang seine Stimme, sein Rufen so schrill wie die jedes anderen kampanischen Jungen. Das weiße Hemd, die Kniebundhose, Kleider, die seine Brüder oder Cousins ohne Bedenken auftragen würden. Die goldgesprenkelten Augen. Er verschwand, elf Jahre alt, nachdem mein und sein Vater eine Nacht lang gespielt hatten.
Das Dorf heißt Croce del Carmine, und unser Haus lag im Westen, am Rand. Die Villa hatte zwei Stockwerke, auf dem Dach befand sich ein Türmchen, und die Freitreppe führte auf drei Seiten hinunter zu den Zypressen und wilden Pfirsichbäumen. Früher muß das Anwesen Reichtum und erlesenen Geschmack ausgestrahlt haben, doch in meiner Erinnerung sehe ich geschlossene Fensterläden, ein geschlossenes Cembalo, und höre den Wind durch die Reisigbündel pfeifen, die im Winter geschichtet unter den Arkaden des Nebengebäudes lagen. Und natürlich erinnere ich mich an das Zimmer nach Westen hinaus, in dem mein Vater und Benedetto Conti am Spieltisch gesessen haben. Es war Juli. Die Fenster standen offen. In der Luft, die in der Windstille ins Zimmer zog, war unvermeidlich auch ein Hauch von Vulkanrauch. Mit kreidebleichem Gesicht wartete Benedetto Conti den Einsatz ab, der diese Nacht auf einen Schlag auslöschen konnte.
»... Gasparos Operation.«
Am folgenden Sonntag blieb mein Vater zu Hause, und es war Faustina, das Kindermädchen, die mich in die Santa Monica mitnahm. Als wir durch das Mittelschiff nach vorne gingen, war das Gloria bereits gesungen. Ein paar Frauen machten uns Platz. Faustina schob mich in eine Bank und bückte sich, um mit einer raschen Bewegung mein neues Kleid mit den großen goldenen Vögeln glattzustreichen. Ich schaute zum Chor. Vier rotgekleidete Jungen schritten die Altarstufen hinunter, um rechts von der Orgel, in einem Lichtfleck, eine vierstimmige Motette zu singen. Ich kannte sie alle.
Gasparo, der erste Sopran, war ausgetauscht worden.
Zuerst empfand ich nichts. Obwohl ich mit dem ganzen Sachverstand meiner zehn Jahre lauschte, konnte ich die Komposition mit der sauberen Orgelbegleitung nicht sofort einordnen. Es fehlten gewisse Obertöne. Die vier Stimmen sangen mit jugendlicher Inbrunst, und der Maestro ließ erkennen, daß er das Laudate notfalls mit den Händen nach oben tragen würde. Doch ich mußte an einen trüben und bewölkten Herbsttag denken, an dem es weder Licht noch Schatten gibt. Da überkamen mich plötzlich eine unbekannte Trauer und ein Schrecken, als zerspränge etwas in meiner Brust. Während ich den Kopf sinken ließ, fing ich an zu begreifen, daß mein Vater gewußt hatte: Die Messe würde an diesem Sonntag nicht hörenswert sein.
»Ich will, daß du mir erzählst, wo Gasparo geblieben ist«, sagte ich, als wir uns durchs Portal hinausdrängten.
Faustina berührte das Weihwasser und bekreuzigte sich. Dann sagte sie: »Er wird wohl krank sein.«Aber ich sah sie an und blieb stehen, so daß sie schließlich sagen mußte: »Ich habe gehört, daß er in Norcia ist.«Sie senkte die Stimme und begann mir zu erzählen, daß in Norcia Benediktus geboren sei, ein Abt, der sei so über alle Maßen heilig gewesen, daß er nicht wie ein normaler Mensch im Bett liegend gestorben sei, sondern stehend, auf beiden Füßen, die Augen auf die Madonna gerichtet. Ich hörte zu und wußte genau, daß sie mich irreführen wollte, doch ihre leise Stimme ließ meine Aufmerksamkeit abschweifen. Ich faßte nach ihrer Hand und ließ mich folgsam nach Hause führen. Norcia, dachte ich ab und zu schläfrig, und das war alles.
Trotzdem klang der Name dieses Ortes, auch später noch, wie ein geheimnisvoller, beunruhigender Refrain in mir nach. Und Jahre später wunderte ich mich nicht, als ich von den Operationen hörte, die man in Norcia mit großem Geschick vornahm.
Der Junge darf nicht älter als zwölf sein, zwölf ist die Grenze, doch schon geraume Zeit davor muß der zum Singen bestimmte Knabe im Auge behalten werden. Nur ein Kenner sieht, daß die Rundung der Kieferpartie knochiger wird. In den Augen schimmert eine Mattigkeit, die verrät, daß Haut und Blut zu suchen beginnen. Das ist der Wendepunkt. Lippen und Wangen sind noch die eines Kindes, aber die Bewegungen werden ungelenker, und das gibt den Ausschlag: Morgen werden die Pferde eingespannt. Der Eingriff in Norcia ist nicht besonders schwer. Nur jeder vierte Junge überlebt ihn nicht. Der Chirurg setzt alles daran, die Samenstränge und Hoden zu entfernen, ohne sonst irgend etwas zu beschädigen. Wenn das gelingt— und das ist häufig genug der Fall —, erlangt das Kind, nachdem die Wunde verheilt ist, sein normales Körpergefühl und alle Lebenslust wieder. Der Junge wird sich entwickeln, und die ihm verbliebenen Drüsen werden seinen Körper der ungewöhnlichen Umstände wegen mit ein paar originellen, unschuldigen, reizvollen Akzenten ausstatten. Mit einer Haut, die weich und nahezu unbehaart ist. Mit einem Brustkorb, der äußerst geübten Lungen reichlich Raum bietet. Und mit einem vollendet modellierten Kehlkopf, der eine Stimme voller schmerzlicher Schönheit hervorbringt, eine Stimme, die bewegt, berauscht, die von einer Welt außerhalb der Welt zeugt, aber dennoch zu einem ganz normalen Körper gehört: warm und voll dunkler Sehnsüchte.
Der Sommer verging. Im August, dem Monat zwischen den beiden Ernten, feierten die Leute vom Fuße des Vesuvs. Im Morgengrauen wurde ich oft auf wundersame Weise von den Karren geweckt, die an unserem Haus vorbei ins Dorf zurückkehrten. Es wurde gesungen und die Fiedeln und Colascioni spielten, seit man tags zuvor aufgebrochen war. Ich liebe den frühen Morgen. Durchs Fenster kitzelt einen der neue Tag in der Nase.
Eines Abends ging ich mit meinem Vater zum Dorfplatz, um uns von einer Musikantentruppe aus Neapel ergötzen zu lassen. Es war das Fest des heiligen Bibiano. Im Dorf wimmelte es von Chaisen und Wagen. Ich erinnere mich, daß mein Vater schon damals sehr schlecht zu Fuß war, aber trotzdem ließ er die mit Tüchern überspannte Ehrentribüne links liegen. Wir standen mitten im Gewimmel, schauten und lauschten der Musik, die so wild war, daß sie regelrecht wütend klang. Neapolitaner ertragen keine schleppenden Tempi. Zwei Geigen, zwei Mandolinen und ein Cello begleiteten einen Sänger und eine Sängerin, die ihre Kanzonette in den merkwürdigsten Windungen in die Höhe jagten. Es waren beides Sopranstimmen. Wenn das Mädchen, weil es sich so ergab, die tiefere Stimme sang, produzierte der Mann, der musico, mit der größten Leichtigkeit weiter seine rasenden Falsettöne. Um mich herum wurde geklatscht und geschrien, es wurde getanzt, die Nacht roch nach Feuer. Als das Lied zu Ende war, fingen ein paar Leute an zu diskutieren. Ich hörte meinen Vater sagen: »Hört sich ganz passabel an.«Seine Stimme klang freundlich. Ich dachte, er werde die ganze Gruppe wie früher zu uns nach Hause einladen.
Aber am nächsten Morgen stand ich in der Küchentür und sah, daß die Öfen kalt waren. Die Diener liefen wie geistesabwesend herum. Und das einzige Instrument, das an diesem Tag gestimmt wurde, war das kleine Clavicembalo aus Zedernholz, auf dem ich damals meine Scarlatti-Sonaten übte.
Mußte ich, außer der Verbannung, etwa auch das Heimweh mit meinem Vater teilen?
Ich wünschte, ich stünde in einem Festsaal und jemand erzählte mir das allerneueste Geheimnis. Ich wünschte, meine Schwester käme wieder einmal.
Sie kam. Eines schönen Samstags ratterte eine von sechs Pferden gezogene carrozza die Allee herauf, und unter dem halb heruntergelassenen Verdeck saßen zwei lachende Frauen: Angelica Margherita, die älteste Tochter meines Vaters, und ihre Tante. Im ersten Moment war ich wie geblendet. Dann sah ich das Gesicht meiner Schwester. Eine erwachsene Dame von siebzehn Jahren hockte vor mir, hatte mich geküßt und in die Arme geschlossen und schien jetzt, mit unruhig hin und her schießenden Augen, im selben Atemzug hören zu wollen, ob ich denn auch genug lachte, äße, schliefe. Sie war schön. Auf ihrem Lockenkopf trug sie wie der erstbeste Weinhändler einen mit Hahnenfedern geschmückten Hut, der die Form eines Zuckerbrots hatte.
Angelica Margherita, meine Halbschwester, sieben Jahre älter als ich. Ihre ganze Jugend war gedacht als Vorbereitung auf eine sorgfältig eingefädelte Hochzeit. Sie selbst hatte andere Vorstellungen. Animiert durch das Fehlen einer Mutter und die Zerstreutheit ihres Vaters, reiste sie an einem Palmsonntag nach Neapel zu einer jungen Tante, die Schönheit und Lust zu ihrem Lebensprinzip erhoben hatte. Nach einem Jahr begriff mein Vater, daß er sich die Mitgift sparen konnte.
Nun aber war das Haus sofort in heller Aufregung. Vom Keller bis zum Speicher schallten die Rufe, Schränke zu öffnen und Karaffen zu füllen. Im Speisezimmer hörte sich mein Vater die Berichte seiner Tochter an.
Sie lerne Griechisch. Sie mache Konversation über Elektrizität. Sie besitze fünf französische Roben.
Die Tante beugte sich vor. »Seit dem Frühjahr tanzt sie als Ballerina im Bartolomeo-Theater.«
Im Spiegel sah ich meinen Vater ungläubig lächeln.
Aber es stimmte. Spät in der Nacht, beim Zubettgehen, erklärte mir meine Schwester, wie man sich dem Papst widersetze und nicht nur auf den neapolitanischen Bühnen, sondern auch in Rom in aller Öffentlichkeit als Frau tanzen könne. Es sei kinderleicht: Man verkleide sich als diejenige, die man sei. Inmitten der Reihe junger Tänzer, die mit ihren glattrasierten und geschminkten Gesichtern, ihren Frauenkleidern eine exotische Weiblichkeit ausstrahlten, befinde sich stets auch ein Mädchen. Sie trage die gleiche Perücke wie die Jungen und das gleiche Tanzkleid, und darunter, ganz nach Vorschrift, eine die Schenkel eng umschließende Hose. Und trotzdem sei es vielleicht gerade sie, die durch ihre Anwesenheit den ersehnten Zweifel, den Taumel auslöse.
Angelica Margherita zog ihr Hemd aus, als ob sie eine Augenbinde löse. Vom Bett aus verfolgte ich das Schauspiel der noch ein wenig nachwippenden weichen, perlmuttrosa Brüste.
Sie sagte: »Es ist schön da, ehrlich wahr, glaub mir, du wirst dort verrückt vor Freude.«
Es folgten Tage voller Glanz. Wenn ich in Gesellschaft der beiden Frauen durch die nähere Umgebung fuhr, um Verwandte zu besuchen, lehnte ich mich in der Kutsche zurück, schaute von den Pferden zum Himmel und unterschied mich in nichts von einem großen, närrischen Schmetterling.
Ja; doch eines Tages hörte ich meine Schwester murmeln: »Scher dich zum Teufel.«Sie stand zwischen den Zypressen vor unserem Haus. Es war die Zeit der Dämmerung. Sie schaute auf die Fassade mit der Treppe und den Fensterläden wie jemand, der den bösen Blick hat. Tags darauf sagte sie: »Im Winter ist das hier kein Vergnügen.«
Kurz darauf reiste sie mit ihrer Gefährtin ab, um wieder auf einer Bühne zu tanzen, zwischen Samtdraperien und vor einer Kulisse, die mit ihrer Traumarchitektur aus Kuppeln und sich in der Ferne verlierenden Galerien das Bild der Welt vollkommen verändert.
Und ich blieb in einem verlassenen Dorf zurück.
Ich muß sagen, ich komme aus einem schönen Dorf. Alle Häuser, ob groß oder klein, haben Gärten mit Blumen und Vögeln. Und in der Mitte, an einem gepflasterten Platz, steht eine Kirche mit einer bunt bemalten Orgel, die Divina Pietà genannt wird. Das Dorf lebt von der Sonne und einem Boden, der vom Vesuv überschüttet und alles andere als arm ist. In den Schwefeldämpfen, die zu den verrücktesten Zeiten aus Bodenlöchern aufsteigen, gedeihen Trauben, Korn und Obst. Über den Häusern strahlt der Himmel, und unter dem Himmel raucht in der Ferne der Vulkan. Dieses schöne Dorf war der Verbannungsort meines Vaters. Ich bin in einem Ort der Verbannung geboren.
Als mein Vater Anfang dieses Jahrhunderts auf einem großen grauen Pferd nach Spanien zog, um für Philipp zu kämpfen, war er mit Sicherheit keine Ausnahme. Der neapolitanische Adel unterstützte die Könige von Kastilien und Aragón. Mein Vater brach an der Spitze einer gut ausgebildeten, von ihm besoldeten Hundertschaft auf, um Katalonien und das Königreich Neapel gegen die Habsburger zu verteidigen. Wie hat er sein nobles Tun bereuen müssen! Als er nach einem Jahr voll Feuer und Blut in seine Heimatstadt zurückkehrte, wehte auf dem Dach des königlichen Palastes die Fahne mit dem Adler: Karl von Habsburg hatte Neapel eingenommen. Der Österreicher richtete milde. Mein Vater und eine Reihe anderer Barone wurden auf ihre Landgüter verbannt.
Die Villa erlebte gute Zeiten, anfangs jedenfalls, und das ganze Dorf verdiente ordentlich dazu. Ich weiß, daß mein Vater und seine zweite Frau, meine Mutter, aufsehenerregende Feste gaben. Angelica Margherita erinnert sich noch an die Masken und die goldgewirkten Kostüme. Ich erinnere mich an derlei Dinge nicht. Ich war erst drei Jahre alt, als meine Mutter kurz vor der Siesta plötzlich mit einem Seufzer auf den rosa Marmor ihres Schlafzimmerbodens niedersank. Faustina, die bei ihr war, erzählte, daß sie die Schildpattkämme, die sie gerade aus dem schweren schwarzen Haar gezogen hatte, aus der Hand fallen ließ. Verschwand in diesem Augenblick die Seele aus dem Haus? Mein Vater muß sich seit ihrem Todestag nach und nach mit der Öde der Verbannung abgefunden haben. Und er muß, mehr denn je, Zuflucht bei dem gesucht haben, was einem als Mensch, als Fremdling in diesem Leben, noch bleibt. Dem Rausch. Spiel, Trunkenheit, Verliebtheit, Musik: glückliche Augenblicke in einer Welt, die nicht die deine ist. Mein Vater entschied sich für die Würfel und die Karten.
Wie oft habe ich nach Sonnenuntergang gehört, wie die Freunde, die routinierten Spieler, in unser Haus kamen, um sich in das nach Westen gelegene Zimmer zu begeben! Ich kannte die Geräusche des Dreißiger- und Vierzigerspiels, des banco fallito, und ich kannte die von leisen Verwünschungen unterbrochene Stille, wenn an manchen Abenden minchiate gespielt wurde. Siebenundneunzig große, von Michelangelo entworfene Karten werden rasch gemischt und ausgeteilt. Die Einsätze sind hoch. Jeder Verlierer schreibt seine Schulden auf die weiße Rückseite einer Karte. Mein Vater verlor sein Geld und seine Ländereien, die Wagen, Pferde, portugiesischen Münzen. Er hatte einen Gegenspieler, dem er — die Heilige Jungfrau mag wissen warum — nicht widerstehen konnte.
Ich sehe Benedetto Conti in einer Julinacht an der Freitreppe unseres Hauses auftauchen. Hinter den Türen der Eingangshalle wartet mein Vater. Die beiden Männer schütteln sich die Hand und sehen sich mit leerem Blick an. Beide sind auf der Hut. Mit großer Zurückhaltung suchen sie die Gesellschaft des anderen, um sich einem hochfahrenden, strikt persönlichen Abenteuer hinzugeben. In der sengenden Luft, die durch die Fenster hereinströmt, setzen sie sich an den Tisch und fangen an zu trinken und zu würfeln. Sie bleiben nüchtern wie Teufel in der Hölle. Zwei, drei Stunden verstreichen, Conti verliert. Auch als sie zum Kartenspiel überwechseln, verliert Conti weiterhin Korn, Wein, Land, sein Gesicht wird bleich. Auf einmal schaut er auf. Auch mein Vater schaut auf. Ihre Blicke treffen sich.
Hat mein Vater in diesem Augenblick dank der unverhofften Gunst des Schicksals begonnen, an die anderen Kostbarkeiten in seinem Leben zu denken? Plötzlich gab es eine Angelegenheit, die er dringend mit Conti zu regeln hatte.
»Gut«, sagte er leise. »Versuchen wir, diese Situation durch einen einzigen Einsatz ins reine zu bringen.«Er lächelte und machte ein ergebenes Gesicht.
Gasparos Stimme. Gasparo Contis Stimme, dieses unglaubliche Etwas, das die Chöre und Musikensembles der ganzen Gegend dirigierte, spukte meinem Vater schon lange im Kopf herum. Er und andere Eingeweihte hatten Conti auf die Zukunft des Jungen hingewiesen: Reichtum und Beifallsstürme. Aber der Mann machte den Eindruck, als lasse ihn die Sache kalt oder, schlimmer noch, gehe ihn nichts an. Mit Hilfe seiner älteren Söhne bewirtschaftete er seine Weinberge und ließ den jüngsten, eben jenes Wunder, inzwischen ruhig weiterwachsen. Rom ... Neapel ... die Opernhäuser von ganz Europa ... Conti gähnte oder pfiff durch die Zähne. Erst nachts, an dem mit grünem Tuch bespannten Tisch, ließ er erkennen, daß er seiner festen Überzeugung nach zum Siegen geboren war.
»Gasparos Operation.«
Conti nickte und legte die Karten einzeln, mit Daumen und Zeigefinger, auf den Tisch. Er verlor.
Er verlor, und nichts konnte mehr verhindern, daß der Junge aus unserem Dorf verschwand. Zunächst wußte ich nicht, wie ich auf die Idee kam, Gasparo hätte etwas von mir mitgenommen, hätte etwas mitgehen lassen, das ich um jeden Preis hatte behalten wollen. Danach geschah es immer häufiger, daß meine Gedanken abschweiften und mir eine blendend helle Stunde aus meiner Jugend einfiel. Er war elf, und ich war zehn. Er stand vor der halbrunden Kirchenwand, ich saß auf dem Eckplatz in der ersten Reihe. Durch die Fenster strömte Licht herein und blieb mitten im Raum hängen. Für einen Augenblick war es vollkommen still. Dann, auf ein Zeichen des Kapellmeisters, setzte die Arie ein. Im Wechsel mit dem Chor sang Gasparo eine Arie, die ich noch nie gehört hatte. Überrascht lauschte ich dem leisen Einsatz, dem langen Ton und dem Crescendo, das sich wie ein straffes Seidenband spannte. Was war das? War das Kirchengewölbe zu eng? Ich setzte mich aufrecht hin und sah den singenden Jungen an. Es war, als wüßte ich, daß ich mir seine selbstzufriedenen roten Lippen auf Jahre hinaus würde einprägen müssen, die Stirn, das Haar, das Chorhemd mit den Ärmeln aus Spitze und die Kehle, durch die er, ohne die geringste Emotion zu zeigen, die Töne strömen ließ, die mich auf ihrem Weg mitnahmen ... Zuneigung. Vertrautheit. Verbindungen zwischen zwei Gebieten. Der Chor setzte zum letztenmal ein, als ich meine Lage endlich begriff. Ich schloß die Augen und dachte: O welche Unruhe! Welches Verlangen! Ich bin glücklich.
War das, schon damals, Verliebtheit?
Jahre später sah ich ihn wieder. Einen großen Mann mit runden Schultern. In seiner Jugend war er einmal nach Norcia gereist, ohne zu wissen, daß er im Halbdunkel der Kutsche das Liebessehnen eines Mädchens mitnahm.
Als ich fünfzehn wurde, war es an der Zeit, zu heiraten. In unserer Gegend sind die Frauen mit fünfzehn am schönsten, schöner werden sie ihr ganzes Leben lang nicht mehr. Ich war eine Aristokratin mit rabenschwarzem Haar, das von Faustina, meiner Zofe, geflochten und dann in einem grünseidenen Netz so drapiert wurde, daß es genau über den Schultern hing. Ich hatte eine Wespentaille, eine große Nase und Augen, die ich unter Brauen, die bis zu den Schläfen liefen, nicht eben schnell niederschlug.
Daß man mich in Latein und Heraldik unterwiesen hatte, war ganz normal. Daß ich in die vornehmen Häuser der näheren Umgebung eingeladen wurde, lag auf der Hand. Junge Frauen wie ich erschienen in tief ausgeschnittenen Kleidern aus geblümtem Brokat. Wir sangen. Wir improvisierten auf dem Cembalo. Nach einem Souper, bestehend aus Schwein in Honig, Taube, Lamm, Hase, Seewolf in scharfer roter Soße, Risotto, Eis, Konfekt, Torte und den ersten Kirschen aus mit warmem Wasser gegossenen Obstgärten ließen wir uns gerne bitten, draußen auf der Terrasse, zwischen den Zwergpalmen, etwas Lyrisches über Götter und Schäferinnen zum besten zu geben. Wir taten das mit einer verblüffenden Leichtigkeit.
Meine Mitgift freilich hatte sich nach und nach in Luft aufgelöst.
Eines Tages sagte mein Vater: »Der Herzog von Rocca d’Evandro hat um deine Hand angehalten.«
Ich mußte lachen. »Berto!?«
Mein Vater zwinkerte nicht einmal.
Berto, der Mann, der mich zur Gemahlin nehmen wollte, war ein Freund des Hauses, den ich schon seit Kindertagen kannte. Er kam aus einer Advokatenfamilie, die über unerschöpfliche Mittel verfügte dank einer Angewohnheit der Neapolitaner, sich von einem Tag auf den anderen an einen Streit mit einem Verwandten oder Nachbarn zu erinnern, der notfalls über Generationen hinweg ausgefochten werden mußte. In dieser Stadt, in der es von Prinzen und Baronen nur so wimmelte, appellierte man noch häufiger an die Justiz als das Pariser Parlament. Berto besaß Güter und Ländereien, Wagen und Pferde und einen Palazzo an der Via Toledo. Sein Herzogstitel war gekauft. Als er um mich anhielt, war er bereits über vierzig. Ich kannte ihn als einen Mann mit neugierigen pechschwarzen Augen, die durch mich hindurchschauen konnten, als sähen sie jemand anders als meine Person.
Meine Person. Mein Zukünftiger stellte diesbezüglich zwei Bedingungen. Ich sollte auf seinem etwa vierzig Meilen entfernten Landgut bei Altavilla wohnen und nicht in seinem Haus in Neapel. Und ich sollte mich in seinem Beisein weder mit Amber noch mit Moschus parfümieren. Wir heirateten an einem unbarmherzig kalten Wintertag.
Über den Stand der Ehe wird mich niemand schlecht reden hören. Auf einmal bewohnte ich ein luxuriöses, gut bestelltes Haus. Ich empfing dort meine Freunde, meinen Vater und meine Schwester. Faustina richtete ich das Kabinett neben meinem Schlafzimmer ein, das mit Fresken aufgeputzt war. Ich kommandierte meine Dienstboten und bat sie mindestens genausogern in den Salon, denn unter ihnen befanden sich vier ausgezeichnete Musiker, zwei Gitarristen, ein Cellist und ein Geiger. Vor allem mit letzterem, dem Leibdiener meines Mannes, erlebte ich phantastische Stunden der Inspiration. Wir spielten den Thüringer Bach und den Venezianer Vivaldi, und wir spielten alle Violinsonaten von Corelli, wobei wir uns erlaubten, ein Stück in kleiner Terz auch mit einer kleinen Terz abzuschließen, ja, warum eigentlich nicht? Wenn der Bursche das wunderbare Solo von Besozzi zu Gehör brachte, erschien fast immer Berto. Nachdenklich lauschte er dem Vortrag des jungen, mit einer weißen Hose bekleideten Mannes. Ich war daran gewöhnt, daß sie in den unerwartetsten Augenblicken nach Neapel aufbrachen.
Wir kamen gut miteinander aus, Berto und ich. Daß er oft monatelang weg war, machte mir nichts aus, es gehörte zu unserem Kontrakt. Aber wenn er am Kopf der Tafel hinter dem Kandelaber saß und sich nach links und rechts mit unseren Gästen unterhielt, betrachtete ich ihn voll Sympathie. Es war keineswegs unangenehm, mit diesem vertrauten Bekannten im selben Haus zu leben und manchmal, zur heißesten Stunde des Tages, auf demselben Bett zu liegen. Die Anatomie seines Körpers, sein Mechanismus — Berto hat meine Wißbegier nicht enttäuscht. Unter seinen großen, sanften Händen und seinen Plaudereien im Dunkeln trieben meine Gedanken sehr schnell davon. Ich fand es keineswegs lästig, daß er meine Wünsche zu durchschauen schien. Das also war Lieben. Es verlangte mich bald immer mehr nach dieser Tyrannei aus Panik und Glück. Auch die Wohligkeit danach fand ich herrlich, die Mattigkeit, als hätte man mit den Beinen in der Sonne gelegen.
»Du bist doch nicht ungeduldig?«habe ich meinen Mann in einer Sommernacht gefragt.
Denn Zweck der Sache war natürlich, daß der Name und das Geschlecht meines Gemahls fortbestehen sollten. Als ich Berto zu Beginn unseres zweiten Ehejahrs eine Tochter schenkte, reagierte er großmütig. Er nahm das Kind auf den Arm und lachte über den kleinen gähnenden Mund. Drei Jahre später wurde das zweite Mädchen geboren. Wieder große Rührung und ein Feuerwerk über den Orangenbäumen. Nein, er sei nicht ungeduldig. Berto führte meine smaragdgeschmückten Finger an seine Lippen und verschwand für mehr als acht Monate in die katholische Stadt an der heidnischen Bucht.
Kirchen ... Prozessionen auf den Straßen ... purpurne Segel, die auf den Hafen zusteuern ... Neapel fing an, mich zu locken. Wenn meine Schwester von den damastbehangenen Hausfassaden erzählte, machte mich das nicht froh, sondern ich wandte den Kopf ab. »Die Stadt umfängt einen ganz und gar«, sagte Angelica Margherita. »Man schläft in ihr und man geht, fährt und tanzt in ihr. Und trotzdem ist man sich nie sicher, was eigentlich passiert.«Mein Blick verlor sich in der goldgelben Landschaft hinter dem Fenster, und ich hörte Glocken, die von allein zu läuten begannen, und Heiligenstatuen, die leise sprachen: mal spanisch, dann wieder neapolitanisch. Ich muß wirklich dorthin, dachte ich. Aber ich unternahm nichts, lange Zeit nicht. Ohne zu wissen warum, wartete ich ab. Meine Unruhe und mein Zaudern verschwanden erst, als die Verbannung meines Vaters aufgehoben wurde.
Denn eines Tages waren wieder die Spanier in Neapel. Während die europäischen Dynastien erneut in einen Erbfolgekrieg verwickelt waren, war Karl von Bourbon, der Sohn des spanischen Königs, mit seinem Heer in die Stadt einmarschiert. Der kleine gutgelaunte Prinz, der eine grandiose Gemäldesammlung in seinem Gepäck mitführte, vertrieb die Habsburger und bestieg den Thron. Neapel applaudierte. Nach fast dreihundert Jahren erhielt das Königreich beider Sizilien wieder einen eigenen Hof. Was würde mein Vater tun? Würde er an diesen ausgelassenen Ort zurückkehren? Ja, gewiß doch?
Mein Vater wurde krank. Der Triumph in seinen Augen war schon bald wieder erloschen. Anfangs sagte er, er wolle noch etwas Geduld üben, da seine Rückkehr natürlich vorbereitet werden müsse. Dann meinte er, der Winter dauere sehr lange. Er sagte, daß er nicht mehr essen wolle. Ich holte ihn zu mir ins Haus und ließ mehrere Ärzte kommen. Allabendlich schickte ich die beiden Gitarristen an sein Bett, um ihm vorzuspielen. Wir versuchten ihn aufzumuntern. Faustina rieb seine Beine mit Öl und Weinraute ein. Berto erzählte von dem Opernhaus, das der König in Neapel erbauen ließ, ein ovales Phantasiegebilde mit sechs Etagen und Hunderten von mit blauem Samt ausgeschlagenen Logen, an deren Balustraden von Kerzen beschienene Spiegel angebracht werden sollten, so daß sich die Symmetrie des Raums, die darauf angelegt war, jedes Gefühl für Zeit und Ort ins Wanken zu bringen, bis ins Erschreckende verschieben würde ... Mein Vater hörte mit gelassenem Lächeln zu, sagte jedoch eines Tages, daß er nicht mehr trinken wolle. Ich denke, sein Tod war eine Ausflucht.
Nicht lange danach reiste ich ab. Im frühen Morgengrauen setzte ich mich neben Berto in eine seiner schönsten, grünlackierten Kutschen und drehte mich zum Haus um. Gleich würde ich winken, bis meine beiden Töchter und ihre Betreuer meinen Blicken entschwunden wären. Da knallte die Peitsche. Waren wir soweit? Hatten wir nichts vergessen? Ich schlug ein Kreuz, Berto lachte mir zu, wir hatten eine freundschaftliche Vereinbarung getroffen. Nach einer in Neapel verbrachten Saison würde ich nach Hause zurückkehren und wieder schwanger werden. Wenn die Madonna es wollte, würde ich einen Sohn zur Welt bringen. Die Morgenluft strich an meinen Wangen vorbei, wir fuhren mit einem Troß von drei Kutschen; außer Faustina hatte ich eine ganze Ladung Perücken und Roben mitgenommen.