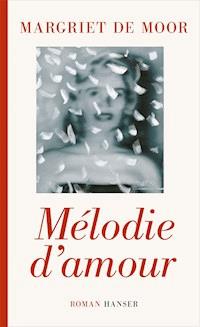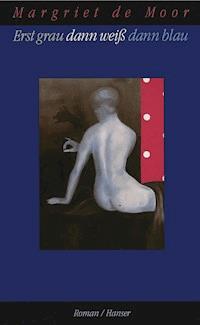Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Tief setzt sich von Grönland aus in Richtung Westeuropa in Bewegung. Am selben Tag bittet Armanda ihre Schwester Lidy, am Wochenende einen Besuch bei ihrem Patenkind in Zeeland zu übernehmen. Unterdessen will sie selbst Lidys zweijährige Tochter hüten und mit Lidys Mann auf eine Party gehen. Armanda ahnt nicht, dass sie mit ihrem kleinen Rollentausch das große Schicksal provoziert: Lidy gerät in jene Sturmflut, die einen Teil der Niederlande für immer von der Landkarte tilgen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Am Montag setzt sich ein kleines Tief von Grönland in Richtung Westeuropa in Bewegung. Am selben Tag bittet Armanda ihre Schwester Lidy, am Wochenende einen Besuch bei ihrem Patenkind in Zeeland für sie zu übernehmen. Unterdessen will sie selbst Lidys zweijährige Tochter hüten und mit dren Mann auf eine Party im Familienkreis gehen. Der Rollentauschwürde kaum Aufmerksamkeit erregen, da die beiden Schwestern einander so ähnlich sind. Armanda ahnt nicht, daß Sie mit ihrer kleinen Komödie das große Schicksal provoziert. Denn als Lidy am Samstag, dem 31. Januar 1953, mit dem Auto nach Zieriksee fährt, bricht jenes historische Unwetter los, in dem fast zweitausend Menschen den Tod finden werden und der Südwesten der Niederlande von der Landkarte gefegt wird. Während Lidy mit einer ihr kaum bekannter Menschen in die lebensgefährliche Sturmflut gerät, versucht Armanda zu Hause das Leben ihrer vermißten Schwester wie ihr eigenes fortzuführen.
Margriet de Moor verflicht die extremen Lebensgeschichten der beiden Frauen in einem mitreißenden Roman. Voller eindrucksvoller Bilder.
Margriet de Moor
Sturmflut
Roman
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Carl Hanser Verlag
Es ist, als laufe die Zeit nicht mehr uns voraus in abnehmender Linie, sondern in Schleifen parallel zwischen uns hin (…)
William Faulkner, Als ich im Sterben lag
Es bellen die Hunde, es rasseln die KettenDie Menschen schlafen in ihren Betten
Wilhelm Müller/Franz Schubert, Winterreise
Für meine Schwestern Bernadien, Maria, Fridoline, Simone, Josefien und Leida.
I
Der Wochenendausflug
1 Eines rauhen Morgens nahmen sie Abschied voneinander
Die eine, Lidy, stand am Fenster und schaute hinaus. Es war einer dieser Morgen mitten im Winter, wenn es gerade hell wird und der Sturm der vergangenen Nacht nicht mehr behaglich ist, sondern quengelig und nervend. Sie hielt ihre kleine Tochter auf dem Arm, den Mantel hatte sie bereits zugeknöpft. Im Aufbruch begriffen, zögerte sie diesen Moment noch ein wenig hinaus wie jemand, der gern mal fortwill, wenn es sich so ergibt, ebenso gern aber daheim bliebe. Daß der ganze Plan nicht von ihr stammte, sondern von Armanda, spielte keine Rolle. In diesem Moment dachte sie nur: Ich habe Lust, mal wieder Auto zu fahren. Kümmere du, Armanda, dich heute und morgen um meine Tochter und geh heute abend mit meinem Mann zur Fete deiner Freundin, die zufällig seine Halbschwester ist. Morgen, spätestens am Nachmittag, bin ich wieder zurück.
Die Wohnung nahm das zweite und dritte Stockwerk in einem der herrschaftlichen Häuser an einem kleinen Park in einem einfachen Wohnviertel ein. Gedankenverloren blickte sie über die schwarzen, kahlen Baumwipfel auf das Rechteck der Häuserfassaden. Sie merkte nicht, daß schräg gegenüber in einer Dachrinne eine Männergestalt herumkroch, bis ihren Händen plötzlich eine flatternde Fahne entsprang, die sofort straff zitternd im Nordwestwind stand. Es war der letzte Tag im Januar. Wenn ihr jemand gesagt hätte, daß sie sich, Nadja fest im Arm, alles noch einmal genau ansehen solle, weil ihr Abschied ein Abschied für immer war, hätte sie im Innersten zwar gewußt, daß so etwas jederzeit möglich ist, im Leben, aber sie hätte es nicht geglaubt. Sie war schließlich erst dreiundzwanzig.
Also fragte sie leichthin, ohne sich umzudrehen: »Ob es schneien wird?«
Und Armanda, die mit einem Becher Kaffee in der Hand vom Tisch aufstand, antwortete: »Aber nein, dafür ist der Wind zu stark«, ohne die leisesten Gewissensbisse in der Stimme. Sie begann jetzt auf und ab zu gehen, mit großen Schritten und währenddessen von ihrem Kaffee schlürfend, wie es ihrer Gewohnheit entsprach. Nicht zuletzt, weil sie ihre Schuhe ausgezogen hatte und einen Rock mit einer Strickjacke trug, war sie es, die hier, in den hohen Räumen mit der Stuckrosette an der Decke, zu Hause zu sein schien, und nicht Lidy. Viel Licht gab es nicht. Im hinteren Zimmer standen die Möbel fast im Dunkeln. Im Schein einer grünen Schirmlampe war lediglich ein an die Wand geschobener Tisch zu sehen und auf ihm ein paar Gegenstände, Teekanne, Telefon, eine Mappe, umschlungen von einem Band, sowie die Tür zum Flur und zu den Treppen. Das Haus war heruntergekommen wie die meisten dieser großen Kästen am Park, und auch hier waren die schönen Hartholztüren im Krieg verheizt worden. Doch vor allem an den Räumen im dritten Stock, wo es nach Betten, Kleidern, Seife und Kosmetika roch, konnte man den Stil des Fin de siècle noch immer erkennen. In den Schlafzimmern wurde das Licht von Bleiglasscheiben im oberen Teil der Fenster gefiltert.
Eine Regenbö klatschte an die Scheiben und rann herab. Lidy spähte durch die Tropfen hinaus. Gut, entschied sie, ich nehme den Weg entlang der Küste. Hinter Rotterdam fahre ich nicht über den Moerdijk, sondern bei Maassluis mit der Fähre über den Nieuwe Waterweg. Sie hatte sich noch kaum Gedanken über die Route gemacht, doch sie wußte, im Auto lagen Karten. Ich seh dann schon, was ich mache. Zwischen zwei Böen war es für einen Augenblick so still, daß sie die Bodenbretter unter Armandas Füßen knarren hörte, und als selbst das aufhörte, wußte sie, daß auch die andere in das Sauwetter hinausblickte.
»Doch irgendwie komisch, daß ich die Leute überhaupt nicht kenne«, sagte sie.
»Ihnen wird es nichts ausmachen«, sagte Armanda, jetzt am Fenster nebenan. »Sie haben mich auch ein Jahr lang nicht gesehen.« Sie kicherte spöttisch. »Gut möglich, wenn du in das Hotel kommst, du weißt doch, Hotel Kirke in der Verre Nieuwstraat, daß sie sich dann alle vertun und wirklich nicht gleich daran denken, daß du nicht ich bist, sondern, ähm, eben du.«
Kleines verärgertes Grinsen, bei beiden.
Sie sahen sich ähnlich. Das fanden alle. Sie waren große Mädchen mit schmalen, starken Schultern, immer leicht vorgebeugt, was ihnen etwas Besorgtes gab, das in Wirklichkeit gar nicht da war. Und hätten sie sich in diesem Moment umgedreht, dann hätte das simultane Porträt erst recht frappiert: dunkles, fast schon kastanienschwarzes Haar, das glatt hinter den Schultern verschwand, die zarten kleinen Ohren freiließ und die Stirn mit dem geradegeschnittenen Pony völlig verdeckte. Über diese Stirnen würde kein Mensch je etwas wissen. Aus dem doppelten Augenpaar konnte man dann alles mögliche herauslesen, Fröhlichkeit, Betrübtheit, Spottsucht, Lustlosigkeit, Schwärmerei, und auch, daß all das sehr rasch wechseln konnte, doch was vor allem daraus zu sprechen schien, war, daß das Schwesternpaar die Welt höchstwahrscheinlich mit exakt dem gleichen Blick wahrnahm und beurteilte.
Lidy stellte Nadja auf den Boden und umarmte sie. Täuschende Ähnlichkeit hin oder her, sie war hier die Mut-ter. »Paß auf, daß sie sich nicht erkältet«, murmelte sie, während sie, am Boden hockend, die Nase an den Hals des Kindes drückte, mit einem gewissen Gefühl des Selbstbewußtseins, das von den zahllosen Malen herrührte, die sie das Mädchen von Babytagen an nachts zu sich ins Bett genommen hatte, während sie ihrem Mann zuflüsterte, ein Stückchen beiseite zu rücken und vielleicht auch etwas leiser zu schnarchen.
Sie stand schon wieder. »Hast du mir jetzt die Autoschlüssel gegeben oder nicht?« Während sie in ihren Manteltaschen kramte, sah sie sich um.
Beide begannen, durch die Zimmer zu gehen. Sie suchten auf den Möbeln, bis Armanda einfiel, daß sie die Schlüssel zu Hause hatte liegenlassen.
»Dann geh ich jetzt«, sagte Lidy. »Ich hol sie mir dort.«
Auf dem Flur sagte Armanda: »Vergiß das Geschenk nicht«, und steckte der anderen ein Päckchen zu. Sie küßten sich flüchtig. Als Armanda sagte: »Grüß schön«, lachten sie beide.
Lidy drückte den Regenschirm an die Brust, hob mit der einen Hand den Mantelsaum an und ging mit ihrem Gepäck die Treppen hinunter. Als sie die Haustür öffnete, trug ihr Gesicht einen etwas feierlichen Ausdruck, Falte zwischen den Augen. Als wüßte sie, daß sie den Rollentausch, auch wenn es nur für einen Tag war, in völligem Ernst annehmen mußte.
An der Ecke, bei der Straße mit den kleinen Geschäften und Cafés, die auf den Markt mündete, sah sie Leute mit Einkaufstaschen durch den schräg herabprasselnden Regen gehen: Alltagsleben, vielleicht banal, aber mit reichlich Arbeit behaftet, da konnte sie mitreden, den größten Teil des Lebens verbrachte man mit Nichtigkeiten. Heute tat sie also einen abenteuerlichen Schritt zur Seite. Sie überquerte die Straße. An der langen Seite des Parks, vor Haus Nummer 77, stand an der gewohnten Stelle das Auto ihres Vaters.
»Jemand zu Hause?«
Sie hatte den Schlüssel benutzt. Jetzt ging sie durch den Marmorflur zur Treppe, wo sie ihre Schritte dämpfte, wie man es unbewußt in einem Haus tut, das von seinen Bewohnern verlassen scheint. Unten stand die Tür zum Wartezimmer offen, und das Sprechzimmer ihres Vaters war wie üblich geschlossen. Wo steckten sie nur alle? Sie vermutete, daß ihr Vater zu dieser Stunde wohl seine Runde entlang den Bettreihen im Binnengasthuis machte. Und ihre Mutter war wohl in der Stadt zum Einkaufen. Als hätte sie alle Zeit der Welt, ging sie jetzt durch die Wohnräume im ersten und zweiten Stock. In Armandas Zimmer, dem Balkonzimmer, das einst das ihre gewesen war, wollte sie gewohnheitsgetreu einen Blick in den Spiegel werfen, doch die Wand neben dem Fenster erwies sich auf einmal als leer, nicht willens, den Ausdruck ihres Gesichts zu reflektieren. Danach konnte sie es aus irgendeinem Grund nicht lassen, schnell auch noch ins Dachgeschoß zu gehen. Dunkel, und was für einen höllischen Lärm der Wind auf dem Dach machte! Und natürlich fand sie dort auf seiner Matratze unter dem niedrigen Spitzboden ihren Bruder, schlafend, wie ein Dreizehnjähriger das kann, als wolle er damit bis in alle Ewigkeit fortfahren. Das kleine Dachfenster war beschlagen. Tageslicht fiel auf das Kopfkissen. Sie betrachtete den flehentlichen Ausdruck auf dem Jungengesicht und dachte derweil: wozu noch länger warten.
Schließlich fand sie die Autoschlüssel auf dem Schreibtisch im Sprechzimmer.
Kurz darauf verließ Lidy in einem schwarzen Citroën das Viertel, in dem sie geboren und aufgewachsen war, sie fuhr die Ceintuurbaan entlang Richtung Amstel. Anfangs mußte sie, unvertraut, mit den Fingern noch suchend über das Armaturenbrett tasten. Sie gab zur Übung ein paarmal Zwischengas, bremste mit dem Motor, gab wieder Gas. Da war die Kreuzung, an der Ecke eine baufällige Kirche, dann nach rechts. Dies alles gehörte zu dem Zusammentreffen verschiedener Umstände, das am vergangenen Montag, dem sechsundzwanzigsten, in Gang gesetzt worden war, als Armanda in einer ihrer spontanen Anwandlungen Lidy angerufen hatte, um ihr einen Vorschlag zu machen.
Diese hatte zunächst gezögert. Auf ihre Fingernägel starrend, hatte sie gemault: »Also, ich weiß nicht …«, worauf Armanda ihr vorhielt, daß ihr so ein ulkiger unerwarteter Ausflug doch auch richtig Spaß machen könnte. Daraufhin war es kurz still geblieben, während beide bereits wußten, die Antwort würde »ja« lauten, denn so war ihre Beziehung. Die Jüngere konnte so überzeugend auf die Ältere einreden, daß aus einer kleinen Angelegenheit schon bald ein Idee wurde und aus einer Idee im folgenden eine tolle Idee.
»Du kannst das Auto von Vater haben, das hab ich schon für dich gedeichselt«, lockte Armanda die flexible Lidy, die im Geiste bereits eine Karte des Westens der Niederlande bis zu den großen Meeresarmen vor sich sah.
Es war am späten Abend gewesen. Lidy war ins Bett gegangen, aber wach geblieben, bis sie ihren Mann nach Hause kommen hörte. Ohne Licht zu machen, hatte er sich im Schlafzimmer ausgezogen und war wie immer sofort dicht an sie herangerückt. Überall ringsum war es ruhig gewesen. Auf der Straße waren keine Verkehrsgeräusche zu hören gewesen, und die Bäume im Park auf der Vorderseite des Hauses standen da, als hätten sie nie im Leben unter einem Nord- oder Südwestwind geächzt. Dennoch hatte sich genau zu diesem Zeitpunkt, Tausende von Kilometern entfernt, ein Tief in Bewegung gesetzt, ein kleines Tiefdruckgebiet. Entstanden oberhalb der Labradorsee, war es ziemlich schnell nach Osten gezogen und hatte ein paar weitere Tiefs mitgerissen.
Als Lidy auf der Schnellstraße Richtung Den Haag fuhr, konnte sie schon nach einer Viertelstunde die Scheibenwischer ausschalten, es war trocken. Allerdings spürte sie, daß es wie verrückt windete. Der Wind, der in der vergangenen Nacht mit Orkanstärke über Schottland gerast war, ganze Wälder entwurzelt hatte und gegen Morgen die Ostküste Englands verließ, für sie war er nur: ein anhaltender Druck, der sie zwang, die ganze Zeit ein wenig nach rechts gegenzusteuern. An so etwas hat man sich nach fünf Minuten gewöhnt, und dann achtet man nicht mehr darauf.
Kurz vor Maassluis hielt sie an einer Tankstelle. Ein junger Mann in blauem Arbeitsanzug füllte ihr den Tank und wusch die Scheiben. Lidy folgte ihm in das kleine Büro, wo es nach Kaffee und Zigaretten roch. Im Radio liefen gerade die Nachrichten.
»Wie komme ich zum Fährhafen?« fragte sie, als der junge Mann die Kassenschublade zuschob.
Er bedeutete ihr mit einer Kopfbewegung, ihm zu folgen, und zeigte ihr in der offenen Tür, wie sie fahren mußte. Während Lidy nickte und sich den schnurgeraden Weg mit einer leichten Kurve am Ende und dahinter eine Kreuzung einprägte, begann im Hintergrund der Nachrichtensprecher gerade, nicht ernster oder weniger ernst als gewöhnlich eine Meldung des Sturmflutwarndienstes zu verlesen.
… Kräftiges Hochwasser für die Kreise Rotterdam, Willemstad, Bergen op Zoom und Gorinchem …
Lidy bedankte sich und trat wieder in den Wind hinaus.
»Sie können es nicht verfehlen!« rief der Tankwart ihr nach.
Sie fand den Weg tatsächlich ganz leicht. Im Nu war sie am Hafen. Sie schirmte die Augen mit einer Hand ab. Das Wasser war nur sehr schmal. Trotzdem war das andere Ufer ein richtiges anderes Ufer, eine graue Linie, die eher dazu bestimmt zu sein schien, ausradiert zu werden, als stehenzubleiben. Den Schal um den Kopf, ging sie zur Anlegestelle, wo eine Tafel mit dem Fahrplan stand. Sie las, daß die Fähre erst in einer halben Stunde von drüben eintreffen würde. In einer Bude, ein paar Stufen hoch, bestellte sie Kaffee. Trübes Licht, wieder das Radio, sie überließ sich der abwartenden Stimmung. Dasitzen, nichts weiter. Ein wenig dösig steckte sie sich eine Zigarette zwischen die Lippen.
Was mache ich hier um Himmels willen? Wer oder was hat mich hierhergeführt?
2 Die Schwestern
Eine Viertelstunde nachdem sie ihre Schwester zum letztenmal lebend gesehen hatte, ging Armanda über den Markt. Sie schob einen Sportwagen. Darin saß, unter einer durchsichtigen Haube, Nadja. Weil sie an diesem Abend zu einer Fete ging, wollte Armanda sich einen Steckkamm für ihr Haar kaufen. Da es so windig war und der Wind immer noch zulegte, waren eine ganze Reihe von Marktleuten dabei, ihre Waren wieder einzupacken und die Planen ihrer Stände einzurollen. Auf Armanda machte das um das Gestänge flatternde Tuch im Kontrast zu den besorgt dreinschauenden Kunden in ihren Wintermänteln den Eindruck wilder, ansteckender Ungebundenheit. Sie kaufte den Kamm und danach auch noch ein paar mit kleinen Perlen bestickte Gummibänder. Sie schob die Haube des Sportwagens hoch, und während sich der syrische Markthändler hinhockte und dem Kind einen Spiegel vorhielt, wand Armanda die Gummibänder um zwei senkrecht in die Höhe stehende Schwänzchen auf Nadjas Kopf, die nun aussah wie ein Pinselaffe.
»Schau mal, wie hübsch du bist …«
Sie liebte das Kind. Nadja war etwas Unglaubliches, war der freche Streich, mit dem Lidy sie vor ungefähr zweieinhalb Jahren verblüfft hatte. Nackt, im Balkonzimmer, hatte Lidy sich mit dem Zeigefinger sanft in den Unterleib gepiekt. Armanda konnte dieses Bild noch immer jederzeit heraufbeschwören: die lange weiße Lidy, die im Spiegel ihren Blick suchte, während sie erzählte, daß sie am Nachmittag beim Hausarzt gewesen sei, bei dem sie die Knie peinlich weit auseinander über ein paar lächerlich harte Bügel habe legen müssen.
»Oh! Aber …« hatte Armanda nach einer Pause gestammelt. Und dann: »Hast du nicht aufgepaßt?«
Übermannt von einem sonderbaren Gefühl der Niedergeschlagenheit, etwas für immer verloren zu haben, hatte sie im Spiegel Lidy betrachtet, die sich rasch mit einer Bewegung zu ihr umdrehte, die für sie, Armanda, synonym war mit Hüften, Schultern, weichen Oberarmen, Brüsten: eine Frau, die in einer Liebesaffäre sehr weit gegangen war. Es war zu Sommerbeginn gewesen, Mitte Mai, und gerade als Armanda ausrechnete, daß es demnach wahrscheinlich Anfang März passiert sein mußte, klingelte das Telefon. Sie rannte auf den Flur. Nach dem geräumigen, hellen Zimmer war es dort plötzlich dunkel und wie in einem Tunnel. Mit einemmal unschlüssig, blieb sie vor der Wand mit dem läutenden Apparat stehen, griff dann nach dem Hörer und vernahm die Stimme von jemandem, den sie gut kannte, den sie folglich auch sofort vor sich sah, jetzt aber zum erstenmal so: lang, gutaussehend, blond, er hat ein kräftiges Gesicht mit einer faszinierenden, gescheiten Nase. Ich fand es immer schön, mit ihm und seiner Halbschwester über Politik, Geld und englische Literatur zu reden, daß er mich küßte, verführerisch und gefährlich, wie man es in französischen Filmen sieht, damit bin ich auch einmal einverstanden gewesen, großer Gott: Er küßte mich auf den Hals, stürzte sich mit einem merkwürdigen Schnauben auf meinen Nacken, pustete mir in die Ohren, und nachdem er das alles getan hatte, sah er mir ins Gesicht, wobei mir auffiel, daß seine Augen furchtbar ernst waren. Gut. Aber als sich an den darauffolgenden Tagen nichts tat, kein Brief, kein Anruf, überhaupt nichts … warum habe ich mir da keinen Moment lang Gedanken gemacht?
Es war Sjoerd Blaauw, ein Freund von ihr, der zur Zeit mit Lidy ging. Noch völlig außer Fassung, begrüßte sie ihn mit Worten, die ihr gerade in den Sinn kamen: »Sjoerd, wo ich dich schon mal an der Strippe habe, kannst du mir vielleicht sagen, ob …«
Noch bevor sie hatte fragen können, ob der neue Buñuel schon im Rialto lief, hatte Lidy ihr, in einem offenen karierten Kleid, den Hörer aus der Hand geschnappt. Nun wurde lange atemlos geflüstert, doch Armanda stand bereits auf dem Balkon, blickte auf die Rückseite der Häuser in der Govert Flinckstraat und sah ein, sah ein, was sie wohl einsehen mußte, daß sie bereits neunzehn war. Ei-nen Teil vom Leben verpaßt, dachte sie. Es einfach nicht im Auge behalten, schade, jetzt hat es sich woanders hingewandt. In den Gärten und auf den Innenhöfen unter ihr schien die Nachmittagssonne auf Sandkästen, Schuppen, Hunde, Fahrräder. Und etwas näher, auf dem Lattenrost des Balkons, standen die frisch geweißten Tennisschuhe von Lidy ordentlich nebeneinander zum Trocknen und sahen im Widerschein des Sonnenlichts nicht weiß, sondern orange aus. Die beiden hatten Lust, sich zu verlieben, na schön, sie haben es folglich auch getan und nicht nur ein bißchen. Ich will mir nichts vorlügen: Ich bin gewaltig schockiert! Sie hatte an ihrem Rock herumgefingert, nach oben gestarrt und mit altjüngferlichem Ausdruck in den Augen einen imaginären Vogel verfolgt. Der sehr simple Gedanke derweil lautete: Ich habe mein Leben noch vor mir. Das damit einhergehende Unbehagen hieß im Kern: Okay, die großartigen Dinge erwarten mich vielleicht noch, aber alles deutet darauf hin, daß mir das Talent, sie zu erleben, sie in meiner unmittelbaren Nähe auch nur zu bemerken, leider Gottes fehlt.
Armanda studierte weiter an der Universität, Englisch. Lidy brach ihr Studium der französischen Sprach- und Literaturwissenschaft ab und heiratete ihren zupackenden Liebhaber, der schon damals eine Stelle mit guten Perspektiven bei Mees & Hope hatte. In den darauffolgenden Monaten sagte kein Mensch mehr, die Mädchen glichen sich so sehr, denn Lidy schwoll an. Nicht nur ihr Bauch tat das, auch Arme und Beine verwandelten sich in weiche, gerundete Gliedmaßen. Und ihr Gesicht, in dem die Lider geheimnisvoll herabhingen, nahm etwas Mollig-Schwermütiges an. Zum erstenmal unterschieden sie sich äußerlich sehr.
Einmal unterhielten sie sich über dieses Thema.
»Was bedeutet das eigentlich«, sagte Lidy und schenkte sich ein Glas Sinalco ein, nachdem sie einen wachsamen Blick auf Armandas noch halbvolles Portweinglas geworfen hatte, »was bedeutet das eigentlich, sich ähnlich sehen. Etwa, daß wir dieselbe Augenfarbe haben?«
»Ich denke, schon.«
Sie musterten einander kurz, wobei Lidy langsam, auf eine Weise, die Armanda bedeutungsvoll fand, bemerkte: »Sma-ragd-grün.«
Es war am Ende eines Nachmittags im November. Vom Wohnzimmer an der Schmalseite des Parks, wo Lidy jetzt mit ihrem Mann wohnte, konnte man beinahe das Elternhaus der Mädchen sehen.
Armanda trank ihr Glas aus. Sie sagte: »Jeder findet die Idee der Brüderschaft, der Schwesternschaft schön. Gott, und sie ist natürlich auch schön, aber … ich meine, warum eigentlich dermaßen schön?«
»Was weiß ich. Nestinstinkt, irgendeine Erinnerung an gegenseitiges Wärmen und so, dem anderen auf die Schliche kommen, auch auf die harmlosesten, du weißt schon …«
»Vielleicht auch: Irgendwann gehen wir alle drauf?«
»O Gott! Wer weiß. Ja, bestimmt auch.«
Armandas Blick fiel auf den alten Perserteppich, der von zu Hause war, mit den blauen Vögeln und den Girlanden, die ihr hier merkwürdigerweise wesentlich vertrauter vorkamen als dort, im übrigen auch wesentlich schöner. Während sie auf die blauen Vögel starrte, sagte sie sich: Es waren einmal zwei Mädchen, die als Kinder die gleichen Kleider trugen, die mit sechs Jahren in dieselbe Schule gingen und mit zwölf wieder in die gleiche Lehranstalt, diesmal eine höhere. Sie sah auf und fuhr laut fort: »Das Vossius-Gymnasium. Weil beide gut in Sprachen waren, entschieden sie sich für den sprachlichen Zweig, und die Lehrbücher der einen konnten zwei Jahre später direkt von der anderen übernommen werden.«
Lidy starrte sie einen Moment lang verdutzt an. »Ha, Schicksalsverbundenheit!« sagte sie dann und goß Armandas Glas so voll, daß diese schnell den Kopf vorstreckte und ein paar Schlucke abtrank.
»Zum Teufel.« Armanda hatte sich wieder gerade hingesetzt, die Hände zu beiden Seiten ihres Glases flach auf dem Tisch. »Deine Unterstreichungen waren noch drin«, sagte sie. »Weisheiten bei Goethe, Rache und Verwünschungen bei Shakespeare, alles schrecklich schön und wahr. Mein Blick wanderte also automatisch zu denselben Dingen wie deiner ein paar Jahre zuvor, ja, wirklich, zu genau denselben erhabenen und grandiosen Dingen.«
Sie spürte, wie ihr der Alkohol in den Kopf stieg.
Ein wenig rauh fuhr sie fort: »Glaub bloß nicht, ich hätte alle diese schönen Dinge auf dieselbe Weise gelesen wie du.«
Die beiden schwiegen eine Weile. Doch Rede und Gegenrede gingen, da sie sich schon so lange kannten, schweigend weiter.
Die dicke Lidy wie ein Götzenbild ihr gegenüber, sagte Armanda etwas traurig: »Man kann nie fühlen, was ein anderer fühlt.« Und als Lidy nur abwesend nickte, im selben Ton: »Die Bewegungen von diesem kleinen Scheusal in deinem Bauch, spürst du das genauso, wie du die Zunge in deinem Mund spürst, nur größer?«
»So ein Quatsch!« Lidy stand so unkontrolliert auf, daß sie sich am Tischrand festhalten mußte.
»Paß doch auf!« sagte Armanda herzlich, ohne sich jedoch auch nur einen Zentimeter zu rühren.
Lidy stapfte schwerfällig aus dem Zimmer.
Als sie nach einigen Minuten zurückkam, war Armandas Stimmung umgeschlagen. Verdutzt, ja, tief gerührt blickte sie auf den Körper von Lidy, die sich mit gespreizten Beinen und auf den Bauch gelegten Armen wieder zu ihr setzte.
Sie beugte sich vor. Sanft und nachdrücklich, wie jemand, der etwas schon sehr lange weiß, aber erst jetzt endlich die Worte dafür findet, sagte sie: »Weißt du, daß ich, ganz objektiv, mich selbst absolut nicht leiden kann?«
»He — was?«
»Wirklich wahr. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber nicht allzuviel mit mir zu tun haben wollen.«
»Na, Pech für dich.«
»Lach nicht, es ist wirklich so, schon als Kind hatte ich keine Spur von Sympathie für mich selbst, keine Spur.«
Weil sie ziemlich beduselt war, kamen ihr die Worte nur mühsam, doch ihre Hand gestikulierte derweil beredt genug.
»Diese Kleider mit den gesmokten Vorderteilen standen mir doch überhaupt nicht!«
»Ach, hör auf.«
»Eine viel zu hohe Stirn für ein Kind.«
»Stimmt, ja. Hatte ich auch.«
»Mir stand es nicht.«
»Unsinn«, widersprach Lidy ohne großes Interesse, doch Armanda blieb dabei, daß die meisten Menschen wirkliche Zärtlichkeit für sich selbst empfänden. Sie aber nicht. Und daß es daher gar nicht so schlecht sei, wirklich gar nicht so schlecht, eine ältere Schwester zu haben, die jetzt, in diesem Augenblick, mit einem Körper, wesentlich umfangreicher als der ihre, ihr so selbstzufrieden gegenübersitze, daß es einfach ansteckend sei.
Eine Woge plötzlicher Liebe durchfuhr sie, die sie merkwürdigerweise in erster Linie als Liebe zu sich selbst empfand.
»Gar nicht so schlecht«, wiederholte sie warm und schlug die Augen, die ungeniert feucht wurden, zu ihrer Schwester auf.
Lidy drehte den Kopf zur Seite.
»Sei mal still!«
Auch Armanda spitzte die Ohren. Unten war die Haustür aufgegangen und dröhnend wieder zugefallen. Sie sprang auf. »Ist es schon so spät?«
Das Treppenhaus in dieser Art von Häusern war schmal. Drückte man unten auf den Lichtschalter und machte sich dann auf den Weg nach oben, so konnte man sich darauf verlassen, daß die Lampe auf halber Treppe wieder ausging. Im Stockdunkeln begegnete Armanda, sich den Mantel zuknöpfend, Lidys Mann, der mit einer raschelnden Zeitung in der Hand nach oben kam. Sie mußten beide lachen. Armanda spürte seinen Atem auf ihrem Gesicht.
Nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte, ging Armanda mit Nadja im Sportwagen wieder zu Lidys und Sjoerds Haus an der Schmalseite des Parks. Während sie Stufe um Stufe mit dem Kind an der Hand die Treppe hinaufstieg, dachte sie über die Fete am Abend nach und murmelte bei sich: nach neun. Er darf mich nicht früher als neun Uhr abholen. Sie wollte diesmal eher spät auftauchen. Betsy veranstaltete häufig Feten in ihrer Dachwohnung am Nieuwezijds Voorburgwal. Anfangs hatte Armanda nicht glauben können, daß Sjoerd der Bruder dieser Freundin war, die ein ganzes Stück älter als sie war und die sie ihres schmalen, klugen Gesichts und des schwarzen lockigen Haars wegen bewunderte. Dann erfuhr sie, daß die beiden Halbgeschwister waren: Sie hatten denselben Vater, aber verschiedene Mütter.
Sie kam keuchend oben an, auf der zweiten Treppe hatte sie das Kind getragen. Warum, durchfuhr es sie kurz, als sie im Wohnzimmer den kleinen Schmuckkamm hervorholte und noch einmal betrachtete, warum hatte sie eigentlich um jeden Preis auf diese Fete gewollt? Obwohl sie wegen eines verabredeten Besuchs in Zierikzee, eines alljährlichen Liebesdienstes, an dem sie bisher immer viel Freude gehabt hatte, wirklich nicht hinkonnte, war sie am Montag abend auf den Flur gegangen. Manche Entscheidungen entscheiden offenbar selbst. Ein festes Vorhaben im Sinn — das blaue Kleid mit dem engen Rock, das sie anziehen wollte —, hatte sie zum Telefon gegriffen und ihre Schwester an den Apparat bekommen.
»Mevrouw Blaauw.«
Sehr komisch, immer noch. Sie hatte sich spöttisch geräuspert. »Hallo, ich bin’s.«
Lidy hatte das Ganze zunächst natürlich nicht verstanden und es auch merkwürdig gefunden: Armandas Patenkind wurde sieben und rechnete fest damit, daß die Tante, die liebe Patin, die sie einmal im Jahr besuchte, die weite Reise in die kleine Provinzstadt unternehmen würde, um ihr Ballettschuhe zu schenken. Und nun wolle Armanda, daß sie das übernehme? Oh. Warum denn?
»Also gut, okay, eigentlich habe ich Lust dazu«, hatte Lidy nach fünfminütigem Hin und Her gesagt.
Es war eine plötzliche Regung gewesen, eine bedeutungslose Anwandlung, die ihr letzten Montag, kein Mensch wußte, woher, gekommen war und die sie einfach so, aus gar keinem Grund, diesmal nicht verjagt hatte.
Als Sjoerd kurz nach Mittag nach Hause kam, saß Armanda am mit Papieren übersäten Tisch über ihre Vordiplomarbeit gebeugt. Sie legte den Stift hin und begrüßte ihn mit einem Lächeln, das besagte, sie und Nadja, die am Kopfende des Tisches, zwei Finger im Mund, einen Bären ausmalte, hätten es den ganzen Vormittag über zusammen allerbestens gehabt. Kurz darauf hatte sie Kaffee eingeschenkt. Auf einem Wörterbuch zwischen ihnen ein Teller mit Milchbrötchen. Kameradschaftliche Stimmung, in der Sjoerd ihr gutmütig von der Besprechung zu berichten versuchte, die er an diesem Samstag vormittag, sehr dringend, mit einem Kunden im Büro über ein Hypothekendarlehen von vielen hunderttausend Gulden gehabt hatte, das am Montag wie der Blitz in eine sechsprozentige Hypothekenanleihe umgewandelt werden sollte, doch die Sache interessierte sie nicht, so daß das Gespräch schon bald auf Betsys Fete kam.
»Mir recht.« Er starrte sie einen Augenblick an und sagte dann ziemlich gleichgültig: »Viertel nach neun hol ich dich ab.«
Der Regen hatte aufgehört, aber es stürmte noch immer sehr.
»Scheint schlimmer zu werden«, sagte er, ohne sich zum Fenster umzudrehen.
»Ja?«
Armanda betrachtete sein Gesicht, das vom Hintergrund, von dem es sich abhob, fast verschlungen wurde: scheppernde Fensterscheiben im Westen, und dahinter hin und her schwingende, kraus verästelte Baumkronen. Plötzlich wurde sie von dem Gefühl übermannt, alles passe auf absurd stimmige Weise zu der Geschichte, die sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit den halben Vormittag lang beschäftigt hatte. Denn der Teil, an dem sie gearbeitet hatte, betraf ein Theaterstück, in dem ein Sturm, über eine Insel rasend, auf menschlichen Befehl hin losgebrochen war. So, und warum sollte das eigentlich nicht möglich sein? Auf menschlichen Befehl? Aus Rache, aus heiliger Empörung oder sonst irgendeinem Grund? Das erschien ihr jetzt, während sie noch einmal darüber nachdachte, als absolut nicht undenkbar. Früher — und nehmen wir mal getrost an, daß die Spezies damals nicht dümmer war als heute, vielleicht sogar klüger — hat man schlichtweg geglaubt, es sei möglich, höchstwahrscheinlich möglich, daß die Einfühlung, der Aberwitz der Erfindung, ein Ereignis in die Wirklichkeit mogeln konnte. Gott, und warum auch nicht? Was spricht eigentlich dagegen, daß alles, was unbedingt geschehen soll, erst einmal richtig ausgetüftelt werden muß? Ausgetüftelt und, eventuell, möglichst überzeugend niedergeschrieben? Sie schlug ihre Bücher zu. Während sie darüber nachsann, daß das Ereignis, wenn es sich denn meldet, ein gemachtes Bett vorfindet und daher die Phantasie so vertraut anspricht, daß die Betroffenen, also wir, ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen können, schob sie ihre Blätter zusammen. Dialoge, Gesten, Szenen, allesamt vorgekaut von einer Vision des Gedächtnisses!
Sie machte eine unkontrollierte Bewegung. Ihr Stift rollte auf den Fußboden. Er bückte sich schneller als sie.
»Danke dir.«
Sie sah etwas in seinen Augen zu ihr hinblitzen. Was für eine Ehe führen die beiden? dachte sie, und in dem Moment zog sich etwas so Böses um ihr Herz, daß sie gar nicht erst versuchte, es mit dem Verstand zu erfassen. Sie stand auf und begann ihre Sachen in eine Tasche zu schieben.
»Okay«, sagte Sjoerd und erhob sich ebenfalls.
Armanda bückte sich, um ihre Schuhe unter dem Tisch hervorzuangeln. Sie hörte, wie das Haus unter einer Sturmbö knarrte. Mein Gott, dachte sie, abgeklärt wie jemand, der gerade in gar nichts lügt, was für ein spannendes, behagliches Geräusch! Stell dir vor, das Wetter verschlechtert sich im Laufe der Nacht so sehr, daß bestimmte Fährverbindungen ausfallen und die Kapitäne morgen, vielleicht auch noch übermorgen und meinetwegen bis zum Sankt Nimmerleinstag auf den Dienst pfeifen! Stell dir vor!
Mit zerstreuter Miene verabschiedete sie sich.
Als sie und Sjoerd abends am Nieuwezijds Voorburgwal aus dem Taxi stiegen, stand die Eingangstür von Betsys Haus offen. Sjoerd ging ihr auf vier schmalen, fast senkrechten Treppen so schnell voran, daß sie sich oben vor der Wohnungstür einen Augenblick sprachlos ankeuchten. Er nahm ihr den Mantel von den Schultern. Über dem Treppengeländer hing bereits ein Berg nasser Kleidungsstücke. Betsy entdeckte sie, rief etwas Gastfreundliches und führte sie in den einst als heimliche Kirche benutzten Bodenraum, der sehr hoch war und bereits von Stimmengewirr erfüllt. Armanda fühlte sich äußerst wohl. Es war so angenehm, in Begleitung des unbekümmerten Sjoerd in seinem alten Tweedjackett einzutreten. Und natürlich gab es etliche entferntere Bekannte, die sich auf den ersten Blick vertaten.
»Armanda«, mußte sie ein paarmal sagen. »Ich bin Armanda.«
3 Landschaft?
Zum erstenmal an diesem Tag überquerte sie Wasser. Der Nieuwe Waterweg ist eine tiefe, aber ziemlich schmale Rinne, die Fähre braucht nicht länger als zehn Minuten hinüber. Trotzdem wird von den zuständigen Stellen ein Viertelgulden dafür berechnet. Lidy sah, wie ein erschrekkend altes, bäurisches Männergesicht neben ihrem linken Fenster auftauchte. Sie begriff, kurbelte die Scheibe hinunter und legte den verlangten Obolus in die Pranke. Als die Scheiben daraufhin ringsum beschlugen, stieg sie doch aus und wurde vom Wind überrascht, der ihr hier auf dem Wasser sehr heftig vorkam.
Sie blickte sich um. Amüsiert sah sie oben auf der Brücke einen breitschultrigen Mann in Kapitänsuniform ernst an einem Steuerrad stehen. Ich befinde mich wirklich auf einem Schiff. Ringsum kleine Wellen, schräg vor ihnen nahm ein Ozeandampfer Kurs aufs offene Meer, und links fuhr der Frachter RO 8 in Richtung Rotterda-mer Hafen. An das Auto gelehnt, stand sie im verwirrenden Licht eines Regenschauers, der jeden Moment niedergehen konnte. Unter der Überdachung des Gangbords Fahrradfahrer und Fußgänger. Ihr Blick fiel auf einen neben der Reling stehenden Kasten, auf dem in weißen Buchstaben »Rettungswesten« stand, wie um ihr noch einmal zusätzlich klarzumachen, daß sie das Festland tatsächlich verlassen hatte. Bereits wenig später schwenkte das Schiff rasch herum und stoppte auf. Die Laderampe fiel dröhnend auf den Kai. Und dennoch: Als Lidy auf die Insel Rozenburg fuhr, hatte die Überfahrt, so kurz sie auch gewesen sein mochte, es doch geschafft, sie weiter von zu Hause zu entfernen, als sie erwartet und beabsichtigt hatte. Dieser kleine Ausflug hatte doch nur eine Phantasie sein sollen, eine kleine Tyrannei ihrer Schwester Armanda, mit der sie selbst fast nichts zu tun hatte?
Richtig, aber von einer ordentlichen Straße war in der nun folgenden Stunde keine Rede mehr. Ein Labyrinth kleiner Wege, Schleusen und Brücken nahm ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Unmöglich, einstweilen etwas anderes im Leben für wichtiger zu halten als die Route, die sich höchst eigenwillig verhielt und sich nur sehr wenig um die auf dem Beifahrersitz ausgebreitete Karte scherte. Bei Nieuw-Beijerland mußte sie wieder mit der Fähre übers Wasser und kam dann nach einer Viertelstunde zum Seedeich, an dem eine schmale Asphaltstraße entlangführte. Sie hielt an und rannte im Wind zu einem verblichenen Straßenschild, auf dem sie, zum Glück, Numansdorp entziffern konnte. Dort, am Hollands Diep, mußte der Hafen liegen, von dem aus mehrere Fähren die großen Meeresarme überquerten.
Das Meer selbst sah man nicht. Doch sie hatte den unverkennbaren Geruch in der Nase, als sie wieder Gas gab und dicht an der Windschutzscheibe leicht erschrocken auf die Landschaft blickte. Landschaft? Konnte man den Boden hier angesichts des gewaltigen Raums darüber nicht genausogut streichen? Die Regendecke war vom Wind zerfetzt worden. Wolken mit leuchtenden Rändern schoben sich wie Kulissenteile vor- und hintereinander über das Panorama hinter der Autoscheibe. Inwieweit war dieses Panorama eigentlich bewohnt? Nur zweimal überholte sie einen zerzausten Radfahrer mit dem Wind im Rücken, und einmal machte ein an einem Seitenweg mit Pferd und Wagen wartender Bauer eine Armbewegung, als sie hupte. Turmspitze, Gehöft, Mühle mit kreisenden Flügeln, Pferd hinter einem Zaun. Alles unter dem Himmel begraben und alles zum Deich hin liegend, der nicht hoch war, aber trotzdem das Meer den Blicken entzog. Hat etwas Gespenstisches, dachte sie. Käme der Hafen nur endlich in Sicht. Sie würde das Land und das Meer gern mal gleichzeitig sehen. Dies hier war noch immer die Provinz Zuid-Holland, ein Zwischengebiet mit kahlen schwarzen Poldern, das ihr, wie auch immer, wohlbekannt war. Sie hatte vor, im Hafen von Numansdorp die Fähre nach Zeeland zu nehmen, einer Provinz, in der sie noch nie im Leben gewesen war, deren Schatten sie aber schon den ganzen Vormittag spürte, weil sie ihr Reiseziel war. Daß die Nadel ihres Kompasses auf eine Gruppe wildfremder Menschen zeigte, eine Familie in einer kleinen Provinzstadt, die sie nicht interessierte, es nie getan hatte und zweifellos auch nie tun würde, empfand sie im Laufe dieser wenigen Stunden allmählich als ganz normal.
Um wieviel Uhr erwarteten sie die Patentante eigentlich?
Es wurde zwei. Der Wind an der Küste, der seine Geschwindigkeit gerade auf etwa 30 Knoten pro Stunde mäßigte, was einer Windstärke von reichlich 7 auf der Beaufortskala entspricht, sollte von nun an jede Stunde ein Beaufort zulegen. Lidy erreichte den Hafen und fuhr auf den Platz. Zu ihrer Zufriedenheit sah sie, daß sie ihre Reise genau gemäß ihrem an diesem Morgen gefaßten Plan fortsetzen konnte. Am Kai wartete neben ein paar schaukelnden Frachtern die Fähre Den Bommel mit offenem Laderaum. Daß die Landungsbrücke ein Stück weit unter Wasser lag, kam ihr nicht anormal vor.
Und das war es auch nicht. Durchschnittlich zweimal pro Monat stieg das Wasser des Hollands Diep bis zu dem Punkt an, den man als Grenzpegel bezeichnete, und ging auch oft genug über diesen hinaus. Örtlich gab es dann die entsprechende Nässe, kein Mensch, der sich darüber Gedanken machte. Sie stieg aus. Ihr Weg zu der Bude, in der Fahrkarten für die Fähre verkauft wurden, war von einem entwurzelten Baum versperrt. Sie kletterte darüber und sah zu, daß sie in den Windschatten des Hafengebäudes kam. Als sie sich der Schlange anschloß, glühte ihr Gesicht genauso wie das der anderen Passagiere für die Fähre Numansdorp — Zijpe, die alle munter, ja sogar genüßlich vom Wetter sprachen. Man weiß doch, was Sturm ist. Wenn’s pustet, dann pustet’s, heute ziemlich kräftig, aber wir erinnern uns, daß es manchmal schon schlimmer war!
Zehn Minuten später fuhr sie, ziemlich steil abwärts, über Metallplatten in den Laderaum und stieg aus dem Auto. Über eine eiserne Innentreppe kam sie in den Passagierraum mit Billardtisch und einer Bar. Die Fähren waren stabile Pötte. Die Den Bommel hatte 10000 Bruttoregistertonnen und besaß eine 400-PS-Dieselmaschine, die das Schiff mit einer Geschwindigkeit von zehn Knoten in zwei Stunden nach Schouwen-Duiveland bringen konnte. Schweres Wetter, das heißt, ein West- oder Nordweststurm ab Windstärke neun aufwärts, erforderte in diesem ohnehin tückischen Revier großes Geschick beim Steuern. Windgeschwindigkeiten von vierzig bis sechzig Knoten konnten die Gewässer des Haringvliet, des Volkerak und des Grevelingen in Meere mit steilen, unaufhörlich anrollenden Wellen verwandeln. Ein Boot sollte sich tunlichst nicht quer zu ihnen legen.
Schau auf einen festen Punkt. Das ist ja schlimmer als betrunken zu sein. An einem Tisch mit einem strammen Max und einem Kakao vor sich merkte sie schon bald, daß sie besser an die frische Luft ging. Der schräg geneigte Boden und das Wogen dessen, was hinter den Fensterscheiben war, deckte sich in nichts mit den Wahrnehmungen ihrer Augen oder irgendeines ihrer anderen Sinne. Mit todbleichem Gesicht eilte sie zum Zwischendeck, wo noch mehr Passagiere im Schutz des Maschinenraums standen und starr auf die anrollenden Wassermassen blickten.
Ihr Unwohlsein war sofort verflogen. Da spürte sie, daß sie von der Seite her beobachtet wurde. Ein Passagier neben ihr öffnete bereits den Mund, um etwas zu ihr zu sagen, doch sie hielt den Blick ostentativ in die Ferne gerichtet. In Gedanken die Karte lesend, wußte sie, daß sie auf dem Weg zum schmaleren Arm des Volkerak gerade die Kreuzung von Haringvliet und Hollands Diep überquerte, doch die Flut war im Kommen, und es war deutlich, daß die Nordsee jetzt die Regie übernommen hatte. Wirklich schön. Der Wasserspiegel kam in bleifarbenen Wogen auf sie zu, überzogen von derart weißen Schaumstreifen, daß man einfach nicht verstand, woher sie den Widerschein hatten.
Warum sehe ich keine Ufer, warum keine Turmspitzen, keine Dächer? Überall ringsum muß doch Land sein?
»Sehen Sie sich das an!« ertönte es neben ihr.
Der Mitreisende hatte sie angesprochen. Ein Bär von einem Kerl mit rotem Gesicht machte sie mit ausgestrecktem Arm und wichtiger Miene auf etwas aufmerksam. Sie schaute hin und nickte nachdenklich, als sie zu hören bekam, daß man auf dem Deichvorland ausgezeichnet Kaninchen jagen konnte, normalerweise, daß die Chose jetzt aber unter Wasser stand. Als hätte sie danach gefragt, nannte der Mann ihr seine Funktion. »Chefingenieur bei der Reichswasserbaubehörde.«
Wie? Ah. Eigentlich nicht geneigt, den Anblick des Meeres, endlich, durch eine Plauderei herabzumindern, antwortete sie trotzdem: »Das heißt, diese großartige Ansicht ist … Ihr Arbeitsgebiet?«
»Ja, genau.«
Der Chefingenieur beugte sich näher zu ihr. Sie roch eine ordentliche Alkoholfahne. »Was Sie da sehen, Mevrouw, ist eine Tide, die den Grenzpegel mehrerer Meßstationen heute deutlich überschreiten wird, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen.«
Sie schwieg, runzelte die Stirn.
Der andere sah sie jetzt eindringlich an. »Was Sie hier sehen«, sagte er langsam, insistierend, »ist der ansteigende Meeresspiegel, an sich also nichts Besonderes, denn das passiert bei jeder Flut. Das ist Ihnen natürlich bekannt. Eine Angelegenheit von Sonne und Mond, die das Wasser an sich ziehen.« Er zog instruktionshalber die Hände gekrümmt hoch. »Aber manchmal, ähm, spricht die Flut die Sprache des Windes und nicht die der Astronomie.«
»Wie bitte?«
»Ja. Manchmal ist es der Sturm, der dem Wasser hier an der Küste zusätzlich noch einen ungnädigen Schubs nach oben verpaßt!«
Sie ließ ihren Blick nicht mehr abschweifen. Sie wandte sich ihrem Gesprächspartner halb zu, was noch nicht bedeutete, daß die Wasserfläche, die das Schiff inzwischen hinter sich gelassen hatte, nicht mehr auf sie wirkte, im Gegenteil. Schleichend griff sie ihren Richtungssinn an und versetzte sie in eine Art Narkose, durch die die Stimme des Chefingenieurs so logisch wie eine Traumgeschichte klang …
»Meine Güte«, sagte sie.
»Ich nehme an, daß Sie jetzt ein paar Fakten und Zahlen von mir hören wollen. Oder etwa nicht?«
Sie neigte den Kopf.
»Also« — der Chefingenieur richtete den Blick kurz konzentriert nach oben — »in diesem Jahrhundert hat es schon etliche Sturmfluten gegeben, und die meisten davon waren niedrig, niedrige Sturmfluten haben wir hier fast jedes Jahr, und dann steht überall einiges unter Wasser, tja. Mittlere Sturmfluten, wie wir sie bei der Reichswasserbaubehörde nennen, sind schon ein Stück saftiger, die kommen, sagen wir mal, einmal in zehn bis hundert Jahren vor. Erinnern Sie sich an den Winter 1906, als ein Orkan die Nordsee bei Vlissingen bis auf beinahe vier Meter über Amsterdamer Normalnull hochgedrückt hat, was gewaltige Verwüstungen angerichtet hat. Wie bitte? Nein, dabei sind keine Menschen ertrunken. Oder vielleicht allenfalls ein paar.«
Der Chefingenieur rieb sich die Hände. Sie sah, daß das Gesicht ihr gegenüber den Ausdruck wechselte, sah, wie niedrige und mittlere Sturmfluten sichtlich etwas Drastischerem Platz machten, und, jawohl: »Die dritte Kategorie, die wir unterscheiden, ist die hohe Sturmflut. Ein häufiges Phänomen? Nein. Tritt lediglich alle hundert bis tausend Jahre auf. Gut, Sie nicken schon. Die haben wir von der Reichswasserbaubehörde in der Tat noch nie als solche gemessen, geschweige denn in einer ordentlichen Statistik untergebracht.«
Er schwieg kurz. Mit einer Begeisterung, die ihr rätselhaft vorkam, erklärte er ihr dann, daß die Wissenschaft schließlich noch eine allerhöchste Sturmflutkategorie kenne, einen Viersternepreis, um eine Katastrophe zu bezeichnen, die, mochte sie vielleicht auch unwahrscheinlich sein, er ihr aber unmöglich verschweigen dürfe, da wir sie doch, sagen wir mal, alle zehntausend Jahre einmal in unserer Region erwarten könnten.
Er streckte den Kopf vor, artikulierte etwas mit den Lippen, aber sie verstand es nicht.
»Bitte?« fragte sie und erhielt eine brüllende Antwort.
»Die extrem hohe Sturmflut! Oh! Können Sie sich die nicht vorstellen? Haben Sie denn noch nie von den teuflischen Katastrophen von früher gehört? Die Sankt-Elisabeth-Flut im fünfzehnten Jahrhundert, die unseren kompletten südholländischen Waard verschluckt hat. Ein Jahrhundert später: Sankt Felix, eine noch bösere, die sich bemüßigt fühlte, alle zwanzig Dörfer rings um Reimerswaal für immer den Muscheln und Krabben zurückzugeben. Und! verflixt, vierzig Jahre später, statistisch gesehen also im Handumdrehen, tritt die Allerheiligenflut ein, und wieder denkt jeder, die Welt geht unter!«
Der Chefingenieur lachte kurz. Dann: »Wutanfälle der Natur, jeder von ihnen verantwortlich für gewaltige Totenzahlen!« Ob sie sich inzwischen klarmachen wolle, daß dieses ganze Spektakel nicht nur durch Zutun der Natur, sondern auch infolge der laxen Instandhaltung der Deiche oft so kraß verlaufen sei. Nur ein Berg halte seine Masse von sich aus zusammen. Ob sie ihm, bitte, glauben wolle, wenn er ihr versichere — es war deutlich, daß er jetzt etwas ganz ungeschminkt sagen wollte, so etwas macht hell-hörig —, als Insider versichere, daß die Höhe der Deichkronen auch heute noch keineswegs der Norm entspreche?
Er sah sie mit der Barschheit eines Menschen an, der die Zahlen verdammt genau kennt.
»Ähm … Sie sind ein sympathisches Mädchen. Ich beunruhige Sie doch nicht?«
Keineswegs, allerdings richtete sie den Blick nun doch auf etwas anderes. Ein kleines Schiff, wahnwitzig klein sogar. Es tuckerte in ungefähr fünfzig Metern Entfernung in die entgegengesetzte Richtung. Sie kniff die Augen zusammen. Mal verschwand es bis zum Ruderhaus in den Wogen, mal konnte sie die schwarze Persenning sehen und den Namen des Schiffes, Compassion, lesen, bevor es erneut in die Tiefe tauchte. Lichtbündel, die zwischen den Wolkengebilden herabschienen, gaben dem Ganzen etwas Theatralisches.
»Ich … finde es wirklich sehr schön!«
»Es ist in der Tat beeindruckend«, gab der Chefingenieur zu. Dann, nach einer Pause: »Kosmische und irdische Kräfte fließen aus unvorstellbar fernen Gebieten genau vor unseren Augen zusammen.«
Sie sah prüfend in seine leicht blutunterlaufenen Augen. Er grinste nicht.
»Erhabene Worte.«
»Langweile ich Sie?«
»Absolut nicht. Ich bin nämlich zum erstenmal hier.« Und wie jemand, der in einem zufälligen Moment erkennt, daß der Himmel unsere ewige, bleibende Urlandschaft ist, sagte sie: »Ja, wir nennen es schön, aber was steckt da nicht alles dahinter, nicht wahr?«
»Gewiß, gewiß.«
Einmütigkeit. Die vom Chefingenieur dazu genutzt wurde, jetzt auf den Strahlstrom zu sprechen zu kommen, das rasende Windband in der obersten Schicht der Troposphäre. In zehn, zwölf Kilometer Höhe fege das Ding über die Kontinente hinweg und sei imstande, die Atmosphäre in einem kompletten Tiefdruckgebiet zusammenzupressen oder ein Hochdruckgebiet wie einen Ballon aufzupumpen.
»Stellen Sie sich eine Fahrradpumpe von gigantischen Ausmaßen vor.«
Das tat sie, spähte aber währenddessen den Horizont weiter ab: Schon seit einiger Zeit fuhren sie an Deichen entlang, auf denen hier und da ein kleines Gebäude stand und über die gelegentlich auch ein Kirchturm ragte. An einem dieser Türme entdeckte sie eine wild flatternde Fahne. Das ist schon die zweite oder dritte heute, dachte sie, bis ihr einfiel, daß Prinzessin Beatrix Geburtstag hatte. Wie alt wurde das Mädchen? Vierzehn, fünfzehn?
»Zum Schluß sind wir beim Wetter angelangt«, sagte der Chefingenieur. »Regen, Wind, tja, Wetter gibt es immer, nicht wahr. Strenggenommen bilden Wetter und Wind den Hintergrund unseres ganzen Lebens.«
»Eigenartiger Gedanke.«
»Luft, die nichts anderes tut, als von einem Hoch- in ein Tiefdruckgebiet zu strömen.«
Sie lächelte ihn über die Schulter an, fast gesellig. Er bremste das ab. In plötzlich ziemlich autoritärem Ton sagte er: »Ähm … wie Sie spüren, nimmt die Gewalt des Windes mit jeder Minute zu!«
Inzwischen hatte das Schiff, auf deutlich anderem Kurs, zu stampfen begonnen. Sie merkte, daß sich die Ufer wieder entfernt hatten und daß sie genau gegen den Wind fuhren. Die Stimme des Chefingenieurs, schwer zu verstehen jetzt, war noch immer dabei, seine phantastische Naturlehre an ihr zu exerzieren. Als sie nicht reagierte, tippte er ihr auf den Ärmel.
»Und dieses Getöse, wollen Sie von mir wissen? Nun, Sie können mir ruhig glauben, nur wenn das monströse Herz des Sturms sich über der Nordsee zusammenzieht und dort alles kraftvoll aufbläst — ja? —, nur dann kann man hier ein richtig großes Spektakel erwarten …«
Damit schien das Gespräch beendet. Schien, denn Lidy, die tatsächlich dachte: Herrgott, alles schön und gut, bloß wie werde ich diesen Mann jetzt los, blieb sekundenlang mit ihrem Blick an dem seinen hängen.
»Ja?« fragte der Chefingenieur.
Sie schüttelte den Kopf und sah weg.
Soweit das Auge reichte, heranrollende Flut. Sie schauten beide darauf, bis der Chefingenieur sich ihr wieder zuwandte. Nachdrücklich, als vertraue er ihr eine Schlußfolgerung an, sagte er: »Vlissingen. Hoek van Holland.«
Ja?
Ob sie sich vorstellen könne, daß er nach diesem Wochenende wahnsinnig gespannt sei, was die Meßstationen dort heute messen würden?
Schlaffes Lächeln. Den Rücken ihm halb zugewandt, erwiderte sie nichts mehr. Der Chefingenieur stellte sich wieder vor sie. Sie rieb sich die gefalteten Hände und hauchte sie an. Was jetzt noch?
»Ich glaube, ich lege mich mal lang!«
Wenn sie gestatte. Er lege sich, sagte er, auf eine der Bänke im Fahrgastraum, die Hochzeit im Hoekse Waard, von der er komme, habe bis zum Morgengrauen gedauert. Für ihn gebe es nichts Herrlicheres, erklärte er, als bei Sturm und Unwetter zu schlafen. Also verschaffe er sich jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf heute nacht. Ob sie noch nicht genug habe von der Kälte und dem Wind? Na schön, er schüttelte ihr die Hand und machte dann im selben Zuge eine weite Armbewegung.
»Dort liegt England, schräg gegenüber Frankreich, da oben haben wir die Westfriesischen Inseln, und in der Mitte sind wir. Stellen Sie sich dazwischen eine Skulptur aus Wasser vor, ein Meeresgebirge, ziemlich niedrig an den Ausläufern, aber in der Mitte monumental in die Höhe steigend, und ziehen Sie eine Senkrechte nach hier!«
Der Chefingenieur ging lachend zur Treppe. Seine Stimme hatte ihr zusammen mit dem Wind laut in den Ohren gegellt.
Dämmerung. Ein Nachmittag im Januar. Lidy, auf einem Fährschiff auf dem Krammer, wußte so ungefähr, wo sie sich befand. Der Krammer ist der südöstliche Teil des Grevelingen, und der Grevelingen ist der Arm der Nordsee, der Zuid-Holland und Zeeland trennt. Bekannte Dinge, die heute absolut nicht gegen das ankamen, was sich dort vor ihren Augen abspielte, und nicht nur vor ihren Augen. Auch unter ihr, in der Tiefe, und hinter ihr war etwas im Gange, das sich unmöglich auf irgendeiner Land- oder Wasserkarte einzeichnen ließe. Es ließ sich nicht ein-mal richtig betrachten. Groß und lautstark schien es sich selbst umzusehen, mit Absichten, die kein Mensch in Worte fassen konnte aufgrund der simplen Tatsache, daß kein Mensch hier auch nur die geringste Rolle spielte. Man konnte es allenfalls ein wenig umschreiben: Es bläst ein kalter Wind von See — und es dann dabei belassen.
Es flogen noch Vögel. Sie sah die grauschwarzen Klumpen unter der Wolkenschicht hervorsegeln. Die mußten doch triftige Gründe haben, auch nur irgendeine Strecke in diesem Hexenkessel zurückzulegen. Während sie von den Vögeln zu den Wogen blickte, die, obwohl sich meterhoch auftürmend, doch unterhalb ihrer Füße blieben, machte sie die Entdeckung, daß »unten« oder »oben« nicht mehr existierten. Und weil es nun rasch dunkler wurde, erkannte sie bald keinen Raum mehr, auch keine Fläche, sondern nur noch Schaumfetzen. Weißlich, azurgrün. In die die Fähre im zirkuszeltartigen Licht ihrer Scheinwerfer eintauchte, in ihnen verschwand und wieder emporstieg, um eine Fahrt fortzusetzen, die keinerlei Zeitdauer mehr hatte. Nur Umstände.
Sie erschrak und begann schnell an zu Hause zu denken, denn auf einmal hatte sie sich selbst, in ihren Wintermantel eingemummt, auf dem Zwischendeck gesehen. Eine eigenartige junge Frau ohne Gedanken. Ihre Lebensfrage übernommen vom Spektakel ringsum. An einem solchen Ort muß man sich ein Tuch um die Augen binden und an zu Hause denken. Wo stehen die Stühle und Tische?