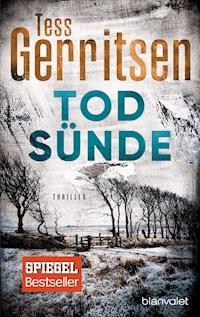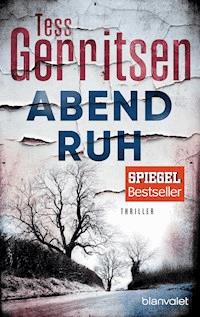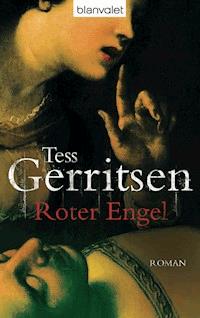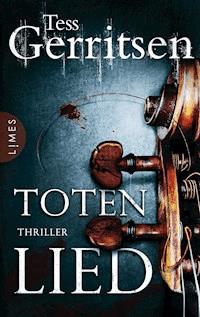10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für Rizzoli & Isles - von Weltklasseautorin Tess Gerritsen!
Detective Jane Rizzoli wird zu einem Tatort in einem reichen Bostoner Vorort gerufen. Der Arzt Richard Yeager wurde in seinem eigenen Haus grausam ermordet, von seiner jungen Frau Gail fehlt zunächst jede Spur. Als man kurz darauf auch ihre Leiche in einem Waldstück findet, werden böse Erinnerungen in Jane wach: Die Fälle ähneln einer Mordserie, in der Jane ein Jahr zuvor ermittelt hat. Der Täter von damals sitzt im Gefängnis, doch die neuen Morde tragen eindeutig seine Handschrift …
Verpassen Sie auch nicht »Spy Coast – Die Spionin« und »Die Sommergäste«, Tess Gerritsens brillante neue Thrillerreihe über eine Gruppe aus ehemaligen Spionen, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Detective Jane Rizzoli wird zu einem Tatort in einem reichen Bostoner Vorort gerufen. Der Arzt Richard Yeager wurde in seinem eigenen Haus grausam ermordet, von seiner jungen Frau Gail fehlt zunächst jede Spur. Als man kurz darauf auch ihre Leiche in einem Waldstück findet, werden böse Erinnerungen in Jane wach: Die Fälle ähneln einer Mordserie, in der Jane ein Jahr zuvor ermittelt hat. Der Täter von damals sitzt im Gefängnis, doch die neuen Morde tragen eindeutig seine Handschrift …
Autorin
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller Die Chirurgin, in dem Detective Jane Rizzoli erstmals ermittelt. Seither sind Tess Gerritsens Thriller um das Bostoner Ermittlerduo Rizzoli & Isles von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Maine.
Weitere Informationen zu Tess Gerritsen und ihren Büchern finden Sie unter: www.tess-gerritsen.de
Von Tess Gerritsen bereits erschienen
Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied
Die Rizzoli-&-Isles-Thriller
Die Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · Blutzeuge
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Tess Gerritsen
Der Meister
Ein Rizzoli-&-Isles-Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Apprentice« bei Ballantine Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2002 by Tess Gerritsen
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2003 by Limes Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by Arrangement with Tess Gerritsen Inc.
Dieses Werk wurde im Auftrag von Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Baertels
WR · Herstellung: wag
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-10628-7V007www.blanvalet.de
Für Terrina und Mike
Prolog
Heute habe ich einen Mann sterben sehen.
Es war ein unerwartetes Ereignis, und ich staune immer noch darüber, dass sich dieses Drama direkt zu meinen Füßen abspielte. So vieles von dem, was unserem Leben Würze gibt, ist nicht vorhersehbar. Deshalb müssen wir lernen, die Schauspiele, die es für uns bereithält, zu genießen, wann immer sie geboten werden, und die seltenen Momente des Nervenkitzels als Lichtblicke im sonst so monotonen Fluss der Zeit zu schätzen. Und meine Tage vergehen quälend langsam hier hinter diesen Mauern, wo Menschen nur Zahlen sind, wo man uns nicht nach unseren Namen oder unseren von Gott verliehenen Talenten unterscheidet, sondern nur nach der Art unserer Vergehen. Wir tragen identische Kleidung, essen die gleichen Mahlzeiten, lesen die gleichen zerfledderten Bücher von ein und demselben Bibliothekswagen. Ein Tag ist wie der andere. Und dann erinnert uns plötzlich ein ungewöhnlicher Vorfall daran, zu welch überraschenden Wendungen das Leben fähig ist.
So geschehen heute, an diesem zweiten August, der zu einem wunderbar heißen und sonnigen Tag herangereift ist, so wie ich es liebe. Während die anderen Männer schwitzen und träge umherschleichen wie Vieh auf der Weide, stehe ich in der Mitte des Gefängnishofs, das Gesicht zur Sonne gewandt, wie eine Eidechse, die die Wärme gierig aufsaugt. Ich habe die Augen geschlossen, weshalb ich den Messerstich selbst nicht sehe; und ich sehe auch nicht, wie der Mann taumelt und hinterrücks zu Boden fällt. Aber ich höre das aufgeregte Stimmengewirr um mich herum und schlage die Augen auf.
In einer Ecke des Hofs liegt ein Mann blutend auf der Erde. Alle anderen weichen zurück und setzen ihre gewohnten Masken der Gleichgültigkeit auf – nichts sehen und nichts wissen ist ihr Motto.
Nur ich gehe auf den Gefallenen zu.
Einen Moment lang stehe ich da und blicke auf ihn herab. Seine Augen sind offen, er ist bei Bewusstsein; ich muss ihm wie ein dunkler Schattenriss vor dem Hintergrund des strahlend blauen Himmels erscheinen. Er ist jung, mit weißblondem Haar, sein Bart kaum dichter als Flaum. Als er den Mund aufmacht, quillt rosafarbener Schaum heraus. Auf seiner Brust breitet sich ein roter Fleck aus.
Ich knie neben ihm nieder und reiße sein Hemd auf, um die Wunde freizulegen, die sich unmittelbar links vom Brustbein befindet. Die Klinge ist sauber zwischen zwei Rippen eingedrungen und hat mit Sicherheit die Lunge durchbohrt, vielleicht auch den Herzbeutel verletzt. Die Wunde ist tödlich, und er weiß es. Er versucht etwas zu sagen. Seine Lippen bewegen sich lautlos, seine Augen mühen sich verzweifelt, mich zu fixieren. Er will, dass ich mich näher zu ihm herunterbeuge, vielleicht um seine letzte Beichte zu hören, aber ich bin nicht im Geringsten daran interessiert, was er mir zu sagen hat.
Stattdessen habe ich nur Augen für seine Wunde. Für sein Blut.
Ich bin mit Blut bestens vertraut. Ich kenne es in- und auswendig, ich weiß Bescheid über seine Zusammensetzung. Ich habe zahllose Röhrchen mit dieser Flüssigkeit in den Händen gehalten, habe seine vielen verschiedenen Abstufungen von Rot bewundert. Ich habe es in der Zentrifuge geschleudert und in zweifarbige Säulen von dicht gepackten Zellen und strohblassem Serum getrennt. Ich kenne seinen Glanz, seine seidige Konsistenz. Ich habe seinen schimmernden Strom aus frischen Schnitten in der Haut fließen sehen.
Das Blut strömt aus der Brust des Mannes wie wundertätiges Wasser aus einer heiligen Quelle. Ich drücke den Handteller auf die Wunde, bade meine Haut in der feuchten Wärme, und das Blut überzieht meine Hand wie ein scharlachroter Handschuh. Er glaubt, dass ich ihm helfen will, und Dankbarkeit blitzt in seinen brechenden Augen auf. Dieser Mann hat in seinem kurzen Leben sehr wahrscheinlich nur wenig Nächstenliebe erfahren. Welche Ironie, dass ausgerechnet ich einem Sterbenden als das Antlitz der Barmherzigkeit erscheine.
Hinter mir höre ich das Scharren von Stiefeln und eine Stimme, die in barschem Ton befiehlt: »Zurück! Alles zurücktreten!«
Irgendjemand packt mich am Hemd und reißt mich hoch. Ich werde nach hinten gestoßen, weg von dem sterbenden Mann. Staub wirbelt auf, und die Luft ist von Schreien und Flüchen erfüllt, während man uns in einer Ecke zusammenscheucht. Das Werkzeug des Todes, das Messer, liegt unbeachtet auf der Erde. Die Wachmänner traktieren uns mit Fragen, aber niemand hat etwas gesehen, niemand weiß etwas.
Nie weiß irgendjemand irgendetwas.
Während sich auf dem Hof tumultartige Szenen abspielen, stehe ich ein wenig abseits von den anderen Gefangenen, die mich von Anfang an gemieden haben. Ich hebe die Hand, von der noch das Blut des toten Mannes trieft, und atme seinen süßlichen, metallischen Duft ein. Allein der Geruch verrät mir, dass es junges Blut ist, aus jungem Fleisch geflossen.
Die anderen Insassen starren mich an und rücken noch weiter von mir ab. Sie wissen, dass ich anders bin; sie haben es schon immer gespürt. So verroht diese Männer auch sein mögen, mir gehen sie voller Argwohn aus dem Weg, weil sie wissen, wer – und was – ich bin. Ich lasse den Blick über ihre Gesichter schweifen, suche meinen Blutsbruder in ihren Reihen. Ich sehe ihn nicht, nicht hier, nicht einmal in diesem Haus voller Monster in Menschengestalt.
Aber er existiert. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige meiner Art auf dieser Erde bin.
Irgendwo ist noch ein anderer. Und er wartet auf mich.
1
Die Fliegen waren schon zur Stelle. Nach vier Stunden auf dem aufgeheizten Pflaster von South Boston war das zerschmetterte Fleisch regelrecht gar gekocht und strömte das chemische Äquivalent eines Essensglöckchens aus, was ganze Schwärme summender Insekten angelockt hatte. Obwohl das, was von dem Körper übrig geblieben war, inzwischen mit einem Tuch abgedeckt war, fanden die Aasfresser noch reichlich herumliegendes Gewebe, an dem sie sich gütlich tun konnten. Klümpchen grauer Gehirnmasse und andere, nicht identifizierbare Fragmente waren in einem Radius von zehn Metern über die Straße verstreut. Ein Schädelsplitter war in einem Blumenkasten im ersten Stock gelandet, und an den parkenden Autos klebten Fleischfetzen.
Detective Jane Rizzoli hatte schon immer einen kräftigen Magen gehabt, aber selbst sie brauchte einen Moment, um sich zu fangen. Mit zusammengekniffenen Augen und geballten Fäusten stand sie da, wütend auf sich selbst wegen dieses Moments der Schwäche. Nicht schlappmachen. Bloß nicht schlappmachen. Sie war die einzige Kriminalbeamtin in der Mordkommission des Boston Police Department, und sie wusste, dass die Scheinwerfer immer gnadenlos auf sie gerichtet waren. Jeder Fehler würde sofort von allen bemerkt, ebenso wie jeder Triumph. Ihr Kollege Barry Frost hatte zu seiner Schande bereits vor aller Augen sein Frühstück zurückgehen lassen. Jetzt saß er zusammengekrümmt im klimatisierten Einsatzfahrzeug und wartete darauf, dass sein Magen sich wieder beruhigte. Sie konnte es sich einfach nicht leisten, ebenfalls von Übelkeit überwältigt zu werden. Als einzige Polizeibeamtin am Tatort zog sie alle Blicke auf sich, und die Schaulustigen, die sich hinter dem Absperrband drängten, registrierten jede ihrer Bewegungen, jedes Detail ihrer äußeren Erscheinung. Sie wusste, dass man ihr ihre vierunddreißig Jahre nicht ansah, und sie war peinlich darauf bedacht, so viel Autorität wie möglich in ihr Auftreten zu legen. Was ihr an Körpergröße fehlte, versuchte sie mit ihrem durchdringenden Blick und ihrer straffen Haltung wettzumachen. Sie hatte die Kunst gelernt, eine Szene zu beherrschen, und sei es nur durch die schiere Intensität ihrer Ausstrahlung.
Aber diese Hitze zehrte an ihrer Entschlossenheit. Sie war wie üblich in einem schlicht-eleganten Kostüm erschienen, die Haare sorgfältig gekämmt. Aber jetzt hatte sie den Blazer längst abgelegt, ihre Bluse war zerknittert, und die Luftfeuchtigkeit hatte ihre Haare zu widerspenstigen Locken gekräuselt. Sie fühlte sich von allen Seiten attackiert – von dem Gestank, den Fliegen, der brennenden Sonne. Sie musste sich auf zu vieles gleichzeitig konzentrieren. Und dann all diese Augen, die sie auf Schritt und Tritt verfolgten.
Laute Stimmen zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann mit Cityhemd und Krawatte versuchte einen Streifenbeamten zu beschwatzen, ihn vorbeizulassen.
»Hören Sie, ich muss zu einer Vertreterkonferenz, okay? Ich bin sowieso schon eine Stunde zu spät dran. Aber Sie wickeln zuerst mein Auto mit Ihrem verdammten Absperrband ein, und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass ich nicht wegfahren darf? Das ist mein Wagen, zum Donnerwetter!«
»Es handelt sich hier um den Tatort eines Verbrechens, Sir.«
»Es war ein Unfall!«
»Das haben wir noch nicht geklärt.«
»Und Sie brauchen den ganzen Tag, um das rauszufinden? Warum hören Sie uns nicht einfach mal zu? Die ganze Straße hat doch mitgekriegt, wie es passiert ist.«
Rizzoli trat auf den Mann zu, dessen Gesicht mit einer glänzenden Schweißschicht überzogen war. Es war halb zwölf; die Sonne stand schon fast im Zenit und brannte wie ein zornig starrendes Auge auf sie herab.
»Was genau haben Sie gehört, Sir?«, fragte sie.
Er schnaubte verächtlich. »Dasselbe, was alle anderen auch gehört haben.«
»Einen lauten Knall.«
»Ja. Gegen halb acht. Ich kam gerade aus der Dusche. Ich hab aus dem Fenster geschaut, und da lag er, mitten auf dem Gehsteig. Sie sehen ja selbst, was für eine gefährliche Stelle das hier ist. Diese Schweine kommen mit einem Affentempo um die Kurve gerast. Muss ein Lkw gewesen sein, der ihn erwischt hat.«
»Haben Sie einen Lkw gesehen?«
»Nee.«
»Oder gehört?«
»Nee.«
»Und einen Pkw haben Sie auch nicht gesehen?«
»Lkw, Pkw.« Er zuckte mit den Achseln. »So oder so, es war ein Unfall mit Fahrerflucht.«
Es war dieselbe Geschichte, die sie schon dutzendfach von den Nachbarn des Mannes zu hören bekommen hatten. Irgendwann zwischen sieben Uhr fünfzehn und sieben Uhr dreißig war auf der Straße ein lauter Knall zu hören gewesen. Es gab keine Augenzeugen für das, was passiert war. Sie alle hatten lediglich das Geräusch gehört, und dann hatten sie die Leiche des Mannes entdeckt. Rizzoli hatte die Möglichkeit, dass der Mann sich in den Tod gestürzt hatte, bereits in Betracht gezogen, aber gleich wieder verworfen. Der Straßenzug bestand nur aus zweistöckigen Gebäuden; kein Punkt lag hoch genug für einen Sturz mit derart verheerenden Folgen. Und es waren auch keine Spuren einer Explosion zu entdecken, die einen menschlichen Körper dermaßen zerfetzt haben könnte.
»He, kann ich jetzt vielleicht mein Auto hier wegfahren?«, fragte der Mann. »Es ist der grüne Ford da hinten.«
»Der mit den Hirnspritzern auf der Motorhaube?«
»Ja.«
»Was glauben Sie denn?«, fuhr sie ihn an. Dann ließ sie ihn einfach stehen und ging hinüber zu dem Gerichtsmediziner, der in der Mitte der Straße kauerte und den Asphalt absuchte. »Das sind doch alles Arschlöcher hier in der Straße«, sagte Rizzoli. »Das Opfer ist ihnen völlig schnuppe. Und es weiß auch niemand, wer er ist.«
Dr. Ashford Tierney blickte nicht zu ihr auf; er starrte weiter unbeirrt auf die Straße. Unter den spärlichen grauen Haarsträhnen glitzerte sein Schädel von Schweiß. Noch nie war ihr Dr. Tierney so alt und müde vorgekommen. Als er sich jetzt aufzurichten versuchte, streckte er die Hand nach ihr aus; eine stumme Bitte um Hilfe. Rizzoli ergriff sie, und sie konnte das Knirschen und Knacken der ermüdeten Knochen und Gelenke spüren, das sich durch seine Finger auf ihre übertrug. Er stammte aus Georgia; ein Südstaaten-Gentleman der alten Schule, der mit der direkten Art der Bostoner, wie Rizzoli sie verkörperte, nie recht warm geworden war, ebenso wenig wie sie mit seiner Förmlichkeit. Das Einzige, was sie verband, waren die sterblichen Überreste der Menschen, die auf Dr. Tierneys Autopsietisch landeten. Aber als sie ihm nun aufhalf, registrierte sie seine Gebrechlichkeit mit einem Anflug von Traurigkeit, und sie musste an ihren eigenen Großvater denken, dessen Lieblingsenkelin sie gewesen war – vielleicht, weil er in ihrem unbeugsamen Stolz und ihrer hartnäckigen Zielstrebigkeit sich selbst wiedererkannte. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihm aus dem Sessel aufgeholfen hatte, an seine vom Schlaganfall gelähmte Hand, die wie eine Klaue auf ihrem Arm geruht hatte. Selbst ein vor Energie strotzender Mann wie Aldo Rizzoli war von den unerbittlichen Mühlen der Zeit schließlich in ein Häuflein brüchiger Knochen und knackender Gelenke verwandelt worden. Sie konnte den gleichen Effekt an Dr. Tierney beobachten, als er nun schwankend in der Mittagshitze stand und sich mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte.
»Das ist ja ein Prachtexemplar von einem Fall; genau das Richtige zum Abschluss meiner Karriere«, sagte er. »Übrigens, Detective, werden Sie auch zu meiner Abschiedsparty kommen?«
»Äh… zu welcher Party?«, fragte Rizzoli.
»Zu der, mit der Sie alle mich überraschen wollen.«
Sie seufzte. Und gab zu: »Ja, ich bin dabei.«
»Ha. Von Ihnen habe ich noch immer eine offene Antwort bekommen. Ist es nächste Woche?«
»In zwei Wochen. Und Sie wissen es nicht von mir, okay?«
»Ich bin froh, dass Sie es mir gesagt haben.« Er blickte auf den Asphalt hinab. »Ich mag Überraschungen nicht besonders.«
»Also, was haben wir denn hier, Doc? Unfall mit Fahrerflucht?«
»Dies hier ist offenbar der Aufschlagpunkt.«
Rizzoli betrachtete den ausgedehnten Blutfleck. Dann wanderte ihr Blick zu der verhüllten Leiche, die in fast vier Meter Entfernung auf dem Gehweg lag.
»Sie meinen, er ist hier aufgeprallt und dann bis dort drüben geschleudert worden?«, fragte Rizzoli.
»So sieht es aus.«
»Muss ja ein ziemlich großer Lkw gewesen sein, der den armen Kerl so zu Matsch gefahren hat.«
»Kein Lkw«, war Tierneys rätselhafte Antwort. Er begann mit gesenktem Blick die Straße abzuschreiten.
Rizzoli folgte ihm, während sie die Schwärme von Fliegen zu verscheuchen suchte, die um sie herumschwirrten. Nach etwa zehn Metern blieb Tierney stehen und zeigte auf einen grauen Klumpen, der am Bordstein hing.
»Noch mehr Hirnmasse«, stellte er fest.
»Es war also kein Lkw?«, fragte Rizzoli.
»Nein. Und auch kein Pkw.«
»Was ist denn mit den Reifenspuren auf dem Hemd des Opfers?«
Tierney richtete sich auf und ließ den Blick über die Straße, den Gehsteig und die Häuser schweifen. »Fällt Ihnen an dieser Szenerie irgendetwas Interessantes auf, Detective?«
»Sie meinen, abgesehen von der Tatsache, dass da hinten ein toter Mann liegt, dem sein Gehirn abhanden gekommen ist?«
»Sehen Sie sich den Aufprallpunkt an.« Tierney deutete auf den Fleck auf dem Asphalt, neben dem er anfangs gekauert hatte. »Können Sie das Verteilungsmuster der Leichenteile erkennen?«
»Ja. Er ist in alle Himmelsrichtungen gespritzt. Der Aufprallpunkt liegt in der Mitte.«
»Richtig.«
»Es ist eine viel befahrene Straße«, sagte Rizzoli. »Die Autos kommen mit zu hoher Geschwindigkeit dort um die Kurve geschossen. Und das Opfer weist Reifenspuren auf dem Hemd auf.«
»Sehen wir uns diese Spuren doch noch einmal an.«
Als sie zu der Leiche zurückgingen, gesellte sich Barry Frost zu ihnen, der endlich wieder aus dem Van hervorgekrochen war. Er sah bleich und ein wenig betreten aus.
»Oh, Mann«, stöhnte er.
»Geht’s Ihnen wieder besser?«, fragte sie.
»Ob ich mir wohl eine Magen-Darm-Grippe eingefangen habe oder so?«
»Oder so.« Sie hatte Frost immer gemocht, hatte sein sonniges Gemüt und seine duldsame Art schätzen gelernt, und es tat ihr weh, ihn so in seinem Stolz verletzt zu sehen. Sie klopfte ihm auf die Schulter und schenkte ihm ein mütterliches Lächeln. Frost schien Mutterinstinkte geradezu herauszufordern, selbst bei der so gar nicht mütterlichen Rizzoli. »Das nächste Mal nehme ich eine Kotztüte für Sie mit«, erbot sie sich.
»Ach, wissen Sie«, meinte er, während er hinter ihr hertappte, »ich glaube wirklich, dass es bloß ein Virus ist…«
Sie standen vor der verstümmelten Leiche. Tierney ging ächzend in die Knie; seine Gelenke protestierten gegen diesen neuerlichen Anschlag, während er das Tuch zur Seite zog. Frost wurde noch blasser und trat einen Schritt zurück. Rizzoli musste gegen den dringenden Wunsch ankämpfen, das Gleiche zu tun.
Der Rumpf war in Höhe des Nabels in zwei Teile zerrissen. Die obere Hälfte, bekleidet mit einem beigefarbenen Baumwollhemd, war von Osten nach Westen ausgerichtet, während der untere Teil, der in Bluejeans steckte, in Nord-Süd-Richtung lag. Die beiden Hälften waren nur noch durch ein paar Haut- und Muskelstränge miteinander verbunden. Die inneren Organe waren herausgerissen worden und lagen auf dem Asphalt, zu einer breiförmigen Masse zerquetscht. Durch den Aufprall war der Hinterkopf zerschmettert, das Gehirn herausgeschleudert worden.
»Jung, Geschlecht männlich, dem Anschein nach hispanoamerikanischer oder mediterraner Herkunft, Alter zwischen zwanzig und vierzig«, sagte Tierney. »Ich erkenne offensichtliche Frakturen der Brustwirbelsäule, der Rippen, der Schlüsselbeine und des Schädels.«
»Könnte nicht auch ein Lastwagen so etwas anrichten?«, fragte Rizzoli.
»Es ist zweifellos möglich, dass ein Lastwagen derart massive Verletzungen bewirkt.« Aus seinen blassblauen Augen sah er Rizzoli herausfordernd an. »Aber niemand hat ein solches Fahrzeug gehört oder gesehen, habe ich Recht?«
»Ja, leider«, gab sie zu.
Frost brachte endlich auch einen Kommentar heraus. »Wissen Sie was, ich glaube, das sind gar keine Reifenspuren da auf seinem Hemd.«
Rizzoli nahm die schwarzen Streifen auf der Vorderseite des Hemds noch einmal in Augenschein. Sie berührte einen der verschmierten Streifen mit ihrer behandschuhten Hand und inspizierte anschließend den Finger. Etwas von der schwarzen Farbe war an dem Latexhandschuh hängen geblieben. Sie starrte den Fleck noch einen Moment lang an, während sie die neue Information verarbeitete.
»Sie haben Recht«, sagte sie. »Das sind keine Reifenspuren. Es ist Schmierfett.« Sie richtete sich auf und blickte sich auf der Straße um. Nirgends konnte sie blutige Reifenspuren oder Autoteile entdecken. Keine Glas- oder Plastiksplitter, wie sie nach einer so heftigen Kollision mit einem menschlichen Körper zweifellos zurückgeblieben wären.
Eine Zeit lang sagte niemand etwas. Sie sahen einander nur an, während allen dreien allmählich die einzig mögliche Erklärung dämmerte. Wie um die Theorie zu bestätigen, flog in diesem Augenblick ein Düsenjet donnernd über ihre Köpfe hinweg. Rizzoli legte den Kopf in den Nacken und sah mit zusammengekniffenen Augen eine 747 vorüberfliegen, im Landeanflug auf den etwa acht Kilometer nordöstlich gelegenen Flughafen Logan International.
»O mein Gott«, sagte Frost, der sich die Hand schützend über die Augen hielt. »Was für ein Abgang. Bitte sagen Sie mir, dass er schon tot war, bevor er hier unten ankam.«
»Das ist sehr wahrscheinlich«, antwortete Tierney. »Ich vermute, dass er herausgerutscht ist, als das Fahrwerk für die Landung ausgeklappt wurde – wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine ankommende Maschine handelte.«
»Ja, sicher«, sagte Rizzoli. »Wie viele blinde Passagiere versuchen schon, aus diesem Land herauszukommen?« Ihr Blick fiel auf den dunklen Teint des Opfers. »Er kommt also mit einem Flugzeug her, von Südamerika zum Beispiel…«
»Es dürfte eine Flughöhe von mindestens dreißigtausend Fuß gehabt haben«, sagte Tierney. »Im Fahrwerkschacht gibt es keinen Druckausgleich. Ein blinder Passagier ist dort unweigerlich einem rapiden Druckabfall ausgesetzt. Und Erfrierungen. Selbst im Hochsommer herrschen in diesen Höhen eisige Temperaturen. Unter derartigen Bedingungen wäre er nach wenigen Stunden bereits unterkühlt und würde durch den Sauerstoffmangel das Bewusstsein verlieren. Wenn er nicht schon beim Einholen des Fahrwerks nach dem Start zerquetscht wurde. Ein längerer Flug im Fahrwerkschacht würde ihm wahrscheinlich den Rest geben.«
Rizzolis Beeper unterbrach Dr. Tierney just in dem Moment, als der Wissenschaftler so richtig in Fahrt zu kommen schien. Er begann bereits auf- und abzuschreiten wie ein Professor bei der Vorlesung. Sie warf einen Blick auf die Anzeige des Geräts, doch die Nummer war ihr unbekannt. Die Vorwahl deutete auf einen Anschluss in Newton hin. Rizzoli nahm ihr Handy heraus und wählte.
»Detective Korsak«, meldete sich eine männliche Stimme.
»Hier spricht Rizzoli. Sie haben mich angepiepst.«
»Haben Sie mit dem Handy zurückgerufen, Detective?«
»Ja.«
»Haben Sie Zugang zu einem Festnetzanschluss?«
»Im Moment nicht, nein.« Sie wusste nicht, wer Detective Korsak war, und sie wollte das Gespräch möglichst kurz halten. »Warum sagen Sie mir nicht einfach, worum es geht?«
Eine Pause. Sie hörte im Hintergrund Stimmen, das Knacken und Rauschen eines Polizeifunkgeräts. »Ich bin hier in Newton an einem Tatort«, sagte er. »Ich denke, Sie sollten herkommen und sich das einmal ansehen.«
»Möchten Sie das Boston P. D. um Unterstützung bitten? In diesem Fall könnte ich Sie an einen anderen Beamten von unserer Einheit weiterleiten.«
»Ich habe schon versucht, Detective Moore zu erreichen, aber mir wurde mitgeteilt, er sei im Urlaub. Deshalb rufe ich Sie an.« Wieder machte er eine bedeutungsschwangere Pause, um dann leise hinzuzufügen: »Es geht um den Fall, bei dem Sie und Moore letzten Sommer die Ermittlungen geleitet haben. Sie wissen schon, wovon ich spreche.«
Rizzoli schwieg. Sie wusste genau, was er meinte. Die Erinnerung an diesen Fall verfolgte sie immer noch, quälte sie immer noch in ihren Albträumen.
»Fahren Sie fort«, sagte sie leise.
»Soll ich Ihnen die Adresse durchgeben?«, fragte er.
Sie nahm ihren Notizblock zur Hand.
Einen Augenblick später beendete sie das Gespräch und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Dr. Tierney zu.
»Ich habe ähnliche Verletzungen bei Fallschirmspringern gesehen, deren Schirm sich nicht geöffnet hatte«, sagte er. »Ein Körper, der aus einer solchen Höhe abstürzt, erreicht die maximale Fallgeschwindigkeit. Das sind rund sechzig Meter pro Sekunde – genug, um einen Menschen so in Stücke zu reißen, wie wir es hier vor uns sehen.«
»Ein verdammt hoher Preis, um in dieses Land zu gelangen«, meinte Frost.
Wieder dröhnte ein Jet am Himmel vorüber. Sein Schatten huschte vorbei wie der eines Raubvogels, der sich auf seine Beute stürzt.
Rizzoli blickte zum Himmel empor. Sie stellte sich vor, wie ein Körper von dort oben herabstürzte, Hunderte von Metern im freien Fall. Sie malte sich aus, wie die kalte Luft an ihm vorüberzischte. Luft, die immer wärmer wurde, je näher die wirbelnde Wand des Erdbodens kam.
Dann fiel ihr Blick wieder auf die abgedeckten Überreste des Mannes, der es gewagt hatte, von einer neuen Welt zu träumen, von einer rosigeren Zukunft.
Willkommen in Amerika.
Der Polizist vom Department Newton, der vor dem Haus postiert war, konnte noch nicht lange bei der Truppe sein, denn er erkannte Rizzoli nicht. Er hielt sie an der Grenze des abgesperrten Bereichs an, und der brüske Ton, in dem er sie anredete, passte genau zu seiner nagelneuen Uniform. Auf seinem Namensschild stand Ridge.
»Hier dürfen Sie nicht durch, Ma’am – Spurensicherung.«
»Ich bin Detective Rizzoli vom Boston P. D. Ich möchte zu Detective Korsak.«
»Ihren Dienstausweis, bitte.«
Mit dieser Aufforderung hatte sie nicht gerechnet; sie musste erst einmal in ihrer Handtasche nach dem Ausweis suchen. In der Bostoner City wusste so gut wie jeder Streifenbeamte, wer sie war. Aber sie musste nur ein paar Kilometer über die Grenze ihres Reviers hinaus in diesen wohlhabenden Vorort fahren, und schon war sie gezwungen, ihren Dienstausweis hervorzukramen. Sie hielt ihn dem jungen Mann direkt vor die Nase.
Er warf einen Blick darauf und lief knallrot an. »Es tut mir wirklich Leid, Ma’am. Aber Sie müssen verstehen, gerade vor ein paar Minuten ist diese miese Reporterin hier aufgekreuzt, hat mich einfach niedergequatscht und ist an mir vorbeigestürmt – und ich habe mir geschworen, dass mir das nicht noch einmal passiert.«
»Ist Korsak da drin?«
»Ja, Ma’am.«
Sie warf einen Blick auf die Fahrzeuge, die kreuz und quer am Straßenrand parkten; darunter war ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift Regierung von Massachusetts, Rechtsmedizinisches Institut auf der Seitentür.
»Wie viele Opfer?«, fragte sie.
»Eins. Sie sind wohl gleich so weit, dass sie ihn rausbringen können.«
Der Streifenbeamte hob das Absperrband an, um sie in den Vorgarten zu lassen. Die Vögel zwitscherten, es duftete nach frischem Gras. Du bist nicht mehr in South Boston, dachte sie. Der Garten war hervorragend gepflegt, mit sauber gestutzten Buchsbaumhecken und einem Rasen, dessen leuchtendes Grün beinahe unecht wirkte. Auf dem mit Ziegeln gepflasterten Pfad blieb sie kurz stehen und blickte zum Dach mit seinen Giebeln und Türmchen in Tudor-Manier empor. Pseudo-englischer Landhausstil war die Bezeichnung, die ihr in den Sinn kam. Ein Haus – und überhaupt eine Wohnlage –, wie sie sich eine redliche Polizistin niemals würde leisten können.
»Ziemlich noble Hütte, hm?«, rief Ridge ihr zu.
»Was war dieser Mann von Beruf?«
»So viel ich weiß, war er so eine Art Chirurg.«
Chirurg. Für sie hatte dieses Wort eine ganz besondere Bedeutung, und sein Klang fuhr ihr wie eine eisige Nadel ins Herz. Der Hitze des Tages zum Trotz überlief sie ein Kälteschauer. Sie warf einen Blick auf die Haustür und sah, dass der Knauf ganz rußig von Fingerabdruck-Pulver war. Sie holte noch einmal tief Luft, streifte ein Paar Latexhandschuhe über und zog Überschuhe aus Papier an.
Im Innern des Hauses sah sie glänzendes Eichenparkett und ein Treppenhaus, das an das Mittelschiff einer Kathedrale erinnerte. Durch ein Buntglasfenster fiel das Licht in farbig schimmernden Rhomben ein.
Dann hörte sie das Rascheln von Papier-Überschuhen, und im nächsten Moment kam ein Bär von einem Mann in die Diele getappt. Er war durchaus korrekt gekleidet, mit Hemd und ordentlich geknoteter Krawatte, doch die Wirkung wurde durch die beiden ausgedehnten Schweißinseln unter seinen Achseln einigermaßen ruiniert. Seine hochgekrempelten Ärmel ließen muskulöse Arme mit einem dichten, struppigen Pelz aus dunklen Haaren erkennen. »Rizzoli?«, fragte er.
»Richtig geraten.«
Er kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu, doch dann fiel ihm ein, dass sie ja Handschuhe trug, und er ließ den Arm wieder sinken. »Vince Korsak. Tut mir Leid, dass ich am Telefon nicht mehr sagen konnte, aber heutzutage hat schließlich jeder Idiot eine Richtantenne. Eine Reporterin hat sich sogar schon hier reingemogelt – dieses Miststück.«
»Hab’s schon gehört.«
»Also, Sie fragen sich sicher, was Sie hier draußen eigentlich sollen. Aber ich habe Ihre Arbeit letztes Jahr verfolgt. Sie wissen schon, die Morde des Chirurgen. Und da dachte ich mir, das hier würde Sie bestimmt interessieren.«
Ihr Mund war plötzlich ganz trocken. »Was haben Sie denn für mich?«
»Das Opfer ist im Wohnzimmer. Dr. Richard Yeager, sechsunddreißig. Orthopädischer Chirurg. Das hier ist sein Haus.«
Sie blickte zu dem Buntglasfenster auf. »Sie hier in Newton kriegen die ganzen Morde der gehobenen Kategorie ab.«
»Ach, von mir aus könnt ihr sie alle haben. Eigentlich dürfte so was hier in der Gegend gar nicht vorkommen. Besonders so kranke Sauereien wie das hier.«
Korsak führte sie den Flur entlang ins Wohnzimmer. Das Erste, was Rizzoli sah, war das gleißende Sonnenlicht, das durch die zwei Stockwerke hohe Fensterwand mit Scheiben vom Boden bis zur Decke einfiel. Obwohl mehrere Beamte der Spurensicherung noch bei der Arbeit waren, wirkte der riesige Raum steril und leer – nur weiße Wände und glänzendes Parkett.
Und Blut. Ganz gleich, wie viele Schauplätze von Gewaltverbrechen sie schon gesehen hatte – der erste Anblick des Blutes war für sie immer noch ein Schock. Eine arterielle Fontäne war wie ein Kometenschweif an die Wand gespritzt und in dünnen Rinnsalen herabgeflossen. Die Quelle dieses Blutes, Dr. Richard Yeager, saß mit dem Rücken an die Wand gelehnt am Boden. Seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Er war nur mit Boxershorts bekleidet, und seine Beine waren gerade ausgestreckt und an den Knöcheln mit Klebeband zusammengebunden. Das Kinn war ihm auf die Brust gesunken, so dass die Wunde, die zu der tödlichen Blutung geführt hatte, verdeckt war. Doch auch ohne den Schnitt zu sehen, wusste sie, dass er sehr tief sein musste und die Klinge die Halsschlagader und die Luftröhre durchtrennt haben musste. Sie war bereits allzu vertraut mit dieser Art von Verletzung, und sie konnte die letzten Sekunden des Ermordeten aus dem Muster der Blutspritzer herauslesen: Zuerst war es aus der Arterie herausgeschossen, dann hatten die Lungen sich mit Blut gefüllt, das der tödlich Verwundete durch seine durchschnittene Luftröhre eingeatmet hatte. Er war in seinem eigenen Blut ertrunken. Ein Sprühregen von ausgeatmeten Tröpfchen war auf seiner nackten Brust getrocknet. Seinen breiten Schultern und der gut entwickelten Muskulatur nach zu urteilen war er körperlich fit gewesen – mit Sicherheit in der Lage, sich gegen einen Angreifer zur Wehr zu setzen. Und doch war er mit gesenktem Kopf gestorben, in einer unterwürfigen Haltung.
Die beiden Mitarbeiter des Leichenschauhauses hatten schon ihre Bahre hereingebracht. Sie standen neben dem Opfer und überlegten, wie sie den von der Leichenstarre erfassten Körper am besten abtransportieren könnten.
»Als die Gerichtsmedizinerin die Leiche um zehn Uhr heute Morgen untersucht hat, waren die Totenflecke bereits ausgeprägt und die Leichenstarre eingetreten«, sagte Korsak. »Nach ihrer Schätzung ist der Tod zwischen Mitternacht und drei Uhr früh eingetreten.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Seine Assistentin. Nachdem er heute Morgen nicht in der Klinik erschienen war und auch nicht ans Telefon ging, hat sie sich ins Auto gesetzt und ist hergekommen, um nach ihm zu sehen. Sie hat ihn um neun Uhr gefunden. Seine Frau ist spurlos verschwunden.«
Rizzoli sah Korsak fragend an. »Seine Frau?«
»Gail Yeager, einunddreißig. Sie wird vermisst.«
Der eiskalte Schauer, den Rizzoli empfunden hatte, als sie vor der Haustür der Yeagers gestanden hatte, überkam sie erneut. »Eine Entführung?«
»Ich habe lediglich gesagt, dass sie vermisst wird.«
Rizzoli starrte auf Richard Yeager herab, dessen muskulöser Körper nicht stark genug gewesen war, um sich gegen den tödlichen Angriff zur Wehr zu setzen. »Erzählen Sie mir etwas über diese Leute. Ihre Ehe.«
»Ein glückliches Paar. Das sagen alle.«
»Das sagen sie immer.«
»In diesem Fall scheint es zu stimmen. Waren erst zwei Jahre verheiratet. Und vor einem Jahr haben sie sich dieses Haus gekauft. Sie arbeitet in seiner Klinik als OP-Schwester, also hatten sie den gleichen Freundeskreis, die gleichen Arbeitszeiten.«
»Dann waren sie ja ziemlich viel zusammen.«
»Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich würde ja verrückt werden, wenn ich den ganzen Tag mit meiner Frau zusammenhocken müsste. Aber sie haben sich offenbar glänzend verstanden. Letzten Monat hat er sich zwei ganze Wochen freigenommen, um bei ihr sein zu können, nachdem ihre Mutter gestorben war. Was schätzen Sie, wie viel ein orthopädischer Chirurg in zwei Wochen verdient, hm? Fünfzehn, zwanzigtausend Dollar? Ganz schön teurer Trost, den er ihr da gespendet hat.«
»Sie wird ihn gebraucht haben.«
Korsak zuckte mit den Achseln. »Trotzdem.«
»Sie haben also keinen Grund finden können, weshalb sie ihn hätte verlassen sollen.«
»Geschweige denn umlegen.«
Rizzoli blickte zum Fenster hinaus. Die Nachbarhäuser waren durch Bäume und Sträucher vollständig verdeckt. »Sie sagten, der Todeszeitpunkt habe zwischen Mitternacht und drei Uhr gelegen?«
»Ja.«
»Haben die Nachbarn irgendetwas gehört?«
»Die Nachbarn zur Linken sind zurzeit in Paris – oh, là, là. Und die auf der rechten Seite haben die ganze Nacht friedlich geschlafen.«
»Gewaltsames Eindringen?«
»Ja, durch das Küchenfenster. Der Täter hat das Fliegengitter ausgehebelt und einen Glasschneider benutzt. Im Blumenbeet sind Abdrücke von Schuhen, Größe zweiundvierzig. Dieselben Sohlen haben auch Blutspuren in diesem Zimmer hinterlassen.« Er nahm ein Taschentuch heraus und wischte sich die feuchte Stirn. Korsak gehörte zu den bedauernswerten Menschen, für die kein Deo stark genug ist. In den paar Minuten seit ihrem Eintreffen hatten sich die Schweißflecken auf seinem Hemd noch weiter ausgebreitet.
»Okay, ziehen wir ihn erst mal von der Wand weg«, sagte einer der Männer vom Leichenschauhaus. »Wir lassen ihn einfach auf das Laken fallen.«
»Pass auf den Kopf auf! Er rutscht weg!«
»Au, verdammt!«
Rizzoli und Korsak verstummten, als die beiden Dr. Yeager seitlich auf ein Einweglaken legten. Ober- und Unterkörper bildeten einen rechten Winkel, und in dieser Position war die Leiche erstarrt. Die beiden Männer überlegten hin und her, wie sie Dr. Yeager in dieser grotesken Haltung am besten auf die Bahre legen sollten.
Rizzolis Blick fiel plötzlich auf ein kleines weißes Etwas, das an der Stelle, wo der Tote gesessen hatte, am Boden lag. Sie bückte sich, um es aufzuheben. Es schien ein winziger Porzellansplitter zu sein.
»Das ist von der kaputten Teetasse«, sagte Korsak.
»Was?«
»Neben dem Opfer haben wir eine Teetasse mit Untertasse gefunden. Sah aus, als wäre sie ihm vom Schoß gefallen oder so. Wir haben sie schon eingepackt fürs Labor.« Er bemerkte ihren verwirrten Blick und zuckte mit den Achseln. »Fragen Sie mich nicht.«
»Ein symbolischer Gegenstand?«
»Ja, bestimmt. Teezeremonie für einen Toten.«
Sie starrte die kleine Porzellanscherbe in ihrer Hand an und grübelte über ihre Bedeutung nach. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Irgendetwas kam ihr auf erschreckende Weise vertraut vor. Eine Leiche mit durchschnittener Kehle. Fesselung mit Klebeband. Nächtlicher Einbruch durch ein Fenster. Das oder die Opfer im Schlaf überrascht.
Und eine vermisste Frau.
»Wo ist das Schlafzimmer?«, fragte sie. Und wollte es doch nicht sehen. Weil sie Angst davor hatte.
»Okay. Das ist es, was ich Ihnen zeigen wollte.«
Gerahmte Schwarzweißfotografien hingen an den Wänden des Flurs, der zum Schlafzimmer führte. Es waren nicht die Schnappschüsse lächelnder Familienmitglieder, wie man sie in den meisten Häusern findet, sondern unterkühlte weibliche Akte – anonyme Körper, das Gesicht verdeckt oder von der Kamera abgewandt. Eine Frau, die die Arme um einen Baumstamm schlang und ihre zarte Haut an die raue Borke presste. Eine Sitzende, vornübergebeugt, so dass ihr üppiges langes Haar zwischen ihren bloßen Schenkeln herabfiel. Eine Stehende, die sich nach dem Himmel reckte, die nackte Haut von Schweißperlen bedeckt wie nach einer großen körperlichen Anstrengung. Rizzoli blieb stehen, um ein Foto genauer in Augenschein zu nehmen, das irgendjemand im Vorbeigehen verrückt hatte.
»Das ist alles ein und dieselbe Frau«, stellte sie fest.
»Das ist sie.«
»Mrs. Yeager?«
»Standen wohl auf abartige Spielchen, die beiden, hm?«
Sie betrachtete Gail Yeagers wohlgeformten und durchtrainierten Körper. »Ich finde das ganz und gar nicht abartig. Es sind wunderschöne Bilder.«
»Ja, gut, wie Sie meinen. Das Schlafzimmer ist hier.« Er zeigte auf die Tür.
Rizzoli blieb an der Schwelle stehen. Sie erblickte ein französisches Bett, die Laken zurückgeschlagen, als ob die Schlafenden plötzlich geweckt worden wären. Der Nylonflor des blassrosafarbenen Teppichs war in zwei Bahnen, die vom Bett zur Tür führten, plattgedrückt.
Rizzoli sagte leise: »Sie sind beide aus dem Bett gezerrt worden.«
Korsak nickte. »Unser Täter überrascht sie im Bett. Überwältigt sie irgendwie, fesselt sie an Händen und Füßen. Er schleift sie über den Teppich hinaus auf den Flur, wo das Parkett anfängt.«
Die Handlungen des Mörders waren ihr ein Rätsel. Sie stellte sich vor, wie er dort gestanden hatte, wo sie jetzt stand, und auf das schlafende Paar herabgesehen hatte. Im Licht, das durch vorhanglose Fenster hoch über dem Bett ins Zimmer gefallen war, würde er gleich erkannt haben, wer der Mann und wer die Frau war. Er würde sich zuerst Dr. Yeager vorgenommen haben. Es war nur logisch, so vorzugehen – den Mann zuerst zu überwältigen und sich die Frau für später aufzuheben. So weit konnte Rizzoli sich alles gut vorstellen. Das Anschleichen an die Opfer, die erste Attacke. Aber was dann kam, konnte sie nicht mehr nachvollziehen.
»Warum hat er sie in das andere Zimmer geschleift?«, fragte sie. »Warum hat er Dr. Yeager nicht gleich hier getötet? Was hat er damit bezweckt, dass er sie aus dem Schlafzimmer gebracht hat?«
»Ich weiß es nicht.« Er deutete auf die offene Tür. »Es ist schon alles fotografiert. Sie können reingehen.«
Es kostete sie Überwindung, den Raum zu betreten, und sie mied sorgfältig die Schleifspuren, als sie auf das Bett zuging. Weder auf dem Bettlaken noch auf den Decken konnte sie Blutflecken entdecken. Auf einem Kopfkissen lag ein langes blondes Haar – das musste Mrs. Yeagers Seite gewesen sein, dachte sie. Sie drehte sich zur Kommode um. Das gerahmte Foto eines Paares, das darauf stand, lieferte ihr die Bestätigung, dass Gail Yeager in der Tat blond war. Und sehr hübsch – mit wasserblauen Augen, die tiefbraune Gesichtshaut mit winzigen Sommersprossen gesprenkelt. Dr. Yeager hatte ihr den Arm um die Schultern gelegt. Er strahlte das robuste Selbstvertrauen eines Mannes aus, der um seine imponierende Erscheinung weiß. Kein Mann, von dem man sich vorstellen konnte, dass er eines Tages tot in seinem Wohnzimmer liegen würde, nur mit einer Unterhose bekleidet und an Händen und Füßen gefesselt.
»Es liegt auf dem Stuhl«, sagte Korsak.
»Was?«
»Sehen Sie selbst.«
Sie drehte sich um und erblickte in der Zimmerecke einen antiken Stuhl mit hoher Rückenlehne, auf dem ein zusammengefaltetes Nachthemd lag. Als sie näher trat, sah sie die leuchtend roten Spritzer auf dem cremefarbenen Satin.
Sofort stellten sich ihre Nackenhaare auf, und für ein paar Sekunden vergaß sie schier zu atmen.
Sie griff nach dem Kleidungsstück und hob eine Ecke an. Auch an der Unterseite waren Blutflecken.
»Wir wissen nicht, um wessen Blut es sich handelt«, sagte Korsak. »Es könnte von Dr. Yeager sein, es könnte aber auch von seiner Frau stammen.«
»Die Blutflecken waren schon darauf, bevor es zusammengefaltet wurde.«
»Aber es gibt im ganzen Zimmer keine weiteren Blutspuren. Und das bedeutet, dass das Nachthemd die Spritzer in dem anderen Raum abbekommen hat. Danach hat er es hierher ins Schlafzimmer gebracht. Und es fein säuberlich gefaltet, um es wie ein Abschiedsgeschenk auf diesem Stuhl zu platzieren.« Korsak hielt einen Moment inne. »Erinnert Sie das an irgendwen?«
Sie schluckte krampfhaft. »Das wissen Sie ganz genau.«
»Dieser Killer hat die Signatur Ihres Knaben kopiert.«
»Nein, das hier ist etwas anderes. Etwas ganz anderes. Der Chirurg hat nie Paare überfallen.«
»Das zusammengefaltete Nachthemd. Das Klebeband. Die Opfer, die im Bett überrascht wurden.«
»Warren Hoyt war hinter allein stehenden Frauen her. Er hat sich Opfer ausgesucht, die er schnell und mühelos überwältigen konnte.«
»Aber Sie dürfen auch die Parallelen nicht übersehen! Ich sage Ihnen, wir haben es hier mit einem Nachahmungstäter zu tun. Mit irgendeinem Spinner, der alles über den Chirurgen gelesen hat.«
Rizzoli starrte immer noch das Nachthemd an. Sie dachte an andere Schlafzimmer, die sie gesehen hatte, andere Schauplätze des Todes. Es war in einem unerträglich heißen Sommer passiert, ähnlich dem, den sie jetzt erlebten; die Frauen hatten bei offenem Fenster geschlafen, und Warren Hoyt hatte sich in ihre Wohnungen geschlichen. Er hatte seine düsteren Fantasien mitgebracht und seine Skalpelle, die Instrumente, mit denen er seine blutigen Rituale an den Opfern vollführte – an Opfern, die wach waren und jeden Stich, jeden Schnitt seiner Klinge bei vollem Bewusstsein miterlebten. Sie sah das Nachthemd vor sich auf dem Stuhl liegen, und das Bild von Hoyts absolut gewöhnlichem Gesicht tauchte vor ihrem geistigen Auge auf – ein Gesicht, das sie immer noch in ihren Träumen verfolgte.
Aber das hier ist nicht sein Werk. Warren Hoyt ist hinter Gittern, an einem sicheren Ort, von dem er nicht entfliehen kann. Das weiß ich, weil ich das Schwein selbst dorthin gebracht habe.
»Der Boston Globe hat die Geschichte in allen sensationellen Details abgedruckt«, sagte Korsak. »Sogar die New York Times hat über Ihren Burschen berichtet. Und jetzt ahmt dieser Täter ihn nach.«
»Nein. Ihr Killer tut Dinge, die Hoyt niemals getan hat. Er schleppt dieses Paar aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Er lehnt den Mann in sitzender Haltung an die Wand und schneidet ihm dann die Kehle durch. Es ist eher so etwas wie eine Hinrichtung. Oder ein Teil eines Rituals. Und dann ist da die Frau. Er tötet ihren Mann, aber was macht er mit ihr?« Sie brach ab, als ihr plötzlich der Porzellansplitter vom Wohnzimmerboden wieder einfiel. Die zerbrochene Teetasse. Ihre Bedeutung durchfuhr sie urplötzlich wie ein eisiger Windstoß.
Wortlos verließ sie das Schlafzimmer und ging ins Wohnzimmer zurück. Dort sah sie sich zunächst die Wand an, an der Dr. Yeagers Leiche gelehnt hatte. Ihr Blick wanderte zum Boden, und sie begann in immer weiteren Kreisen umherzugehen, während sie die Blutspritzer auf dem Holz aufmerksam betrachtete.
»Rizzoli?«, sagte Korsak.
Sie wandte sich zu der Fensterfront um und kniff die Augen zusammen, als das Sonnenlicht ihr Gesicht traf. »Es ist zu hell hier. Und die Scheiben sind zu groß. Das können wir nicht alles abdecken. Wir müssen wohl heute Abend noch einmal herkommen.«
»Sie denken daran, mit Luma-Lite zu arbeiten?«
»Wir werden UV-Licht brauchen, um es zu sehen.«
»Wonach suchen Sie denn?«
Sie drehte sich wieder zur Wand um. »Dr. Yeager saß hier, als er starb. Unser unbekannter Täter hat ihn aus dem Schlafzimmer herübergeschleift. Dann hat er ihn an die Wand gelehnt, und zwar so, dass sein Gesicht der Zimmermitte zugewandt war.«
»Klar.«
»Warum wurde er in diese Position gebracht? Warum hat der Täter sich die ganze Arbeit gemacht, während sein Opfer noch am Leben war? Es muss einen Grund dafür geben.«
»Und welchen?«
»Er wurde an die Wand gelehnt, weil er etwas sehen sollte. Weil er Zeuge dessen werden sollte, was sich hier in diesem Zimmer abspielte.«
Jetzt endlich dämmerte in Korsaks entsetztem Gesicht die Erkenntnis. Er starrte die Wand an, wo Dr. Yeager gesessen hatte – der einzige Zuschauer in einem Theater des Grauens.
»O Gott«, stieß er hervor. »Mrs. Yeager.«
2
Rizzoli nahm sich vom Italiener an der Ecke eine Pizza mit und kramte zu Hause noch einen vergammelten Salatkopf aus dem Gemüsefach ihres Kühlschranks hervor. Sie zupfte die verwelkten braunen Blätter ab, bis sie zu dem gerade noch essbaren Kern vorgedrungen war. Es war ein blasser und wenig appetitanregender Salat, den sie mehr aus Pflichtgefühl als aus Genuss verzehrte. Zum Genießen fehlte ihr die Muße – sie aß nur, um ihren Energiespeicher für die vor ihr liegende Nacht aufzufüllen – eine Nacht, von der sie wünschte, sie wäre schon vorbei.
Nach ein paar Bissen schob sie ihr Essen von sich und starrte auf die leuchtend roten Flecken von Tomatensauce auf ihrem Teller. Die Albträume holen dich ein, dachte sie. Du glaubst, du bist immun dagegen, du glaubst, genug Abstand gewonnen zu haben und stark genug zu sein, um mit ihnen zu leben. Und du spielst die Rolle gekonnt, du weißt, wie du sie alle austricksen kannst. Aber diese Gesichter lassen dir keine Ruhe. Die Augen der Toten.
War Gail Yeager eine von ihnen?
Rizzoli betrachtete ihre Hände, die Narbenwülste, die beide Handflächen entstellten wie verheilte Kreuzigungsmale. Immer, wenn es draußen kalt und feucht war, schmerzten ihre Hände – eine quälende Erinnerung an das, was Warren Hoyt ihr vor einem Jahr angetan hatte, an dem Tag, an dem er seine Klinge in ihr Fleisch gesenkt hatte. Die alten Wunden taten ihr auch jetzt weh, aber diesmal konnte sie es nicht auf das Wetter schieben. Nein, es lag an dem, was sie heute in Newton gesehen hatte. Das gefaltete Nachthemd. Die fächerförmigen Blutspritzer an der Wand. Sie hatte einen Raum betreten, in dem selbst die Luft noch vom Entsetzen gesättigt schien, und sie hatte Warren Hoyts unheilvolle Präsenz gespürt.
Das war natürlich unmöglich. Hoyt saß im Gefängnis, genau dort, wo er hingehörte. Und doch – wenn sie an dieses Haus in Newton dachte, überlief es sie eiskalt, so wohlbekannt war ihr das Szenario des Schreckens erschienen.
Sie war versucht, Thomas Moore anzurufen, mit dem sie bei der Aufklärung der Hoyt-Morde zusammengearbeitet hatte. Er kannte die Einzelheiten ebenso gut wie sie, und er wusste, wie schwer es war, sich aus dem Netz der Angst zu befreien, das Hoyt um sie alle gesponnen hatte. Aber nach Moores Heirat hatte sein Leben eine andere Richtung genommen als das ihre. Es war nun einmal sein neues Glück, was zwischen ihm und Rizzoli stand. Glückliche Menschen leben in einer eigenen Welt; sie atmen eine andere Luft, und für sie scheint das Gesetz der Schwerkraft nicht zu gelten. Die Veränderung in ihrem Verhältnis mochte Moore nicht bewusst sein, doch Rizzoli hatte sie gespürt; sie trauerte dem Verlorenen nach und schämte sich zugleich, weil sie ihm sein Glück neidete. Und sie schämte sich auch für ihre Eifersucht auf die Frau, die Moores Herz erobert hatte. Vor wenigen Tagen erst hatte sie seine Postkarte aus London bekommen, wo er mit Catherine Urlaub machte. Nur ein kurzer Gruß, auf die Rückseite einer Ansichtskarte des Scotland-Yard-Museums gekritzelt, ein paar Zeilen, in denen er Rizzoli wissen ließ, dass sie einen angenehmen Aufenthalt hatten und in ihrer Welt alles in Ordnung war. Wenn sie an diese Karte mit ihrer vor Optimismus überschäumenden Botschaft dachte, dann war ihr klar, dass sie ihn nicht mit diesem Fall belästigen durfte. Sie durfte nicht zulassen, dass Warren Hoyts Schatten das Leben der beiden noch einmal trübte.
So saß sie nur da und hörte den Verkehr unten auf der Straße vorüberrauschen – den Lärm, der die vollkommene Stille in ihrer Wohnung nur noch zu verstärken schien. Sie blickte sich in ihrem karg möblierten Wohnzimmer um, sah die kahlen Wände, an denen sie immer noch kein einziges Bild aufgehängt hatte. Die einzige Dekoration – falls das die richtige Bezeichnung war – bestand aus einem Stadtplan von Boston, der über ihrem Esstisch hing. Vor einem Jahr war die Karte mit farbigen Stiften gespickt gewesen, die sämtliche Morde des Chirurgen markierten. So begierig auf Anerkennung war sie gewesen, so sehr hatte sie sich gewünscht, dass ihre männlichen Kollegen sie als ihresgleichen akzeptierten, dass die Jagd nach dem Killer ihr ganzes Leben ausgefüllt hatte – bis in ihre Wohnung hinein, wo sie ihre Mahlzeiten mit der blutigen Spur des Killers vor Augen eingenommen hatte.
Jetzt waren die Stifte verschwunden, die das Revier des Chirurgen bezeichnet hatten, doch der Stadtplan war noch da und wartete auf die Markierungen, mit denen sie die Streifzüge eines neuen Killers nachzeichnen würde. Sie fragte sich, was das wohl über sie selbst aussagte, welche beklagenswerte Deutung es zuließ, dass auch nach zwei Jahren in dieser Wohnung ihr einziger Wandschmuck dieser Stadtplan von Boston war. Mein Revier, dachte sie.
Meine Welt.
Im Haus der Yeagers brannte kein Licht, als Rizzoli um zehn nach neun in die Auffahrt einbog. Sie war die Erste, und da sie keinen Schlüssel zu dem Haus hatte, blieb sie im Wagen sitzen, während sie auf die anderen wartete. Die Fenster hatte sie heruntergedreht, um die kühle Nachtluft hereinzulassen. Das Haus stand in einer ruhigen Sackgasse, und auch bei den Nachbarn zur Linken und zur Rechten war alles dunkel. Das würde ihnen an diesem Abend zum Vorteil gereichen, da zu viele zusätzliche Lichtquellen ihre Suche nur behindern würden. Aber in diesem Augenblick, da sie allein in ihrem Wagen saß und zu dem Haus des Schreckens hinübersah, sehnte sie sich nach hellem Licht und menschlicher Gesellschaft. Die Fenster des Yeagerschen Hauses starrten sie an wie die glasigen Augen einer Leiche. Die Schatten um sie herum nahmen immer neue, unheilvolle Formen an. Sie nahm ihre Waffe aus der Handtasche, entsicherte sie und legte sie auf ihren Schoß. Dann erst wurde sie ein wenig ruhiger.
Im Rückspiegel tauchten Scheinwerfer auf. Sie drehte sich um und sah zu ihrer Erleichterung den Transporter der Spurensicherung hinter ihr einparken. Sogleich steckte sie die Pistole wieder ein.
Ein junger Mann mit breiten, muskulösen Schultern stieg aus dem Van und kam auf ihren Wagen zu. Als er sich bückte, um durch das Fahrerfenster zu schauen, sah sie seinen goldenen Ohrring aufblitzen.
»Hallo, Rizzoli«, sagte er.
»Hallo, Mick. Danke, dass Sie gekommen sind.«
»Nette Gegend.«
»Warten Sie ab, bis Sie das Haus gesehen haben.«
Wieder flackerten Scheinwerfer in der Einfahrt auf. Korsak war eingetroffen.
»Alle Mann an Bord«, sagte sie. »Dann wollen wir mal.«
Korsak und Mick kannten sich noch nicht. Als Rizzoli sie einander vorstellte, bemerkte sie, wie Korsak den Ohrring des Spurensicherungs-Experten anstarrte und einen Moment zögerte, bevor er Mick die Hand reichte. Sie konnte beinahe sehen, wie es in Korsaks Gehirn arbeitete. Ohrring. Gewichtheber-Figur. Der ist bestimmt schwul.
Mick machte sich daran, seine Geräte auszuladen. »Ich habe das neue Mini-Crimescope 400 mitgebracht«, sagte er. »Vierhundert-Watt-Bogenlampe. Dreimal heller als die alte Dreihundertfünfzig-Watt GE. Die intensivste Lichtquelle, mit der wir je gearbeitet haben. Das Ding hier ist noch heller als eine Fünfhundert-Watt-Xenonlampe.« Er sah Korsak an. »Würde es Ihnen was ausmachen, die Kameraausrüstung zu tragen?«
Bevor Korsak antworten konnte, hatte Mick dem Detective schon einen Aluminiumkoffer in die Hand gedrückt und sich wieder zum Wagen umgedreht, um das nächste Ausrüstungsstück herauszunehmen. Korsak stand einen Moment lang wie vom Donner gerührt da, mit dem Kamerakoffer in der Hand und einem ungläubigen Ausdruck auf dem Gesicht. Dann drehte er sich um und ging steif auf das Haus zu.
Als Rizzoli und Mick an der Haustür ankamen, beladen mit diversen Kisten und Behältern, die das Crimescope sowie Stromkabel und Schutzbrillen enthielten, hatte Korsak im Haus bereits das Licht eingeschaltet. Die Tür stand halb offen. Sie zogen ihre Überschuhe an und gingen hinein.
Wie zuvor Rizzoli blieb auch Mick im Eingang kurz stehen und blickte sich staunend in der hohen, offenen Diele um.
»Oben sind Buntglasfenster«, sagte Rizzoli. »Sie sollten es erst mal bei Tag sehen, wenn die Sonne hereinscheint.«
Aus dem Wohnzimmer tönte Korsaks gereizte Stimme: »Fangen wir jetzt vielleicht mal an, oder was?«
Mick warf Rizzoli einen Blick zu, den man nur mit Was ist denn das für ein Arschloch? übersetzen konnte, und sie antwortete mit einem Achselzucken. Sie gingen zusammen den Flur entlang.
»Das ist das Zimmer«, sagte Korsak. Er hatte inzwischen ein frisches Hemd angezogen, aber auch dieses war bereits von Schweißflecken gezeichnet. Er stand da, das Kinn emporgereckt, die Beine gespreizt, wie ein missmutiger Kapitän auf dem Deck eines Meutererschiffs. »Wir konzentrieren uns auf diesen Bereich des Fußbodens.«
Das Blut hatte nichts von seiner verstörenden Wirkung eingebüßt. Während Mick seine Geräte aufbaute, den Netzstecker anschloss und die Kamera auf dem Stativ festmontierte, wurde Rizzolis Blick wieder von der Wand angezogen. Auch wenn man noch so fleißig schrubbte, dieses stumme Zeugnis der Gewalt würde man nie ganz auslöschen können. Die biochemischen Spuren würden immer zurückbleiben wie ein geisterhafter Fingerabdruck.
Aber es war nicht Blut, wonach sie heute Abend suchten. Sie suchten nach etwas, das viel schwerer zu erkennen war, und dazu benötigten sie eine besondere Lichtquelle, die stark genug war, um das sichtbar zu machen, was ihren Augen jetzt noch verborgen blieb.
Rizzoli wusste, dass Licht nichts anderes war als elektromagnetische Energie, die sich in Wellen fortpflanzte. Das für das menschliche Auge sichtbare Licht hat eine Wellenlänge von 400 bis 700 Nanometern. Kürzere Wellenlängen – im ultravioletten Bereich – können wir nicht mehr wahrnehmen. Wenn aber UV-Licht auf gewisse natürliche und künstliche Substanzen fällt, können Elektronen in diesen Materialien angeregt werden, wodurch sichtbares Licht freigesetzt wird. Dieser Prozess ist als Fluoreszenz bekannt. Mit UV-Licht können Körperflüssigkeiten, Knochensplitter, Haare und Fasern sichtbar gemacht werden. Deshalb hatten sie das Mini-Crimescope angefordert. Unter seiner UV-Lampe würden sie vielleicht eine ganze Reihe neuer Spuren entdecken können.
»So, dann kann es losgehen«, sagte Mick. »Jetzt müssen wir nur noch diesen Raum so weit wie möglich abdunkeln.« Er wandte sich zu Korsak. »Könnten Sie schon mal das Licht im Flur ausmachen, Detective Korsak?«
»Moment mal. Was ist mit den Schutzbrillen?«, fragte Korsak. »Dieses UV-Licht wird doch meine Augen ruinieren, oder nicht?«
»Bei den Wellenlängen, die ich benutze, ist es nicht besonders schädlich.«
»Ich hätte trotzdem gerne eine Brille.«
»Sie sind in dem Koffer dort. Eine für jeden von uns.«
Rizzoli sagte: »Ich übernehme das mit dem Flurlicht.« Sie ging hinaus und knipste das Licht aus. Als sie zurückkam, sah sie, dass Korsak und Mick immer noch den größtmöglichen Abstand voneinander einhielten – als ob sie Angst vor irgendwelchen ansteckenden Krankheiten hätten.
»Also, auf welche Bereiche konzentrieren wir uns?«, fragte Mick.
»Fangen wir auf dieser Seite an, wo das Opfer gefunden wurde«, antwortete Rizzoli. »Und dann immer weiter, bis das ganze Zimmer abgedeckt ist.«
Mick schaute sich um. »Da drüben haben wir einen beigefarbenen Teppich, der dürfte vermutlich fluoreszieren. Und das weiße Sofa da wird im UV-Licht auch ziemlich stark leuchten. Ich will Sie nur warnen; es wird schwierig sein, vor einem solchen Hintergrund irgendetwas zu erkennen.« Er warf einen Blick auf Korsak, der bereits seine Schutzbrille aufgesetzt hatte und nun wie irgendein hoffnungsloser, alternder Versager aussah, der glaubt, mit seiner Wrap-around-Sonnenbrille besonders cool auszusehen.
»Gut, jetzt machen Sie das Licht hier im Zimmer aus«, sagte Mick. »Wollen mal sehen, wie dunkel wir es kriegen können.«
Korsak drückte auf den Schalter, und sie standen im Dunkeln. Zwar drang durch das große, vorhanglose Fenster ein wenig Sternenlicht ein, aber der Mond schien nicht, und die Bäume im Garten verdeckten die wenigen Lichter der umstehenden Häuser.
»Nicht schlecht«, meinte Mick. »Damit kann ich arbeiten. Nicht wie an manchen anderen Tatorten, wo ich mit einer Decke über dem Kopf herumkriechen musste. Wussten Sie, dass schon an Darstellungssystemen gearbeitet wird, die auch bei Tageslicht eingesetzt werden können? Eines schönen Tages werden wir nicht mehr wie Blinde in einem Tunnel herumstolpern müssen.«
»Könnten wir jetzt vielleicht mal zur Sache kommen?«, fuhr Korsak ungehalten dazwischen.
»Ich dachte, Sie interessieren sich vielleicht ein bisschen für die technischen Aspekte.«
»Ein anderes Mal, okay?«
»Meinetwegen«, erwiderte Mick gleichmütig.
Rizzoli setzte ihre Schutzbrille auf, als das blaue Licht des Crimescope aufleuchtete. Ringsum tauchten fluoreszierende Formen aus der Dunkelheit auf, und ein gespenstisches Leuchten erfüllte den Raum. Wie Mick vorausgesagt hatte, reflektierten der Teppich und das Sofa das Licht besonders stark. Der bläuliche Lichtstrahl richtete sich auf die Wand gegenüber, an der Dr. Yeagers Leiche gelehnt hatte, und auf der jetzt merkwürdige schimmernde Striche auftauchten.
»Irgendwie hübsch, nicht wahr?«, meinte Mick.
»Was ist das?«, fragte Korsak.
»Haare, die in dem Blut festkleben.«
»O ja, das ist wirklich sehr hübsch.«
»Richten Sie es auf den Boden«, sagte Rizzoli. »Da müsste es sein.«
Mick lenkte den UV-Strahl nach unten, und sofort leuchteten zu ihren Füßen unzählige neue Fasern und Haare auf – winzige Spuren, die den Staubsaugern des Spurensicherungstrupps entgangen waren.
»Je intensiver die Lichtquelle, desto stärker die Fluoreszenz«, sagte Mick, während er den Boden absuchte. »Das ist das Tolle an diesem Gerät. Mit seinen vierhundert Watt ist es so hell, dass es alles erfasst. Das FBI hat gleich einundsiebzig von den Dingern gekauft. Es ist so kompakt, dass man es sogar als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen kann.«
»Sie sind wohl ein ziemlicher Technik-Freak«, meinte Korsak.
»Ich stehe nun mal auf coole Apparaturen. Ich war auf der technischen Hochschule.«
»Wirklich?«
»Warum überrascht Sie das so?«
»Ich dachte, Typen wie Sie interessieren sich nicht für technische Dinge.«
»Typen wie ich?«
»Na, ich meine, der Ohrring und so. Sie wissen schon.«
Rizzoli seufzte. »Voll ins Fettnäpfchen…«
»Was denn?«, entgegnete Korsak. »Ich mache diese Leute doch nicht runter oder so was. Ich habe ganz einfach festgestellt, dass nicht viele von ihnen sich für Technik und Naturwissenschaften interessieren. Sondern eher für Theater, Kunst und solche Dinge. Ich persönlich finde das gut. Wir brauchen doch schließlich Künstler.«
»Ich habe an der University of Massachusetts studiert«, erklärte Mick, der Korsak den Lapsus gar nicht übel zu nehmen schien. Er suchte weiter den Fußboden ab. »Elektrotechnik.«
»Was Sie nicht sagen. Elektriker verdienen ja gar nicht so schlecht.«
»Äh, das ist nicht ganz dasselbe Berufsbild.«
Sie rückten weiter in halbkreisförmigen Bewegungen vor. Das UV-Licht ließ immer wieder neue Haare, Fasern und andere, undefinierbare Partikel aufleuchten. Plötzlich wurde der Boden blendend hell.
»Der Teppich«, sagte Mick. »Ich weiß nicht, was das für Fasern sind, aber sie fluoreszieren jedenfalls tierisch stark. Vor dem Hintergrund werden wir nicht viel erkennen können.«
»Suchen Sie ihn trotzdem genau ab.«
»Der Couchtisch ist im Weg. Könnten Sie den mal zur Seite stellen?«
Rizzoli streckte die Hände nach dem Tisch aus, den sie nur als geometrisches Muster vor dem fluoreszierenden weißen Hintergrund des Teppichs erkennen konnte. »Nehmen Sie das andere Ende, Korsak«, sagte sie.
Nachdem sie den Couchtisch weggetragen hatten, erschien der Teppich als bläulich-weiß schimmerndes Oval zu ihren Füßen.
»Wie sollen wir da irgendetwas erkennen?«, fragte Korsak. »Das ist ja, als ob man eine Glasscheibe sucht, die in einem Wasserbecken schwimmt.«
»Glas schwimmt nicht«, sagte Mick.
»Ach ja, hab ganz vergessen, dass Sie ja der Experte sind. Übrigens, wofür ist Mick eigentlich die Abkürzung? Für Micky Maus?«
»Nehmen wir uns das Sofa vor«, schaltete Rizzoli sich ein.
Mick richtete die Kamera neu aus. Der Sofabezug leuchtete ebenfalls unter dem UV-Licht, doch es war eine weichere Fluoreszenz, wie Schnee im Mondlicht. Langsam ließ er den Strahl über die Polster gleiten, dann über die Sofakissen, ohne jedoch irgendwelche verdächtigen Flecken zu Tage zu fördern. Nur ein paar lange Haare und Staubpartikel waren zu sehen.
»Das waren sehr reinliche Leute«, bemerkte Mick. »Keine Flecken, und auch nur sehr wenig Staub. Ich wette, dieses Sofa ist nagelneu.«
Korsak schnaubte verächtlich. »Muss angenehm sein, so ein Leben. Das letzte Mal, dass ich mir ein Sofa gekauft habe, war nach unserer Hochzeit.«
»Okay, dort hinten ist noch ein Stück Fußboden. Machen wir da weiter.«
Rizzoli kollidierte im Dunkeln mit Korsak, und sein käsiger Schweißgeruch stieg ihr in die Nase. Er atmete geräuschvoll, als ob er ein Problem mit den Nebenhöhlen hätte, und in der Dunkelheit klang sein Geschniefe noch lauter. Verärgert wich sie ihm aus und stieß prompt mit dem Schienbein gegen den Couchtisch.
»Mist!«
»He, passen Sie auf, wo Sie hintreten!«, sagte Korsak.
Sie verkniff sich eine Erwiderung; die Atmosphäre in diesem Zimmer war ohnehin schon angespannt genug. Stattdessen bückte sie sich, um sich das Schienbein zu reiben, doch die plötzliche Bewegung machte sie schwindlig, und sie verlor kurz die Orientierung. Sie musste in die Hocke gehen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ein paar Sekunden lang kauerte sie so in der Dunkelheit und hoffte nur, dass Korsak nicht über sie fallen würde; er hätte sie mit seinem Gewicht schier zerquetscht. Sie konnte hören, wie die beiden Männer ein paar Schritte von ihr entfernt werkelten.
»Das Kabel hat sich verheddert«, sagte Mick. Der Strahl des Crimescopes schwenkte plötzlich in Rizzolis Richtung, als er sich umdrehte, um die Schnur zu entwirren.
Als der Lichtkegel direkt vor Rizzoli über den Teppich huschte, erstarrte sie. Dort, umrahmt von der Fluoreszenz der Teppichfasern, erblickte sie einen dunklen, unregelmäßig geformten Fleck, kleiner als eine Zehn-Cent-Münze.
»Mick«, sagte sie.
»Können Sie den Couchtisch auf Ihrer Seite mal kurz anheben? Ich glaube, das Kabel hat sich um das Bein gewickelt.«
»Mick!«
»Was denn?«
»Kommen Sie mit der Kamera hierher. Leuchten Sie den Teppich an. Hier, direkt vor mir.«
Mick kam auf sie zu. Korsak schloss sich ihm an; sie hörte seinen schnaufenden Atem näher kommen.
»Richten Sie es auf meine Hand«, sagte sie. »Ich habe den Finger an die Stelle gelegt.«
Im nächsten Moment war der Teppich in bläuliches Licht getaucht, und ihre Hand erschien als schwarze Silhouette vor dem fluoreszierenden Hintergrund.
»Da«, sagte sie. »Was ist das?«
Mick ging neben ihr in die Knie. »Irgendein Fleck. Ich mache am besten ein Foto davon.«
»Aber dieser Fleck ist ja dunkel«, wandte Korsak ein. »Ich dachte, wir suchen nach einer fluoreszierenden Substanz.«
»Wenn der Hintergrund stark fluoreszierend ist, so wie diese Teppichfasern, dann können im Kontrast dazu Körperflüssigkeiten tatsächlich dunkel erscheinen. Dieser Fleck könnte alles Mögliche sein. Wir werden die Laboruntersuchung abwarten müssen.«
»Was denn – sollen wir jetzt etwa ein Stück aus diesem schönen Teppich rausschneiden, nur weil wir einen alten Kaffeefleck oder so was gefunden haben?«
Mick schwieg einen Moment. »Es gibt noch einen Trick, den wir ausprobieren könnten.«
»Welchen?«
»Ich werde die Wellenlänge des Geräts verändern. Ich reduziere sie auf kurzwelliges UV-Licht.«
»Und was bewirkt das?«
»Das ist echt cool – wenn es funktioniert.«