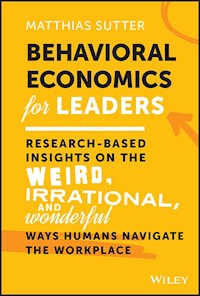Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: Carl Hanser
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie tickt mein Gegenüber? Im Berufsleben ist es entscheidend, mit anderen Menschen „zu können“ und ihre typischen Verhaltensweisen zu kennen. Das gilt auf allen Hierarchieebenen und in allen Bereichen der Zusammenarbeit und ist die Basis für persönlichen und unternehmerischen Erfolg. Dieses Buch präsentiert aktuelle verhaltensökonomische Erkenntnisse, um den „menschlichen Faktor“ im Berufsleben besser zu verstehen und um ein erfolgreiches Miteinander zu ermöglichen. Es liefert eine umfassende Perspektive auf das „große Ganze“, indem es analysiert, wie Menschen „ticken“, wie sie auf Anreize (monetärer oder nicht-monetärer Natur) reagieren und was das für das Miteinander – oder auch Gegeneinander – im Beruf bedeutet. Die moderne verhaltensökonomische Forschung ist wie keine andere Forschungsrichtung geeignet, diesen Fragen nachzugehen und Antworten zu liefern. Der Autor, laut FAZ-Ranking einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, forscht seit 20 Jahren im Bereich der Verhaltensökonomie und nimmt Sie mit auf eine Reise, welche Faktoren vom Berufseinstieg bis zur Führungsposition für beruflichen Erfolg wichtig sind. - Überraschende Erkenntnisse mit Aha-Effekt - Das Gegenüber verstehen und Stolperfallen vermeiden - Wissenschaftlich fundiert, zugleich wohlproportioniert und leicht verständlich Jetzt auch als Hörbuch in den gängigen Shops erhältlich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Sutter
Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt
55 verhaltensökonomische Erkenntnisse
Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt geprüft und getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht.
Ebensowenig übernehmen Autor und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigen auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf vorheriger Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2023 Carl Hanser Verlag, Münchenwww.hanser-fachbuch.deLektorat: Lisa Hoffmann-BäumlHerstellung: Carolin BenedixSatz: Eberl & Koesel Studio, KemptenCoverrealisation: Max KostopoulosTitelmotiv: © Matthias Sutter, Lisa Hoffmann-Bäuml und Max Kostopoulos, unter Verwendung von Grafiken von © gettyimages.de/enisaksoyHubert & Co. GmbH und Co. KG BuchPartner, Göttingen
Print-ISBN: 978-3-446-47864-0E-Book-ISBN: 978-3-446-47984-5ePub-ISBN: 978-3-446-47917-3
Mit Freude – und großer Dankbarkeit für die vielen positiven Rückmeldungen zur 1. Auflage – schreibe ich dieses Vorwort zur 2. Auflage meines Buches über den menschlichen Faktor im Berufsleben. Beim Erscheinen der 1. Auflage vor einem Jahr wurde ich manchmal gefragt, ob es nicht trivial wäre, dass unser aller Berufsleben von der Zusammenarbeit mit anderen Menschen und deren Fähigkeiten und Eigenheiten abhängt. Meine Antwort – damals wie heute – lautet, dass ein gutes Verständnis menschlicher Verhaltensmuster für den Erfolg im Berufsleben sehr förderlich ist und dass es nach wie vor in vielen Unternehmen ein zu geringes Bewusstsein für die Bedeutung des menschlichen Faktors gibt. Der Erfolg der 1. Auflage und die zahlreichen Berichte in den Medien – beispielsweise das FAZ-Interview mit Johannes Pennekamp am Erscheinungstag oder die Radiosendung „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl – machen mich optimistisch, dass die verhaltensökonomischen Einsichten über menschliches Verhalten zunehmend auch im Berufsleben Beachtung finden. Ich hoffe, dass auch die 2. Auflage dieses Buches einen Beitrag dazu leisten kann.
Aufgrund von Anregungen bei Vorträgen und Diskussionen über das Buch habe ich für die zweite Auflage fünf neue Kapitel hinzugefügt. Sie behandeln aktuelle Themen, auf die mich viele Zuhörer und Leser angesprochen haben. Wie können Führungskräfte Meetings produktiver machen? Verlieren wir durch die vielen Videokonferenzen im Homeoffice unsere Kreativität? Spielt es etwa für die eigene Arbeitsleistung eine Rolle, wie hoch jemand das Gehalt der Führungskraft einschätzt? Wie verändern sich Arbeitsnormen, wenn Arbeitnehmer für Selbstverständlichkeiten – wie die Anwesenheit – bezahlt werden? Zuletzt habe ich noch ein Kapitel mit der provokanten Aussage „Rauchen hilft Ihrer Karriere (aber sicher nicht der Gesundheit)“ in die neue Auflage aufgenommen, weil es einmal mehr die Bedeutung des menschlichen Faktors im Berufsleben demonstriert.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe und vor allem hilfreiche Einsichten für die berufliche Karriere. Viel Erfolg, alles Gute und herzlichen Dank für Ihr Interesse an den nun 55 verhaltensökonomischen Erkenntnissen, auf die es im Berufsleben ankommt!
Matthias Sutter
Innsbruck, Bonn und Köln, Juni 2023
Dieses Buch widme ich meiner Frau Heidrunund unseren beiden Töchtern Charlotte und Constanze.
Wie verhalten wir uns im beruflichen Umfeld? Ist beispielsweise die Körpergröße wirklich für mehr Gehalt verantwortlich? Fordern Frauen seltener Gehaltserhöhungen? Oder werfen wir alle unsere moralischen Bedenken über Bord, wenn nur genügend Geld lockt? Wie „tickt“ der Mensch?
Im Berufsleben ist es entscheidend, mit anderen Menschen „zu können“, mit ihnen erfolgreich zusammenzuarbeiten, sie zu verstehen und ihre typischen Verhaltensweisen zu kennen. Das gilt auf allen Hierarchieebenen und allen Stufen des Berufslebens und ist die Basis für persönlichen und unternehmerischen Erfolg.
Dieses Buch basiert auf Einsichten und Erkenntnissen der Verhaltensökonomie, einer relativ neuen Disziplin in der modernen Wirtschaftswissenschaft. Die Verhaltensökonomie nutzt empirische Methoden, um die Motive für menschliches Handeln zu ergründen und die daraus folgenden Entscheidungen besser erklären zu können. Die Verhaltensökonomie bildet den idealen methodischen Rahmen, um verschiedenste – oft überraschende – Aspekte des Berufslebens besser verstehen zu können. Das betrifft sowohl Aspekte, die für Berufseinsteiger wichtig sind – wie etwa die Frage, inwieweit es eine Rolle spielt, ob man das Vorstellungsgespräch für eine offene Stelle als erste oder als letzte Kandidatin führt – als auch Themen, die für Führungskräfte bis zur Vorstandsebene relevant sind – etwa warum soziale Fähigkeiten eine immer größere Rolle im Berufsleben spielen. Auch geht es um kontroverse Fragestellungen, etwa ob Quotenregelungen in Unternehmen berechtigt sind, ob man Gehälter veröffentlichen sollte oder ob sogenannte Whistleblower (die Missstände in Unternehmen aufdecken) Helden oder Verräter sind.
Die Verhaltensökonomie kann auf diese Fragen Antworten geben, weil „der menschliche Faktor“ der primäre Untersuchungsgegenstand dieser Forschungsrichtung ist. Methodisch basieren verhaltensökonomische Studien vor allem auf ökonomischen Experimenten. In einem wirtschaftswissenschaftlichen Experiment treffen reale Menschen unter klar festgelegten Bedingungen Entscheidungen, die dann reale Konsequenzen (etwa in Form von Geld oder Prestige oder anderen immateriellen Belohnungen) haben. Wenn man die Bedingungen systematisch variiert, kann man erkennen, wovon menschliches Verhalten abhängt und wie Menschen auf unterschiedliche Bedingungen reagieren.
Viele der in diesem Buch beschriebenen Erkenntnisse basieren auf sogenannten Feldexperimenten. Das sind Studien, die im Rahmen von normalen Arbeitsprozessen durchgeführt wurden. Beispielsweise beschreibe ich in Kapitel 25 ein Feldexperiment, bei dem wir ein Call-Center gemietet und dafür ungefähr 200 Personen als Mitarbeiter eingestellt haben. Neben Feldexperimenten spielen sogenannte Laborexperimente in der Verhaltensökonomie eine große Rolle. Solche Experimente werden üblicherweise in Computerlabors durchgeführt. Meist nehmen daran Studierende teil, die in Abhängigkeit von ihren Entscheidungen bezahlt werden. Auch wenn Feldexperimente als realitätsnäher gelten, stellen Laborexperimente eine unverzichtbare Ergänzung dar, um menschliches Verhalten quasi unter der Lupe studieren zu können. Beispielsweise beschäftigt sich Kapitel 15 mit einer meiner Studien zum Einfluss verschiedenster Quotenregelungen auf die Wettbewerbsbereitschaft von Frauen.
Sowohl in Feld- als auch Laborexperimenten geht es immer um die Frage, wie menschliches Verhalten auf (monetäre und nichtmonetäre) Anreize reagiert. Darum geht es auch im Berufsleben vom Anfang bis zum Ende. Dementsprechend spanne ich einen Bogen vom Berufseinstieg und seinen Stolperfallen, über die Bestimmungsgründe für beruflichen Erfolg bis zum Aufstieg auf den „Chefsessel“.
All diese Abschnitte des Berufslebens habe ich in den vergangenen über 25 Jahren selbst durchlebt und manchmal auch durchlitten und sie stellen auch seit über 20 Jahren einen Schwerpunkt meiner verhaltensökonomischen Forschung dar. Dabei gewann ich häufig überraschende Einsichten, die meinen Erwartungen widersprachen (etwa über die Wirkung von Quotenregelungen). Genau deshalb aber liebe ich dieses Forschungsgebiet, weil ich meine Erwartungen – und manchmal auch Vorurteile – mit empirischen Daten überprüfen und gegebenenfalls revidieren kann.
Als ich mich vor über 25 Jahren erstmals auf eine Stelle als studentische Hilfskraft an der Universität Innsbruck bewarb, führte mich mein Weg zunächst in eine Buchhandlung, um mir Fachliteratur zu den Themen „Wie verfasse ich einen Lebenslauf?“ und „Wie trete ich bei einem Vorstellungsgespräch möglichst überzeugend auf?“ zuzulegen. Als ich vor wenigen Jahren als Direktor an ein Max-Planck-Institut mit fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berufen wurde, griff ich unter anderem zu Büchern über effiziente Mitarbeiterführung und Leitfäden für Mitarbeitergespräche.
In beiden Fällen haben mir diese Ratgeber zwar geholfen, hatten aber aus meiner Sicht meist einen eingeschränkten, manchmal sogar einseitigen Blickwinkel. Was mir damals fehlte, war der Blick auf das „große Ganze“. Für den Berufsanfänger wären das Einblicke in verschiedenste Aspekte und Möglichkeiten des Berufs gewesen, wie etwa die Fragen, welche Qualitäten ein Wissenschaftler mitbringen sollte oder wohin der berufliche Weg führen kann und welche Möglichkeiten er bietet. Heute wiederum interessiert mich, da ich viel mit jungen Berufsanfängern zu tun habe, neben meinen Führungsaufgaben auch sehr, welche Anforderungen der Arbeitsmarkt an junge Leute stellt und welche Faktoren beim Berufseinstieg oder Berufswechsel wichtig sind.
Es fehlte mir bei den gängigen Ratgebern zum Berufsleben so etwas wie die große Klammer, die Einsicht, welche Faktoren im Berufsleben wirklich wichtig sind, und zwar unabhängig vom Lebensalter – also für den Berufseinsteiger ebenso wie für den knapp vor dem Pensionsantritt stehenden Mitarbeiter, für den Manager auf der mittleren Ebene ebenso wie für die Vorständin, für Arbeitnehmer genauso wie Arbeitgeber – und jeweils Frauen und Männer gleichermaßen in all diesen verschiedenen Rollen. Diese große Klammer ist in meinen Augen das, was ich in diesem Buch als den „menschlichen Faktor“ bezeichne, also der nur auf den ersten Blick triviale Umstand, dass es im Berufsleben immer um den Menschen geht. Menschliches Verhalten ist aber sehr komplex und manchmal erst auf den zweiten Blick zu verstehen.
Verhaltensökonomen rund um den Globus haben auf die Frage, wie der Mensch „tickt“, in den vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten eine reiche Fülle an Erkenntnissen zu Tage gefördert. Ich möchte Sie als Leserin und Leser an diesen Erkenntnissen teilhaben lassen und hoffe, dass Sie sie genauso spannend finden wie ich, manchmal überraschend, aber in jedem Fall zum Nachdenken anregend!
Bevor es losgeht, noch eine kurze „Gebrauchsanweisung“ für dieses Buch: Es umfasst insgesamt 55 Kapitel. Zwar haben die Kapitel eine logische Abfolge, nämlich vom Berufseinstieg bis zum Vorstandsvorsitz, jedoch präsentiert jedes Kapitel eine zentrale Einsicht, die auch unabhängig von den anderen Kapiteln gelesen und verstanden werden kann. Viele der folgenden 55 Kapitel beginnen mit kurzen Geschichten zur Illustration des jeweiligen Themas. Diese Geschichten sind meist fiktiver Natur. Um aber fiktive Charaktere von realen Personen unterscheiden zu können, haben die fiktiven Charaktere immer nur Vornamen (Peter oder Claudia), während reale Personen und vor allem Autoren von Studien immer mit Vor- und Zunamen genannt werden (etwa Ernst Fehr von der Universität Zürich oder Muriel Niederle von der Stanford University). Die einleitenden Geschichten werden dann im Lichte aktueller Forschungsergebnisse interpretiert, um daraus empirisch fundierte Schlussfolgerungen für den Berufsalltag ziehen zu können.
Der besseren Lesbarkeit wegen habe ich nicht durchgehend beide Geschlechterbezeichnungen – etwa Manager und Managerin – verwendet. In allen Fällen sind immer beide Geschlechter gemeint, außer in den Beispielen, wo es explizit um Geschlechterunterschiede geht. Dort wird dann auch sprachlich klar zwischen Frauen und Männern unterschieden.
Und nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, von jungen Berufseinsteigern über erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zu Vorstandsvorsitzenden eine gewinnbringende Lektüre.
Matthias Sutter
Bonn und Innsbruck, Februar 2022
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Abschnitt IVom Berufseinstieg und seinen Stolperfallen
1. Von der Bewerbung zum Vorstellungsgespräch – ein Weg mit unerwarteten Hindernissen
2. Der Vorstellungstermin – Frauen haben es schwerer
3. Lieber „Sutter“ als „Anfang“? Warum es günstig sein kann, im Alphabet hinten zu stehen
4. Unternehmen machen systematische Fehler beim Einstellungsprozess – aber sind Maschinen besser?
5. Warum viele Firmen offene Stellen durch Empfehlungen bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzen
Abschnitt IIBerufswechsel und Wiedereinstieg
6. Treue – ein Wert mit Gültigkeit
7. Durchhaltevermögen in einem anstrengenden Beruf
8. Arbeitssuche und Geduld
9. Einen neuen Job finden – Nudging in der Arbeitsvermittlung
Abschnitt IIIPersonalauswahl und Unternehmenserfolg
10. Start-ups und Personalauswahl
11. Mit Geduld zum Unternehmenserfolg
12. Personalauswahl und Kundenvertrauen
13. Homeoffice – zwischen Licht und Schatten
14. Vermindert Homeoffice die Kreativität aufgrund von Videokonferenzen?
Abschnitt IVWettbewerbsbereitschaft
15. Ein Argument für Quotenregelungen
16. Wettbewerbsbereitschaft, Ausbildung und Berufswahl
17. Zentrale Rolle der Familie
18. Die kulturelle Prägung und Wettbewerbsbereitschaft
Abschnitt VKooperation, Teamwork und Produktivität
19. Gemeinsam ist der Fang höher
20. Der „Mitbestimmungsbonus“
21. Mit gutem Beispiel vorangehen
22. Führung durch Beispiel-Geben
Abschnitt VIFairness und Vertrauen
23. Vertrauen als zentraler Produktionsfaktor
24. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Neue Einsichten zu einem alten Problem
25. Produktivität von Arbeitnehmern und Fairness von Arbeitgebern
26. Fairness und die Zahlungsmoral
Abschnitt VIIProduktivität
27. Auf den Blickwinkel kommt es an: Wie man die Produktivität in Unternehmen steigern, aber auch das Gegenteil bewirken kann
28. Ein Teambonus für die Backstube
29. Wie man in den Wald hineinruft
30. Mission, Motivation und Produktivität
Abschnitt VIIIGehalt
31. Fragen Frauen nicht nach höheren Gehältern?
32. Je größer, desto mehr Gehalt?
33. Gehaltsvergleiche spornen an, aber nicht immer
34. Die erwünschten und unerwünschten (Neben)Wirkungen von Gehaltstransparenz
Abschnitt IXBonuszahlungen
35. Gut gemeint, aber nicht immer gut getroffen
36. Wenn der Bonus für Lehrlinge zum Malus für ihren Einsatz wird
37. Die Grenzen des Homo Oeconomicus
38. Der Einfluss auf die Risikobereitschaft
39. Die dunkle Seite – relative Entlohnung und Sabotage
Abschnitt XMoral in Unternehmen und auf Märkten
40. Von Märkten, Mäusen und Moral
41. Unmoralisches Verhalten: eine Frage von Kosten und Nutzen?
42. Wenn die Moral auf die schiefe Bahn gerät – warum unmoralisches Verhalten schwer zu erkennen sein kann
43. Unternehmensskandale, Whistleblowing und der menschliche Faktor
44. Firmenkultur: Sozialisation mit Konsequenzen
Abschnitt XIEntscheidungen treffen
45. Bessere Entscheidungen bei besserer Bezahlung?
46. In der Hitze des Augenblicks
47. Mit den richtigen Anreizen Entscheidungen lenken
Abschnitt XIILeadership
48. Charisma: Das besondere Etwas?
49. Wie Führungskräfte die Meetingkultur und damit die Arbeitszufriedenheit positiv beeinflussen können
50. Der Wert sozialer Fähigkeiten
51. Menschen managen
52. Rauchen hilft der Karriere (aber sicher nicht der Gesundheit)
Abschnitt XIIICEO oder „Am Gipfel“
53. Was CEOs eigentlich tun
54. Was CEOs von anderen Managern unterscheidet
55. Weibliche CEOs, Gehaltsverteilung und Produktivität
Kompakte Zusammenfassung aller Erkenntnisse – zum Nachschlagen und für Schnellleser
Quellenverzeichnis
Danksagung
Der Autor
Die erste Hürde auf dem Weg zu einem neuen Job besteht in der Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Dabei können sich der Name oder die Attraktivität des Bewerbungsfotos als nachteilig erweisen.
In den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz gibt es eine immer wiederkehrende Diskussion, wie man Bewerbungsverfahren auf dem Arbeitsmarkt fairer machen könnte. Dabei wird schnell mit sehr hehren Worten gefordert, dass jede Bewerberin und jeder Bewerber die gleichen Chancen haben sollte, eine offene Stelle zu bekommen. Wörtlich genommen ist diese Forderung Unsinn. Unternehmen – seien es öffentliche oder private – haben in erster Linie Interesse daran, aus der Menge an Bewerbungen die beste für das Unternehmen auszuwählen. Dass dabei die Ausbildung, bisherige Berufserfahrung und sogenannte Soft Skills – wie Team- und Kommunikationsfähigkeiten oder Führungsqualitäten – eine große Rolle spielen, ist selbstverständlich. Da aber nicht jede Bewerberin und jeder Bewerber im Hinblick auf diese Fähigkeiten gleich sind, ist es gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll, dass alle Bewerberinnen und Bewerber gleiche Chancen haben, sich in einem Bewerbungsverfahren durchzusetzen. Wenn das nämlich so wäre, könnte man gleich mithilfe eines großen Würfels entscheiden, welcher Arbeitnehmer in welchem Unternehmen in welcher Position zu arbeiten hat. Selbst in kommunistischen Planwirtschaften war die Zuteilung von Arbeitskräften auf Unternehmen effizienter organisiert als in einer wörtlich genommenen Vorstellungswelt von gleichen Chancen für alle.
Wenn die öffentliche Diskussion über Fairness in Bewerbungsverfahren trotzdem immer wieder entflammt, dann liegt das daran, dass es einige vermeintlich unbedeutende Aspekte im Rahmen von Bewerbungen gibt, die einen starken Einfluss auf die individuellen Erfolgschancen haben, obwohl sie das bei nüchterner Betrachtung nicht sollten.
Hierzulande ist es beispielsweise gängig, dass der Lebenslauf ein Foto einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers enthält. Das ist nicht überall so. In den USA oder Großbritannien ist es sehr unüblich, bei Bewerbungen ein Foto beizulegen. Warum sollte ein Foto auch eine Rolle spielen?
Um dieser Frage nachzugehen, führten verschiedene Forschungsteams Feldstudien durch, in denen praktisch identische Lebensläufe fiktiver Personen erstellt und diese Lebensläufe dann zusammen mit einem Anschreiben an reale Firmen geschickt wurden, die offene Stellen in öffentlichen Ausschreibungsportalen eingestellt hatten. In Ländern, in denen es üblich ist, einer Bewerbung ein Foto beizulegen, wurden zunächst also identische Lebensläufe kreiert. In der Hälfte der Fälle wurde das Bild einer Person beigefügt, die als „attraktiv“ eingestuft wurde, und in der anderen Hälfte das Bild einer weniger attraktiven Person. Zur Beurteilung der Attraktivität wurden die Fotos üblicherweise mehreren Testpersonen vorgelegt, die die Person auf dem Foto als „unattraktiv“, „durchschnittlich“ oder „attraktiv“ beurteilen sollten. Für die Feldstudien wurden Bilder ausgewählt, bei denen die Testpersonen einstimmig eine der drei Kategorien gewählt hatten. Damit konnte man vergleichen, ob Fotos unterschiedlicher Attraktivität bei sonst gleichen Lebensläufen einen Einfluss darauf haben, wie häufig ein Unternehmen auf eine bestimmte Bewerbung reagiert und den Bewerber bzw. die Bewerberin zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Wenn nur die im Lebenslauf angeführten Qualifikationen eine Rolle spielen würden, sollte das Foto keinen Einfluss haben.
Tatsächlich aber scheint ein attraktives Foto einen Vorteil darzustellen, weil es im Gegensatz zu unattraktiven oder durchschnittlichen Fotos zu häufigeren Einladungen zu Vorstellungsgesprächen führt. Bewerberinnen und Bewerber mit attraktiveren Fotos werden häufiger eingeladen als jene mit durchschnittlichen oder unattraktiven Gesichtern.
Diese Befunde zur Bedeutung des Bewerbungsfotos sind der Grund, warum in Deutschland diskutiert wird, ob Fotos nicht aus Lebensläufen verbannt werden sollten, um bei gleicher Qualifikation Menschen mit unterschiedlichem Aussehen die gleichen Chancen für eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu geben.
Wenn die Beilage eines Fotos (wie in vielen anderen Ländern) abgeschafft würde, bliebe noch der Namen, der ebenfalls einen großen Einfluss hat. Doris Weichselbaumer von der Universität Linz versandte fast 1500 Bewerbungen als Reaktion auf Stellenanzeigen von deutschen Unternehmen. Einmal verwendete sie einen deutschen Namen für die Bewerberin (Sandra Bauer) und einmal einen türkischen (Meryem Öztürk). Beide Versionen hatten dasselbe Foto und denselben Lebenslauf. Die fiktive Frau Bauer wurde in 19 % der Bewerbungen zu einem Gespräch eingeladen, die fiktive Frau Öztürk aber nur in 14 % der Fälle. Wenn in einer dritten Variante die fiktive Frau Öztürk auf dem Foto ein muslimisches Kopftuch trug, sank die Wahrscheinlichkeit für eine Einladung gar auf 4 %. Religiös motivierte Symbole können also starke Nebenwirkungen haben. Ethnische Minderheiten haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Julie Chytilova von der Universität Prag konnte in Studien in Deutschland und der Tschechischen Republik zeigen, dass die Bewerbungsunterlagen von Bewerbern mit Namen von ethnischen Minderheiten signifikant weniger oft vollständig angeschaut wurden als die Unterlagen von Bewerbern mit Namen der ethnischen Mehrheit. Als unmittelbare Konsequenz davon erhielten Mitglieder ethnischer Minderheiten um die Hälfte weniger Einladungen zu einem Vorstellungsgespräch.
Die bisherigen Ergebnisse unterstützen also die Argumente der Befürworter von anonymisierten Bewerbungen, bei denen auf Fotos und sogar den Namen verzichtet wird. Bei gleicher Qualifikation könnten die Verfahren dadurch fairer werden. Dabei wird aber gerne übersehen, dass die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch nur die erste Hürde auf dem Weg zu einem Jobangebot ist. Beim Vorstellungsgespräch lassen sich nämlich Namen, Aussehen und Geschlecht im Regelfall nicht mehr verheimlichen. Die nächste große Hürde stellt also das Vorstellungsgespräch selbst dar.
Wir neigen dazu, uns Ähnliches als positiver einzuschätzen als uns Unähnliches. Was wir als attraktiv einschätzen, beurteilen wir positiver als Unattraktives. Darum reduzieren fremd klingende Namen oder als wenig attraktiv empfundene Bewerbungsbilder die Wahrscheinlichkeit, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Arbeitsmärkten ist noch lange nicht perfekt. Das fängt schon bei den Vorstellungsgesprächen an, bei denen Frauen oft Nachteile haben. Ein Blick hinter den Vorhang im Kulturbetrieb und auf akademische Hierarchien.
Die Violinistin betritt die Bühne und schreitet zur Mitte hin. Der Boden ist mit einem dicken Teppich ausgelegt, sodass ihre Absätze beim Gehen kein Geräusch verursachen. Auf der Bühne ist niemand außer der Violinistin selbst. Der Vorhang zum Zuschauerraum ist zugezogen. Über Lautsprecher kommt die Ansage, mit dem Spiel zu beginnen. Die Frau hat sich für ein Stück von Johann Sebastian Bach entschieden. Konzentriert setzt sie den Bogen an und beginnt. Die Melodie klingt himmlisch. Aber wer hört überhaupt zu?
Hinter dem Vorhang – im Zuschauerraum – sitzen fünf Personen, die aufmerksam auf jeden Ton achten. Sie wissen nicht, wer im Moment hinter dem Vorhang für die offene Stelle einer Violinistin in ihrem Orchester vorspielt, ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelt, ob die Person jung oder alt, ob ihre Hautfarbe weiß oder farbig ist. Da der dicke Teppich auf dem Bühnenboden die Schrittgeräusche schluckt, können sie auch nicht am Klang der Schritte versuchen zu erahnen, ob gerade ein Mann oder eine Frau vorspielt. Die fünf Personen sollen einfach die bestqualifizierte Person – ob männlich oder weiblich – für die freie Stelle finden.
Diese Art der Bewerbung für eine offene Stelle ist heutzutage bei vielen Orchestern auf der ganzen Welt verbreitet. Um Chancengleichheit für Männer und Frauen, Junge und (relativ) Ältere, Weiße oder Farbige herzustellen, findet das Vorspielen „blind“ statt, wie man sagt. Das bedeutet, die Auswahlkommission entscheidet allein aufgrund des Gehörten, wer die offene Stelle bekommen soll. Erhöht das die Chancen von Frauen, eine Stelle zu bekommen?
Erst in den letzten Jahrzehnten hat der Anteil an Frauen in führenden Orchestern – wie den Wiener oder Berliner Philharmonikern oder den New York Philharmonic – kontinuierlich zugenommen. Anhand von Daten über die Besetzungen offener Stellen bei den besten US-amerikanischen Orchestern lässt sich belegen, dass ein „blindes“ Vorspielen substanziell dazu beigetragen hat, dass mehr und mehr Frauen eingestellt wurden. Im Vergleich zu Einstellungsverfahren ohne „blindes“ Vorspielen erhöht die Anonymität beim „blinden“ Vorspielen die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die nächste Runde erreichen, um ca. 50 %. In der letzten Ausscheidungsrunde setzen sich Frauen bei „blindem“ Vorspielen sogar fast doppelt so häufig durch wie ohne „blindes“ Vorspielen. Mit anderen Worten, ein „blindes“ Vorspielen vermeidet Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Im Normalfall sind Vorstellungsverfahren aber nicht „blind“. Ganz im Gegenteil, üblicherweise stellt sich eine Stellenbewerberin bzw. ein Stellenbewerber persönlich einem Auswahlgremium oder einer einzelnen Person vor. Während man Bewerbungsunterlagen ohne Fotos – und sogar ohne Namen und Geschlecht (wenn die zentrale Verwaltung die einlangenden Bewerbungen anonymisiert) – verschicken kann, offenbart ein persönliches Vorstellungsgespräch unvermeidlich persönliche Attribute wie das Geschlecht, das Alter, die Größe oder das Aussehen. Selbstverständlich ist bei der Besetzung offener Stellen der persönliche Eindruck eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin – neben allen fachlichen Qualifikationen – bedeutsam. Informell wird gerne darauf hingewiesen, dass bei einem Einstellungsverfahren eben „die Chemie“ zwischen allen Beteiligten stimmen muss. Allerdings ist es empirisch belegbar, dass das Geschlecht eines Bewerbers für die Chemie von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. In Industrien mit steilen Hierarchien stoßen Frauen immer wieder an unsichtbare Hürden, die im Englischen als „glass ceiling“ bezeichnet werden. Damit ist der Umstand gemeint, dass die Wege in die höchsten Ämter häufig trotz bester Referenzen und Qualifikationen für Frauen versperrt bleiben. Und das kann – vielleicht etwas überraschend – auch an der Geschlechterzusammensetzung des Auswahlgremiums liegen, wie neue Arbeiten über Beförderungen an Universitäten in Italien und Spanien nahelegen.
In beiden Ländern müssen sich Bewerberinnen und Bewerber für Professorenstellen staatlich organisierten Auswahlverfahren stellen, bei denen sich die Kandidaten vor einer Kommission aus Wissenschaftlern des betreffenden Fachgebiets präsentieren. Auf der Basis von über 100 000 Bewerbungsverfahren mit über 8000 Kommissionsmitgliedern konnten Manuel Bagues von der University of Warwick und Kollegen überprüfen, ob es für die Erfolgschancen von Frauen bedeutsam ist, wie viele Frauen in einer Kommission sitzen. Aus dem Bauch heraus könnte man vermuten, dass ein höherer Frauenanteil in der Kommission einen Vorteil für weibliche Kandidaten darstellen würde. Die Daten aus Italien und Spanien liefern keinen Beleg für diese Vermutung. Im Gegenteil, mehr Frauen in der Kommission verringern sogar die Erfolgschancen von weiblichen Kandidaten, wenn auch in geringem Umfang.
Die Erklärung für die Verringerung liegt darin, dass weibliche Kommissionsmitglieder zwar weibliche Kandidaten im Schnitt besser beurteilen als männliche Kommissionsmitglieder, dass die männlichen Kommissionsmitglieder weibliche Kandidaten aber deutlich schlechter bewerten, sobald Frauen der Kommission angehören. Dieses Ergebnis wirkt so, als ob Männer in Auswahlgremien härter gegenüber weiblichen Kandidaten werden, gerade weil schon andere Frauen im Auswahlgremium sitzen, die es offenbar „nach ganz oben“ geschafft haben. Wenn derzeit – nicht nur im akademischen Bereich – verpflichtende Quoten für die Präsenz von Frauen in wichtigen Entscheidungsgremien (wie Auswahlkommissionen) festgelegt werden, dann kann das also ungewollte Auswirkungen auf weibliche Kandidaten haben, die auf der Suche nach einer Stelle sind.
Bei Entscheidungen spielt der Status quo (und dessen Verteidigung) oft eine große Rolle. Ist der Frauenanteil in verantwortlichen Positionen bereits relativ hoch, werden Frauen von Männern bei Vorstellungsgesprächen negativer eingeschätzt. Mehr Frauen in Personalauswahlgremien sind daher oft ein Nachteil für weibliche Bewerberinnen.
Die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ist der erste Schritt zum Erfolg. Dann aber können Kleinigkeiten eine Rolle spielen – zum Beispiel der Nachname.
Seit über 50 Jahren lebe ich mit meinem Nachnamen Sutter. Er ist Teil meiner Identität und er gefällt mir. Zugegeben, als Schulkind war ich nicht immer begeistert, dass mein Nachname mit „S“ beginnt. Klassenlisten sind ja meist alphabetisch geordnet und dadurch war ich immer weit hinten (meist Dritt- oder Viertletzter). So habe ich meine Schularbeitenbzw. Klassenarbeitsnoten immer sehr spät erfahren, was die Spannung im Gegensatz zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, die deutlich vor mir im Alphabet waren, oft unangenehm in die Länge zog. Später erlebte ich auch alphabetische Warteschlangen an der Universität oder beim Militärdienst. Bis ins Erwachsenenalter hinein hielt ich daher meinen Nachnamen eher für einen Nachteil als einen Vorteil. Das wurde noch dadurch untermauert, dass es in meinem Forschungsbereich häufig zu einer alphabetischen Anordnung von Autorennamen kommt. Da verschwindet „Sutter“ dann häufig am Ende der Liste, während (zwei meiner geschätzten) Koautoren wie „Angerer“ oder „Czermak“ weit vorne stehen.
In einem Punkt aber stellte sich im Laufe der Jahre heraus, dass mein Nachname auch Vorteile hat, und zwar bei Vorstellungsgesprächen. In den meisten Bewerbungsverfahren, an denen ich teilnahm – etwa für Professorenstellen an diversen Universitäten –, wurde die Reihenfolge der Kandidaten und Kandidatinnen von den Berufungskommissionen alphabetisch festgelegt. In Ermangelung einer anderen klaren Systematik ist das für viele Verfahren – auch außerhalb des akademischen Bereichs – ein gängiges Verfahren. Wie sich zeigte, war es für meine Chancen hilfreich, relativ weit hinten oder gar als letzter vorzutragen. Jedenfalls konnte ich mich in meiner bisherigen Karriere nicht über mangelnde Angebote beklagen. Natürlich bilde ich mir ein, dass meine Erfolge bei Bewerbungsverfahren auch mit meinen akademischen Leistungen zu tun haben, aber mein Nachname hat aller Voraussicht nach auch ein klein wenig dazu beigetragen. Dafür gibt es wissenschaftliche Belege. Weil ich selbst ein Fan klassischer Musik bin, illustriere ich das am liebsten am Beispiel eines Musikwettbewerbs, nämlich des Königin-Elizabeth-Klavierwettbewerbs, der in Belgien ausgetragen wird und zu den renommiertesten Wettbewerben zählt. Die Liste der bisherigen Sieger enthält so bekannte Klaviervirtuosen wie Vladimir Ashkenazy oder Valery Afanassiev.
Der Wettbewerb umfasst mehrere Stufen. In der letzten – und entscheidenden – Stufe konkurrieren zwölf Pianistinnen und Pianisten um den Sieg. Der Sieger bekommt nicht nur ein Preisgeld, sondern auch eine feste Zusage für Konzertauftritte, die für die weitere Karriere ein prestigeträchtiges Sprungbrett sind. Die zwölf Teilnehmer der Finalrunde treten an sechs verschiedenen Abenden auf, an denen jeweils zwei von ihnen ihre Darbietungen präsentieren. Die Jury – vergleichbar mit einer Berufungskommission an Universitäten oder einem Auswahlgremium für offene Stellen in Unternehmen – besteht aus Experten des Fachs. Jedes Jurymitglied beurteilt jeden Finalisten separat und aus den einzelnen Wertungen wird dann ein Sieger ermittelt. Die Auftrittsreihenfolge der Finalisten wird zufällig bestimmt und zwar so, dass ein bestimmter Buchstabe gezogen wird und dann von diesem Buchstaben ausgehend alphabetisch vorgegangen wird. Wenn etwa mit „M“ begonnen wird, kommen zuerst alle Finalisten von M bis Z und danach noch jene von A bis L.
Wer es ins Finale dieses Musikwettbewerbs geschafft hat, zählt schon zu den besten Musikern seines Jahrgangs. Da außerdem die Reihenfolge des Auftretens zufällig festgelegt wird und nicht zu erwarten ist, dass der Nachname eines Interpreten mit seinem Können systematisch zusammenhängt, sollte die Auftrittsreihenfolge eigentlich keinen Einfluss auf das Ergebnis des Wettbewerbs haben. Das ist aber nicht der Fall. Von den zwei Finalisten, die am selben Tag auftreten, wird der später auftretende Finalist im Schnitt um einen Platz besser gereiht. Es ist also ein eindeutiger Vorteil, innerhalb eines Tages später aufzutreten bzw. in einem Vorstellungsgespräch später dranzukommen. Wenn sich das Auswahlverfahren über mehrere Tage erstreckt – wie im Fall des Klavierwettbewerbs –, dann ist der erste Tag der schlechteste für einen Auftritt. Beim Klavierwettbewerb werden die beiden Finalisten des ersten Tages im Schnitt drei Ränge schlechter gereiht als die Finalisten der folgenden Tage. Eine Bestätigung dieser Ergebnisse habe ich in eigenen Forschungen zum Ferruccio-Busoni-Wettbewerb in Bozen gefunden. Dort zeigte sich, dass in einem dreistufigen Finale die Wahrscheinlichkeit, eine Runde weiterzukommen, immer am höchsten war, wenn man am letzten Tag der jeweiligen Stufe auftrat.
Obwohl also eine zufällige – häufig alphabetische – Reihung der Kandidaten für eine offene Stelle oder einen Sieger in einem Wettbewerb an sich keine Rolle für das Ergebnis des Wettbewerbs spielen sollte, ist es günstiger, spät aufzutreten. Da viele Verfahren rein alphabetisch organisiert werden, ist ein Nachname weiter hinten im Alphabet ein Vorteil, weil es eine Tendenz von Gutachtern oder Kommissionsmitgliedern gibt, bei den ersten Präsentationen nicht die Bestnoten zu vergeben. Es könnte ja immer noch eine bessere Person kommen. Je weniger dann noch kommen, umso eher sind Prüfer gewillt, bei sehr guten Leistungen auch Höchstnoten zu vergeben.
Neben guter Leistung braucht es also – wie immer – ein Quäntchen Glück, um erfolgreich zu sein. Manchmal besteht das Glück einfach in einem Nachnamen, der weit hinten im Alphabet liegt.
Bei Bewerbungsprozessen müssen Mitglieder von Auswahlgremien Vergleiche zwischen verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten vornehmen. Dabei spielt die Reihenfolge der Vorstellungen eine Rolle, weil frühere Kandidaten weniger wahrscheinlich beste Bewertungen bekommen als spätere Kandidaten, wenn danach niemand mehr kommt. Darum ist es bei Vorstellungsgesprächen günstiger, am Ende dranzukommen.
Menschliches Entscheidungsverhalten unterliegt systematischen Verzerrungen. Das trifft auch für die Einstellung neuer Mitarbeiter zu, wie die vorigen Kapitel zeigten. Können maschinelle Algorithmen Fehler bei der Personalauswahl verringern? Oder zahlt es sich für Unternehmen aus, wenn die Leiter der Personalabteilung Entscheidungsspielräume haben?
Susanne brütet über einem Stapel an Bewerbungen für eine offene Stelle in ihrem Unternehmen. Es soll jemand für die Dateneingabe und Aufbereitung einfacher Statistiken für die Geschäftsführung eingestellt werden. Nichts wirklich Anspruchsvolles, aber doch wichtig, weil die Daten ja schließlich stimmen, also sorgfältig erfasst und ausgewertet werden müssen. Der Stapel umfasst ca. 30 Bewerbungen. Als Leiterin der Human Resources (HR)-Abteilung des Unternehmens ist Susanne dafür verantwortlich, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und wem danach ein Jobangebot gemacht werden soll. Susanne hat diese Aufgabe vor etwa 20 Jahren übernommen und seither sehr viel Erfahrung im Beurteilen von Bewerbungsschreiben und Lebensläufen gesammelt. Seit Kurzem ist die Unternehmensleitung eine Kooperation mit einem Personalberatungsunternehmen eingegangen. Dieses Unternehmen bewertet eingehende Bewerbungen anhand eines maschinell erstellten Algorithmus und gibt dann Empfehlungen über die Qualität der Bewerbungen ab, indem eine Bewerbung als grün (hohes Potenzial), gelb (mittleres Potenzial) oder rot (geringes Potenzial) eingestuft wird. Die Unternehmensleitung verspricht sich davon eine Verbesserung des Rekrutierungsprozesses, insbesondere im Hinblick auf eine längere Verweildauer von neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Allerdings ist Susanne als HR- Chefin nicht an die Empfehlungen des Computeralgorithmus gebunden, sondern völlig frei in ihren Einstellungsentscheidungen. Sie soll die Empfehlungen aber als zusätzliche Information berücksichtigen. Das führt immer wieder dazu, dass sie jemanden, der als „grün“ empfohlen wird, als gar nicht so gut einstuft, und umgekehrt einen „gelben“ Kandidaten als sehr geeignet erachtet. Im Zweifelsfall vertraut Susanne auf ihre Erfahrung und den persönlichen Eindruck im Vorstellungsgespräch. Als jemand mit einer gesunden Portion an Selbstreflexionsfähigkeit würde es sie allerdings wirklich interessieren, ob Algorithmen weniger Verzerrungen im Einstellungsprozess verursachen könnten und ein Unternehmen vom Einsatz solcher Algorithmen profitieren würde.
Mitch Hoffmann von der Universität in Toronto ist dieser Frage mithilfe von Daten von 445 HR-Managern nachgegangen, die in Summe über 90 000 Stellenbesetzungen in 15 nordamerikanischen Firmen vornahmen. Diese (realen) Firmen unterstützten ihre jeweiligen HR-Abteilungen durch ein Testverfahren eines Personalberatungsunternehmens, das wie im obigen – fiktiven – Beispiel Bewerbungen in Grün, Gelb und Rot einteilt. Im Rahmen des Tests werden Bewerberinnen und Bewerber in einem ausführlichen Fragebogen über ihre technischen Fähigkeiten, ihre Computerkenntnisse, ihre Persönlichkeit und ihre kognitiven Fähigkeiten befragt und sie müssen verschiedene Berufsszenarien durchspielen und bewerten. Daraus ermittelt dann das Personalberatungsunternehmen die Kategorien Grün, Gelb und Rot. Der Algorithmus für die Bewertung basiert auf Tests aus der Vergangenheit und dem Abschneiden früherer Bewerberinnen in ihrem späteren Beruf, etwa im Hinblick auf ihre Produktivität oder Verweildauer in einem Unternehmen. Das Personalberatungsunternehmen hat sich auf Jobs im unteren Segment des Arbeitsmarkts spezialisiert, also etwa auf Dateneingabetätigkeiten, Mitarbeit in Call-Centern oder einfache Datenauswertungstätigkeiten. Im Laufe der letzten Jahre wurden im Schnitt 48 % aller Bewerbungen als grün, 32 % als gelb und 20 % als rot eingestuft. In den 15 Unternehmen waren die HR-Manager angehalten, auf die farblich abgestuften Bewertungen zu achten, die Manager hatten aber freie Wahl, wen sie letztlich einstellen wollten.
Mitch Hoffmann und Kollegen gingen jetzt der Frage nach, ob es einen Einfluss hat, wenn ein Manager jemanden mit einer „gelben“ Bewertung einstellt, obwohl jemand mit einer „grünen“ Bewertung verfügbar wäre. Der Effekt kann in beide Richtungen gehen. Ein größerer Entscheidungsspielraum ermöglicht, dass Manager aufgrund ihrer eigenen Erfahrung besser als ein Computeralgorithmus abschätzen können, ob jemand gut in das Unternehmen und jeweilige Arbeitsteam passt oder nicht. Gleichzeitig aber kann ein größerer Entscheidungsspielraum dazu führen, dass die Manager nach ihrem „persönlichen Geschmack“ entscheiden statt nach statistisch berechneten Wahrscheinlichkeiten, welche Bewerbung erfolgversprechender sei.
Die Ergebnisse von Hoffmann und Kollegen sind ernüchternd für die Qualität menschlichen Entscheidungsvermögens bei Einstellungsentscheidungen. Wenn HR-Manager häufiger eine (im Farbcode) schlechter bewertete Person einer besser bewerteten (und verfügbaren) Person vorziehen, dann bleiben diese neu eingestellten Personen weniger lang im Unternehmen, als wenn die HR-Manager der Farbempfehlung folgen. Diese entgegen der Farbempfehlung eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber nicht etwa produktiver – was ein legitimer Grund für das Abweichen von der Empfehlung des Algorithmus wäre –, sondern im Schnitt sogar weniger produktiv.