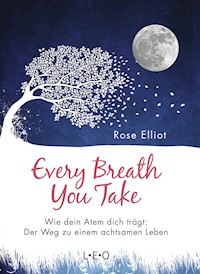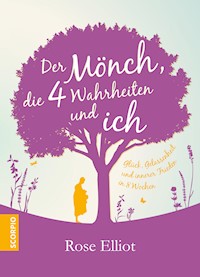
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Als Rose Elliot einen buddhistischen Mönch einlädt, bei ihr im Wohnzimmer einen Meditationskurs abzuhalten, ist das für sie ein Experiment. Doch im Verlauf des 8-Wochen-Kurses vermag der Mönch nicht nur sie und ihren Mann zu überzeugen, sondern auch ein bunt gemischtes, kleines Grüppchen an Teilnehmern, zu dem auch ein Student, ein Friseur, ein Arzt und eine Großmutter gehören. In den alltagsbezogenen Fragen dieser Teilnehmer können wir uns wiederfinden, die Antworten des Mönchs sind voll tiefer Weisheit und mitfühlendem Humor. Woche für Woche werden wir auf diese Weise in andere Aspekte der Meditation und den Kern der buddhistischen Lehre eingeführt und motiviert, diese Einsichten in unseren Alltag zu integrieren. Ein inspirierendes Buch für alle, die ihre Sorgen und Ängste verabschieden und das Leben im Hier und Jetzt genießen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rose Elliot
Der Mönch,die 4 Wahrheitenund ich
Glück, Gelassenheit undinnerer Frieden in 8 Wochen
Aus dem Englischen vonUlla Rahn-Huber
Wichtiger Hinweis:
Namen, Orte und Ereignisse wurden von der Autorin nach eigenem
Ermessen verändert, um die Privatsphäre der in diesem Buch erwähnten
Personen zu schützen.
Titel der Originalausgabe: I Met a Monk
All Rights Reserved
Copyright © Watkins Media Limited 2015
Text copyright © Rose Elliot 2015
First published in the UK and USA in 2015 by Watkins,
an imprint of Watkins Media Ltd.
www.watkinspublishing.com
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2019
© der deutschen Ausgabe: 2019 Scorpio Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-260-6
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Robert, meinen geliebten Mann, für alles.
Inhalt
Vorwort
Einleitung:Der Mönch in meinem Wohnzimmer
Woche 1:Achtsamkeit – die ersten Schritte zum Frieden
Woche 2:Leiden? Tun wir alle
Woche 3:Die Ursache von Leid
Woche 4:Freiheit erlangen
Woche 5:Der Weg ins Glück
Woche 6:Achtsam leben
Woche 7:Innerer Frieden, äußerer Frieden
Woche 8:Metta – liebende Güte
Epilog:Was danach geschah
Dank
Über die Autorin
Quellenangaben
Vorwort
Ich war eine hart arbeitende Kochbuchautorin und verbrachte meine Tage damit, mir Rezepte für meine Bücher und Artikel auszudenken, sie auszuprobieren und zu Papier zu bringen. Im Übrigen hangelte ich mich durchs Leben mit all seinen üblichen Stressmomenten, Herausforderungen und Höhen und Tiefen – bis ich einem Mönch begegnete. Er kam zu uns ins Haus, um für eine Gruppe von Interessierten einen Kurs zu geben – und veränderte mein Leben. Die Erfahrung brachte mir so viel, dass ich mich entschloss, sie lebendig zu halten, indem ich sie auch anderen zugänglich mache. Und so ist dieses Buch entstanden.
Ich würde mich freuen, wenn du beim Lesen dieses Buches das Gefühl hast, selbst live dabei zu sein – und hoffe, dass sich dein Leben durch den Kurs ebenso tief greifend ändert, wie es bei mir der Fall war.
Du kannst das Buch einfach von Anfang bis Ende lesen; noch mehr würde es dir aber bringen, es als Kurs zu betrachten und dir jede Woche – oder was immer deinem eigenen Tempo entspricht – ein Kapitel vorzunehmen und wie die Leute im Buch alle Übungen mitzumachen.
Ich wünsche dir, dass du von der Begegnung mit dem Mönch in meinem Wohnzimmer ebenso profitierst wie ich.
Also dann, tritt ein. Willkommen.
Rose Elliot
Es ist früher Nachmittag an einem herrlichen Junisonntag, als der Mönch bei uns vor der Tür steht. Er ist mittelgroß, muskulös und in ein goldbraunes Tuch gehüllt, das er wie ein wadenlanges Gewand um Schultern und Taille geschlungen trägt.
Sein Kopf ist kahl rasiert und glänzt, und er trägt lederne Sandalen. Wie eine Umhängetasche baumelt ihm eine große Metallschüssel von der Schulter. Ich weiß, dass sie sein einziger Besitz ist und ihm als Geschirr für die zwei Mahlzeiten dient, die er täglich zu sich nimmt – ein Frühstück und ein frühes Mittagessen, das er vor zwölf Uhr einzunehmen hat.
Ich zögere und widerstehe dem Impuls, ihm die Hand zu reichen, denn mir ist bewusst, dass ihm als ordinierter Mönch jeglicher physische Kontakt mit anderen verboten ist, besonders der zu einer Frau. Ich lächle also, lege einer spontanen Eingebung folgend die Hände in Gebetsposition vor der Brust zusammen und sage: »Willkommen.«
Einen Besucher wie ihn empfange ich nicht alle Tage. Der Mönch ist gekommen, um vor einer Gruppe von Leuten über »Achtsamkeit, Meditation und die Erlangung von Glück, Freiheit und Frieden« zu sprechen. Die Idee zu dem Ganzen stammt von Robert, meinem Mann. In einer schwierigen Lebensphase hatte er angefangen, ein nahe gelegenes buddhistisches Kloster zu besuchen, um das Meditieren zu lernen. Er hatte das Gefühl, dass es ihm sehr guttat, und es hatte ihn wirklich verändert. Allen war aufgefallen, dass er viel ausgeglichener und zufriedener wirkte. So war er auf die Idee gekommen, einen der hochrangigeren Mönche zu bitten, bei uns im Haus vor einer Gruppe von Leuten Unterweisungen zu geben.
Er sprach mit ein paar buddhistischen Gruppen hier am Ort, mit Freunden von Freunden, praktisch mit allen, die irgendwie Interesse an einem Kurs über Achtsamkeit und Meditation haben könnten. Sein Vorhaben sprach sich herum, und schließlich entwarf er einen Flyer und schickte ihn herum. Die meisten Leute, die sich daraufhin angemeldet haben, kenne ich nicht.
Wie es aussieht, ist das Interesse an Achtsamkeitsmeditation groß. Und wenn sich jemand damit auskennt, sind es buddhistische Mönche, die täglich mehrere Stunden damit zubringen. Nachdem Robert so gute Erfahrungen damit gemacht hat, hoffen wir, dass auch andere davon profitieren werden.
Ich bin selbst neugierig und prinzipiell offen für seine Idee, gehe aber trotzdem ein wenig misstrauisch an die Sache heran.
Misstrauisch? Ja, ich gebe zu, dass ich gewisse Vorerfahrungen mit Gruppen habe. Du musst wissen, dass ich in einem religiösen Retreat-Zentrum aufgewachsen bin, das von meiner Großmutter und meinen Eltern geleitet wurde. Bevor ich meine eigenen Wege ging, habe ich sogar ein paar Jahre dort gearbeitet. Genau genommen sind meine ersten beiden größeren Kochbücher aus den Rezepten entstanden, die ich mir dort in meiner Zeit als Köchin ausgedacht habe. Es gab verschiedene Gründe, warum ich am Ende fortging und dem allem den Rücken kehrte – dem Retreat-Zentrum ebenso wie allem, was mich auch nur entfernt an »Religion« erinnerte. Und ich bin seither sehr zögerlich, was die Teilnahme an irgendwelchen Gruppen anbelangt. Warum bin ich also heute hier? Warum mache ich die Gastgeberin für diese Meditationsgruppe? Was soll ich mit einem Mönch in meinem Haus? Gute Frage! Genau genommen mache ich es Robert zuliebe. Ich weiß, wie viel es ihm bedeutet. Und ja, ich betrachte mich als spirituellen Menschen, obwohl ich nicht »religiös« im eigentlichen Sinne bin. Außerdem glaube ich daran, dass Meditation positive Wirkungen sowohl auf den Körper wie auch den Geist haben kann. Darum bin ich bereit, mich auf einen Versuch einzulassen.
Da stehe ich jetzt also vor diesem buddhistischen Mönch und frage mich, was ich ihm sagen, was ich tun und wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Robert, der ein deutlich entspannteres Verhältnis zu Mönchen hat, ergreift die Initiative. Die Sonne scheint, und uns bleibt noch ein wenig Zeit, bevor die Teilnehmer eintreffen, und so lädt er den Mann auf einen kleinen Spaziergang in den Garten ein.
Wir gehen durch die Diele hinaus, und die Wärme des Tages umfängt uns. Ich muss zugeben, dass mich der Mönch mit seiner schlichten, offenen und »normalen« Art irgendwie berührt. Es ist schön, dass er einfach so seine Zeit opfert, um hier bei uns im Haus einen Kurs für ihm völlig unbekannte Leute zu halten. Dafür bin ich ihm dankbar.
Draußen im Garten taut er sichtlich auf. Mit offenkundigem Interesse schaut er sich um und redet so locker und natürlich, dass ich spüre, wie sich meine Anspannung löst. »Oh, eine Armandii«, sagt er und deutet auf die üppig grüne Clematis, die sich an einer Seite unseres Hauses an der Fassade emporrankt. »Die muss laufend zurückgeschnitten werden, nicht wahr?« Er erzählt uns, dass er viele Jahre Gärtner gewesen sei, bevor er sich entschloss, Mönch zu werden; dass sein Vater 90 Jahre alt sei und in einiger Entfernung vom Kloster lebe und er ihn regelmäßig besuchen fahre. Zum Glück habe er ein Seniorenticket. Dass buddhistische Mönche so alltagsorientiert und praktisch sein können, habe ich nicht erwartet. Wie ich ihn so vor mir stehen sehe, sonnengebräunt und mit leuchtenden Augen, wirkt er alles andere als alt genug für ein Seniorenticket. Es scheint einiges für einen kahl rasierten Schädel zu sprechen. Oder vielleicht liegt es am Leben im Kloster?
Wir kehren ins Haus zurück und gehen durch die Diele ins Wohnzimmer. »Was für ein schöner Raum!«, ruft der Mönch.
Ich bin froh, dass er ihm gefällt. Wir haben am Vorabend Stunden darauf verwendet, unser Wohnzimmer in einen Meditationsraum oder, wie der Mönch sagt, einen »Schreinraum« zu verwandeln. Einige schwerere Möbelstücke mussten aus dem Weg gerückt werden, und wir haben Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen aufgestellt. Die Esszimmerstühle stehen im Oval entlang der Wände, sodass diejenigen Gäste, die lieber auf dem Boden sitzen möchten, ausreichend Platz haben für ihre Meditationsunterlagen, Matten und Zafus, wie man die festen, runden Meditationskissen nennt, die wie kleine Puffs aussehen. Man sitzt mit gekreuzten Beinen auf dem Zafu, und darunter liegt die gepolsterte Matte.
Über den Kamin am Ende des Raumes haben wir ein Stück burgunderfarbenen Stoff drapiert, das auf dem Sims von zwei schweren, mit weißen Blüten gefüllten Vasen gehalten wird – Bauern-Jasmin aus unserem Garten. Das Tuch verdeckt nicht nur den Kamin, sondern bietet zugleich einen schönen Hintergrund für Roberts heiß geliebten großen, holzgeschnitzten Buddha, den wir von einer Reise nach Sri Lanka mitgebracht haben. Er thront nun auf dem gläsernen Couchtisch, den wir dorthin gerückt haben.
Ich führe den Mönch an seinen Platz am anderen Ende des Raumes, am »Kopfende«, rechts neben dem »Schrein« mit Blick zur Tür. Er nimmt mit gekreuzten Beinen auf dem Zafu und der Meditationsmatte Platz, die ich für ihn bereitgelegt habe. Ich frage ihn, ob er einen Tee oder Kaffee möchte. »Ja, gern«, antwortet er. »Eine Tasse schwarzer Tee wäre wunderbar. Schön stark und mit viel Zucker und Milch! Aber bitte keine Kuhmilch. Hättest du vielleicht etwas Sojamilch?« Die habe ich. Ich bin vorbereitet, denn man hat mich entsprechend gewarnt. Als praktizierendem Mönch ist es ihm nicht erlaubt, nach zwölf Uhr mittags irgendwelche Lebensmittel zu sich zu nehmen, und Kuhmilch zählt offenbar dazu. Sojamilch hingegen gilt als »Medizin« und ist folglich erlaubt. Warum das so ist? Ich habe keine Ahnung … Ich kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken, denn ich kenne ein paar Leute, die nicht im Kloster leben und trotzdem meinen, dass Sojamilch wie Medizin schmeckt. Ich selbst mag überhaupt keine Milch im Tee oder Kaffee, verwende aber Sojamilch statt Kuhmilch zum Kochen.
Der Mönch hat seinen Satz kaum beendet, als es an der Tür klingelt. Die ersten Teilnehmer sind gekommen: ein großer Mann namens Tim mit kurzem, an den Schläfen ergrautem Haar und Geheimratsecken. Er trägt einen dünnen Seidenschal locker um den Hals geschlungen. Und eine lebhaft wirkende Frau mit kurzer roter Stachelfrisur, die sich mir als Suzi vorstellt. Sie tragen Kissen, Meditationsunterlagen und Matten unter dem Arm.
Ich zeige ihnen, wo sie ihre Sachen ablegen können, wo das WC und die Namensschilder sind, die ich am Abend zuvor vorbereitet habe, und wie sie zum Meditationsraum finden. Inzwischen ist auch ein blasser, recht nervös wirkender junger Mann mit Brille namens Sam eingetroffen. Nachdem ich ihm erklärt habe, wo er sein Fahrrad abstellen kann, gehe ich, um dem Mönch seinen Tee zu machen.
Wieder klingelt es. Weitere Leute treffen ein, Robert nimmt sie an der Tür in Empfang. Ich begegne ihnen in der Diele, als ich dem Mönch seinen Tee bringe. Da sind Dan, ein ziemlich gut aussehender, dunkelhaariger junger Mann in Jeans, und eine Frau namens Nicky mit langem, glattem, glänzend braunem Haar. Sie trägt cremefarbene Leggings und ein lockeres Oberteil, das ihr seitlich von der Schulter rutscht. Wenn man sie so ansieht, könnte man meinen, sie wäre auf dem Weg zu einer Yummy-Mummies-Yogastunde. Hoffentlich hat sie sich nicht verirrt …
Als ich das nächste Mal durch die Diele komme, sind wieder neue Leute gekommen: Ein großer, schlaksiger Typ streckt mir die Hand entgegen. »Maurice«, sagt er. Er hat lockiges, goldbraunes Haar, trägt eine getönte Brille und sieht aus, als würde er in einer Rockband spielen. Ich frage mich, ob er im Auto eine Gitarre herumliegen hat.
Ein paar der anderen Gäste kenne ich bereits: Pam etwa, eine große Frau mit glänzend blondem, exakt geschnittenem Bob und einem Pony, der ihr weit in die Stirn reicht; und ein älteres Ehepaar – Rodney und Joan. Die meisten aber sehe ich heute zum ersten Mal. Mehr und mehr Teilnehmer treffen ein. Irgendwann höre ich auf zu zählen. Ich verliere das Gefühl für die Zeit, verliere den Überblick. Einen Moment lang gerate ich in Panik: Ist unser Wohnzimmer überhaupt groß genug, um alle diese Menschen unterzubringen?
Ich versuche, mir Namen zu merken und mit Gesichtern zu verknüpfen. Da ist Ed, muskulös, mit kräftiger Gesichtsfarbe, ein sehr sportlich wirkender Typ; dann eine Mittdreißigerin namens Maggie mit blassem Teint, dunklen Haaren und stechend grünen Augen; und Gwyn, im seidenen altroséfarbenen Top mit makellosem Platinhaar und Perlenohrringen, die einen sehr ruhigen, gelassenen Eindruck auf mich macht.
Innerhalb kurzer Zeit stehen etwa 15 Paar Schuhe und Sandalen neben der Wohnzimmertür, und bis auf einen haben alle Teilnehmer, die wir erwartet haben, drinnen ihren Platz gefunden. Manche sitzen auf Stühlen, andere auf dem Boden auf diversen Zafus, Kissen oder Matten und manche sogar auf niedrigen, klappbaren, hölzernen Meditationshockern – sieht so aus, als würden sie es mit dem Meditieren ernst meinen!
Ich schaue auf das letzte verbleibende Namensschild: »Debbie«, lese ich. Der Name sagt mir nichts. Gerade überlege ich, ob wir ohne sie anfangen sollen, da wir ohnehin schon fünf Minuten über der Zeit sind, als ich es klingeln höre. Und da steht sie also, mit ihrer wilden, dunkelblonden Lockenpracht. Sie wirkt völlig aufgelöst.
»Tut mir furchtbar leid, dass ich so spät dran bin«, sagt sie. »Ich musste unterwegs noch meine Kinder zu meiner Mutter bringen, und dann habe ich auf der Autobahn die falsche Ausfahrt genommen.«
»Kein Problem«, beruhige ich sie. »Wir haben noch nicht angefangen, also keine Sorge. Ich bin froh, dass du es noch geschafft hast.« Ich zeige ihr den Weg zur Toilette, gebe ihr ihr Namensschild und führe sie in den Schreinraum. Er wirkt wie ein Hort des Friedens. Alle sitzen still da, als würden sie schon meditieren. Debbie setzt sich auf den einzigen noch freien Stuhl. Ich mache mich auf den Weg zu meiner eigenen Meditationsmatte und versuche dabei, auf niemanden zu treten.
Schließlich sitzen wir alle an unserem Platz. Nach einer kleinen Pause stellt Robert den Mönch vor und sagt, wie glücklich wir sind, ihn bei uns zu haben. »Ich freue mich auch, hier bei euch allen zu sein«, sagt der Mönch. »Möge dies eine Zeit des Friedens und der inneren Regeneration sein, eine Oase abseits der Anforderungen des Alltags.«
Er steht vor dem Schrein, den wir auf unserem Couchtisch errichtet haben, und zündet die erste der dicken, weißen Kerzen und das Räucherstäbchen an. Er nimmt die kleine, sandgefüllte Schale mit beiden Händen und streckt die Arme nach oben, als würde er einen Segen erbitten. Dann stellt er sie auf den Tisch zurück und kehrt wieder zu seiner Meditationsmatte zurück.
Wir beginnen mit einem kleinen Chant im Stehen, wobei wir die Worte von den Blättern ablesen, die Robert vom Kloster bekommen hat. Sie sind in Pali, einer dem Thai ähnlichen, inzwischen ausgestorbenen altindischen Sprache, in der die buddhistische Lehre niedergeschrieben wurde. In der Erklärung dazu heißt es, dass sie einen Dank an den Buddha für seine Lehre beinhalten und einen Dank an seine Schüler, die danach lebten und dafür sorgten, sie an die Nachwelt zu überliefern.
Das Chanten des Mönches klingt beruhigend, und jeder macht so gut es geht mit. Dabei scheint die Gruppe enger zusammenzurücken. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht sehr wohl in meiner Haut fühle – es fühlt sich für mich zu sehr nach »Religion« an. Ich frage mich, ob es anderen Teilnehmern genauso geht. Aber ich habe mir vorgenommen, erst mal für alles offen zu sein. Außerdem hat der Mönch eine angenehme, tiefe Stimme, und so überlasse ich mich einfach dem Klang.
Dem Beispiel des Mönchs folgend neigen wir an bestimmten Stellen den Kopf, und als wir uns wieder auf unsere Kissen bzw. Stühle setzen, frage ich mich, wie viele der Anwesenden womöglich schon Buddhisten sind, wer bereits meditieren kann und mit welchen Erwartungen die Leute gekommen sind.
Der Mönch hält einen Augenblick inne, bevor er zu sprechen beginnt. »Gut«, sagt er und lächelt in die Runde. »Vielleicht könnten wir uns erst einmal vorstellen, und jeder sagt, warum er hier ist und was er sich von diesem Kurs verspricht.«
Wie üblich, wenn ein solcher Vorschlag kommt, rührt sich erst mal keiner. Der Mönch wartet einen Moment ab, dann sagt er lachend: »Also, vielleicht sollte ich den Anfang machen. Ihr könnt dann weitermachen, wenn ihr mögt.«
Sein Name, sagt er, sei Ehrwürdiger Bhante. Wenn wir möchten, fügt er hinzu, könnten wir ihn ruhig einfach Bhante nennen, obwohl er für mich wohl immer »der Mönch« bleiben wird. Er sei seit über 30 Jahren buddhistischer Mönch und zunächst 15 Jahre lang Zen-Buddhist gewesen, bevor er zur Theravada-Schule wechselte. Es gäbe auch einen tibetischen Zweig des Buddhismus, dessen Oberhaupt der Dalai Lama sei.
Die Theravada-Schule, führt er aus, sei die älteste Form des Buddhismus, wie sie der Buddha selbst in sich wiederholenden, beinahe poetischen Worten an seine Schüler weitergegeben habe. Die Mönche lernten sie auswendig, indem sie sich diese Worte unzählige Male anhörten und rezitierten. Auf diese Weise gelang es, die Lehre von Generation zu Generation weiterzugeben, bis sie schließlich etwa 300 Jahre nach dem Tod des Buddha niedergeschrieben werden konnte. Die tibetische und Zen-Schule des Buddhismus entwickelten sich später, gehen jedoch auf dieselben Wurzeln zurück.
»Ich liebe dieses Gefühl von Kontinuität; das Wissen, dass die weisen Worte, so wie der Buddha sie selbst gesprochen hat, über alle Zeiten hinweg ständig wiederholt wurden und dabei so vielen Menschen geholfen haben«, vertraut uns der Mönch an. »Und inzwischen haben sie sich in der ganzen Welt verbreitet, sodass der Buddhismus mittlerweile nach dem Christentum, dem Islam und dem Hinduismus zur viertgrößten Religion geworden ist. Und in manchen Ländern der westlichen Welt ist sie zudem die am schnellsten wachsende.«
Er hält inne, bevor er mit einem Lachen hinzufügt: »Das heißt, wenn man beim Buddhismus überhaupt von einer Religion sprechen kann.«
Die Bemerkung wird in der Gruppe überrascht aufgenommen. Rodney, der ältere Mann, hebt skeptisch die Augenbraue.
»Wirklich?«, fragt er. »Ich scheibe immer ›Buddhist‹, wenn ich irgendwo meine Religion angeben soll. Die meisten Leute dürften den Buddhismus doch sicher als Religion betrachten, oder?«
»An dieser Frage scheiden sich die Geister. Eine endlose Debatte. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht?« Er lacht.
»Und warum?«, will Rodney wissen.
»Der Buddhismus kennt viele der Dinge nicht, die eine Religion normalerweise ausmachen. Es gibt keinen Gott, den man anbeten könnte – der Buddha bestand stets darauf, dass er nur Lehrer sei; einer, dem man zuhört und dessen Worte man befolgt, wenn sie einem sinnvoll erscheinen. Aber man betet ihn nicht an.
Er war in diesem Punkt ganz klar. Er wollte, dass man seine Lehre auf den Prüfstand stellt und alles selbst ausprobiert. Er riet seinen Anhängern, nichts zu glauben, was man ihnen sagt, was in heiligen Schriften geschrieben steht oder von früheren Generationen überliefert wurde. ›Glaubt nur an das, was euch richtig erscheint und euch und den Menschen ringsum weiterhilft‹, das war seine Botschaft.«
Als ich dies höre, spüre ich, wie sich meine innere Anspannung löst und ich locker werde. An dieser Betrachtungsweise ist wirklich nichts auszusetzen! Ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem so starke religiöse Überzeugungen galten (und seien diese noch so unorthodoxer Natur gewesen), dass ich sehr früh lernte, den Mund zu halten und nicht zu hinterfragen, was man mir sagte. Dieser Zustand der Unterdrückung währte, bis mit Ende 20 mit einem Mal all meine bis dahin nicht geäußerten Zweifel und Ungewissheiten an die Oberfläche drängten und ich schließlich mit meiner Familie brechen musste, um herauszufinden, woran ich denn wirklich glaubte.
Die Erlaubnis zu bekommen (ja, von einem spirituellen Lehrer den Rat zu erhalten!), mir nur diejenigen Aussagen zu eigen zu machen, die sich richtig für mich anfühlen, klingt da für mich nach einer ziemlichen Befreiung. Meine Stimmung hebt sich augenblicklich, und ich bin neugierig auf das, was kommt. Der Mönch hat meine Aufmerksamkeit gewonnen.
»Und obwohl sich die Lehre im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und in verschiedene Richtungen verzweigt hat, ist die Kernbotschaft des Buddha bis heute erhalten geblieben, und sie ist jedem zugänglich: nämlich, wie sich mit Achtsamkeit und Meditation Glück, Freiheit und Frieden finden lassen. Ob Mann, Frau oder Kind – wer mag, kann es selbst ausprobieren.
Und genau darum sind wir heute hier: um Achtsamkeit und Meditation zu lernen und zu erfahren, inwieweit sie uns nutzen können.«
Aus der Gruppe kommt zustimmendes Murmeln, und die Anspannung weicht spürbar. Ed, den man seinem Äußeren nach eher auf einem Rugby-Feld als in einen Schreinraum vermuten würde, meldet sich zu Wort. Sein Arzt habe ihm gesagt, zu meditieren könne ihm helfen, seinen Blutdruck in den Griff zu bekommen.
»Das ist in der Tat eine der nachweislichen positiven Wirkungen des regelmäßigen Meditierens«, antwortet der Mönch.
Als hätte sich ein Korken aus der Flasche gelöst, sprudeln auf einmal alle in der Gruppe los, und einer nach dem anderen stellt sich vor. Ich versuche, mir alles zu merken. Namen und Stimmen schwirren durch die Luft. Ich bekomme nur Bruchstücke mit, wie: Dan: »… habe versucht zu meditieren, hatte aber Schwierigkeiten damit … müsste ruhiger werden …« Nikki: »… mache mir ständig Sorgen … könnte mir helfen, zur Ruhe zu kommen … suche nach einem tieferen Sinn im Leben … möchte glücklicher sein … habe einfach das Gefühl, dass in meinem Leben was fehlt …«
»Danke«, sagt der Mönch am Ende. »Ich hoffe, dass jeder von euch hier etwas von dem findet, wonach er sucht. Heute Nachmittag werden wir uns mit dem allerersten Werkzeug befassen, das der Buddha seinen Schülern mit auf den Weg gegeben hat – das, was wir ›Achtsamkeit‹ nennen. Und wir werden sehen, wie wir dieses Instrument im Alltag und in der Meditation einsetzen können. Der Begriff ist ja neuerdings ziemlich in Mode gekommen.
In den folgenden Wochen werden wir dann auf diesem starken Fundament aufbauen. Nach und nach werdet ihr dabei weitere einfache Übungen aus des Buddhas Werkzeugkasten kennenlernen und mehr über deren positive Wirkungen erfahren. Dabei steht nicht das im Vordergrund, was ich euch erzähle. Ihr werdet vielmehr Gelegenheit haben, alles selbst auszuprobieren.«
Der Mönch schaut lächelnd in die Runde. »Darf ich fragen, wie viele von euch schon einmal meditiert haben?«
Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer hebt die Hand.
»Und wie viele von euch praktizieren die Meditation regelmäßig, also jeden Tag oder annähernd jeden Tag?«
Fast alle Hände sinken, und es wird ein wenig gelacht.
»Das bedeutet«, sagt der Mönch, »dass Meditation für die meisten von euch neu oder so gut wie neu ist?«
Ein zustimmendes Murmeln geht durch den Raum. Maggie, die blasse, dunkelhaarige Frau mit grünen Augen, die drüben an der Stirnseite des Raumes sitzt, hebt die Hand.
»Ja?« Der Mönch nickt ihr lächelnd zu.
»Ich bin etwas verunsichert. Es wird heutzutage viel von ›Meditation‹, ›Achtsamkeit‹ und ›Achtsamkeitsmeditation‹ geredet, aber ich weiß nicht recht, was sich hinter diesen Begriffen eigentlich verbirgt. Was genau ist Meditation? Und was ist der Unterschied zwischen ›Achtsamkeitsmeditation‹ und ›einfacher Meditation‹?«
»Gute Frage«, gibt der Mönch zurück. »Ich werde es erklären. Der Begriff ›Meditation‹ hat viele verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wer ihn benutzt. Meditieren kann einfach nachdenken oder reflektieren bedeuten. Zudem wird der Begriff als Bezeichnung für alle möglichen Techniken benutzt, darunter Entspannungsübungen, geführte Visualisationen, die sogenannte ›Mantra-Meditation‹, bei der man wie in der Transzendentalen Meditation ein Wort oder einen Klang rezitiert bzw. chantet, um in einen Zustand des Friedens zu gelangen; bei wieder anderen konzentriert man sich intensiv auf ein bestimmtes Objekt und so weiter. Für die Art von Meditation, wie der Buddha sie lehrte und wie wir sie hier üben und praktizieren werden, hat sich der Begriff der ›Achtsamkeitsmeditation‹ eingebürgert.«
Maggie lächelt entschuldigend. »Ich habe früher schon mal zu meditieren versucht«, sagt sie. »Und ich weiß auch, dass es mir guttut und ich es öfter machen sollte. Das Problem ist nur, dass es mir so schwerfällt, mich einfach hinzusetzen und es zu tun.«
»Damit bist du nicht allein«, antwortet der Mönch. »Den meisten Menschen geht es genauso wie dir, und ich kann das gut verstehen. Wir haben nicht immer Lust zu machen, was uns ›guttut‹, nicht wahr?«
Alles lacht.
»Und wenn man ans Meditieren denkt, stellt sich dabei manchmal eine Art Pflichtgefühl ein, als wäre es etwas, was man erledigen muss«, fährt er fort. »Wir denken dann etwa: ›Ich sollte meditieren, dann wäre ich ein besserer Mensch. Wenn ich ein besserer Mensch wäre, würde ich mehr meditieren. Dann würde ich inneren Frieden finden und vielleicht die eine oder andere faszinierende spirituelle Erfahrung machen.‹ Solche Gedanken können einem schon ab und zu mal die Laune vermiesen.«
Wieder lachen alle.
»Ich bin heute hier, um eure Vorstellung vom Meditieren zu entmystifizieren. Das Ganze wird oft komplizierter dargestellt, als es ist. Man muss dazu nicht in einem abgedunkelten, schalldichten Raum sitzen; es braucht keine brennenden Kerzen oder Räucherstäbchen, und wenn sie auch noch so angenehm duften«, sagt er mit einem Nicken Richtung Couchtisch. »Und man muss nicht viele, viele Jahre Übung darin haben. Meditieren kann jeder. Gehen wir es also Schritt für Schritt an, und am Ende dieses Kurses werdet ihr wie die Profis meditieren.«
Der Mönch schmunzelt, dann nimmt er einen langen Atemzug, schaut in die Runde und sagt: »Mit Achtsamkeit fängt alles an.«
Achtsamkeit
»Was also ist genau mit Achtsamkeit gemeint?«, fragt er und gibt gleich selbst die Antwort: »Achtsamkeit oder Achtsamsein heißt einfach, völlig bewusst im gegenwärtigen Augenblick zu sein – wirklich wahrzunehmen, wie wir uns fühlen, was wir im Blickfeld haben, zu sehen, zu hören – und alles genau so zu akzeptieren, wie es ist, ohne zu werten, zu vergleichen, zu kritisieren oder irgendeine Veränderung herbeizuwünschen. Es bedeutet nur, uns darauf zu konzentrieren, wie die Dinge in diesem Moment sind – jetzt –, ohne sie in irgendeiner Weise zu ändern. Manche nennen das auch ›im Jetzt sein‹.«
Nach einer Pause fährt er fort: »Das mag nach nichts Besonderem klingen, aber zu lernen, achtsam zu sein und Achtsamkeit zu üben, gehört zu den hilfreichsten und für die persönliche Weiterentwicklung vorteilhaftesten Dingen überhaupt – und jeder kann es tun. Seit einigen Jahren erkennt auch die Medizin zunehmend den Wert der Achtsamkeitspraxis und setzt diese in mehr und mehr Therapien ein. Aber man muss nicht krank sein, um von den positiven Wirkungen zu profitieren. Achtsam zu sein ist gut für alle und jeden.
Also …« Sein Blick geht in die Runde. »Wie oft tun wir etwas, während wir gleichzeitig an etwas anderes denken oder uns wünschen, woanders zu sein, oder uns Sorgen machen oder Angst haben, was wohl als Nächstes passiert?«
Ich bin mir sicher, dass jeder im Raum weiß, wovon er da spricht. Ich weiß es ganz bestimmt.
»Wenn wir unsere Gedanken wandern lassen, sind wir nicht im gegenwärtigen Augenblick. Wir sind nicht achtsam. Wir können in Gedanken Hunderte von Meilen entfernt sein; vielleicht sind wir Jahre zurück in der Vergangenheit oder weit voraus in der Zukunft und denken über Dinge nach, die passiert sind oder passieren könnten.
Unsere Gedanken sind überall und nirgends, vielleicht setzen sie uns zu und beunruhigen uns, vielleicht lösen sie Anspannung im Körper aus. Womöglich hindern sie uns sogar daran, uns im gegenwärtigen Augenblick richtig zu freuen, weil wir uns vorstellen, wie traurig wir sein werden, wenn der schöne Moment vorbei ist.«
Bei diesen Worten erinnere ich mich plötzlich lebhaft daran, wie ich einmal in Griechenland am Meer war. Ich schwamm an diesem herrlichen Tag im klaren blauen Wasser, aber ich war kreuzunglücklich, weil die Ferien zu Ende gingen und ich befürchtete, im nächsten Jahr womöglich nicht wiederkommen zu können. Wie ein dunkler Schleier legte sich die Traurigkeit über die Freude in der Gegenwart. Die letzten Urlaubstage fühlen sich für mich häufig so an.
»Sind wir aber achtsam«, fährt der Mönch fort, »muss es nicht so sein. In dem Maße, wie wir lernen, achtsam zu sein und uns auf das zu konzentrieren, was wir jetzt, in diesem Moment konkret tun, spüren wir die Qualität des Augenblicks: die sanfte Brise im Gesicht, den Duft der Rosen, das Vogelgezwitscher, den Geschmack des Essens am Gaumen … wir genießen es wirklich.
Natürlich ist diese Form von Konzentration nicht leicht aufrechtzuerhalten. Fangen wir an, uns in Achtsamkeit zu üben, fällt uns sehr bald auf, wie oft unsere Gedanken nichts mit dem gegenwärtigen Augenblick zu tun haben, wie oft wir uns von Angstgedanken, Sorgen, Werturteilen und so weiter ablenken lassen.
Aber allein dies zu merken ist ein Schritt in die richtige Richtung, und je häufiger wir Achtsamkeit praktizieren und unseren Geist geduldig immer wieder in die Gegenwart zurückholen, desto einfacher wird es, und desto natürlicher kommt es uns vor. Und anders als bei beinahe jeder anderen Form von Betätigung brauchen wir, um Achtsamkeit zu üben, keinerlei Ausrüstung; wir müssen nicht reisen, es kostet nichts … Nur einer Sache bedarf es: dem Willen, es zu tun.«
Der Mönch hält kurz inne. Dann fährt er fort: »Eine der besten Möglichkeiten, in die Achtsamkeit zu finden, ist, darauf zu achten, wie sich unser Körper jetzt, in diesem Augenblick, anfühlt. Lasst uns jetzt genau das tun. Achtet darauf, wie sich das Kissen oder die Matte oder der Stuhl unter euch anfühlt. Ist euch warm oder kalt? Wo sitzt vielleicht Anspannung? Wo zieht oder schmerzt es? Nehmt es einfach zur Kenntnis, ohne es in Gedanken zu kommentieren.«
Es folgt eine Pause, in der alle auf sich konzentriert sind. In die Stille hinein meldet sich Maurice zu Wort, der Typ, von dem ich denke, dass er besser in einen Nightclub passen würde: »Es nicht zu kommentieren, was genau heißt das?« Ich frage mich, womit er sein Geld verdient und warum er hier ist.
»Ich meine damit Folgendes«, antwortet der Mönch. »Da sitzt du nun und konzentrierst dich darauf, wie sich dein Körper anfühlt, und dabei spürst du beispielsweise, wie es unten an deiner Wirbelsäule so eine Stelle gibt, die dir wehtut. Du denkst also: Mann, nee, jetzt meldet sich mein Rücken schon wieder! Hoffentlich wird es im Lauf des Nachmittags nicht noch schlimmer. Ich frage mich, warum er mir schon wieder wehtut? Vielleicht habe ich mir einen Muskel gezerrt, als ich gestern diese Kiste getragen habe? Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Wenn es schlimmer wird, muss ich einen Termin beim Osteopathen machen. Wieder Extrakosten. Und überhaupt, meine Kreditkartenabrechnung ist fällig. Keine Ahnung, wo das Geld hinfließt; verdammtes Finanzamt! Und so weiter und so fort.«
Alle lachen, und der Mönch schiebt nach: »Das ist es, was ich unter ›kommentieren‹ verstehe.« Jetzt lacht er auch.
»Von der Hier-und-Jetzt-Erfahrung des schmerzenden Rückens sind wir zur Selbstkritik gesprungen – Ich hätte vorsichtiger sein sollen –, zur Angst, dass es schlimmer werden könnte, zu Geldsorgen und dem Gejammer über das Finanzamt. Seht ihr, wie ihr mit inneren Kommentaren ein einfaches Zwicken im Rücken zu etwas viel, viel Größerem aufblasen könnt? Und wir alle machen das ständig – unser Schmerz wird so zu einem großen Teil durch gedankliches Kommentieren verursacht.«
»Und wie können wir damit aufhören?«, will Maurice wissen.
Der Mönch antwortet: »Du fokussierst dich darauf, wie du dich jetzt, in diesem Augenblick, fühlst, und wenn da Schmerz ist, spürst du ihn, aber du denkst nicht darüber nach. Lass einfach deinen Körper den Schmerz fühlen. Wehre dich nicht dagegen, kommentiere ihn nicht, bewerte ihn nicht. Er darf einfach da sein, sei einfach bei ihm.
Achtsam zu sein heißt, unseren Geist in den gegenwärtigen Augenblick zurückzuholen und wahrzunehmen, wie das Hineinspüren in unseren Körper uns sofort in die Gegenwart zurückbringt. Das passiert auch, wenn wir uns auf das konzentrieren – also wirklich in den Fokus nehmen –, was wir gerade tun. Aber konzentriert euch nicht so sehr, dass ihr euch anspannt. Es ist mehr ein Gewahrsein, eine Wachheit, Offenheit, ein Bemerken, Beobachten. Zum Beispiel wie sich der Stift zwischen den Fingern anfühlt, wenn wir schreiben; während einer Mahlzeit die Empfindungen des Essens im Mund und wie wir kauen; das Gefühl des Wassers auf der Haut beim Duschen; wie wir beim Autofahren das Lenkrad in den Händen halten. Wir konzentrieren uns auf das, was real ist und tatsächlich jetzt gerade geschieht, ohne uns von unseren Gedanken ablenken zu lassen.
Und jeder von uns verfügt im Inneren über das perfekte Werkzeug, das uns hilft, achtsam zu sein. Habt ihr eine Ahnung, was ich meine?« Der Mönch schaut erwartungsvoll in die Runde, doch die Gruppe hüllt sich in Schweigen.
»Es ist unser Atem«, sagt er schließlich. »Jeder Atemzug, den wir nehmen, gibt uns die Chance, achtsam zu sein und uns mit dem gegenwärtigen Augenblick zu verbinden.«
Er hält kurz inne und atmet tief. »Wir spüren, wie der Atem in unsere Nasenlöcher einströmt; spüren, wie er, noch kühl, zur Lunge hinabfließt; dann, wie er wieder nach oben und durch die Nasenlöcher ausströmt. Wir versuchen nicht, ihn auf irgendeine Weise zu kontrollieren, wir lassen ihn einfach da sein: ein herrlicher, beruhigender, heilender, erfrischender Atemzug.
Uns darauf zu konzentrieren, führt uns automatisch in die Achtsamkeit, weil wir mit dem Akt des Atmens beschäftigt sind. Unser Geist wird dabei klar, wir spüren Frieden und die Kraft des Augenblicks und sind voll und ganz im Hier und Jetzt.
Lasst es uns ausprobieren. Versuchen wir, achtsam zu atmen – oder unseren Atem zu beobachten, wie man gemeinhin sagt.«
Der Mönch wartet, bis sich alle auf ihrem Platz zurechtgerückt haben, und fährt fort: »Atmet ein. Spürt, wie die Luft durch die Nasenlöcher ein- und weiter in die Lunge hinabströmt; dann nehmt wahr, wie sie wieder ausströmt.«
Wir tun, was er sagt. Eine oder zwei Minuten lang atmen wir auf diese Weise. Ich spüre sofort, wie sich ein Gefühl von Frieden einstellt, ich mich geerdeter fühle und stärker in Kontakt mit meiner eigenen Kraft komme. Ich hätte nicht gedacht, dass diese einfache Technik eine solche Wirkung hat.
»Warum mache ich das nicht dauernd?«, frage ich mich im Stillen. Meine Mutter empfahl mir immer, ein paarmal tief durchzuatmen, bevor ich mich in irgendeine unangenehme Situation begeben musste – aber diese Art des Atmens war anders. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Es war eher ein Luftschnappen, vollgepackt mit Ängsten und innerer Abwehr. Tief zu atmen, wie der Mönch es lehrt, fühlt sich ganz anders an. Es bringt mich wirklich zur Ruhe und auf sonderbare Weise tiefer in Berührung mit mir selbst.
»Wenn eure Gedanken zu wandern beginnen, holt sie einfach behutsam zu eurem Atem zurück«, rät der Mönch.
Ich merke, dass ich aufgehört habe, mich auf den Atem zu konzentrieren, und kehre mit meiner Aufmerksamkeit zurück. Und sowie ich die Luft durch die Nase einströmen fühle, stellt sich sofort wieder das Gefühl von Frieden ein; ich fühle mich irgendwie verankert.
»Und, wie war das?«, erkundigt sich der Mönch nach einigen weiteren Atemzügen. Die Andeutung eines Lachens schwingt in seiner Stimme mit.
»Gut. Wirklich gut«, sagt Gwyn.
»Ich spüre nicht, wie die Luft in meine Nasenlöcher einströmt«, meint Ed.
»Achte einfach darauf, ab welchem Punkt du das Einströmen der Luft wahrnimmst«, antwortet der Mönch. »In der Achtsamkeitspraxis geht es darum, was du selbst spürst, und nicht um irgendwas, was du nach Aussage anderer spüren solltest. Nimm wahr, wie es sich in diesem Augenblick für dich anfühlt, wenn du ein- und wieder ausatmest. Gut möglich, dass du während dieser Übung merkst, wie sich deine Wahrnehmung des Atems verändert.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Achtsam zu sein heißt, sich voll und ganz auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren und wahrzunehmen, was jetzt, in diesem Moment, mit uns geschieht, ohne uns von Gedanken ablenken zu lassen, die uns davon wegführen. Es bedeutet, ›wach‹ für alles zu sein, ohne es zu ›kommentieren‹ oder in irgendeiner Weise zu beurteilen. Einfach ›da sein‹.
Wir können Achtsamkeit praktizieren, indem wir nichts anderes tun, als in unseren Körper hineinzuspüren und zur Kenntnis zu nehmen, was in ihm vorgeht; oder indem wir uns voll und ganz auf das konzentrieren, was wir jetzt tun – in diesem Augenblick. Dringen andere Gedanken ein, richten wir unseren Geist immer wieder neu auf diesen Fokus aus. In allererster Linie aber praktizieren wir Achtsamkeit durch die Konzentration auf den Atem.
Was meint ihr, wie oft atmen wir im Verlauf eines Tages?«, fragt der Mönch in die Runde. »Wie oft haben wir also Gelegenheit, im Verlauf eines Tages achtsam zu sein? Unseren Atem mit Achtsamkeit zu begleiten ist ein bemerkenswertes Mittel, das umso wirksamer wird, je häufiger ihr es benutzt. Und desto mehr werdet ihr es schätzen und lieben lernen.
Achtsam zu atmen ist außerdem absolut einfach und unauffällig. Habt ihr euch erst einmal damit vertraut gemacht, könnt ihr es jederzeit praktizieren, wann immer ihr daran denkt und wo immer ihr seid. Es fällt kaum auf, dass ihr es tut. Ihr kommt bloß mehr und mehr in den Frieden, seid glücklicher, fühlt euch wohler in eurer Haut und seid zufriedener mit dem Leben. Ein bisschen Üben lohnt sich da allemal, findet ihr nicht?«
Der Mönch lächelt. »Schließlich atmet ihr die ganze Zeit; warum nicht jeden Atemzug durch das Hineinspüren in den gegenwärtigen Augenblick – ins Jetzt – zum achtsamen Atemzug machen? Wenn euch das gelingt, werdet ihr erfahren, was wahrer Frieden ist.
Das kann durchaus Spaß machen«, fügt er mit einem Schmunzeln an. »Ihr könnt euch ein System von kleinen Gedächtnishilfen ausdenken. So könnte jedes laute Geräusch, das ihr hört, euch daran erinnern, ein paar herrliche, erfrischende, beruhigende, achtsame Atemzüge zu nehmen. Das könnte zum Beispiel so aussehen: Ein Hund bellt. Ihr atmet ein und wieder aus und konzentriert euch ganz auf den Atem und nehmt ihn wirklich wahr. Es klingelt an der Tür. Ihr atmet ein; ihr atmet aus. Eine Sirene schrillt. Einatmen. Ausatmen. Ein Flugzeug fliegt über euch hinweg. Einatmen. Ausatmen. Und so weiter.
Eines lässt sich über das moderne Leben sagen«, fährt er grinsend fort. »Es herrscht darin kein Mangel an Gelegenheiten, uns im achtsamen Atmen zu üben!
Auch sorgenvolle Gedanken bieten sich zur Erinnerungsstütze an. Jedes Mal, wenn irgendeine Sorge in euch aufsteigt, kann euch das ins Gedächtnis rufen, ein paar heilende achtsame Atemzüge zu nehmen: ein, aus, geschehen lassen, loslassen; ein, aus, geschehen lassen, loslassen. Je öfter ihr dies tut, desto natürlicher fühlt es sich an, und mit jedem Mal verstärkt ihr die positive Wirkung noch ein bisschen mehr.
Entschließt euch zur Achtsamkeit! Ihr werdet sehen, dass ihr euch allein dadurch viel öfter an den Atem erinnert. Und je häufiger ihr in der beschriebenen Weise atmet, desto öfter werdet ihr euch daran erinnern, es zu tun, und desto mehr werdet ihr es genießen.«
Meditieren lernen
»Wenn ihr erst mal den Bogen heraushabt, von Augenblick zu Augenblick in der Achtsamkeit zu bleiben, könnt ihr euch als Nächstes der Achtsamkeitsmeditation zuwenden. Zu meditieren heißt eigentlich nur, Momente der Achtsamkeit aneinanderzureihen. Wir nehmen uns etwas Zeit, um uns hinzusetzen und uns auf unseren Atem zu konzentrieren. Wir machen nichts anderes, als wir bisher schon gemacht haben, nur eben länger.
Um die Achtsamkeitspraxis in unseren Alltag zu integrieren, tun wir dies täglich oder auch mehrmals täglich – oder sogar viele Male am Tag, wie wir es im Kloster tun, was ich Anfängern jedoch nicht empfehle. Achtsam zu sein fällt uns dadurch zunehmend leichter, und gleichzeitig bauen wir uns das auf, was ich gelegentlich als ›Achtsamkeits-Reservoir‹ bezeichne – einen Vorrat an Frieden und Kraft in unserem Inneren, auf den wir zurückgreifen können, wann immer wir unter Stress stehen oder besondere Herausforderungen zu meistern haben.
Eins verspreche ich euch: Es ist einfach. Wenn ihr atmen könnt, könnt ihr achtsam sein; und wenn ihr achtsam sein könnt, könnt ihr meditieren. Macht ihr das regelmäßig, werdet ihr merken, wie sich die positiven Wirkungen auf Körper und Geist von ganz alleine einstellen.«
»Aber …«, meldet sich Rodney, der ältere Mann, der aussieht, als würde er ständig eine fein säuberlich gefaltete Ausgabe des Sunday Telegraph in der Jackentasche herumtragen. »Was genau ist das Ziel der Meditation? Frieden zu finden? Den Blutdruck zu senken?« Nach einer Pause fügt er scherzend hinzu: »Die Welt zu retten?« Er klingt nüchtern und effizient, als würde er eine Checkliste durchgehen und die einzelnen Punkte abhaken.
»Das trifft alles zu, würde ich mal sagen.« Der Mönch lacht. »Aber das eigentliche Ziel, Rodney – wenn es bei der Meditation überhaupt so etwas wie ein Ziel gibt –, ist, in einen Zustand zu gelangen, in dem wir keine Ziele mehr brauchen.«
Eine Zeit lang sitzt der Mönch einfach da, und auch wir schweigen. Vielleicht ergeht es den anderen wie mir, und sie versuchen ebenfalls, sich auszumalen, wie es wohl wäre, keine Ziele mehr zu haben.
»Was ich meine, ist Folgendes«, fährt der Mönch schließlich fort. »Meditation bewirkt unter anderem, dass wir uns des gegenwärtigen Augenblicks so bewusst werden – durch die Konzentration auf das Ein- und Ausströmen des Atems und das Gefühl von Frieden, das sich dabei einstellt –, dass wir aufhören, unseren Fokus auf irgendwelche Ziele zu richten.
Es gibt Untersuchungen, die das belegen. In wissenschaftlichen Studien hat man festgestellt, dass sich beim Meditieren nach etwa 20 Minuten ein Wechsel vollzieht und wir statt aus der linken viel mehr aus der rechten Hirnhälfte heraus funktionieren. In einfachen Worten ausgedrückt: Wir sind nicht mehr so aktiv und zielorientiert. Stattdessen fühlen wir uns friedlicher und geerdeter, der Gedankenfluss verlangsamt sich, und wir sind offener für unsere Intuition, Gefühle, Kreativität und natürliche Freude, also stärker in Kontakt mit den tieferen Schichten unseres Seins.«
»Also …«, Rodney lässt nicht locker, »wie lange, glaubst du, wird es dauern, bis wir etwas von diesen positiven Wirkungen zu spüren bekommen – wenn wir täglich oder so gut wie täglich meditieren?«
»Es gibt eine Reihe von Forschungen zu den Wirkungen der Achtsamkeitsmeditation«, antwortet der Mönch. »In einer Studie stellten Forscher bei Teilnehmern, die acht Wochen lang täglich 20 Minuten meditiert hatten, physische Veränderungen im Gehirn fest. Auch war ihr Stresspegel generell niedriger, und sie schnitten im Vergleich zur Kontrollgruppe, die nicht meditierte, bei stressigen Multi-Tasking-Tests besser ab. Regelmäßiges, vorzugsweise tägliches Meditieren hat sich außerdem als gedächtnisstärkend erwiesen. Es lindert Depressionen und verlängert die Aufmerksamkeitsspanne.
Mit anderen Worten …« Der Mönch strahlt. »Es lohnt sich! Und sobald sich die ersten positiven Wirkungen einstellen, wirkt das zusätzlich motivierend. Viele Leute fangen mit dem Meditieren an, weil sie von den Vorzügen gehört haben; und dann bleiben sie dabei, weil sie diese am eigenen Leib erfahren haben und das Meditieren auf einmal zu genießen beginnen … Man bewegt sich also quasi von Gewinn zu Gewinn zu Gewinn.«
Es folgt eine Pause. Der Mönch schaut in die Runde. Nikki, die ich im Stillen die Yoga-Frau nenne, weil sie so aussieht, als würde sie regelmäßig ihre Asanas praktizieren, hebt die Hand.
»Darf ich eine praktische Frage stellen? Gibt es eine bestimmte Tageszeit, die sich besonders zum Meditieren anbietet?«
»Jede Zeit, die du für dich wählst und die in deinen Tagesablauf passt, ist die richtige«, antwortet der Mönch. »Natürlich empfiehlt es sich, die Zeit so zu wählen, dass du von anderen nicht gestört wirst. Sei also pragmatisch und schau, wann du dich am besten zurückziehen kannst.«
Wieder an uns alle gewandt, fährt er fort: »Schaltet euer Handy aus und sagt den Leuten, dass ihr eine Weile für euch sein möchtet – für 10, 15, 20 Minuten oder wie lange auch immer. Wenn ihr dann meditiert, und es kommen Geräusche – Flug- oder Verkehrslärm, Sirenen, Musik oder was auch immer –, lasst euch nicht irritieren. Regt euch nicht darüber auf. In der Meditation öffnen wir uns für den jetzigen Augenblick mit allem, was er beinhaltet – für das, ›was da ist‹.«
In die folgende Pause hinein meldet sich Debbie. Sie scheint sich komplett von ihrem Zuspätkommen erholt zu haben. »Wie oft soll ich meditieren?«, fragt sie. »Möglichst jeden Tag? Und wie lang soll eine solche Sitzung dauern?«
»Oje, da steckt ja sehr viel ›sollen‹ drin«, bemerkt der Mönch lachend.
Alle lachen, und Debbie steigt die Röte ins Gesicht.
»Ich bin Friseurin und habe zwei kleine Kinder und einen Hund, da ist es schwierig, zeitlich alles unterzukriegen«, erklärt sie. »Aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas zur Ruhe finden und es mir leichter fallen würde, alles unter einen Hut zu kriegen, wenn ich täglich meditieren würde.«
»Regelmäßig zu meditieren wird dir sicher helfen«, bestätigt der Mönch. »Wann und wie lang, das hängt davon ab, was für dich am praktikabelsten ist und sich am harmonischsten in deinen Tagesablauf einfügen lässt. Beschließe bewusst, es zu tun. Die Absicht zu fassen, das ist das Wichtigste.
Viele kommen mit 20 bis 25 Minuten gut zurecht, und in wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit des Meditierens wurde mit dieser Dauer gearbeitet. Aber in Stein gemeißelt ist das nicht. Manche sitzen lieber etwas länger, für andere darf es gern kürzer sein.«
Ich denke an Robert, der sich am liebsten mindestens 40 Minuten Zeit nimmt, weil er ziemlich lang braucht, um sich überhaupt in die Meditation hinein zu entspannen. Ich dagegen komme viel schneller rein, habe aber Schwierigkeiten, länger als 15 Minuten durchzuhalten.
Der Mönch fährt fort: »Wenn das Meditieren neu oder vergleichsweise neu für euch ist, empfehle ich, mit zehn Minuten zu beginnen und zu sehen, wie ihr damit zurechtkommt. Wenn euch selbst das am Anfang zu lang vorkommt, kann es sinnvoll sein, sogar auf fünf Minuten runterzugehen: Es gibt dabei keinen Druck und kein Gefühl von ›ich sollte‹. Es geht nur darum, euch ein paar Minuten zu gönnen, um wirklich ihr selbst zu sein, in euch hineinzulauschen und wahrzunehmen, was mit eurem Körper ist, welche Gefühle da sind, was aus der Umgebung an euch herandringt und so weiter.