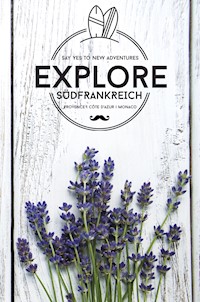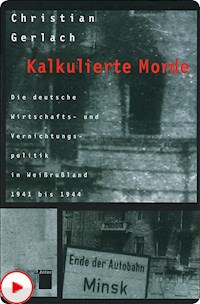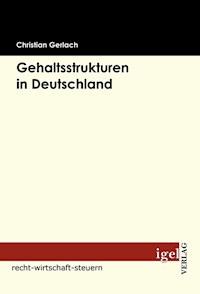16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christian Gerlach bietet mit diesem kompakten Überblick eine nach Themen geordnete Analyse der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden und schließt zugleich eine Lücke. Seine Studie untersucht erstmals systematisch das Vorgehen nichtdeutscher Regierungen und Gesellschaften gegen Juden. So kann sie zeigen, dass der Mord an den europäischen Juden ein Prozess war, an dem sich viele Gruppen mit ganz unterschiedlichen Motiven beteiligt haben. Nach einem kurzen chronologischen Aufriss analysiert Christian Gerlach der Reihe nach zentrale Themenkomplexe wie Kriegführung, Außenpolitik, rassistisches Denken, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Verfolgung nichtjüdischer Opfergruppen. Indem er sie in einen Wirkungszusammenhang stellt, legt er wichtige Aspekte jenseits der üblichen Erklärungsmuster frei. Auch das Verhalten und die Überlebensstrategien jüdischer und anderer Verfolgter werden dargestellt. Gerlachs beeindruckend kenntnisreiche und kluge Analyse ist eine zuverlässige neue Einführung in das wohl schwierigste historische Thema des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christian Gerlach
DER MORD AN DEN EUROPÄISCHEN JUDEN
URSACHEN, EREIGNISSE, DIMENSIONEN
Aus dem Englischen von Martin Richter
C.H.Beck
Zum Buch
Christian Gerlach bietet mit diesem Buch eine nach Themen geordnete Analyse der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden und schließt zugleich eine Lücke. Seine Studie untersucht erstmals systematisch das Vorgehen nichtdeutscher Regierungen und Gesellschaften gegen Juden. So kann sie zeigen, dass der Mord an den europäischen Juden ein Prozess war, an dem sich viele Gruppen mit ganz unterschiedlichen Motiven beteiligt haben.
Nach einem kurzen chronologischen Aufriss analysiert Christian Gerlach der Reihe nach zentrale Themenkomplexe wie Kriegführung, Außenpolitik, rassistisches Denken, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Verfolgung nichtjüdischer Opfergruppen. Indem er sie in einen Wirkungszusammenhang stellt, legt er wichtige Aspekte jenseits der üblichen Erklärungsmuster frei. Auch das Verhalten und die Überlebensstrategien jüdischer und anderer Verfolgter werden dargestellt. Gerlachs beeindruckend kenntnisreiche und kluge Analyse ist einezuverlässige neue Einführung in das wohl schwierigste historische Thema des 20. Jahrhunderts.
Über den Autor
Christian Gerlach ist Professor für Zeitgeschichte in globaler Perspektive an der Universität Bern. Er zählt zu den am besten ausgewiesenen Holocaust-Forschern der jüngeren Generation. Seine Bücher»Kalkulierte Morde«und»Extrem gewalttätige Gesellschaften«sind preisgekrönte Standardwerke.
Inhalt
Danksagung
Abkürzungen
1 Einleitung
Eine Vielfalt von Opfern
Wege zur Erforschung verschiedener Opfergruppen
Vielfältige Kontexte und Motive für Gewalt
Partizipatorische Gewalt
Terminologie und Aufbau des Buches
Teil I Verfolgung durch Deutsche
2 Vor 1933
Die soziale Stellung der Juden
Soziale Mobilität und europäische Juden
Antijüdische Einstellungen
Vorstellungen von «Lösungen»
Deutschland vor dem Nationalsozialismus: eine extrem gewalttätige Gesellschaft?
3 Von der Zwangsemigration zu Territorialplänen: 1933 bis 1941
Antijüdische Gesetze
Verfolgung durch Kommunalbehörden
Gewalt: NS-Organisationen, Beiträge aus der Bevölkerung und deren Reaktionen
Die Politik der erzwungenen Auswanderung
Emigration als vorherrschende jüdische Reaktion
Gewalt gegen Nichtjuden vor 1939
Der Beginn des Zweiten Weltkriegs und Gewalt gegen Nichtjuden
Die Judenverfolgung: 1939 bis 1941
4 Vom Massenmord zur umfassenden Vernichtung: 1941 bis 1942
Der Massenmord an den sowjetischen Juden
Herbst 1941: Die geographische Ausbreitung des Massenmords beginnt
Hitlers Grundsatzentscheidung, alle Juden Europas zu ermorden
Auf dem Weg zu einem Plan für die rasche und direkte Vernichtung
Zwei Beschleunigungen im Jahr 1942
Andere Teile Europas
Schlussfolgerungen
5 Die Ausweitung der Massenvernichtung: 1942 bis 1945
Vernichtung: Initiativen und Stopps
Deutsche Versuche, ausländische Zurückhaltung zu überwinden
Begrenzte deutsche Uneinigkeit: hausgemachte Hindernisse für den Plan zur totalen Vernichtung
Verfolgung in neu besetzten Gebieten
Maßnahmen, die ein Überleben ermöglichten
6 Strukturen und Akteure der Gewalt
Ein teilweise dezentralisierter Prozess
Verantwortlichkeit jenseits von SS und Polizei
Die an der Verfolgung Beteiligten
Autonome Entscheidungsprozesse unter an der Verfolgung Beteiligten
Wurzeln der Brutalität
Teil II Logiken der Verfolgung
7 Rassismus und antijüdisches Denken
Juden im Rahmen des Rassendenkens
Überall Rassenmischung – und ihre Folgen
Die Idee des Ariertums und innere Widersprüche des Rassendenkens
Von Differenzen zwischen rassenkundlichen Konzepten zu Widersprüchen zwischen Politik und Rassismus
Ethnische Stereotype statt Rassenuntersuchungen
Imperialistisches Denken und rassischer Chauvinismus
Warum war Imperialismus populär, und wie populär war er?
8 Zwangsarbeit, deutsche Gewalt und Juden
Das Zwangsarbeitsprogramm im Reichsgebiet
Die Behandlung ausländischer Zwangsarbeiter
Arbeitskräftereservoire und Zwangsarbeit: In den besetzten Ländern
Jüdische Arbeitskräfte: Das Selektionsprinzip
Verschiebung und Ersetzung von Arbeitskontingenten
Die Arbeitspolitik im Generalgouvernement und die Juden
Die Folgen des unqualifizierten Einsatzes jüdischer Arbeitskräfte
SS und Polizei als Organisatoren von Zwangsarbeit
Schlussbemerkung
9 Hungerpolitik und Massenmord
Die Hungerpolitik von 1941
Sowjetische Kriegsgefangene
Die direkte Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener und die Verbreitung des Wissens um ihr Schicksal
Die Behandlung anderer Kriegsgefangener
Andere Insassen totaler Institutionen
Die Ernährungspolitik und der Mord an 2 Millionen polnischen Juden
Warum ließ man nicht alle Juden verhungern?
Ernährung und Überlebenschancen von Juden: Das Beispiel Westeuropa
Ernährung und Vernichtung
10 Die Ökonomie von Absonderung, Enteignung, Zusammendrängung und Deportation
Der Einfluss der Siedlungspolitik
Gewinn von privatem Lebensraum: Wohnungsmangel und Judenverfolgung
Enteignung, Finanzen und Gewalt
Untergruben Judendeportationen in Eisenbahnzügen die deutsche Kriegsanstrengung?
11 Widerstandsbekämpfung und Judenvernichtung
Vier Phasen der Partisanenbekämpfung
Aufstandsfurcht und Judendeportation aus Westeuropa
Eine Tendenz zum Bürgerkrieg
Teil III Die europäische Dimension
12 Gesetzgebung gegen Juden in Europa: ein Vergleich
Länder
Phasen der antijüdischen Gesetzgebung
Themen
Schlussfolgerungen
13 Gespaltene Gesellschaften: Populäre Unterstützung für die Judenverfolgung
Lobbyarbeit: Verdrängung jüdischer Konkurrenten
Pogrome und Plünderungen
Propaganda, Denunziationen und Einverständnis mit Gewalt gegen Juden
Wachsende Feindseligkeit gegen Juden nach dem Krieg
Ein kurzer Überblick über Mitgefühl, Hilfe, Protest und Schutz
Zwischen antijüdischem Eifer, Protest und Schutz: Christliche Kirchen und Partisanen
Durch innere Konflikte geprägte Gesellschaften
14 Jenseits der Gesetzgebung: Nichtdeutsche Gewaltpolitik
Massenmordprogramme und eifrige Polizeikräfte
Ethnisch-religiöse Homogenisierungspolitik
Nationale Interessen und Außenpolitik
Schutz und fehlender Schutz
Ausbeutung, Vertreibung, Enteignung
Jüdische Opfer unter anderen Opfern
15 In den Labyrinthen der Verfolgung: Versuche zu überleben
Zentrale Überlebensstrategien
Gewaltige Schwierigkeiten beim Leben im Untergrund
Individuelle Voraussetzungen für das Überleben
Schwindender Zusammenhalt unter Juden
Überlebensstrategien anderer verfolgter Gruppen
Schluss
16 Schlussfolgerungen: Gruppenvernichtung in extrem gewalttätigen Gesellschaften
Logiken der Verfolgung: Wirtschaft, Ideologie und Multikausalität
Mehr als eine extrem gewalttätige Gesellschaft
Partizipatorische Gewalt
Bedingungen und Strategien des Überlebens
Anmerkungen
1 Einleitung
2 Vor 1933
3 Von der Zwangsemigration zu Territorialplänen: 1933 bis 1941
4 Vom Massenmord zur umfassenden Vernichtung: 1941 bis 1942
5 Die Ausweitung der Massenvernichtung: 1942 bis 1945
6 Strukturen und Akteure der Gewalt
7 Rassismus und antijüdisches Denken
8 Zwangsarbeit, deutsche Gewalt und Juden
9 Hungerpolitik und Massenmord
10 Die Ökonomie von Absonderung, Enteignung, Zusammendrängung und Deportation
11 Widerstandsbekämpfung und Judenvernichtung
Teil III Die europäische Dimension
12 Gesetzgebung gegen Juden in Europa: ein Vergleich
13 Gespaltene Gesellschaften: Populäre Unterstützung für die Judenverfolgung
14 Jenseits der Gesetzgebung: Nichtdeutsche Gewaltpolitik
15 In den Labyrinthen der Verfolgung: Versuche zu überleben
16 Schlussfolgerungen: Gruppenvernichtung in extrem gewalttätigen Gesellschaften
Bibliographie
Quellen
Darstellungen (einschließlich autobiographischen Materials)
Index
Danksagung
Historiker sind für ihre Arbeiten auf viele andere angewiesen. Wie so oft gehören dazu Archivare und Bibliothekare. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Archive, die ich für diese Studie genutzt habe, nicht zuletzt für ihre hilfreichen Anregungen. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vielen Bibliotheken, die ich bei den Recherchen für dieses Buch genutzt habe, vor allem die Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Hillman Library der University of Pittsburgh, der BTO und Schweizerischen Osteuropabibliothek der Universität Bern, besonders Therese Meier-Salzmann, sowie der Josef-Wulf-Bibliothek in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin.
Viele Kollegen waren so freundlich, ihre und meine Arbeit mit mir zu diskutieren und mir weitere Lektürehinweise zu geben. Ich danke insbesondere Götz Aly, Frank Bajohr, Ralf Banken, Hans Blom, Florent Brayard, William Brustein, Marc Buggeln, Marina Cattaruzza, Raya Cohen, Tim Cole, Markus Eikel, Bert Jan Flim, Stig Förster, Odd-Björn Fure, Alfred Gottwaldt †, Heiko Haumann, Sanela Hodzic, Alexander Korb, Patrick Kury, Pieter Lagrou, Irina Livezeanu, Wendy Lower, Christian Axboe Nielsen, Kathrin Paehler, Nicolas Patin, Berna Pekesen, Dieter Pohl, Julia Richers, Peter Romijn, Dirk Rupnow, Hans Safrian, Vladimir Solonari, Wichert Ten Have, Gregor Thum, Feliks Tych (inzwischen verstorben), Krisztián Ungváry, Anton Weiss-Wendt und Franziska Zaugg. Marcus Gryglewski, Anna Hájková, Helene Sinnreich und Nicholas Terry ließen mich ihre wichtigen, noch unveröffentlichten Werke lesen. Besonderer Dank für Hinweise auf relevante Dokumente gebührt meinen Freunden Andrej Angrick und Christoph Dieckmann, die ebenfalls ihre Erkenntnisse mit mir teilten.
Für vielfältige Hilfe bei meiner Forschung danke ich Daniela Heiniger und Florentina Wirz. Michael Wildt gab ein hilfreiches allgemeines Feedback für mein Manuskript und Alexa Stiller (die mir auch weitere Richtungen der Lektüre vorschlug) hilfreiche detaillierte Anregungen; beiden sage ich herzlichen Dank! Ich verdanke auch viele Erkenntnisse den unbekannten Lesern, die mein Konzept und Manuskript für Cambridge University Press prüften. Gregory Sax versuchte mich von Verbrechen gegen die englische Sprache abzuhalten, Peter Kenyon war für die weitere Überarbeitung verantwortlich. Auch Michael Watson von CUP investierte viel Arbeit, um dieses Buch durch seine umsichtigen und wertvollen Vorschläge zu verbessern. Für die deutsche Übersetzung und wichtige Hinweise bin ich Martin Richter sehr dankbar. Für alle verbliebenen sprachlichen und inhaltlichen Mängel des Buches bin ich natürlich allein verantwortlich. Einige Irrtümer wurden in der deutschen Ausgabe bereinigt.
Mehrere akademische Einrichtungen boten mir die Gelegenheit, Teilergebnisse dieser Studie zu präsentieren, darunter die Historischen Institute der University of Pittsburgh und der Universität Leiden, außerdem das Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien und das Mémorial de la Shoah in Paris. Solche Teilergebnisse wurden auch bei den folgenden Konferenzen präsentiert: «Territorialer und innerer Revisionismus: Die Politik der deutschen Verbündeten, 1938–1943», organisiert von den Universitäten Tübingen und Bern in Blaubeuren; «Towards an Integrated Perspective on Nazi Policies of Mass Murder» am Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities in Oslo; «The Holocaust and Other Genocides», organisiert von der ITF Academic Working Group in Den Haag; «Vernichtungskrieg, Reaktionen, Erinnerung: Die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion 1941–1944» im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst; «Rationierung: Logiken, Formen und Praktiken des Mangels» an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a. M.; «Umkämpfte Vergangenheit und Deutungskonkurrenzen: Geschichtspolitik und Forschungsperspektiven in Ungarn» an der Universität Bern; und beim 8. Zentralen Seminar von «Erinnern.at» an der Universität Graz. Ich danke allen Organisatoren dieser Konferenzen und Gastvorträge.
Schließlich half mir meine Familie mit ihrer Liebe über alle Maßen, das Buch zu vollenden. Ich schulde Magdi, Nina und Emilia mehr, als ich hier ausdrücken kann.
Abkürzungen
ADAP
Akten zur deutschen auswärtigen Politik
AIPN
Archiwum Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Archiv des Instituts für Nationales Gedenken – Kommission zur Verfolgung von Verbrechen gegen das polnische Volk, Warschau)
AMV
Archiv ministerstva vnitra (Archiv des Innenministeriums, Prag)
BA
Bundesarchiv, Berlin
BA D-H
Bundesarchiv, Dahlwitz-Hoppegarten
BAK
Bundesarchiv, Koblenz
BA-MA
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.
BAS
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
BBGFW
Bulletin der Berliner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung
BDC
Berlin Document Center (im Bundesarchiv, Berlin)
BdS
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
BGN
Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus
BNGS
Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik
CdS
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
CChlDK
Zentrum für die Aufbewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen, Moskau
CEH
Central European History (Zeitschrift)
DRZW
Militärisches Forschungsamt der Bundeswehr (Hrsg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg
GuG
Geschichte und Gesellschaft
HGS
Holocaust and Genocide Studies
IMG
Der Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd. 1–42 (Nürnberg, 1947–49)
JfW
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
JASF
Jahrbuch für Antisemitismusforschung
JGR
Journal of Genocide Research
JSS
Jewish Social Studies
KG
Kammergericht
LBIY
Leo Baeck Institute Yearbook
MadR
Boberach, Heinz (Hrsg.), Meldungen aus dem Reich: Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938–1945, Bd. 1–17 (Herrsching, 1984)
MGM
Militärgeschichtliche Mitteilungen
OKW
Oberkommando der Wehrmacht
PA AA
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes
RBD
Reichsbahndirektion (regional)
RHS
Revue de l’histoire de la Shoah/le monde juif
RMO
Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (der Sowjetunion)
RSHA
Reichssicherheitshauptamt
SA
Sturmabteilungen
SD
Sicherheitsdienst (der SS)
SDIY
Simon Dubnow Institute Yearbook
SS
Schutzstaffeln
SSPF
SS- und Polizeiführer
StA
Staatsanwaltschaft
SWCA
Simon Wiesenthal Center Annual
TSD
Theresienstädter Studien und Dokumente
VfZ
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
WVHA
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS
YVS
Yad Vashem Studies
ZfG
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
ZStL
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg
1 Einleitung
Dieses Buch bietet eine spezielle Perspektive auf die Vernichtung der europäischen Juden. Es stellt die Judenverfolgung in den Kontext voneinander abhängiger Maßnahmen bezüglich Kriegführung, Besatzung und Polizeiüberwachung, sozialer Fragen, Wirtschaft, rassistischer Ideologie und Populärrassismus. Die Studie beschreibt die Ermordung der Juden auch als Teil der massiven Gewalt gegen andere Gruppen und versucht zwischen diesen unterschiedlichen Formen der Gewalt Verbindungen herzustellen. Damit hebt sie sich von Narrativen ab, die die Verfolgung und Ermordung der Juden allein untersuchen und das Schicksal anderer Gruppen wenig beachten, auf ideengeschichtlicher Grundlage mit relativ wenig anderer Kontextualisierung. Außerdem richtet dieses Buch mehr als viele andere das Augenmerk auf die Verfolgung von Juden durch Nichtdeutsche und versucht eine übergreifende Analyse dieser Verfolgung über nationale Grenzen hinweg zu liefern.
Diese Perspektive leitet sich aus einem neuen Ansatz zum Verständnis von Massengewalt ab, den ich vor einiger Zeit vorgestellt habe.[1] Kurz gesagt, scheinen mir die herrschenden Erklärungen zu staatszentriert, zu fokussiert auf die Absichten und Pläne von Herrschenden und auf Rasse und ethnische Zugehörigkeit als Ursachen. Meist befassen sie sich mit der Verfolgung einer Gruppe ohne Beachtung anderer Opfergruppen. Historisch gesehen, waren dagegen in vielen Ländern unterschiedliche Bevölkerungsgruppen Opfer massiver physischer Gewalt, an der sich verschiedene soziale Gruppen im Verein mit Staatsorganen aus zahlreichen Gründen beteiligten. Diese drei Aspekte – der partizipatorische Charakter der Gewalt, mannigfache Opfergruppen und Multikausalität – waren miteinander verbunden. Einfach formuliert, hängt das Zustandekommen und die Durchschlagskraft von Massengewalt von breiter und vielfältiger Unterstützung ab, aber diese Unterstützung basiert auf einem Spektrum von Motiven und Interessen, durch die Gewalt sich in verschiedene Richtungen und in unterschiedlicher Intensität und Form ausbreitet. Da ich betone, dass Massengewalt auf komplexen partizipatorischen Prozessen beruht, spreche ich von extrem gewalttätigen Gesellschaften. Diese Phänomene lassen sich an vielen wichtigen Fällen von Massengewalt ablesen, etwa der Sowjetunion von den 1930er bis in die 1950er Jahre, dem spätosmanischen Reich (einschließlich der Vernichtung der Armenier), Kambodscha, Ruanda und Nordamerika im 19. Jahrhundert.
Dieselben Merkmale – breite Beteiligung, vielfältige Motive und verschiedene Opfergruppen – treten auch bei der Gewalt von Deutschen und Angehörigen anderer Nationen während des Zweiten Weltkriegs auf. Bevor ich das weiter ausführe, muss ich zunächst festhalten, dass es wenig Nutzen hat, sie nur extrem gewalttätige Gesellschaften zu nennen. Diese Klassifikation sollte weniger das Ziel als der Ausgangspunkt von Überlegungen sein, wie Verfolgung und Gewalt entstanden.
Eine Vielfalt von Opfern
Kurz vor Weihnachten 1944 erstellte das Konzentrationslager Buchenwald eine Monatsaufstellung der Gefangenen in Hauptlager und Außenlagern. In einer vorgedruckten Tabelle wurden die 63.837 Gefangenen aus 28 europäischen Ländern, dazu «Sonstige» und «Staatenlose», in 13 Kategorien eingeteilt: «Schutzhäftlinge» (meist politische Gefangene, darunter viele Franzosen), Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Angehörige der deutschen Wehrmacht, Geistliche, «Rotspanier», «ausländische Zivilarbeiter», Juden, «Asoziale», «Berufsverbrecher», «Sich.-[erungs]verwahrte», «Zigeuner» und (sowjetische) «Kriegsgefangene». Die drei größten Gruppen waren in dieser Reihenfolge politische Gefangene (eine Spezialität von Buchenwald), ausländische Arbeiter und Juden. Zusammen machten sie fast 90 % der Häftlinge aus, Juden allein etwa 20 %.[2] Viele dieser Gefangenen, Juden und Nichtjuden, erlebten die Befreiung nicht. Sie starben an Hunger und Krankheiten, besonders im überfüllten Hauptlager, und an Erschöpfung und Mord, vor allem während der Todesmärsche.
Nicht nur Juden wurden unter dem NS-Regime ermordet. Anders als oft angenommen wird, waren auch die meisten KZ-Häftlinge, abgesehen von der Periode November/Dezember 1938, keine Juden. Ab Mitte 1944 war wieder über ein Drittel jüdisch. Von 1938 bis 1941 waren in Buchenwald und seinen Außenlagern 14–19 % der Insassen Juden; am 1. Juni 1942 waren es 11 %, Ende Dezember 2,4 %. 1944 stieg ihre Zahl wieder – von unter 1 % im Mai auf über 24 %; Ende Februar 1945 waren es 32 %.[3] Insgesamt gab es unterschiedliche verfolgte Gruppen – Opfer verschiedener Politiken, gegen die sich unterschiedliche Arten von Hass richteten und die ihrerseits versuchten, der Repression zu entgehen und ihr Auskommen zu erhalten, indem sie mit den deutschen Besatzern, nationalen und kommunalen Behörden und anderen sozialen Gruppen interagierten.
Hierin ist der Fall Deutschlands nicht einzigartig. Es gab Anfang der 1940er Jahre nicht nur Judenverfolgungen durch andere Regime (und deren Zulassen durch andere Gesellschaften), meist wurden mehrere Bevölkerungsgruppen zugleich ihrer Berufe beraubt, enteignet und vertrieben, als Zwangsarbeiter ausgebeutet oder ermordet.
In vielen europäischen Ländern überstieg die Zahl der nichtjüdischen Opfer der Gewalt durch Deutschland und die Achsenmächte weit die der ermordeten Juden, selbst wenn man die militärischen Verluste ausklammert. In der Sowjetunion (in den Grenzen vom Mai 1941) waren etwa 30 % aller jenseits der Kampfhandlungen durch Deutschland verursachten Todesfälle Juden, in Frankreich 40 %, in Griechenland 20–22 % und in Italien und Jugoslawien je 6 %. Unter den Deutschen war etwa ein Drittel der Naziopfer jüdisch.[4] In Polen, Belgien (38 %) und Tschechien (32 %), machten Nichtjuden eine beträchtliche Minderheit der Opfer aus. In Ungarn waren die zivilen Todesopfer weitgehend Juden.[5]
Im Lauf des Zweiten Weltkriegs töteten Deutsche (und Menschen aus anderen Ländern) 6 Millionen Juden, aber auch 6–8 Millionen andere Nichtkombattanten. Die größte nichtjüdische Gruppe waren sowjetische Kriegsgefangene, von denen 3 Millionen starben. Partisanenbekämpfung auf dem Land (vor allem in den besetzten sowjetischen Gebieten, Jugoslawien und Griechenland) forderte etwa eine Million Todesopfer. Eine weitere Million, meist in Städten, starb durch Hungersnöte, die direkt von der deutschen Politik verursacht wurden. Die Opferzahl durch Terrormaßnahmen in den Städten war hoch, aber ich kenne keine verlässlichen europaweiten Zahlen. Von den etwa 12 Millionen Menschen, die als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht wurden, starben vielleicht 300.000 – mehr als die ermordeten Behinderten und Sinti und Roma.[6]
Wenn Historiker bisher nichtjüdische Opfer untersuchten, konzentrierten sich viele Werke auf bestimmte Gruppen: Behinderte, Sinti und Roma («Zigeuner»), Homosexuelle, Zeugen Jehovas oder politische Gegner. Das hatte viel mit einer Forschungsperspektive zu tun, die sich auf Gewalt gegen Deutsche konzentrierte, und in einigen Fällen mit Interessengruppen, die das Andenken an ihr Schicksal förderten, um dadurch die Konstruktion ihrer Gruppenidentität zu stärken. Unter Deutschen diente die Fokussierung auf deutsche Opfergruppen einer nationalistischen Sicht, die Nicht-Landsleute als Opfer ausblendete und den deutschen Imperialismus soweit wie möglich ignorierte. Die Behinderten und Roma schienen der Untersuchung wert, weil sie mit ähnlichen Methoden ermordet wurden wie die Juden oder weil teilweise dasselbe Personal an den Morden beteiligt war. Dagegen wird das vorliegende Buch über die Judenverfolgung sich auch ausführlich mit den Vorgängen mit den meisten Todesopfern beschäftigen: der Vernichtung sowjetischer Kriegsgefangener, der Partisanenbekämpfung, den Hungersnöten und dem Zwangsarbeitsprogramm.
Da noch viel Forschungsarbeit zu tun ist, könnte man natürlich jede dieser Gruppen einzeln betrachten. Auf lange Sicht reicht eine getrennte Betrachtungsweise aber nicht aus.[7] Diese Studie widmet sich vielmehr solchen Fragen wie den Gründen, warum verschiedene Gruppen zu Opfern von Massengewalt wurden, was das Schicksal dieser Gruppen verband, die gegen sie ergriffenen Maßnahmen und die Motive dafür. In welchem Ausmaß fand Gewalt gegen unterschiedliche Gruppen im gleichen Zusammenhang statt? Was bedeutete es für jede Gruppe, sich in einem weitergehenden Netz von Verfolgung bewegen zu müssen? Was ging in Gesellschaften vor sich, in denen nicht nur eine, sondern viele Gruppen ausgegrenzt, ihrer Rechte beraubt, entmenschlicht oder zu feindlichen Elementen erklärt wurden? Welche Beziehungen gab es zwischen Opfergruppen, deutschen Funktionsträgern und nichtdeutschen Instanzen? Und wie gut waren die Verfolgten in ihre Gesellschaften integriert? Wenn wir solche Verbindungen herstellen, können wir nicht nur das Gesamtbild besser verstehen, sondern auch die Verfolgung jeder einzelnen Gruppe, einschließlich der Juden.
Wege zur Erforschung verschiedener Opfergruppen
Dieses Buch setzt die Verfolgung und Ermordung der Juden ins Zentrum und sucht nach Verbindungen zu anderen Verfolgungen und gemeinsamen Kontexten der Gewalt gegen Juden und andere Gruppen. Es bietet auch vergleichende Perspektiven, geht jedoch über den nicht ungewöhnlichen, aber unproduktiven Ansatz ‹Wer litt am meisten?› hinaus.
Andere Ansätze wären möglich. Henry Friedlander analysierte die Kontinuität von Maßnahmen, Ideen und Tätern zwischen der Ermordung von Behinderten, Juden und Roma. Dieter Pohl hat eine allgemeine, nach Opfergruppen getrennte Darstellung der unterschiedlichen Naziverbrechen geliefert. Doris Bergen legte ein kurzes Buch mit einem knappen Blick auf die Maßnahmen auch gegen andere Opfergruppen vor, und Donald Bloxham stellte die Judenvernichtung primär in den Kontext dessen, was er «Ethnopolitik» nannte.[8]
Es sind auch noch weitere Sichtweisen vorstellbar – indem man zum Beispiel keine Opfergruppe oder eine andere Gruppe als die Juden in den Mittelpunkt stellt.[9] Doch die Realität sieht anders aus. Es gibt auf Englisch tausende von Büchern über die Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden. Ihre Zahl kennt niemand genau, dagegen kann man mit Sicherheit sagen, wie viele Fachbücher in englischer Sprache allein von der zweitgrößten Gruppe der NS-Opfer, den 3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, handeln: keins. Weder eine Monographie noch ein Aufsatzband behandeln dieses Thema auf Englisch. Es gibt daher gute Gründe, etwas mehr über nichtjüdische Opfer zu sprechen und die jüdischen Opfer nicht ständig ins Zentrum zu stellen, wenn man über deutsche Gewalt spricht. Das vorliegende Buch ist aber nicht so avantgardistisch, dass es dies zum übergreifenden Strukturprinzip erhebt. Es behandelt die nichtjüdischen Opfergruppen nicht so eigenständig, wie sie es verdienen. Die Tatsache, dass das Schicksal der europäischen Juden im Mittelpunkt des Buches steht, bedeutet allerdings nicht, dass Juden zwangsläufig im Zentrum des Denkens der historischen Akteure standen. Meistens war es nicht so.
Zu anderen möglichen Wegen, sich mit verschiedenen Opfergruppen zu befassen, gehört es, all jene zu untersuchen, die in einem Land, einer Region oder einer Stadt verfolgt wurden. So berichtete zum Beispiel eine Kommission sowjetischer Gerichtsmediziner im September 1944 über deutsche Gräueltaten in Černigov (Ukraine):
Im November 1941 wurde eine so genannte dreitägige Kampagne zur Erschießung der jüdischen Bevölkerung der Stadt durchgeführt. Im Januar 1942 wurden die psychisch Kranken erschossen, im Frühjahr 1942 die Zigeuner, und in den anschließenden Monaten des Jahres 1942 sowjetische Aktivisten. Im Februar und März 1943 wurden die Kriegsgefangenen und diejenigen Zivilisten, die in Lager geraten waren, erschossen.[10]
Tatsächlich wurden die 2000 Roma im Juni oder August 1942 erschossen statt im Frühjahr, und die Erschießung der geistig Behinderten begann im Oktober 1941. Von diesen Tatsachen ausgehend, könnte man die politischen, ideologischen, organisatorischen und anderen Verbindungen zwischen diesen Massakern wie auch ihre sozialen Auswirkungen untersuchen, eventuell auch im Zusammenhang mit den umfangreichen Deportationen von Zwangsarbeitern aus der Stadt 1942/43 und der Partisanenbekämpfung in der Umgebung.
Man könnte auch erforschen, wie ein und dieselbe deutsche Organisation, Institution oder Einheit (oder eine Person) gegen unterschiedliche Gruppen vorging. So wurden zum Beispiel die Motive der ‹unpolitischen› Männer in deutschen Ordnungspolizeibataillonen diskutiert, die 1941 und 1942 eine große Zahl von Juden erschossen.[11] In der Debatte darüber, wie diese Männer töten konnten, zog kaum ein Autor in Betracht, dass dieselben Einheiten auch gegenüber anderen Gruppen extreme Gewalt ausübten. Bevor es Juden in Polen erschoss, hatte etwa das heiß diskutierte Reservepolizeibataillon 101.1940 an der Deportation von fast 37.000 Juden und Nichtjuden von West- nach Zentralpolen mitgewirkt, 1941 das hungernde Warschauer Ghetto bewacht und im selben Jahr Transporte mit tödlich erschöpften sowjetischen Kriegsgefangenen begleitet.[12] Das Polizeibataillon 322, um das sich ähnliche Debatten drehten, deportierte oder tötete in denselben Monaten des Jahres 1941, als es in der westlichen Sowjetunion Juden erschoss, auch Zivilisten bei der Partisanenbekämpfung und beteiligte sich 1943/44 an blutigen Operationen gegen Partisanen in Jugoslawien und Albanien.[13] Der Ansatz, die Gewaltausübung einer Einheit gegenüber unterschiedlichen Gruppen zu untersuchen, hat sich im Fall der 253. Infanteriedivision als fruchtbar erwiesen, die in der UdSSR an der Front stand. Diese Truppe tötete versprengte Rotarmisten, nahm zivile Geiseln und führte in Gegenden, wo es Partisanenaktivität gab, Vergeltungsmaßnahmen gegen Dörfer aus oder plünderte sie. Die Division benutzte auch erst sowjetische Kriegsgefangene und dann Zivilisten als Zwangsarbeiter, erschoss einige Kriegsgefangene und schickte andere zurück, nachdem sie bis zur völligen Erschöpfung ausgenutzt worden waren, zwang Zivilisten zur Minenräumung, schickte Zwangsarbeiter ins Reich, sperrte 1944 33.000 Frauen und Kinder in ein improvisiertes Lager in Frontnähe, das vermint und bewusst mit Typhus infiziert wurde (wobei 9000 Menschen starben), und zerstörte bei ihrem Rückzug Häuser auf einer Fläche von 5000 Quadratkilometern. Eine Studie hat gezeigt, dass fast alle Teile der Division sich an Gewalttaten gegen Nichtkombattanten beteiligten und dass dabei manche ihrer Maßnahmen und Strategien ohne Befehle von oben selbst entwickelt wurden.[14] Die 1. Gebirgs-Division war 1941 am Pogrom gegen Juden im ukrainischen Lwow beteiligt, tötete 1943/44 tausende von Zivilisten beim Antipartisanenkampf in Jugoslawien, Griechenland und Albanien und erschoss Geiseln. Dazu ermordete sie italienische Offiziere und Soldaten auf der griechischen Insel Kephalonia, nachdem Italien vor den Alliierten kapituliert hatte, und half bei der Deportation von Juden aus Nordwestgriechenland, die später in Auschwitz ermordet wurden.[15]
Eine weitere Reihe von Fragen lässt sich an Dokumente wie die schon erwähnte Häftlingsliste aus Buchenwald knüpfen. Hier hatten die Deutschen Menschen aus ganz verschiedenen Gruppen an einem Ort zusammengepfercht. Gelang es ihnen aber wirklich, sie entsprechend der 13 säuberlichen Kategorien unterschiedlich zu behandeln? Erhielten sie unterschiedliche Essensrationen, Kleidung oder medizinische Versorgung? Konnte das Wachpersonal sie räumlich trennen? Konnten die Gefangenen zu unterschiedlichen Arten von Arbeit gezwungen werden? Hatten die Wachen in dem überfüllten Lager Zeit, die Häftlinge aus verschiedenen Gruppen unterschiedlich zu misshandeln? Oder ebneten die Umstände die Misshandlungen so ein, dass sie für alle gleich wurden?[16] Wie weit war also die Situation in Buchenwald unter Kontrolle und verlief nach Plan? Wurden Ideen einer rassisch-sozialen Hierarchie tatsächlich umgesetzt (wie es den deutschen Organisatoren in Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlagern oft möglich war)? Und worin bestanden die folgenschweren Dynamiken bei der Interaktion unter den Gefangenen, die gemäß Kategorien und Nationalitäten 100 verschiedenen Gruppen angehörten und mindestens 24 Sprachen sprachen?
Für Zivilisten gab es noch andere Lager mit mehreren Funktionen, einige unter Leitung der Wehrmacht.[17] Auch hier scheint das Organisieren der Gewalt schwieriger gewesen zu sein als erwartet, und Menschen, die zuerst unterschiedlichen Arten von Verfolgung ausgesetzt waren, wurden zusammengeworfen. Analoge Beobachtungen kann man an anderen Lagern wie dem deutschen Lager im serbischen Semlin (Zajmiste) und dem kroatischen Lager Jasenovac machen. Selbst eine scheinbar einheitliche Gruppe bestand oft aus unterschiedlichen Untergruppen, wie die nichtjüdischen Polen in Mauthausen, zu denen Intellektuelle, Zwangsarbeiter, Widerstandskämpfer und Zwangsevakuierte aus Warschau gehörten.[18]
Nicht alle diese Ansätze können im vorliegenden Buch verfolgt und nicht all diese Fragen beantwortet werden. Als Synthese kann es keine umfassende Studie einzelner Orte, Einheiten oder Institutionen bieten. Es verfolgt vielmehr das Schicksal einer Gruppe und versucht systematisch darzustellen, wie ihr Schicksal mit der Behandlung anderer Menschen verknüpft war. Das ist so bisher noch nicht geschehen. Man könnte sagen, Juden befanden sich in einem fast unentrinnbaren Labyrinth der Verfolgung; gleichzeitig waren aber auch andere Gruppen in ihren eigenen Labyrinthen gefangen. Darum werde ich auch Überlebens- und Bewältigungsstrategien der unterschiedlichen Gruppen vergleichen.
Vielfältige Kontexte und Motive für Gewalt
Wie bei der Judenverfolgung muss jeder, der die nichtjüdischen Opfer von Gewaltanwendung der Achsenmächte insgesamt betrachtet, auch den Imperialismus einbeziehen. Etwa 300–350.000 der 6–8 Millionen ermordeten Nichtjuden waren Deutsche, d.h. aus deutscher Perspektive waren rund 95 % Ausländer. Von den 6 Millionen ermordeten Juden waren 165.000 Deutsche, also 97 % Ausländer.[19] Quantitativ gesehen trugen ausländische Nichtjuden ein fast zehnmal so hohes Risiko, unter dem NS-Regime getötet zu werden (3–4 % aus einer Bevölkerung von 220 Millionen) wie deutsche Nichtjuden (0,4–0,5 %). Diese Tendenz ist in gewissem Maße auch bei Juden sichtbar, deren Risiko, getötet zu werden, viel höher lag als bei Nichtjuden: Ein Drittel der deutschen Juden, aber über 80 % der nichtdeutschen Juden wurden ermordet.[20] Die weitaus meisten getöteten Juden und Nichtjuden waren Ausländer; die meisten starben in deutsch-besetzten Ländern, und selbstverständlich starben die meisten nach September 1939. Darum ist es schwer, das Schicksal dieser Menschen losgelöst von Krieg und Besatzung zu analysieren. Und es versteht sich, dass Deutschland den Expansionskrieg nicht nur führte, um mehr Juden unter seine Kontrolle zu bringen.
Hätte das NS-Regime im Sommer 1939, vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, geendet, so würde man sich daran erinnern, dass es mehrere tausend Todesopfer verursacht, deutsche, österreichische und tschechische Juden verfolgt und die Hälfte von ihnen ins Exil getrieben, über 100.000 politische Gegner und zehntausende Angehörige sozialer Randgruppen eingesperrt und 300.000 Menschen zwangssterilisiert hatte. Zu jenem Zeitpunkt gab es innerhalb und außerhalb Europas viele deutlich brutalere Regime. Wäre Nazideutschland im Mai 1941 zusammengebrochen, so würde man sich dessen als einem Land erinnern, das einen Angriffskrieg geführt, Zwangsarbeiter deportiert, 300.000 Juden und Nichtjuden aus Westpolen nach Zentralpolen deportiert und 200.000 Zivilisten ermordet hatte: die Hälfte dieser Toten waren geistig Behinderte in Deutschland und Polen, ein Viertel gehörte der polnischen Führungsschicht an, Zehntausende starben unschuldig bei deutschen Luftangriffen und viele Tausende waren Juden, die in großen Ghettos verhungerten oder im Herbst 1939 ermordet wurden.[21] Zu diesem Zeitpunkt hatten die sowjetische und japanische Politik Millionen von Opfern gefordert und die faschistischen Regime Italiens (in Afrika) und Spaniens mehr Zivilisten getötet als Deutschland. Soldaten zogen damals in den Kampf, nachdem sie Wochenschauen über Gräueltaten in China, Äthiopien und Spanien gesehen hatten.[22] Erst später überstieg die durch Nazideutschland verursachte Opferzahl die all der genannten Regime und Gesellschaften. Doch am 13. Mai 1940, als Winston Churchill britischer Premierminister wurde, war es übertrieben, dass er vom NS-Regime als «unübertroffen im dunklen und beklagenswerten Katalog menschlicher Verbrechen» sprach.[23]
Aus diesem Grund ist auch die prozessuale Dimension wichtig, wenn man Verbindungen zwischen unterschiedlichen Formen und Zielrichtungen von Gewalt sucht. Es kann also illustrativ sein, zeitliche Cluster zu identifizieren. In Tabelle 1.1 folgt eine sehr provisorische Version auf der Makroebene. Fast alle deutschen Morde an Zivilisten und anderen Nichtkombattanten fanden während des Zweiten Weltkriegs statt; genauer starben 95 % der Opfer nach dem Einmarsch in die Sowjetunion 1941. Die folgende Tabelle zeigt die intensivste Periode der Gewalt unter NS-Herrschaft mit Bezug auf jede der großen Opfergruppen:
Tabelle 1.1: Zeiträume der größten Vernichtung[24]
Opfergruppe
1940
1941
1942
1943
1944
Sowjetische Kriegsgefangene
----------
Opfer von Hungersnot
-------
Juden
--------
Zwangsarbeiter
---------------
Partisanenbekämpfung
----------------
Bürgerkriege
--------------
Als der Krieg härter wurde, wurden auch die Verfolgungen deutlich brutaler. Geographisch breitete sich die Gewalt von den besetzten sowjetischen Gebieten und Jugoslawien in andere Teile Europas aus wie in ein immer größeres rückwärtiges Gebiet. Als der Ausgang des Weltkonflikts 1941/42 auf Messers Schneide zu stehen schien, wurde der deutsche Versuch intensiver, sich Europas Ressourcen – zuerst Nahrungsmittel, dann Arbeitskräfte – anzueignen. Den sowjetischen Kriegsgefangenen Nahrung zu verweigern, verursachte Millionen Tote. Sie waren 1941 die größte Opfergruppe. 1942 waren es die Juden, und 1943 lagen Juden und Zivilisten, die der Unterstützung für Partisanen verdächtigt wurden, gleichauf. Die Ernährungspolitik stand auch mit der Ermordung der Juden in Polen und anderswo in Zusammenhang.[25] Der Höhepunkt der Judenvernichtung fiel mit einer gigantischen Mobilisierung von Arbeitskräften zusammen, vor allem sowjetischen und polnischen Zivilisten, deren Reservoir für Deutschland groß genug war, um auf die stark geschwächten sowjetischen Kriegsgefangenen sowie Juden zu verzichten. In der zweiten Kriegshälfte konzentrierte sich die deutsche Führung darauf, Arbeitskräfte auf dem Land auszuheben und Widerstand gegen ihre Besatzung zu bekämpfen. Das Okkupationsregime auf dem Land wurde noch härter, indem die Besteuerung und die Requirierung von Lebensmitteln sich verstärkten[26] und es schwieriger wurde, sich zu verstecken, auch für Juden. Gewalttätige Konflikte brachen auch innerhalb Gesellschaften besetzter Länder offen aus. Sie entstanden aus politischen Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft, aber auch aus früheren internen Spannungen, zumal als viele Menschen verarmten und unterdrückt wurden und einige wenige profitierten. Natürlich sind das nur Tendenzen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Örtlich konnten Ereignisse oft ganz anders ablaufen.
Viele Fakten legen nahe, dass nicht nur antijüdische Einstellungen, sondern auch andere Faktoren das Schicksal von Juden und ihre Überlebenschancen beeinflussten. Die NS-Führung erlaubte es Juden bis 1938, Funktionen als Unternehmer und Fachkräfte in der Wirtschaft auszufüllen; 1944 deportierte sie Juden als Zwangsarbeiter nach Deutschland, nachdem sie das Reich zuvor für mehr oder weniger ‹judenfrei› erklärt hatte; und die große Mehrzahl der britischen, US-amerikanischen, französischen und jugoslawischen Juden in deutschen Kriegsgefangenenlagern überlebte den Krieg. Auch die scharf judenfeindliche Regierung Rumäniens organisierte zunächst den Massenmord oder Hungertod von mindestens 250.000 rumänischen und ukrainischen Juden im besetzten Transnistrien, weigerte sich dann aber, weitere 250.000 rumänische Juden an Deutschland auszuliefern, und ließ sie überleben. Dieses Buch untersucht solche Faktoren.
Partizipatorische Gewalt
Je mehr Opfergruppen ins Bild kommen, desto klarer wird, dass ein breites Spektrum von Personen an der Gewalt beteiligt war. Verfolgung ging nicht nur von zentralisierten Regierungsmaßnahmen und einer Handvoll staatlicher Organisationen aus, vor allem SS und Polizei. Die meisten sowjetischen Kriegsgefangenen starben unter der Aufsicht der Wehrmacht. Die Bedingungen für Zwangsarbeiter wurden teilweise vom Management privater Firmen bestimmt, manchmal auch von den Kommandanten militärischer Einheiten. Zivil- und Militärverwaltungen organisierten die Rekrutierung von Zwangsarbeitern und waren auch für die Ernährungspolitik allgemein und für die Ernährung, Unterbringung und Beschäftigung von Juden zuständig, zumindest bis 1942/43 und an manchen Orten noch länger. Sie führten auch viele Selektionen von Juden zu Zwangsarbeit oder Ermordung durch. Obwohl SS und Polizei die meisten Massenmorde an Juden begingen, bedeutet das nicht, dass sie allein die jeweils zugrunde liegende Politik bestimmten. Auch die unterschiedlichen Haltungen, Interessen, Lebensgeschichten und Bildungswege von Personen außerhalb SS und Polizei, die diese Maßnahmen mitbestimmten, sind wichtig.
Besatzungspolitik war wichtig, weil die überwiegende Zahl der Opfer, auch der jüdischen Opfer, aus besetzten Ländern stammte. Es gab aber keine deutsche Institution, die allein die Verfolgung der europäischen Juden organisierte, so wie auch keine einzelne NS-Behörde den Völkern Europas einen Platz in der Hierarchie zuwies. «Weder gab es eine Landkarte, die zeigte, wie ein deutsches Europa nach dem ‹Endsieg› aussehen sollte, noch eine Planskizze für die Vernichtung der europäischen Juden.»[27] Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Analyse. Die oft zitierte ‹Neue Ordnung›, die Deutschland einführte, war nirgends definiert. Es gab kein geplantes oder kohärentes Besatzungssystem im ganzen deutsch kontrollierten Europa – fast jedes besetzte Land erhielt einen anderen Status, und die Besatzung wurde überall unterschiedlich organisiert. Daher scheint es nötig, die Muster der Besatzungspraxis zu verstehen. Diese Praxis wurde von vielfältigen Akteuren geprägt: der Führung in Berlin, den Ministerien und anderen Zentralbehörden, unterschiedlichen Typen von Zivil- und Militärverwaltungen, die weitreichende Autonomie genossen, und in gewissem Maße auch SS und Polizei. Das wiederum bedeutet, dass diese Akteure auf der Grundlage unterschiedlicher Interessen und Haltungen handelten. Viele beteiligte Personen waren nicht einmal Mitglieder der NSDAP, sondern verschiedene Arten von Konservativen, Chauvinisten und Rassisten (siehe Kapitel 6). Selbst unter echten Nazis waren politische Ideologie und Rassendenken nicht konsistent; so gab es zum Beispiel keine klare und unzweideutige «rassische» Bewertung der Slawen (siehe Kapitel 7).
Genozidexperten und Holocaustforscher haben sich überwiegend auf staatlich organisierte Verbrechen konzentriert. Das daraus entstandene Narrativ in den sogenannten Holocauststudien ist eine gedankliche Falle, in welcher allein der Staat handelt und die Opfer bloß reagieren oder völlig passiv und machtlos sind. Nach weitverbreiteter Anschauung wurde die Verfolgung von Vertretern des Staatsapparats ausgeführt, um Regierungspolitik direkt umzusetzen. Einer der Gründe, warum die Geschichte von Tätern und Opfern häufig nicht zusammenzupassen scheint, ist auch methodologischer Art – Tätergeschichte ist als politische Geschichte geschrieben worden, Opfergeschichte eher als Sozialgeschichte.
Um diese Diskrepanz zu überwinden, muss die Geschichte von Massengewalt stärker als Geschichte sozialer Akteure geschrieben werden.[28] Ein solcher Ansatz richtet sich auch gegen die missliche Tendenz in Studien über den Nationalsozialismus, den Staat, ‹die Deutschen›, ‹die Polen› usw. als monolithische Blöcke darzustellen. Dies verdeckt Unterschiede zwischen sozialen Gruppen und Widersprüche im persönlichen, lokalen und regionalen Verhalten. Nehmen wir etwa die Partisanenbekämpfung. Natürlich sollten deutsche Strategien, deutsche Haltungen gegenüber der unterworfenen Bevölkerung und eine Untersuchung von Wehrmacht, SS, Polizei und Verwaltung dazugehören, wenn man ihre Geschichte schreibt. Doch in keinem Land konnten deutsche Funktionsträger die örtliche Bevölkerung oder die nationale Regierung, soweit vorhanden, als politischen Faktor völlig ignorieren. Und am Kampf gegen Partisanen waren meist einheimische Behörden, Polizisten oder paramilitärische Kräfte beteiligt. Deutsche versuchten diese Kräfte zu benutzen, doch diese versuchten umgekehrt genauso, die Deutschen zu instrumentalisieren. Partisanenkonflikte erwuchsen nicht nur aus der deutschen (oder italienischen, bulgarischen usw.) Besatzung, sondern auch aus schon bestehenden Spannungen in den jeweiligen Gesellschaften. Und die Besatzung heizte Konflikte unter Griechen, Sowjetbürgern, Italienern und anderen weiter an. Alle Guerrillakriege enthielten ein Element innerer Konflikte, und einige entwickelten sich unter der deutschen Besatzung Anfang der 1940er Jahre zu offenen Bürgerkriegen. Häufig kämpften nicht nur zwei, sondern mehrere Gruppen um kontrastierende Vorstellungen über die Zukunft ihres Landes. Es wäre möglich, aber zu eng, dies allein als Geschichte der Behandlung anderer Völker durch die Nazis zu schreiben. Wenn man die Einheimischen in die Analyse einbezieht, ließe es sich immer noch als rein politische Geschichte schreiben, doch auch dieser Ansatz würde viele weitere Zusammenhänge ausklammern. Darum plädiere ich dafür, Elemente einer Sozialgeschichte der Massengewalt einzubeziehen, die in diesem Fall auch ein besseres Verständnis der Überlebenschancen von Juden ermöglicht, die sich inmitten solcher Konflikte befanden (siehe Kapitel 11). Ich werde ähnlich zum partizipatorischen Charakter von Hungersnöten argumentieren; sie sind komplexe soziale Prozesse, die keine Regierung – nicht einmal eine nationalsozialistische – völlig unter Kontrolle hat. Marktmechanismen halfen Juden manchmal zu überleben, zumindest für einige Zeit, aber gewaltsame Maßnahmen versuchten solchen Überlebensstrategien oft entgegenzuwirken (siehe Kapitel 9).
Im Zusammenhang mit den beiden Themen ‹Sicherheit› und Ernährung geschah die Verfolgung von Juden und anderen in einem Rahmen von eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Kommunikation, zahlreichen Verboten und Drohungen, von Registrierungen, Kontrollen, Razzien, der Notwendigkeit des Besitzens offizieller Bescheinigungen und Papiere und von Rationierung, Inflation und Schwarzmärkten – all dies machte den Kampf ums Überleben so schwer. Und die Verfolgung fand vor dem Hintergrund schwindender Solidarität statt, die mit der sozialen Zersplitterung in konfliktgeplagten Ländern einherging. Wer eine oder mehrere Verfolgungen untersuchen will, kann die Krisen europäischer Gesellschaften nicht beiseitelassen.
Selbst wenn man sich auf die deutschen Beteiligten an der Verfolgung konzentriert, reicht der Blick auf Regierungspolitik nicht aus. Möglichkeiten, lokal an der Entstehung von Maßnahmen innerhalb des Staatsapparats mitzuwirken, Initiativen ‹von unten›, Chancen für die Vordenker gewaltsamer Konzepte und Denunziationen – all das modifizierte oder verwässerte das staatliche Gewaltmonopol. Viele Deutsche, die Gewalt in Gang setzten oder verübten, waren keine Nazis, sondern von anderen als explizit nationalsozialistischen Überzeugungen (z.B. christlichen, konservativen, nationalistischen, antikommunistischen) motiviert (siehe Kapitel 6). Auch das unterstreicht die Notwendigkeit, mehr Sozialgeschichte in die heutige Tätergeschichte einzubringen. Wenn man Opferperspektiven rekonstruiert, wird ganz klar, dass die Verfolgten nicht nur mit Strukturen, Behörden oder Ämtern, sondern mit Menschen interagierten und mit ihnen einen Modus des Überlebens zu finden versuchten.
Der Blick auf Deutsche reicht aber nicht aus. Die Gewalt gegen Juden während des Zweiten Weltkriegs war nicht nur geographisch von europäischem Ausmaß, sondern hatte auch eine europäische politische Dimension über das deutsche Handeln hinaus. Die Wehrmacht besetzte Nordfrankreich vier Jahre und ganz Frankreich anderthalb Jahre lang, und dennoch überlebten drei Viertel der französischen Juden. Dies zeigt die Grenzen deutscher Macht, was wiederum bedeutet, dass der Einfluss nichtdeutscher Regierungen und Gesellschaften auf Massengewalt in den 1930er und 1940er Jahren untersucht werden muss. Wir werden sehen, dass die Rolle von Nichtdeutschen sehr wichtig war und über die relativ kleine Zahl direkter Mordaktionen hinausging (Nichtdeutsche, die nicht unter deutschem Kommando standen, töteten nicht mehr als 5–6 % der 6 Millionen jüdischer Opfer). Ausländische Einflüsse waren komplex, wie sich erneut am Beispiel Frankreich zeigt, das eine weitgehend judenfeindliche nationale Regierung und Verwaltung besaß, und eine Gesellschaft, in der viele Bürger ebenfalls Juden ablehnten, wo aber Deportation und Mord häufig sabotiert wurden. Auf keinen Fall soll das, was ich die «europäische Dimension» nenne, heißen, dass Europäer einmütig handelten und insgesamt die Judenverfolgung unterstützten. Diese europäische Dimension ist bereits intensiv auf nationaler Ebene untersucht worden, aber bis jetzt noch kaum systematisch. Mein Versuch in dieser Richtung (in Kapitel 12–14) ist durch den Ansatz der globalen Geschichte beeinflusst, die über einzelne Nationalgeschichten hinauszugehen versucht und grenzüberschreitende Verbindungen und Vergleiche vornimmt, unter Einbezug nichtstaatlicher Akteure. In den 1990er Jahren wurde intensiv über deutsche Akteure geforscht, nach 2000 stärker zu Nichtdeutschen. Meine Darstellung versucht beide Tendenzen zu verbinden.[29]
Das führt uns zu einigen wichtigen Limitationen dieses Buches. Es ist eine Synthese, keine Gesamtdarstellung, die alle Aspekte des Themas behandelt. Es befasst sich nicht mit den Positionen und Handlungen von Staaten, die gegen Deutschland kämpften, und mit den Nachwirkungen der Verfolgung; auch die vielen Interpretationen und Debatten in der Geschichtsschreibung diskutiert es nicht. Auf einer gewissen Abstraktionsebene behandelt es die Zusammenhänge anderer Verfolgungen mit der Judenverfolgung, verschiedene Kontexte und politische Situationen und die Politik verschiedener Länder. Bezüglich der an Verfolgungen Beteiligten kann das Buch aber nur Tendenzen im kollektiven Verhalten skizzieren. Als Synthese sagt es wenig über die Komplexität und Widersprüchlichkeit individueller Motive und Persönlichkeiten. Dieser Ansatz bedeutet auch, dass häufig auf der Grundlage von Zahlen und Prozentzahlen argumentiert wird – wie schon in dieser Einleitung. Bücher über die Verfolgung der europäischen Juden, die quantitative Argumente betonen, sind häufig scharf kritisiert worden,[30] ich halte sie aber dennoch für nützlich. Es ist wahr, dass Statistiken kein umfassendes Verständnis eines menschlichen Lebens vermitteln können, sei es das eines Opfers oder eines an der Verfolgung Beteiligten. Doch die Statistiken in diesem Buch erlauben wichtige Folgerungen für menschliche Schicksale und die Optionen, die verfolgte Menschen besaßen oder die ihnen verwehrt waren. Sorgfältig betrachtet, sprechen die Zahlen Bände.
Terminologie und Aufbau des Buches
An diesem Punkt sind ein paar Anmerkungen zur Wortwahl angebracht. Ich versuche einige Wörter zu vermeiden, weil sie falsche Vorstellungen vermitteln könnten. Die Begriffe ‹Holocaust› und ‹Shoah› sind nicht nützlich, denn sie haben beide keinen analytischen Wert. ‹Holocaust› (vom griechischen holókauton oder Brandopfer) hat eine religiöse Konnotation, die nicht zu dem Ereignis passt, das das Wort beschreiben soll, und während manche, die den Begriff benutzen, damit die Verfolgung und Ermordung der Juden allein meinen, beziehen sich andere allgemein auf die Gewalt des NS-Regimes gegen Gruppen aller Art.[31] Das Wort ‹Shoah› besitzt Untertöne einer Naturkatastrophe.[32] Noch wichtiger, ‹Holocaust› und ‹Shoah› sind auch als «teleologische und anachronistische» Begriffe kritisiert worden, die eine retrospektive Sicht vermitteln, in der komplexe Prozesse «als ein einziges Ereignis» erscheinen.[33] ‹Auschwitz› als Metapher für die gesamte Vernichtung der europäischen Juden ist gerade deshalb irreführend, weil es den Prozess der Verfolgung und Vernichtung zentralisierter und fabrikartiger erscheinen lässt, als er wirklich war.[34] Nur eines von jeweils sechs Opfern der Judenvernichtung starb in Auschwitz (und jeder zweite ermordete Jude starb durch Gas), und kaum mehr als 1 % aller nichtjüdischen Opfer deutscher Gewaltmaßnahmen starb in Auschwitz. Die Verwendung des Begriffs ‹Endlösung› ist weitverbreitet, kommt aber nicht in Frage – nicht nur weil es sich um Tätersprache handelt, sondern weil das Wort seine Bedeutung mit der Zeit veränderte. 1937 oder 1940 meinten die, die es benutzten, etwas anderes als die totale Vernichtung.
Ich benutze auch nicht die Begriffe ‹Antisemit› oder ‹antisemitisch› wegen des möglichen Missverständnisses, dass ich auch Feindschaft gegen Araber und andere Gruppen meine. Und obwohl Hitler und andere sich Antisemiten nannten, wandten ihr Denken und Handeln den wissenschaftlichen Rassismus nicht zwangsläufig so stark an, wie ihre Verwendung des Begriffs suggeriert (siehe Kapitel 7).[35] Statt ‹antisemitisch› benutze ich darum Ausdrücke wie ‹antijüdisch›. Manche Forscher haben sich mit Bezug auf die 1930er und 1940er Jahre wegen seiner unklaren Definition sogar gegen die Verwendung des Wortes ‹Jude› gewandt. ‹Jude› konnte sich damals auch auf Personen beziehen, die Jahrzehnte zuvor zum Christentum konvertiert waren, die sich nicht als Juden definierten, und auf Personen, die von jüdischen Gemeinden nicht als Juden anerkannt wurden. Es bezog sich vielmehr auf Menschen, die von Vertretern des Staates oder Bürgern als Juden kategorisiert wurden. Diese Einschränkung kann aber nicht ständig wiederholt werden, und das Wort ‹Jude› stets in Anführungszeichen zu setzen, löst das Begriffsproblem auch nicht.[36] Ich vermeide auch die Begriffe ‹Kollaboration› und ‹Kollaborateur›, weil sie in diesem Zusammenhang für die meisten Europäer Verrat gegenüber dem eigenen Land implizieren, wohingegen die meisten sogenannten Kollaborateure sich selbst gerade als scharfe Nationalisten sahen. Das Konzept ‹Kollaboration› hat die Forschung in der Vergangenheit behindert. Auch sogenannte ‹Marionettenstaaten› handelten nicht zwangsläufig wie Marionetten.[37] Schließlich werde ich auch möglichst nicht von ‹Tätern› sprechen, weil dieser Begriff – der einem juristischen Rahmen entstammt, der sich weder bei der Analyse noch der Bestrafung der betreffenden Handlungen als sehr erfolgreich erwiesen hat – die Schuld über Gebühr auf jene wenigen Personen reduziert, die Gewalttaten ausführten oder direkt dafür verantwortlich waren, und sie zu leicht von größeren Gruppen abtrennt, die ebenfalls daran beteiligt waren. Ich spreche darum z.B. von «an der Verfolgung Beteiligten». Hinzuzufügen bleibt, dass ‹Verfolgung› meiner Ansicht nach staatliche und halbstaatliche Maßnahmen, aber auch das Handeln nichtstaatlicher Akteure umfasst.[38]
Der Aufbau dieses Buches weicht von den meisten Studien über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden ab. Viele Synthesen und Gesamtdarstellungen folgen einer mehr oder weniger chronologischen Ordnung.[39] Andere sind nach Ländern aufgebaut.[40] Einige wenige verbinden einen chronologischen mit einem thematischen Ansatz.[41] Mein Buch gibt nach dieser Einleitung zunächst einen relativ kurzen chronologischen Abriss und bietet danach zwei längere analytische Teile und dazu Kapitel über die an Verfolgungen Beteiligten und die Reaktionen der Opfer. Der eine Teil enthält Kapitel über jeweils einen ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Kontext der Judenverfolgung und stellt auch Verbindungen zu den Maßnahmen gegen andere große Opfergruppen her. Der andere Teil betrachtet die Judenverfolgung durch nichtdeutsche Staaten und Gesellschaften. Damit bietet das Buch mehr Analyse als Erzählung; es hat wenige exemplarische Geschichten zu bieten.
Teil I Verfolgung durch Deutsche
2 Vor 1933
Im 19. Jahrhundert erlebte die Region, aus der dann das Deutsche Reich wurde, tiefgreifende wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und kulturelle Veränderungen. Besonders ab der Jahrhundertmitte setzte machtvoll die Industrialisierung ein. Im Jahr 1900 war Deutschland eine der beiden führenden Industrienationen neben den USA und führend in der Stahl-, Chemie- und später auch der Elektroindustrie. Um die Jahrhundertwende lebte etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung in Städten, die viele verarmte Landbewohner angezogen hatten und eine breite Mittelschicht aufwiesen, zu der inzwischen immer mehr Angestellte gehörten. Von den 1840er Jahren bis ins späte 19. Jahrhundert wanderten viele arme Landbewohner aus, vor allem nach Nord- und Südamerika. Innerhalb Deutschlands entwickelte sich ein Netz von Großstädten, die durch ein um 1880 weitgehend vollendetes Eisenbahnnetz verbunden waren. Ungleichgewichte blieben – der immer noch von großen Landgütern dominierte Nordosten besaß wenige industrielle, städtische Zentren. Deutschland erreichte auch in Wissenschaft und Technik und zu Anfang des 20. Jahrhunderts in den Künsten eine führende Position.
1806 waren die Reste des verstaubten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation unter den Schlägen Napoleons zusammengebrochen. Unter Führung Preußens, des größten deutschen Teilstaats, wurde 1871 ein neuer deutscher Nationalstaat gegründet – eine konstitutionelle Monarchie, die kleinere Königreiche und Fürstentümer umfasste, aber Österreich ausschloss. Rasch wurden neue Ministerien und starke bürokratische Apparate aufgebaut. Im späten 19. Jahrhundert wuchs der Einfluss der Regierung auf das wirtschaftliche und soziale Leben mit den ersten rudimentären Elementen der Sozialversicherung. Dies löste aber nicht die sogenannte ‹soziale Frage› von Millionen Arbeitern, die unter elenden Umständen in den Städten lebten und zunehmend eigene politische und gesellschaftliche Organisationen bildeten, welche die Herrschaft von Bürgertum und Adel bedrohten. Die Tendenz zum Wohlfahrtsstaat verstärkte sich, nachdem Deutschland Ende 1918 zu einer Republik mit allgemeinem Wahlrecht geworden war, ohne die verbreitete Armut zu beseitigen. Die Monarchie war von aufgebrachten Arbeitern und Soldaten gestürzt worden, die der vor allem von ihnen getragenen Kriegsanstrengung, die immer sinnloser schien, müde waren, besonders als sich die Niederlage abzeichnete. Rote Fahnen wehten über Berlin, doch dann spaltete sich die starke Arbeiterbewegung, und die radikale Linke wurde besiegt. Die Zeit der Weimarer Republik war gekennzeichnet von wirtschaftlicher und politischer Instabilität und scharfen inneren Kämpfen zwischen der Rechten und Linken, welche die zunächst starken Parteien der Mitte zwischen sich zerrieben.
Außenpolitisch gesehen, hatte es nach den Napoleonischen Kriegen auf deutschem Gebiet Jahrzehnte des Friedens gegeben, unterbrochen durch die drei Einigungskriege gegen Dänemark, das Habsburgerreich und Frankreich 1864 bis 1871. Aus ihnen ging das Deutsche Reich als neue Großmacht in Mitteleuropa hervor. Frankreich und später auch Großbritannien und Russland stellten sich gegen das von europäischen Staatsmännern und Intellektuellen häufig wegen seines Militarismus beargwöhnte Deutschland, das sich mit Österreich-Ungarn, anfangs mit Russland und eine Weile mit Italien verbündete. Blutige Kriegführung gab es auch während des angeblich friedlichen Zweiten Deutschen Reichs; von 1904 bis 1908 fanden solche Konflikte aber in den Überseekolonien statt, die es seit 1884 erworben hatte, im Wesentlichen ohne den anderen europäischen Mächten in die Quere zu kommen. Die Germanisierungspolitik im Osten ab den 1870er Jahren scheiterte am Widerstand polnischer Nationalisten. Als sich der deutsche Imperialismus, angetrieben vom Wunsch der herrschenden Klassen nach Dominanz in Europa, in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft, 1914 gegen Russland, Frankreich und Großbritannien wandte, verlor Deutschland mit seinen schwächeren Verbündeten den Ersten Weltkrieg und musste starke Gebietsverluste, weitgehende Entwaffnung und Reparationszahlungen hinnehmen.
Viele dieser Entwicklungen waren nicht auf Deutschland beschränkt. Im selben Zeitraum erlebten auch andere europäische Länder in unterschiedlichem Ausmaß Industrialisierung, Urbanisierung, den Aufstieg der Mittelschicht, die soziale Frage, Wirtschaftsaufschwung und dann Instabilität, Gründung oder Stärkung des Nationalstaats, die Anfänge des Wohlfahrtsstaats und der politischen Massenbeteiligung, Nationalismus und Imperialismus. Das Gleiche gilt für die zunehmende Säkularisierung, und ab den 1920er Jahren führte der Aufstieg der politischen Rechten zu autoritären, rechtsgerichteten Regierungen in großen Teilen Ost-, Süd- und Mitteleuropas.
Die Emanzipation der Juden war mit der politischen Emanzipation des Bürgertums verbunden. In Deutschland waren beide Prozesse lang und konfliktreich. Die rechtliche Diskriminierung der Juden wurde in vier Wellen weitgehend aufgehoben: 1800 bis 1810, in den 1840er und 1860er Jahren und schließlich 1919. Vor 1871 lief dieser Prozess, angetrieben vom Denken der Aufklärung und eher skeptischen Bürokratien, in jedem deutschen Teilstaat getrennt ab.[1] Auch in anderen europäischen Staaten erlangten die Juden zwischen den 1830er und 1870er Jahren die Gleichberechtigung.[2] Die Gewährung der Emanzipation war aber von der Erwartung der Nichtjuden angetrieben, die Juden würden sich assimilieren. Im 19. Jahrhundert wurden große Teile des deutschen Judentums wohlhabend (im Gegensatz zur Lage der meisten Juden um 1800[3]). Während der Industrialisierung halfen traditionelles Handelsgeschick und Bildung solchen Juden, gemeinsam mit Nichtjuden zu Pionieren der ökonomischen Expansion zu werden. Mittel- und westeuropäische Juden wurden zu wichtigen Mitgliedern von Bourgeoisie, Mittelschicht und Bildungselite ihrer Länder. Die jüdische Unterschicht schrumpfte, relativ gesehen, wenn auch in Osteuropa viel schwächer.[4] Immer mehr Juden zogen in die Großstädte, wodurch sie sozial und politisch sichtbar wurden.[5] In den 1920er Jahren lebten 66 bis 92 % der Juden in Großbritannien, Frankreich, Österreich und Dänemark in der Hauptstadt, in Deutschland etwa 30 %.[6]
In religiöser Hinsicht spalteten sich die jüdischen Gemeinschaften in traditionelle, orthodoxe und weitgehend säkularisierte Gruppen.[7] Es gab relativ wenige Übertritte zum Christentum, aber viele interreligiöse Ehen in Deutschland und großen Teilen Europas (Polen war hier eine wichtige Ausnahme), wobei die Kinder meist Christen wurden.[8] Das scheint auf Vertrauen und gutes Einvernehmen hinzudeuten.[9] In der Politik unterstützten die meisten deutschen und österreichischen Juden am Ende des 19. Jahrhunderts liberale Parteien und in den 1920er Jahren die Sozialdemokraten.[10] Parallel zu ihrer sozialen Differenzierung entstanden zahlreiche jüdische politische Organisationen von links über liberal bis konservativ oder linkszionistisch. Diese Vielfalt spiegelte Streit, Debatten und eine gewisse Unsicherheit über die Zukunft der Juden wider. In Deutschland wurden die Zionisten nach 1918 stärker und erlangten in Österreich in den 1930er Jahren sogar eine leichte Mehrheit.[11] Dennoch wanderten vor 1933 nur 2000 deutsche Juden nach Palästina aus.[12] Anfang des 20. Jahrhunderts waren die meisten deutschen, französischen und z.B. ungarischen Juden stolze und mehr oder minder erfolgreiche Bürger und Angehörige der Mittelschichten ihrer Länder und nicht länger ein unterdrücktes, verfolgtes und leidendes Volk. Die Sowjetherrschaft in Russland befreite die dortigen Juden, ebenso die Gesetze in einigen anderen osteuropäischen Ländern – doch die Lage der Juden in diesem Teil des Kontinents, wo sie viel zahlreicher lebten und oft einen größeren Anteil der Bevölkerung bildeten,[13] war prekärer. In vielen Regionen war ihre Existenz durch Kleinstadtleben, geringe Akkulturation, wenige interreligiöse Ehen, verbreiteten Gebrauch der jiddischen Sprache, religiöse Orthodoxie, einen kleinbürgerlichen oder proletarischen Hintergrund und hohe Geburtenraten gekennzeichnet.[14]
Die soziale Stellung der Juden
Jüdische Traditionen wie auch christliche Gesetze, die jüdischen Landbesitz und die Ausübung vieler Berufe verboten, hatten die Aktivitäten von Juden jahrhundertelang auf Handel und Finanzen beschränkt. Nach der Emanzipation wandten sich viele erfolgreich anderen Berufen zu. 1933/34 war noch etwa die Hälfte der wirtschaftlich aktiven deutschen und österreichischen Juden im Handel tätig, gegenüber mehr als 90 % im Jahr 1817.[15] Wie andere Bürger waren auch Juden vom sozialen Wandel betroffen, und während manche sich anpassen konnten, führten andere, die dem Stereotyp der jüdischen Anpassungsfähigkeit weniger entsprachen, die traditionellen Berufe ihrer Familien weiter.[16] Ihre Zahlen schwankten. Im Polen des Jahres 1936 arbeiteten 36,6 % der Juden in Handel und Versicherungswesen. Im Jugoslawien der Zwischenkriegszeit arbeitete ein Drittel der wirtschaftlich aktiven Juden im Handel, 44 % im Staatsdienst und 8 % in den freien Berufen.[17] Ähnlich war es in Italien, wo 1931 34 % der Juden im Handel tätig waren, fast 11 % den freien Berufen angehörten und 25 % als Angestellte arbeiteten.[18]
Juden stellten in vielen Ländern Europas einen großen Teil von Bürgertum und Intelligenz. In Polen waren 58,7 % der in Handel und Industrie (einschließlich der Handwerksberufe) tätigen Personen Juden, aber im Staatsdienst waren sie unterrepräsentiert. Die Zahl der Juden im Handel ging von atemberaubenden 62,7 % 1921 wegen staatlicher Diskriminierung zurück.[19] In vielen Ländern hatten Juden einen Anteil an prestigeträchtigen Stellungen inne, der ihren Bevölkerungsanteil weit überstieg. In Wien waren 1936 62 % der Rechtsanwälte, 47 % der Ärzte, 28 % der Professoren (im Vergleich zu nur 3 % in Frankreich), fast 63 % der Zahnärzte, 73 % der Textilhändler und 18 % der Bankangestellten Juden. Juden leiteten 77 % der Banken, 64 % der Kinos, 63 % der Tageszeitungen und 40 % der Juwelengeschäfte. In Ungarn war die Situation ähnlich.[20] In Rumänien kontrollierten Juden «einen Großteil des privaten Kapitals in der Export-, Versicherungs-, Textil-, Leder-, Elektro-, Chemie-, Wohnungs-, Druck- und Verlagsbranche». Rund 70 % der Journalisten und 99 % der Aktienmakler waren Juden.[21] In Polen waren 1931 56 % der Privatärzte und 33,5 % der Anwälte Juden, und in der Tschechoslowakei war der Anteil ähnlich.[22] Im Vergleich zu anderen Ländern war die Position der Juden in Deutschland, vor allem in den freien Berufen, weniger dominant. 1933 zählten 11 % der Ärzte und 16 % der Anwälte als Juden (in Preußen lag der Anteil etwas höher), und in einigen Branchen waren sie sehr stark vertreten, so kontrollierten sie 40 % des Textilhandels, 80 % des Kaufhausumsatzes und fast 20 % der Privatbanken. Unter Arbeitern und Handwerkern waren deutsche Juden unterrepräsentiert, auch unter Industriellen waren sie nur schwach vertreten.[23] 1861 waren 21 % der Handelsangestellten in Preußen Juden gewesen, 1925 waren es nur noch 5 %, weil Nichtjuden nun in diese Branche strömten. 1933 waren 7 % der Berliner Einzelhandelsgeschäfte in jüdischem Besitz, dagegen war jedes dritte Vorstandsmitglied von an der Berliner Börse notierten Unternehmen jüdisch.[24] In Westeuropa war die sozioökonomische Rolle der Juden weniger ausgeprägt, doch die Position der bulgarischen Juden war in Europa außergewöhnlich, weil sie im Bürgertum gar nicht besonders überrepräsentiert waren.[25]
Im Allgemeinen verdecken diese Zahlen die jüdische Unterschicht; obwohl nur wenige Juden in Mittel- und Westeuropa arm genannt werden konnten,[26] gab es beispielsweise in Polen und Rumänien viele. Dennoch illustrieren viele der angeführten Zahlen, warum Juden in den europäischen Gesellschaften neidvoll betrachtet und kollektiv mit Reichtum identifiziert wurden. Solcher Neid konnte zum einen den Wunsch verraten, Konkurrenten auszuschalten, zum anderen den schadenfrohen Wunsch, bestimmte Teile der Gesellschaft sollten ihren hohen Status verlieren.[27] Obwohl die meisten der genannten Zahlen aus den Werken von Forschern mit jüdischem Hintergrund stammen, benutzten die damalige politische Rechte, die Nationalisten und auch die Nazis sie auf bestimmte Weise,[28] um zu suggerieren, die Eliteposition von Juden sei illegitim und müsse von der Regierung beseitigt werden, weil Juden dem Wohl von Nichtjuden im Wege stünden. Dieser Trend begann, nachdem Nichtjuden in größerer Zahl in Handel und Bildungsschicht eintraten als zuvor, was sie beim Aufbau ihrer Karrieren in direkte Konkurrenz zu den damals bereits etablierten Juden brachte.
Soziale Mobilität und europäische Juden
Forscher stellen die Geschichte der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten häufig in einen sozialgeschichtlichen Zusammenhang mit jüdischem Aufstieg. Diese Argumentation wird durch Daten aus dem späten 19. Jahrhundert gestützt, lässt aber meist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg außer acht.[29] Ich meine vielmehr, die Vernichtung der Juden in Deutschland und anderen Ländern fand in einer Periode ihrer sozialen Stagnation statt, oder sogar ihres Abstiegs wegen komplexer gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, durch die neue Gruppen von Nichtjuden an sozialem Status gewannen.[30]
In Deutschland, Österreich, Böhmen und Mähren, Ungarn und Italien stagnierte der jüdische Bevölkerungsanteil in den 1920er und frühen 1930er Jahren – d.h. vor dem Machtantritt der Nazis – oder ging leicht zurück. Nachdem sie einen bürgerlich-großstädtischen Lebensstil angenommen hatten, bekamen Juden weniger Kinder, aber auch die Auswanderung machte sich bemerkbar.[31] In Deutschland scheint das besonders für Regionen zu gelten, wo von vornherein wenige Juden lebten.[32] Der landesweite deutsche Trend, der schon Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, griff nach 1910 auf München über (wo Hitler damals lebte).[33] In anderen Ländern Europas hielt das starke jüdische Bevölkerungswachstum länger an.[34]
Ereignisse in den 1920er Jahren und vor allem die Weltwirtschaftskrise ab 1929 intensivierten einen bereits bestehenden Trend. Seit dem späten 19. Jahrhundert gründeten immer mehr Nichtjuden Firmen und wurden in großer Zahl im Wirtschaftsleben aktiv, worauf der Marktanteil der Juden vor allem im Handel schrumpfte. Jüdische Autoren im Deutschland der Jahre 1930 bis 1933 bemerkten einen Rückgang der jüdischen Wirtschaftskraft, obwohl in Hinsicht auf die wirtschaftlichen Führungspositionen Juden bis 1933 weniger von der Wirtschaftskrise betroffen waren als Nichtjuden.[35] Während des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik erlitten aber viele kleine jüdische Kaufleute ebenso Einbußen wie Nichtjuden, und dies trug zum Sinken des durchschnittlichen Realeinkommens der deutschen Juden insgesamt bei – obwohl die Zahl verarmter Juden gering blieb.[36] Diese Wohlstandseinbuße widersprach dem weitverbreiteten Feindbild des jüdischen Kriegsgewinnlers.[37] In vielen Ländern traf die wirtschaftliche Unsicherheit der Zwischenkriegszeit Juden besonders hart, besonders in Polen, das stärker litt als seine Nachbarn. Dort «schwächte die Verarmung der jüdischen Massen und ein Rückgang an staatlichen Zuweisungen die [jüdische] Gemeinschaft immer mehr».[38] Dasselbe geschah wegen der Verstaatlichung von Firmen nach der sowjetischen Annexion der baltischen Staaten, Ostpolens, Bessarabiens und der Bukowina.[39] Die vielen Flüchtlinge in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, die vor allem in den Großstädten sozial wieder Fuß zu fassen suchten, konkurrierten – oft erfolgreich – mit jüdischen Firmen, weil sie Hilfe von christlichen Regierungen erhielten. Dies geschah etwa im griechischen Saloniki, von wo in den 1930er Jahren 20–25.000 Juden auswanderten.[40] Angesichts weitverbreiteter Einreisebeschränkungen war die Auswanderung etwa für polnische Juden aber immer weniger ein Ausweg.[41] Die «Selbstmordepidemie» unter deutschen Juden in den 1920er Jahren, die damals in den Zeitungen diskutiert wurde, hing womöglich mit einer Krise kleiner jüdischer Firmen zusammen.[42] Außerdem strebten Nichtjuden zunehmend eine höhere Bildung an, und auch hier verminderte sich der jüdische Vorsprung. In den 1920er Jahren war die Zahl jüdischer Studenten sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ gegenüber 1910 gesunken. Unter polnischen Studenten erreichte der Anteil der Juden 1923/24 mit 24,4 % seinen Höhepunkt und ihre absolute Zahl 1932/33 (als der jüdische Anteil noch 18,7 % ausmachte). Die späteren Numerus clausus-Bestimmungen (die meist die Anzahl jüdischer Studenten auf den jüdischen Bevölkerungsanteil begrenzten) gehören in diesen Kontext und dienten dazu, die Zugewinne von Nichtjuden zu konsolidieren oder zu steigern.[43] Ein ähnlicher Trend zeigte sich auch in weniger angesehenen Berufen: Der Anteil der jüdischen Händler in Polen erreichte 1921 den Höhepunkt, und auch die Zahl jüdischer Fabrikarbeiter begann zu sinken, als neue Staatsmonopole in bestimmten Industrien bevorzugt Christen einstellten. Dadurch waren noch mehr Juden gezwungen, Handwerker zu werden.[44]
Auf vielfältige Weise gerieten Juden unter viele Formen von wirtschaftlichem Druck (nicht ganz unähnlich den deutschen Minderheiten in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg). Dies war die Kehrseite eines umfassenden europäischen wie auch deutschen Prozesses der sozialen Mobilisierung unter Nichtjuden im frühen 20. Jahrhundert.[45] Unter denen, die aufsteigen wollten, befanden sich einige der radikalsten Judenhasser. Viele Gauleiter der NSDAP waren unter diesen Aufsteigern. Sie stammten häufig aus Handwerker- oder Arbeiterfamilien und suchten Anschluss an die politische und gesellschaftliche Elite.[46]
Antijüdische Einstellungen
Traditionelle Gesellschaften in Mitteleuropa waren von der Landwirtschaft geprägt und von christlichen Glaubenslehren strukturiert, die den Juden eine soziale Randposition zuwiesen und zu Diskriminierung führten, sich aber im frühen 19. Jahrhundert aufzulösen begannen. In diesem Kontext ging um 1840 der Begriff «Judenfrage» in die deutsche Sprache ein.[47] Der Wandel durch Fortschritt, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum «führte zur Lockerung jahrhundertalter sozialer Bindungen, zur Aushöhlung religiöser Traditionen und zur Entwertung ethischer Systeme».[48] Neben dem religiösen Antijudaismus, der die jüdische Ablehnung Christi als Messias, die angebliche Schuld der Juden an seinem Tod und Mythen über jüdische Rituale, bei denen Christen ermordet würden, betonte, hatten sich seit dem 12. Jahrhundert Vorurteile gegen Juden als Wucherer, Betrüger und Ausbeuter in Europa verbreitet.[49] Äußerungen von Denkern der Aufklärung für die Judenemanzipation wie auch antijüdische Propaganda am Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts bieten zahlreiche Beispiele dafür, wie beherrschend das Bild vom jüdischen Betrüger geworden war.[50]
Manche Forscher sehen einen tiefgreifenden Wandel der antijüdischen Einstellungen im Deutschland der 1870er Jahre, eine Verlagerung von einer politischen zur rassischen Grundlage, die sich in der Prägung des Begriffs «Antisemitismus» 1879 zeige.[51] Doch eine genauere linguistische Betrachtung antijüdischer Schriften in Deutschland zwischen 1789 und 1872 zeigt schon frühere «Ansätze, den Judenhaß biologisch-anthropologisch zu motivieren». Juden galten bereits als Fremde mit negativem Einfluss auf Staat, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft und wurden in einer Sprache beschrieben, die am häufigsten auf jüdischen Wucher, Verrat, Fremdheit und Einmischung anspielte. Tiermetaphern beschrieben Juden bereits entweder als Parasiten oder als Ungeziefer – eine Bedrohung für das gesunde Blut.[52] Die Mischung aus religiösem, sozioökonomischem und rassistischem Antijudaismus im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts[53] enthielt nur wenige völlig neue Trends.[54] Religiöse Elemente bestanden weiter. In den 1920er Jahren verband die christliche antijüdische Propaganda wiederum religiöse, soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Argumente.[55] Neu war allerdings die Kritik der Rechten nach 1918, Deutschland werde von ‹jüdischen› Politikern versklavt, was sich besonders auf die linken Revolutionsführer/innen in Berlin und München und auf den Hauptautor der Weimarer Verfassung bezog. In Wirklichkeit waren jüdische Minister in den Reichsregierungen zwischen 1919 und 1932 im Verhältnis zum jüdischen Bevölkerungsanteil keineswegs überrepräsentiert.[56]