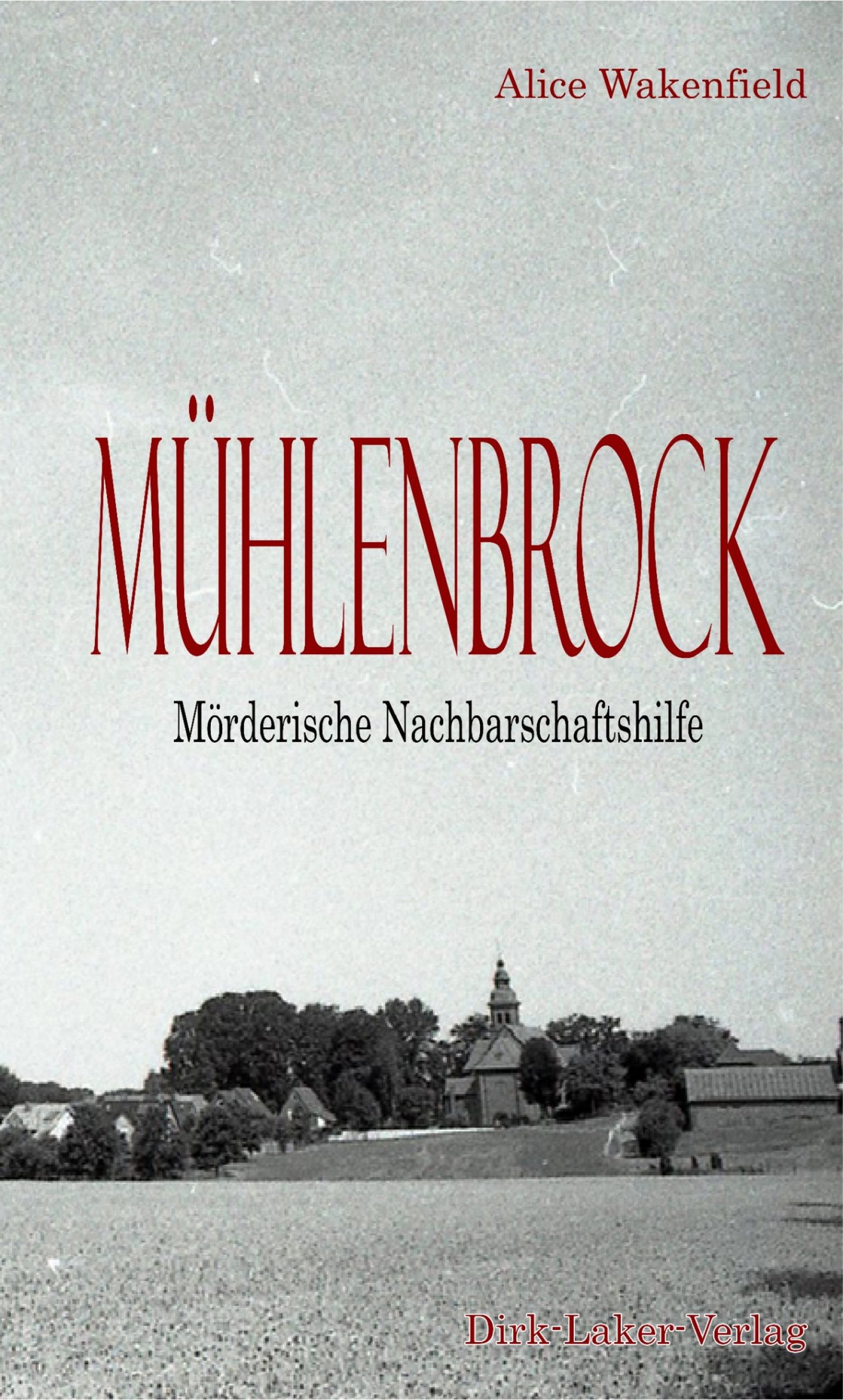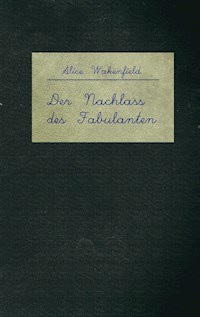
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten wollen erzählt werden. In über 50 Kurzgeschichten stellt Alice Wakenfield Märchenhaftes neben Verstörendes, Skurriles neben Nachdenkliches. Der Blick ist dabei immer auf den Menschen im Mittelpunkt gerichtet, der mit seiner – teilweise phantastischen – Umwelt interagieren muss. Kurze Texte laden zum Schmökern zwischendurch. Im Genre bewegt sie sich dabei frei zwischen Horror, Märchen und seltsamen Alltagsbegegnungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alice Wakenfield, Jahrgang 1968, lebt in der Grauzone zwischen Ruhrgebiet und Münsterland. Sie ist verheiratet, hat vier Söhne, Hunde und Katzen und betreibt neben einem anständigen Beruf, einen Blog, auf dem sie sich ihren Hobbies Schreiben, Fotografieren und Zeichnen widmet.
Fabulant|der – m – Substantiv, jemand, der phantastische Geschichten erfindet
Was wären wir ohne Geschichten? Sie unterhalten und erziehen uns und für manche sind sie das Lebenselexier. Kinder brauchen sie zum Einschlafen, Erwachsene für kurze Pausen im Alltag. Sie entführen uns in spannende, kuriose und märchenhafte Welten, bringen uns zum Lachen oder Weinen und infizieren uns mit neuen Blickwinkeln und Gedanken.
INHALT
Vorwort - Das Café
Die Fototapete
Der Schrank
Umweg über Merfeld
Das Hinterzimmer
Der Fluch
Rosa
Wer hat noch nicht..
Der Spiegel
Der Küchentisch
Die Verabredung
Der Kontrolleur
Das Sofa
Umsteigen in Bologna
Spieglein, Spieglein
Die Katze
Abgang
Der Preis
Fleischlastig
Schau hin
Zeitlupe
Far Far Away
Bällchenbad
Hinter den Kulissen
High Noon
Night Sky
Lost Place
Das Huhn und der Stern
Das Monster
In einer kleinen Stadt
Der Bogenschütze
Lange Haare
Waschtag
Der Backofen
Lange Schatten
Katzenphilosophie
Die Patronenhülse
Die Gabel
Der Wolf
Kleinstadtidylle
Studentenjob
Isolation
Die Prüfung
Der Auftritt
Leere
Beim Friseur
Die Schuhe
Erwartung
Mein reduziertes Leben
Die Tagung
Neuordnung
Eine Weihnachtsgeschichte
Pin-up
Alles auf Anfang
Epilog
VORWORT - DAS CAFÉ
Man erzählte sich, dass schon bei der Gründung der Stadt ein Vorfahre von George ein kleines Café an genau dieser Stelle gehabt haben soll. Und seit nicht zählbaren Generationen wurde es vom Vater an den Sohn weitergegeben, ausgebaut, modernisiert. Das ist sicherlich ein klitzekleines bisschen übertrieben, doch selbst die Ältesten der Stadt konnten sich noch an Erzählungen ihrer Großeltern erinnern, die als Kind dort ihren ersten Kakao tranken. Und da sei es schon alt gewesen.
Es lag mitten in der Altstadt, eingequetscht zwischen einem Friseur und einem Blumengeschäft, der Eingang lag ein wenig zurück zwischen den großen holzumrahmten Schaufenstern, so dass man schon vor dem Eintreten nach links und rechts schauen konnte, ob Bekannte da seien, Freunde gar oder jemand, den man nicht treffen wollte. Die Plätze an den Fenstern waren immer gut besucht, im hinteren Bereich war der Raum dunkel und wurde meist nur von frisch Verliebten oder dubiosen Gestalten aufgesucht, die in Ruhe ihre schmutzigen Geschäfte besprechen wollten. Eine grünweiß gestreifte Markise überspannte die vordere Front. Der Großvater von George hatte sie anbringen lassen, französischer Stil hieß es damals und sie wirkte verspielt vor dem alten Haus, geräumig gewölbt und mit einer schmalen gebogenen Kante erinnerte sie tatsächlich an französische Badeorte der fünfziger Jahre. George wollte sie schon lange austauschen, sie war verschlissen vom ständigen Öffnen und Schließen, was die Hauptaufgabe des ewigen Auszubildenden war, der jeden Morgen mit einer langen Stange durch die Tür heraustrat, umständlich die Öse an der eingefalteten Markise einhakte und kurbelte. Dann stellte er die Stühle und Tische auf den Gehweg, verteilte Speisekarten und kleine Vasen mit Plastiknelken. Den Rest des Tages verschlief er im Hinterzimmer und erwachte erst, wenn er abends die Prozedur rückwärts vornehmen sollte.
Das Innere des Cafés bestand aus einem langen schmalen Raum, der sich hinten, wie erwähnt im Dämmrigen verlor, die rechte Seite wurde von einer langen Theke eingenommen, hinter der George thronte. Er stand immer vorne bei der gewaltigen verchromten Kaffeemaschine, die Straße und die Gäste gleichermaßen im Blick. Meist entspannt, nahezu verträumt blickend, registrierte er jede leere Tasse, jedes aufgegessene Stück Kuchen und jagte mit einer kurzen Bewegung des Kinns, seine dürre, kleine Frau zum betreffenden Gast, um abzuräumen, Nachschub zu liefern oder zu kassieren. Weder Kaffee noch Kuchen waren besonders gut bei George, dennoch saßen immer Gäste innen und außen und gegen Abend wurde es noch ein wenig voller.
Der frühabendliche Ansturm lag daran, dass der Herr Wirt eine große Vorliebe für Rotwein hatte und ihn, da er keine Schanklizenz besaß, vom frühen Nachmittag an, hinter der Theke trank. Kurz vor dem Schließen des Cafés war er meist leicht beschwipst und veredelte heimlich den Kaffee der Gäste mit diversen aromatischen Schnapssorten. Waren die richtigen Leute zusammengekommen, was so zwei dreimal in der Woche vorkam, konnte es auch ausufern und wenn der Auszubildende endlich erwacht die Markise zusammengekurbelt und die Tische hereingestellt hatte, begann hinter den geschlossenen Jalousien ein feuchtfröhlicher Abend. Vor der Polizei hatte er keine Angst, auch wenn der Lärm, den sie beim Trinken und Erzählen machten, bis auf den Bürgersteig drang. Der Dorfpolizist war sein bester Gast.
Der Höhepunkt des Abends war, wenn George erzählte. Dann stellte er sich breitbeinig auf, das Karohemd spannte über seinem gewaltigen Bauch, rieb sich die rote große Nase, wischte ein paarmal durch seinen Backenbart und räusperte sich. Wie Kinder in der Schule schwiegen alle, als ob die Rute drohte. Er war ein begnadeter Erzähler, schmückte an den richtigen Stellen aus, ließ etwas weg, um die Spannung zu erhöhen und steuerte mit seinen Worten immer auf eine hervorragende Pointe zu. Die ließ das Publikum Tränen lachend oder erstarrt zurück, je nachdem wie seine Laune war.
Er liebte es, die Menschen zu manipulieren, auf ihren Gefühlen zu spielen wie auf einer Klaviatur. Waren sie begeistert – und das waren sie immer – gab es zum Abschluss einen Pastis und dann warf er sie hinaus. Er stellte einen Teller auf den Tisch, wo jeder einen Obolus für die Schnäpse drauflegte, von dem er Nachschub für den nächsten Abend holte.
Waren die Gäste gegangen, stand oft seine Frau in der Tür, den Mund missbilligend zu einem schmalen Strich verzogen, schob ihn energisch in Richtung Wohnung, die über dem Café in dem schiefen Haus untergebracht war, und machte sich ans Aufräumen und Putzen, damit sie morgens wieder pünktlich öffnen konnten.
George aber fiel aufs Bett, müde und erlöst, wie immer nach den Geschichten, die auf seiner Seele brannten. Meist schlief er dann bis in den frühen Mittag, kam hervor, wenn das Vormittagsgeschäft schon fast erledigt war und bezog Stellung an der Kaffeemaschine.
Es war ein schweres Erbe, das er trug, man könnte es einen Familienfluch nennen, wenn tatsächlich jemand dabei zu Schaden käme. Das Geschichtenerzählen war ihm nicht nur sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden, er hatte es geerbt zusammen mit dem Café und seiner Neigung zu Rotwein und fettem Essen.
Als kleiner Junge hatte er es geliebt seinem Vater zuzuhören. Er bekam jeden Abend eine Gutenachtgeschichte und jeden Tag war sie neu. Er erzählte ihm von den spannendsten Abenteuern, den wahnwitzigsten Märchen, den skurrilsten Helden, die man sich vorstellen kann. Er hing an den Lippen seines Vaters und schlief nicht eher ein, bevor die Geschichte zu Ende erzählt war.
Eines Tages wurde sein Vater krank, er hatte lange bei Regen auf dem Dach gearbeitet, weil es durchregnete und als er am nächsten Morgen erwachte, hatte er eine dicke Erkältung. Sie begann mit einem furchtbaren Niesanfall, wanderte dann zur Lunge und entdeckte ganz am Ende die Stimmbänder als Basislager. Kurzum, er verlor die Stimme. Der Arzt verordnete Schweigen für mindestens eine Woche und einen widerlich schmeckenden Saft, der gegen die Halsschmerzen helfen sollte.
Am ersten Abend taperte der Vater nur unruhig durchs Haus, saß eine Weile bei George, der auch litt, da er ohne Geschichte nicht schlafen wollte, stand wieder auf und durchquerte jedes Zimmer, ging auf und ab, wie ein Tiger in seinem Käfig.
Der nächste Tag war noch schlimmer. Schon am Frühstückstisch trommelte der sonst so ausgeglichene Mann mit den Fingern auf der Tischplatte, würdigte die Zeitung keines Blickes, trank nur seinen Tee und den medizinisch stinkenden Saft und wirkte, wie ein gefangenes Tier.
Die Unruhe steigerte sich und offenbar konnte er nicht schlafen, denn George hörte ihn die ganze Nacht durchs Haus laufen. Jeden Tag wurde es schlimmer. Er aß nicht, er schlief nicht, seine Laune wurde so schlecht, dass alle nur mit eingezogenen Köpfen durch die Gegend liefen, die Ader an seinem dauerroten Kopf pochte unaufhörlich und die Mutter fürchtete, dass er einen Schlaganfall bekäme. Der Arzt kam nochmal vorbei, denn das taten sie damals noch und verschrieb ihm ein leichtes Beruhigungsmittel, das aber nur wenig half. Am Ende der Woche waren alle wie gerädert. Der Arzt untersuchte ihn und schaute gründlich in seinen Hals. Und dann erlaubte er ihm, wieder zu sprechen.
Und er redete und erzählte, Geschichten einer ganzen Woche platzen aus ihm hervor und mit jeder abgeschlossenen wurde er ein wenig entspannter, ein wenig glücklicher. Am Abend war er wieder fast der Alte, nur George bekam diesmal drei Gutenachtgeschichten und kam am nächsten Morgen zu spät in die Schule, weil der Vater bis zum Morgengrauen die spannendsten Geschichten zum Besten gegeben hatte.
Am nächsten Tag, nach dem Nachsitzen, rief der Vater George zu sich. Er erzählte von dem Familienfluch und dem Café und dass das eine wohl nicht ohne das andere existieren würde, verkaufen und weggehen aber auch nicht ginge, weil das zu sehr auf Kosten ihrer geistigen Gesundheit ginge, er hätte ihn ja erlebt. Und dass er, George, wenn er noch ein wenig älter wäre, es selbst erleben würde, er auch erzählen müssen würde, so wie er und sein Vater vor ihm und dessen Vater und so weiter.
George freute sich darauf, liebte er doch Geschichten über alles.
Er wuchs und fast über Nacht, fast zeitgleich mit dem Ende der Gutenachtgeschichten, begann es auch bei ihm. Er erzählte Geschichten in der Schule, seinen Freunden, beim Einkaufen. Hatte er keine Möglichkeit, weil Ferien waren und niemand da, der ihm zuhören wollte, wurde er unruhig, es brodelte in ihm. Er spürte die Geschichten wachsen, sie gingen auf wie Hefeteig in seinem Kopf und ließen keinen Platz für einen klaren Gedanken.
Er versuchte, die Geschichten den Wänden in seinem Zimmer zu erzählen, es funktionierte nicht. Dann schrieb er sie auf, doch sie bleiben in seinem Hals kurz hinter der Zunge stecken und warteten schön in einer Reihe anstehend, bis sie hinausdurften. Seine Hand brachte noch nicht das erste Wort zu Papier.
Also begann er abends in die Cafés und Kneipen zu gehen und sich dort Zuhörer zu suchen. Manchmal bezahlte er sogar jemandem, nur damit er stillhielt.
Als sein Vater starb und er das Café erbte, fand er bald genug Zuhörer und das Arrangement lief zu seiner Zufriedenheit.
Er hatte keinen Sohn, ganz bewusst hatte er sich gegen Kinder entschieden, was seine Frau ihm bis heute nicht verziehen hatte. Wenn er starb würde er den Fluch mit sich nehmen, den Fluch und das Café.
Frauen haben Geheimnisse, das ist nichts Neues. Und seine Frau war da keine Ausnahme. Auch wenn sie nicht genau wusste, warum er tat, was er tat, ahnte sie, dass es mit den Geschichten eine besondere Bewandtnis haben musste. Jeden Abend, an dem er mit seinen Freunden trank und feierte, saß sie hinter der Tür und wartete auf den Moment, an dem er sich aufbaute, durch den Bart strich und eine der Geschichten herausließ, die er mit sich herumtrug, Dann nahm sie ihren Stift, machte sich ein paar ordentliche Notizen, denn sie war eine sehr aufgeräumte Frau und schrieb die Geschichte mit.
Jahre später, als George und seine Frau tot waren und mit ihnen der Fluch und das Café verschwunden, fand ein Baggerfahrer, der das lange brachliegende Grundstück für einen Neubau vorbereiten sollte, nur ein kleines bisschen in die Erde eingegraben eine Metallkiste. Darin lagen die Notizbücher der Frau, sorgfältig eingewickelt in ein Küchenhandtuch, in das sie ihre Initialen gestickt hatte.
Da er nicht so gerne las, brachte er die Bücher zu seinem Schwager, der wiederum zu einem Freund, der einen Verleger kannte. Und der nahm die Kladden, las sie, tippte sie ab und korrigierte Grammatik und Rechtschreibung dabei. Und dann brachte er sie heraus.
Aber lest selbst…
DIE FOTOTAPETE
Mein Vater schleppte sie eines Tages an, hatte sie über einen Kollegen günstiger bekommen. Das Wohnzimmer sollte schon längst renoviert werden. Keiner von uns konnte noch länger die Blümchentapete ertragen. Da kam er mit den fünf dicken Rollen gerade recht. Eine Fototapete, Dschungel im Wohnzimmer. Wir Kinder waren begeistert, meine Mutter reagierte leicht verhalten. Allerdings hatte die wohlhabende und leicht überkandidelte Nachbarin von gegenüber eine im Salon und man munkelt sogar, eine im Schlafzimmer, was meiner Mutter dann doch zu verrucht war.
Was folgte, war anstrengend. Gemeinsam schleppten wir die Möbel aus dem Weg, breiteten große Papierbahnen entlang der Wände aus, um den Teppich zu schonen und machten uns an den Abriss der alten Wandbespannung. Den Schwamm mit der Seifenlösung in der einen, den Spachtel in der anderen Hand, kratzten wir zentimeterweise die Blümchen von den Wänden. Es dauerte den ganzen Tag. Abends holte mein Vater was von der Pommesbude, wir picknickten im leeren Wohnraum vor kahlen Wänden. Es war ein Fest.
Nachts träumte ich unruhig von sich bewegenden Wänden und trockener, schuppiger Haut. Ich erwachte schweißgebadet und schob es auf die ungewohnte Arbeit.
Am nächsten Tag wurde geklebt. Fünf Bahnen mussten gerade und ohne sichtbaren Übergang aneinander gekleistert werden, eine Arbeit für einen gelernten Tapezierer, wie wir bald merkten. Mittags waren alle mit den Nerven am Ende. Die zweite Bahn hatte schon den ganzen Vormittag gedauert, hing nun aber glatt und fein an der ersten – die ja ganz leicht gewesen war – und verschaffte uns ein erstes Gefühl für die zukünftige Fernsehabendstimmung. Es war grün und saftig. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Raum durch den Kleister tat ein Übriges. Ich meinte Affen zu hören, aber wahrscheinlich war das nur mein Bruder, der eine kleine Pause nutzte und in der Küche das Radio angemacht hatte.
Die dritte Bahn war eine große Herausforderung. Meine Mutter stand auf der Leiter, hielt den klebrignassen Papierbogen oben fest, während mein Vater versuchte ihn gerade und ohne Übergang an die unebene Altbauwand zu pappen. Die Übergänge wollten nicht gelingen, das Papier zog sich, dehnte sich an den falschen Stellen und war an anderen zu kurz. Wellen und Beulen erschienen, wurden glatt gebürstet. Gegen fünf Uhr nachmittags gaben sowohl Tapete als auch meine Mutter auf. Ein leises Ritsch kündigte das Drama an. Ein kleiner Riss tat sich auf, durchzog ein Palmenblatt, wurde mühsam gekittet, überkleistert, wegdiskutiert, da dort ja das Sofa stünde, wobei das nur halb stimmte.
Mein Vater, zusehends nervöser, stand kurz vor einem Wutanfall, rauchte Zigarette um Zigarette in dem feuchten Raum, der nach trocknendem Kleister und frischem Papier roch.
Die nächste Bahn gelang leichter und wir alle atmeten auf. Gegen acht machte meine Mutter Butterbrote, die ein wenig nach Kleber schmeckten. Dann schickte sie meinen Bruder nach oben und meinen Vater ins Bett. Sie schaute mich an und nickte mir auffordernd zu. Ich hatte auch keine Lust, heuchelte aber Begeisterung ob der anstehenden Nachtschicht. Ich kannte sie zu gut, bis zum nächsten Tag würde sie das nicht liegen lassen. Also kochte ich Kaffee für uns beide und ergab mich meinem Schicksal.
Gegen Mitternacht hing sie dann auch, die letzte, die fünfte Bahn. Wir könnten uns kaum satt sehen an den dicken dunkelgrünen Palmwedeln, den dicken Baumstämmen, die im Wohnzimmerboden zu entspringen schienen und durch die Decke nach oben zu wachsen schienen, dem dämmrigen Licht. Die Luftfeuchtigkeit war unerträglich, der Kleister durfte noch keine Frischluft bekommen. Ich hörte Zweige knacken und ein Vogel schrie. Ich schob es auf meine Erschöpfung.
Endlich durfte ich ins Bett, meine Mutter würde noch aufräumen und saubermachen. Ich träumte wieder schlecht, sah gelbschwarze Streifen, spürte warmes, hartes Fell unter meinen Fingern und einen heißen, stinkenden Atem im Gesicht.
Gefrühstückt wurde im Wohnzimmer. Die Qual der letzten beiden Tage war vergessen und wir saßen einträchtig vor dem riesigen Wandbild, betrachteten unsere Leistung glücklich. Der Riss war trotz des Sofas zu sehen, aber wir machten uns nichts draus. Endlich durfte gelüftet werden. Eine leichte Brise trug den Renovierungsgestank aus dem Zimmer. Dafür durchzog ein anderer Geruch den Raum. Da war etwas Erdiges, Pilziges. Wir schoben es auf das neue Papier und ließen den ganzen Tag die Terrassentür offen.
Für den Abend hatte mein Vater einen Videofilm ausgeliehen. Wir wollten ein wenig feiern. Gemeinsames Abendessen im Dschungel sozusagen. Passenderweise handelte der Film von einem Dschungelabenteuer, ein bisschen Indiana Jones. Während des Filmes kreischte meine Mutter einmal, meinte, sie hätte was im Rücken gespürt. Wir lachten, ihre Angst vor Schlangen war legendär und die dicke Anakonda, die soeben gegen den Helden gekämpft und verloren hatte, hatte wahrscheinlich diesen Effekt gehabt. Spät gingen wir alle ins Bett.
Ich träumte schlecht in dieser Nacht. Da waren Insekten, groß wie Handflächen, die über meine Decke spazierten. Ich spürte krabbelnde Beinchen auf meinem Gesicht, erwachte schweißgebadet und konnte nur bei Licht schlafen. Der Film bekam die Schuld.
Wir gewöhnten uns an den Dschungel im Wohnzimmer, allerdings wunderten wir uns, dass auch nach mehreren Tagen die Luft immer noch warm und feucht war. Selbst dauerndes Lüften brachte keine Abhilfe. Der Raum begann erdig zu riechen, manchmal meinte ich Moos in den Ecken zu sehen, was sich freilich beim genauen Hinblicken als Illusion herausstellte. Die Fernsehabende fingen an ungemütlich zu werden. Die Wärme, die von der Wand auszugehen schien, verwirrte uns. Manchmal fuhr ich mit dem Finger über den kleinen Riss und er gab leicht nach, als wäre ein kleines Loch dahinter, das wir zuzuspachteln vergaßen.
Ich schlief immer noch schlecht, manchmal bevölkerten Affen meinen Traum, gelegentlich exotische Vögel, in schlimmen Nächten suchten Spinnen mich heim und ich erwachte schreiend. Den anderen schien es nicht besser zu gehen, beim Frühstück waren sie sehr still und wir alle hatten bald dunkle Ringe unter den Augen.
War ich alleine im Wohnzimmer, was ich zunehmend vermied, hörte ich knackende Zweige und Vögel, die in der Ferne schrien. Einmal meinte ich gelbschwarze Streifen zwischen den Blättern zu sehen, schob es aber auf Lichtreflexe. Die Fernsehabende verliefen in tiefem Schweigen. Wir saßen auf der vorderen Sofakante, lehnten uns nicht mehr an, horchten unentspannt nach hinten und gingen früher ins Bett als gewohnt.
Zwei Tage später hörte ich meine Mutter schreien. Als ich zu ihr rannte, stand sie mit einem Besen bewaffnet vollkommen aufgelöst auf dem Sessel, weinte und erzählte etwas von einer Schlange, die zwischen Sofa und Tisch gelegen haben soll, groß und grau mit einem schmalen Kopf und wachsamen Knopfaugen.
Danach mieden wir das Zimmer.
Am Wochenende fuhr mein Vater mit meiner Mutter in den Baumarkt. Als sie wiederkamen, hatte er fünf Rollen Blümchentapete im Arm und die Telefonnummer von einem Tapezierer.
Wir überließen ihm das Feld, saßen in der Küche und hörten dem reißenden Geräusch zu, als die Fototapete abgelöst wurde. Manchmal hörten wir ihn fluchen, einmal kreischte er kurz. In der Kaffeepause saß er schweigsam in der Küche und rieb sich eine schmerzende Stelle an der Hand. Wir hätten eine Wespe im Wohnzimmer, sagte er. Am nächsten Tag war wieder alles beim Alten. Die Tapetenreste hat mein Vater verbrannt. Nur die kleine blaue Feder, die ich Tage später auf dem Bücherregal fand, habe ich aufgehoben.
DER SCHRANK
Das Geld ist knapp, wie immer. Deshalb geht sie zu dieser Wohnungsauflösung in der Nachbarstraße. Sie braucht noch einen Bücherschrank, das Regal bricht fast zusammen unter der Last.