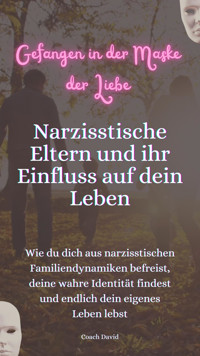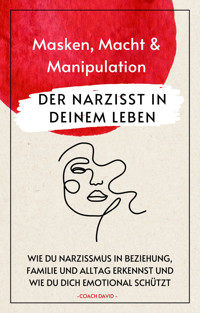
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Narzissmus – Der Narzisst in deinem Leben. Masken, Macht & Manipulation. Wie du Narzissmus in Beziehung, Familie und Alltag erkennst – und dich emotional schützt. Leidest du unter einer toxischen Beziehung? Wirst du emotional manipuliert, kontrolliert oder abgewertet? Fragst du dich, ob dein Partner, Elternteil, Freund oder Kollege narzisstisch ist? Dann ist dieses Buch genau für dich geschrieben. "Narzissmus – Verstehen und Bewältigen" ist ein praxisnaher Ratgeber für alle, die unter narzisstischem Missbrauch leiden oder Menschen begleiten, die betroffen sind. Du erhältst psychologisch fundiertes Wissen, klare Erklärungen und sofort umsetzbare Strategien für dein Leben. Dieses Buch hilft dir, dich aus destruktiven Dynamiken zu lösen, deinen Selbstwert zu stärken und emotionale Freiheit zu gewinnen. Du lernst: - Narzissmus erkennen: typische Merkmale wie Egozentrik, Love Bombing, Gaslighting, Empathielosigkeit und Kontrollverhalten - Den Unterschied zwischen gesunder Selbstliebe und pathologischem Narzissmus - Ursachen: Kindheitstraumata, psychologische Muster und familiäre Prägungen - Warnsignale in Beziehung, Familie und Beruf – z. B. narzisstischer Partner, Mutter, Vater oder Chef - Strategien im Alltag: Wie du dich abgrenzt, Grenzen setzt und deine Energie schützt - Selbsthilfe: Kontaktsperre, innere Distanz, Traumaheilung, Selbstfürsorge und Selbstwertaufbau - Unterstützung für Angehörige: helfen, ohne sich selbst zu verlieren - Therapie & Veränderung: Was wirklich hilft – und was nicht Dieses Buch richtet sich an alle, die sich fragen: „Wie erkenne ich einen Narzissten?“ „Wie komme ich aus einer narzisstischen Beziehung heraus?“ „Wie heile ich nach emotionalem Missbrauch?“ Ob du aktuell betroffen bist, dich bereits getrennt hast oder Angehörige:r bist – dieses Buch begleitet dich Schritt für Schritt in ein selbst bestimmtes, starkes Leben. Ein unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene und Angehörige – mit Tiefgang, Klarheit und Herz. Für mehr Selbstliebe, emotionale Unabhängigkeit und echte Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Coach David
Der Narzisst in deinem Leben. Masken, Macht und Manipulation.
Wie Du Narzissmus in Beziehungen, Familie und Alltag erkennst und wie du dich emotional schützt.
Ein kraftvoller Ratgeber über Narzissmus, emotionale Manipulation und toxische Beziehungen. Lerne, narzisstisches Verhalten zu erkennen, dich abzugrenzen und deinen Selbstwert zu stärken. Für alle, die Klarheit, Heilung und emotionale Freiheit suchen.Inhaltsverzeichnis
Impressum
Der Narzisst in deinem Leben
Masken, Macht & Manipulation
Wie du Narzissmus in Beziehung, Familie und Alltag erkennst und
wie du dich emotional schützt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung…………………………………………………………………3
Was ist Narzissmus?...................................................7
Gesunde vs. ungesunde Selbstliebe……………………….12
Ursachen des Narzissmus………………………………………18
Merkmale und Diagnose………………………………………..25
Grandioser und vulnerabler Narzissmus………………..33
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung……………….42
Narzissmus in Beziehungen……………………………………51
Narzissmus in der Familie………………………………………59
Narzissmus im Berufsleben……………………………………70
Narzissmus in der Gesellschaft………………………………78
Auswirkungen auf Betroffene………………………………..85
Umgang mit Narzissten im Alltag……………………………93
Bewältigungsstrategien für Betroffene………………..101
Unterstützung für Angehörige……………………………..110
Therapie und Ausblick………………………………………….117
Abschlusskapitel………………………………………………….125
Danksagung…………………………………………………………128
Einleitung
Willkommen zu Narzissmus – Verstehen und Bewältigen, einem Buch, das sich umfassend mit dem Thema Narzissmus befasst.
Doch was genau ist mit „Narzissmus“ gemeint? Der Begriff entstammt der griechischen Mythologie: Narziss war ein schöner junger Mann, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte und daran zugrunde ging. Aus dieser alten Erzählung leitet sich der heutige Begriff Narzissmus ab, er steht sinnbildlich für übertriebene Selbstliebe und Eitelkeit.
In der modernen Psychologie beschreibt Narzissmus allerdings weit mehr als nur jemanden, der gerne in den Spiegel schaut. Es geht um ein tiefgreifendes Persönlichkeitsmerkmal und in seiner extremen Ausprägung um eine Persönlichkeitsstörung.
In den letzten Jahren ist Narzissmus zu einem regelrechten Schlagwort geworden. Ob in sozialen Medien, in Ratgebern oder im Alltagsgespräch. Schnell wird jemand als „Narzisst“ bezeichnet, der egoistisch oder selbstverliebt erscheint. Der Begriff wird fast inflationär gebraucht. Das zeigt, wie allgegenwärtig uns narzisstisches Verhalten heute erscheint.
Gleichzeitig besteht die Gefahr von Missverständnissen: Nicht jede ausgeprägte Selbstliebe ist krankhaft, und nicht jeder schwierige Mensch ist gleich ein Narzisst im klinischen Sinne. Dieses Buch möchte Klarheit schaffen, indem es psychologisch fundiert erläutert, was Narzissmus wirklich bedeutet, welche Formen er annimmt und wie man damit umgehen kann.
Dabei richtet sich das Buch sowohl an Betroffene, die unter dem Verhalten eines narzisstischen Menschen leiden, als auch an Angehörige und Freunde, die einer nahestehenden Person helfen möchten.
Es soll aber auch all jenen einen Einblick geben, die einfach verstehen wollen, was hinter der Fassade von Selbstverliebtheit und großer Worte steckt. Oft verbirgt sich hinter dem lauten Auftreten eines Narzissten nämlich große Unsicherheit. Narzissten wirken nach außen hin stark und von sich überzeugt, doch im Inneren kämpfen sie nicht selten mit einem fragilen Selbstwertgefühl. Diese innere Zerbrechlichkeit führt dazu, dass sie sehr empfindlich auf Kritik reagieren, manchmal mit Wut und trotziger Abwehr.
Im Verlauf der Kapitel werden wir Schritt für Schritt tiefer in das Thema eintauchen. Zunächst klären wir die Definition und Grundlagen: Was versteht die Psychologie unter Narzissmus, und wie grenzt es sich von einem gesunden Selbstwertgefühl ab?
Dann betrachten wir die Ursachen: Wie entsteht Narzissmus? Liegt es an der Erziehung, an genetischen Faktoren oder an gesellschaftlichen Einflüssen?
Anschließend widmen wir uns den Merkmalen: Woran erkennt man einen Narzissten, und welche Kriterien müssen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung erfüllt sein?
Ein wichtiger Teil des Buches beleuchtet Narzissmus in verschiedenen Lebensbereichen. Wie verhält er sich in partnerschaftlichen Beziehungen und welche Dynamiken ergeben sich daraus?
Was bedeutet es, einen narzisstischen Elternteil zu haben oder mit einem narzisstischen Kind aufzuwachsen? Ebenso werfen wir einen Blick auf Narzissmus am Arbeitsplatz, wo charismatische Selbstdarsteller einerseits Karriere machen können, andererseits aber ein toxisches Klima erzeugen.
Auch der Blick auf unsere Gesellschaft fehlt nicht: Leben wir wirklich in einer „Narzissmus-Epidemie“? Fördern soziale Medien die Selbstinszenierung? Hierzu betrachten wir auch aktuelle Studien und Trends, die zeigen, dass das Thema differenziert zu betrachten ist
Ganz zentral für dieses Buch sind die Auswirkungen auf die Mitmenschen. Narzissmus ist nicht nur für die Betroffenen selbst problematisch, sondern vor allem für die Menschen um sie herum. Partner, Kinder, Kollegen. Wir werden die typischen Muster aufzeigen, wie Narzissten andere in ihren Bann ziehen, manipulieren und emotional verletzen. Doch es bleibt nicht bei der Problembeschreibung: Ein Schwerpunkt liegt auf Bewältigungsstrategien. Wie kann man mit einem Narzissten im Alltag umgehen, ohne dabei selbst zugrunde zu gehen? Was können Opfer narzisstischen Missbrauchs tun, um sich zu befreien und zu heilen? Und wie können Angehörige und Freunde Unterstützung bieten, ohne sich selbst zu verausgaben?
Die Sprache dieses Buches ist bewusst leicht verständlich gehalten, ohne die fachliche Tiefe zu vernachlässigen. Psychologische Erkenntnisse, von den Theorien eines Sigmund Freud bis hin zu aktuellen Studien werden so erklärt, dass kein Vorwissen nötig ist. Praktische Beispiele und Tipps sollen das Verständnis vertiefen und Wege aufzeigen, wie man mit dem schwierigen Thema Narzissmus umgehen kann.
Egal, ob Sie gerade erst feststellen, dass Sie einen Narzissten in Ihrem Umfeld haben, ob Sie vielleicht selbst narzisstische Züge an sich entdecken, oder ob Sie einfach mehr darüber erfahren möchten. Dieses Buch möchte Ihnen sowohl Wissen vermitteln als auch Mut machen. Narzissmus ist kein neues Phänomen, aber die offene Diskussion darüber bietet die Chance, frühzeitig Warnsignale zu erkennen und gesünder mit solchen Persönlichkeiten umzugehen. In diesem Sinne: Tauchen wir ein in die Welt des Narzissmus, um am Ende besser gerüstet zu sein, ihm zu begegnen und ihn zu bewältigen.
Kapitel 1: Was ist Narzissmus?
Narzissmus, kaum ein Begriff der Psychologie hat in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit erregt. Doch was genau verbirgt sich dahinter?
Im Kern bezeichnet Narzissmus eine übersteigerte Selbstbezogenheit und Selbstbewunderung. Ein narzisstisch veranlagter Mensch hält sich für besonders wichtig und großartig und hat ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung durch andere. Oft geht dies mit einem Mangel an Empathie einher. Die Gefühle und Bedürfnisse anderer spielen nur eine geringe Rolle. In der Fachliteratur heißt es beispielsweise, die narzisstische Persönlichkeitsstruktur zeichne sich durch Überschätzung der eigenen Wichtigkeit, ein gesteigertes Verlangen nach Anerkennung und einen Mangel an Empathie aus. Doch Narzissmus hat viele Facetten und Ausprägungen, vom alltäglichen Narzissmus bis zur klinischen Persönlichkeitsstörung.
Der Begriff selbst stammt, wie in der Einleitung erwähnt vom griechischen Mythos des Narziss. Dieser verliebte sich so sehr in sein Spiegelbild, dass er darüber alles andere vergaß und schließlich starb. An der Stelle, wo er starb, soll der Sage nach eine Blume erblüht sein: die Narzisse. Bis heute steht Narziss sinnbildlich für selbstverliebte Menschen. Natürlich ist der Mythos eine drastische Darstellung. Niemand muss befürchten, tatsächlich an der eigenen Eitelkeit zu sterben. Dennoch vermittelt die Geschichte eine wichtige moralische Lehre: Übermäßige Selbstliebe und Eitelkeit können gefährlich werden,
gefährlich für zwischenmenschliche Beziehungen und für die eigene seelische Gesundheit.
In der Psychologie wird zwischen Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft und Narzissmus als Persönlichkeitsstörung unterschieden.
Ersteres bedeutet, dass jemand narzisstische Züge hat, also z.B. sehr ich-bezogen ist oder gern im Mittelpunkt steht, ohne dass es unbedingt pathologisch sein muss. Man könnte sagen: ein gewisses Maß an Narzissmus steckt in jedem von uns – schließlich hat jeder den Wunsch, sich selbst zu mögen und in einem guten Licht zu erscheinen.
Dieses Maß an Selbstliebe ist zunächst einmal normal und sogar wichtig für ein gesundes Selbstwertgefühl. In der frühen Kindheit durchlaufen alle Menschen eine Phase des „primären Narzissmus“, in der das Kind meint, die Welt drehe sich nur um es. Später lernen wir, dass auch andere Menschen Bedürfnisse haben und wir nicht immer der Mittelpunkt sein können.
Pathologischer Narzissmus liegt dann vor, wenn jemand gewissermaßen in einer kindlichen Ich-Bezogenheit steckenbleibt und das normale Maß bei weitem überschreitet. Dann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS). Diese ist in diagnostischen Manualen wie dem DSM-5 exakt definiert, darauf gehen wir in Kapitel 4 ausführlicher ein.
Charakteristisch für Narzissten im Alltagsverständnis, wie im klinischen Sinne ist, dass sie übermäßig mit sich selbst beschäftigt sind. Sie haben oft grandiose Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht, Schönheit oder idealer Liebe. Kritik vertragen sie schlecht, denn das passt nicht in ihr Selbstbild als etwas Besonderes. Wird ein narzisstischer Mensch kritisiert oder zurückgewiesen, reagiert er häufig mit Abwehr, Wut oder sogar narzisstischer Kränkung. Einer Art tief beleidigter Reaktion, die bis zum sogenannten narzisstischen Zorn gehen kann. Dieser Zorn kann sich durch heftige Wutausbrüche äußern und im Extremfall sogar in Gewalt umschlagen. Gleichzeitig fehlt es an echter Einfühlungsfähigkeit: Narzissten können oder wollen sich nicht in andere hineinversetzen. Andere Menschen sind für Narzissten nur wichtig, wenn sie eine Funktion erfüllen. Das heißt: Entweder nützen mir andere, indem sie mir Bewunderung schenken, Status vermitteln oder mich gut dastehen lassen oder sie sind mir gleichgültig und werden gegebenenfalls abgewertet.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Stellen wir uns einen Kollegen vor, der bei jedem Meeting die Aufmerksamkeit auf sich zieht, mit seinen Erfolgen prahlt und die Ideen anderer als seine eigenen ausgibt. Anfänglich wirkt er vielleicht charmant und überzeugend, weil er selbstbewusst auftritt. Doch nach und nach merken die Teammitglieder, dass dieser Kollege kaum zuhört, Kritik aggressiv abwehrt und
null Interesse an den Beiträgen anderer zeigt. Wenn etwas schiefgeht, schiebt er die Schuld grundsätzlich jemand anderem zu. Lob und Anerkennung hingegen fordert er lautstark für sich ein. Dieses Verhalten entspricht ziemlich gut dem Bild eines narzisstischen Menschen.
Im Gegensatz dazu gibt es aber auch die subtileren Fälle: Personen, die nach außen hin bescheiden oder unsicher wirken, innerlich aber ebenfalls extrem mit sich selbst beschäftigt sind. Sie prahlen nicht offen, doch sie sehnen sich ebenso nach Bewunderung und fühlen sich ständig gekränkt oder übergangen. Auch das ist Narzissmus. Nur in einer „leiseren“ Variante. Diese unterschiedlichen Erscheinungsformen werden wir in Kapitel 5 näher betrachten. Wichtig an dieser Stelle festzuhalten ist: Narzissmus bewegt sich auf einem Spektrum. Am einen Ende steht die normale Selbstliebe, in der Mitte der ausgeprägte aber noch alltagskompatible Narzissmus, etwa der eitle Vorgesetzte, der gern im Mittelpunkt steht, aber noch halbwegs funktional ist und am äußersten Ende die pathologische Persönlichkeitsstörung, bei der Beziehungen und Lebensführung massiv beeinträchtigt sind.
Bevor wir tiefer einsteigen, noch ein Wort zur derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung: Man gewinnt leicht den Eindruck, Narzissmus sei überall. In den Medien ist gar von einer „Generation Ego“ oder einer „Narzissmus-Epidemie“ die Rede. Sicherlich leben wir in einer Zeit, die Selbstinszenierung begünstigt man denke an Social Media wie Instagram, wo sich manche Nutzer täglich in Szene
setzen. Allerdings warnen Psychologen davor, hier zu stark zu verallgemeinern. Aktuelle Studien zeigen nämlich keinen eindeutigen Anstieg des Narzissmus in der Gesamtbevölkerung; einige Befunde deuten sogar eher auf einen leichten Rückgang hin. Dazu später mehr in Kapitel 10. Es lohnt sich also, das Phänomen differenziert zu betrachten.
In diesem ersten Kapitel halten wir fest: Narzissmus bedeutet übersteigerte Selbstliebe, Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie. Die Wurzeln des Begriffs liegen im Mythos, doch heute wissen wir, dass dahinter komplexe psychologische Mechanismen stehen. Narzissmus ist nicht einfach „böse“, oft steckt eine verletzliche Seele dahinter. Trotzdem können narzisstische Verhaltensweisen für das Umfeld sehr schädlich sein. Die folgenden Kapitel werden dieses Spannungsfeld weiter ausleuchten.
Kapitel 2: Gesunde vs. ungesunde Selbstliebe
Nicht jede Form von Selbstliebe ist negativ. Im Gegenteil: Ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz sind wichtig für unsere psychische Stabilität. In diesem Kapitel wollen wir daher klar unterscheiden zwischen gesunder Selbstliebe und ungesundem Narzissmus. Wo verläuft die Grenze? Wann kippt Selbstbewusstsein in Selbstüberschätzung, und Selbstliebe in Egozentrik?
Zunächst zur gesunden Selbstliebe: Damit ist gemeint, sich selbst zu mögen, die eigenen Stärken und Schwächen realistisch anzuerkennen und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Menschen mit gesundem Selbstwert können eigene Fehler zugeben, ohne sich dabei als Person komplett infrage zu stellen. Sie können auch andere bewundern, ohne Neid, weil das eigene Selbstwertgefühl nicht ständig auf dem Prüfstand steht. Wichtig: Ein gesundes Selbstbewusstsein schließt Empathie für andere nicht aus. Im Gegenteil, wer mit sich selbst im Reinen ist, hat meist keine Notwendigkeit, andere klein zu machen.
Narzissmus hingegen, im problematischen Sinne, geht über ein gesundes Selbstvertrauen weit hinaus. Eine Person mit stark narzisstischen Zügen hält sich in unverhältnismäßiger Weise für überlegen. Das eigene Bild ist oft verzerrt und unrealistisch positiv. Schwächen werden ausgeblendet oder geleugnet. Gleichzeitig ist diese Selbstliebe erstaunlich fragil. Es handelt sich nämlich nicht um ein echtes Selbstwertgefühl, das von innen kommt, sondern um ein instabiles Konstrukt, das ständig Bestätigung von außen braucht.
Man kann sagen: Narzisstische Selbstliebe ist nicht stabil. Deshalb müssen Narzissten unentwegt daran arbeiten, sich „großartig“ zu fühlen indem sie Komplimente suchen, sich bewundern lassen oder Erfolge herausstellen. Fällt diese externe Bestätigung weg oder erhalten sie Kritik, bricht das ganze Konstrukt schnell zusammen. Dann treten Unsicherheit, Scham oder Wut hervor, die unter der Oberfläche lauern.
Ein Beispiel: Stellen Sie sich zwei Kollegen vor, Anna und Ben, die beide sehr selbstbewusst wirken. Anna hat ein gesundes Selbstwertgefühl. Wenn sie für ein Projekt gelobt wird, freut sie sich, aber es steigt ihr nicht zu Kopf. Wenn sie in einer Besprechung einen Fehler macht und darauf hingewiesen wird, ist ihr das zwar unangenehm, aber sie kann die Kritik annehmen und daraus lernen. Sie weiß, dass ein Fehler sie nicht als Person abwertet.
Ben hingegen ist narzisstisch veranlagt. Auch er tritt zunächst sehr sicher auf und sonnt sich im Erfolg. Wird Ben jedoch kritisiert, selbst wenn es konstruktiv gemeint ist reagiert er scharf und defensiv. Er sucht Ausreden oder schiebt die Schuld auf andere. Innerlich fühlt er sich sofort verletzt und erniedrigt, als sei seine ganze Person infrage gestellt. Während Anna nach einem Fehler vielleicht denkt: "Okay, das war nicht gut, aber nächstes Mal mache ich es besser", denkt Ben: "Der wagt es, mich zu kritisieren? Der will mich kleinmachen!". Dieses Beispiel verdeutlicht: Beim Narzissten fehlt das stabile innere Fundament des Selbstwerts. Er ist abhängig vom äußeren Echo.
Gesunde Selbstliebe äußert sich auch darin, dass man andere lieben kann. Jemand mit stabilem Selbstwert hat die Kapazität für gegenseitige, mitfühlende Beziehungen. Ungesunder Narzissmus hingegen führt oft zu Einseitigkeit in Beziehungen: Der Narzisst will vor allem bewundert werden und zieht Nutzen aus anderen, anstatt eine wechselseitige Bindung aufzubauen. Man spricht manchmal davon, dass Narzissten andere Menschen als „Erweiterung“ ihrer selbst sehen. In gesunder Selbstliebe erkennt man hingegen: Ich bin ich und du bist du beide mit eigenen Bedürfnissen.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Realitätstüchtigkeit. Gesunde Selbstliebe basiert auf einem realistischen Selbstbild. Ich kenne meine Stärken, aber ich kenne auch meine Grenzen. Ein narzisstisches Selbstbild ist oft idealisiert. Der Narzisst glaubt vielleicht, er sei der Klügste im Raum, auch wenn objektiv andere mehr Expertise haben. Er überschätzt konstant seine Fähigkeiten oder seine Bedeutung. Diese Selbstüberschätzung kann kurzfristig als großes Selbstvertrauen erscheinen, aber langfristig führt sie zu Problemen, weil der Betreffende Warnungen oder Feedback ignoriert.
Man könnte auch sagen: Gesunde Selbstliebe ist leise, unaufdringlich. Wer sich selbst mag, muss das nicht permanent demonstrieren. Narzissmus ist laut: Er drängt nach außen. Narzissten neigen dazu, sich hervorzutun, anzugeben oder im Mittelpunkt zu stehen, weil sie den Applaus brauchen. Trotzdem kann Narzissmus auch
versteckt auftreten, dazu kommen wir gleich noch. Aber generell fühlt sich der Narzisst innerlich zu wichtig, um bescheiden im Hintergrund zu bleiben. Gesunde Selbstliebe braucht diesen Applaus nicht.
Ein häufiges Missverständnis ist: Narzissten lieben sich doch so sehr selbst, also haben sie ein hohes Selbstwertgefühl. Paradoxerweise zeigen viele Untersuchungen, dass hinter der Fassade des hohen Selbstwerts oft ein sehr niedriges Selbstwertgefühl steckt. Die übertriebene Selbstliebe dient als Kompensation. Es ist, als ob der Narzisst sich ständig selbst davon überzeugen muss, wertvoll zu sein, weil er im Innersten zweifelt. Gesunde Selbstliebe hingegen kommt aus einem Gefühl der inneren Sicherheit man weiß um den eigenen Wert, ohne es ständig beweisen zu müssen.
Wie erkennt man nun im Alltag den Unterschied? Ein paar Anhaltspunkte:
Umgang mit Kritik: Menschen mit gesundem Selbstwert können Kritik einordnen und daraus lernen. Narzissten reagieren beleidigt oder aggressiv auf Kritik, selbst wenn sie konstruktiv ist.
Empathie und Interesse: Gesunde Selbstliebe erlaubt, echtes Interesse an anderen zu haben, man ist nicht bedroht von den Erfolgen oder Gefühlen anderer. Ein Narzisst wird schnell neidisch auf Erfolge anderer oder ignoriert fremde Gefühle, weil alles auf sich selbst bezogen wird.
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Natürlich freut sich jeder über Anerkennung. Aber Narzissten brauchen förmlich dauernd Aufmerksamkeit und Bewunderung. Bleibt diese aus, fühlen sie sich schnell minderwertig oder gelangweilt.
Beziehungen: In einer gesunden Beziehung (sei es Freundschaft, Familie, Liebe) gibt es Geben und Nehmen. Bei narzisstischer Persönlichkeitsausprägung neigt die Waage dazu, dass der Narzisst nimmt (Aufmerksamkeit, Gefallen, Bestätigung) und der andere gibt. Der Narzisst hat Schwierigkeiten, gleichwertige Partnerschaften auf Augenhöhe zu führen.
Narzissmus kann also als ungesunde, übersteigerte Selbstliebe verstanden werden, die oft auf unsicherem Grund steht. Gesunde Selbstliebe hingegen stärkt sowohl die eigene Person als auch die Fähigkeit, auf andere einzugehen. Es ist wichtig zu betonen, dass man nicht auf jegliche Selbstliebe verzichten sollte aus Angst, narzisstisch zu wirken. Es ist völlig in Ordnung, ja sogar notwendig, sich selbst wertzuschätzen, Grenzen zu setzen und sich auch mal in den Vordergrund zu stellen, wenn es angebracht ist. Problematisch wird es erst, wenn diese Selbstbezogenheit alles andere überschattet.
Viele Ratgeber nennen in diesem Zusammenhang den Begriff „Selbstwertgefühl“. Ein angemessenes Selbstwertgefühl ist der Schlüssel. Menschen mit hohem, aber authentischem Selbstwert neigen weniger zu destruktivem Narzissmus, weil sie innerlich gefestigt sind. Die Gefahr liegt vielmehr bei einem instabilen Selbstwert:
Ist er hoch, aber hohl, d.h. nicht durch innere Überzeugung gedeckt, braucht es narzisstische Strategien, um ihn aufrechtzuerhalten.
In Summe: Narzissmus ist ungesunde Selbstliebe, die auf Kosten anderer geht und letztlich auch der eigenen seelischen Gesundheit schaden kann. Gesunde Selbstliebe dagegen ist die Grundlage dafür, ein erfülltes Leben zu führen, in dem man sowohl sich selbst als auch andere respektieren kann. Dies im Hinterkopf zu behalten hilft, im konkreten Fall z.B. bei einer Person im Umfeld besser abzuschätzen: Handelt es sich „nur“ um jemanden mit gesundem Selbstvertrauen oder überschreitet es bereits die Grenze zur Egozentrik und Gefährdung zwischenmenschlicher Beziehungen?
Im nächsten Kapitel werden wir einen Blick darauf werfen, warum Narzissmus überhaupt entsteht. Ist es angeboren? Oder hausgemacht durch falsche Erziehung? Die Ursachenforschung gibt einige faszinierende Einblicke in die Entstehung dieses Persönlichkeitsmerkmals.
Kapitel 3: Ursachen des Narzissmus
Was macht einen Menschen zum Narzissten? Diese Frage beschäftigt Psychologen bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert. Es gibt keine einfache Antwort darauf, denn Narzissmus entsteht vermutlich durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Erziehung und Kindheitserfahrungen, genetische Veranlagungen und soziale Einflüsse. In diesem Kapitel beleuchten wir einige der bekanntesten Theorien und Forschungsergebnisse zu den Ursachen von Narzissmus.
Eine weit verbreitete Annahme ist, dass die Wurzeln des pathologischen Narzissmus in der frühen Kindheit liegen. Kinder kommen zunächst mit einem ganz natürlichen Narzissmus zur Welt. Sie sind der Mittelpunkt ihres eigenen Universums. Entscheidend ist, wie Eltern mit diesem kindlichen Narzissmus umgehen und wie das Kind im Laufe der Entwicklung lernt, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden. Viele psychoanalytische Theorien sehen die Ursache von Narzissmus in bestimmten Mustern der Eltern-Kind-Interaktion. Allerdings gehen die Meinungen auseinander, welches Muster genau verantwortlich ist.
Der Psychoanalytiker Heinz Kohut zum Beispiel vermutete, dass Narzissmus entsteht, wenn Eltern ihrem Kind nie die Chance geben, Frustrationen zu erleben. Klingt paradox – aber Kohut sprach von „optimaler Frustration“: Ein Kind braucht gelegentlich zumutbare Enttäuschungen (z.B. mal warten müssen, nicht jeden Wunsch sofort erfüllt bekommen), um ein realistisches Selbstbild zu entwickeln.
Werden einem Kind hingegen alle Wünsche von den Augen abgelesen und es wird wie ein kleiner König behandelt, bleibt es in gewisser Weise in seiner grandiosen Weltsicht stecken. Es lernt nicht, mit den Grenzen der Realität umzugehen. Das wäre die Theorie der übermäßigen Verwöhnung: Zu viel unkritische Bewunderung und Nachgiebigkeit in der Erziehung könnten narzisstische Züge fördern.
Ein anderer Ansatz, vertreten durch Otto Kernberg, sieht das genaue Gegenteil als Ursache: kalte, strenge oder feindselige Eltern. Kernberg meinte, wenn ein Kind in einem lieblosen Klima aufwächst, entwickelt es als Abwehrmechanismus eine Fantasie der eigenen Großartigkeit. Weil es die Eltern nicht idealisieren kann (sie geben ja keine Wärme), idealisiert es sich selbst. Das Kind sagt sich unbewusst: „Meine Eltern geben mir keine Liebe, also brauche ich sie nicht – ich genüge mir selbst, ich bin großartig.“ Das ursprüngliche kindliche Grandiositätsgefühl wird sozusagen nie aufgegeben, weil es keinen Ersatz in Form von liebevoller Identifikation mit den Eltern gibt. So bleibt das Kind auf sich allein gestellt und „stecken“ in einem Zustand von trotziger Selbstüberhöhung. Dieser Ansatz betont also Vernachlässigung und emotionale Kälte als Keimzelle von Narzissmus.
Interessanterweise schließen sich diese beiden Theorien nicht völlig aus. Es gibt Hinweise darauf, dass beide Arten von problematischer Erziehung Narzissmus fördern können, allerdings vielleicht verschiedene Ausprägungen:
Grandioser Narzissmus könnte eher aus Verwöhnung entstehen, verletzlicher Narzissmus eher aus Kälte und Kontrolle. Tatsächlich deuten erste empirische Daten darauf hin, dass grandioser Narzissmus häufig mit übermäßiger Verwöhnung in der Kindheit zusammenfällt, während verletzlicher (also verdeckter, hypersensibler) Narzissmus öfter bei Kindern entsteht, die emotional kontrollierende oder manipulative Eltern hatten. Mit anderen Worten: Das verwöhnte Kind lernt „Ich bin der Größte und alle müssen mich bewundern“, das vernachlässigte Kind lernt „Niemand kümmert sich um mich, also träume ich mich in Großartigkeit, bin aber innerlich unsicher“.
Neben Kohut und Kernberg gibt es noch weitere psychoanalytische Spekulationen: Arnold Rothstein etwa vermutete (1979), dass manche Eltern ihre Kinder dazu benutzen, eigene ehrgeizige Wünsche zu erfüllen. Das Kind wird zum Prestigeprojekt der Eltern. Es soll perfekt sein, damit die Eltern sich über dessen Erfolge definieren können. Daraus kann ein Kind die Botschaft mitnehmen: Ich bin nur wertvoll, wenn ich außergewöhnlich bin. Auch das kann narzisstische Muster fördern. Theodore Millon schlug 1981 vor, dass manche Eltern ihrem Kind regelrecht antrainieren, von anderen besondere Unterwerfung zu erwarten beispielsweise indem das Kind immer als etwas Besseres behandelt wird als andere und so ein Anspruchsdenken entwickelt.