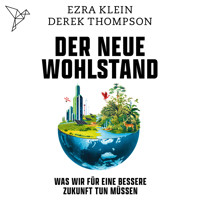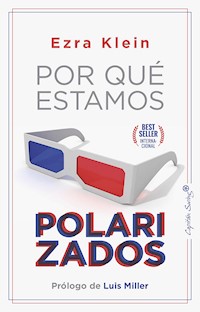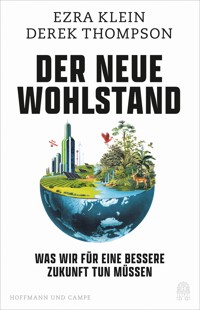
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leseempfehlung von Barack Obama: »Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, die fortschrittlich denken und etwas über einen politischen Entwurf erfahren wollen, wie der Staat reformiert werden müsste, um der arbeitenden Bevölkerung wieder neu dienen zu können.« Die globale Geschichte des 21. Jahrhunderts ist eine Geschichte der Knappheit, ganz gleich, ob es um Wohnungen geht, um Arbeitskräfte, um Technologien oder um saubere Energie. Dabei hat sich die gegenwärtige Krise in den Industriestaaten seit Jahren angebahnt – weil wir eine Politik des Verzichts geübt haben und nicht innovativ genug waren. Ezra Klein und Derek Thompson zeigen, wie wir die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Hindernisse für den Fortschritt überwinden, wie wir Systeme und Institutionen für den Aufbau schaffen und so zu einem neuen Wohlstand gelangen. Ein Wohlstand, der nicht gleichbedeutend ist mit dem Reichtum weniger, sondern mit einer besseren Zukunft für möglichst viele Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ezra Klein | Derek Thompson
Der neue Wohlstand
Was wir für eine bessere Zukunft tun müssen
Katrin Harlaß
Für Annie, Moses und Kieran: Mein Wohlstand
Ezra Klein
Für Laura und Isla
Derek Thompson
Einleitung: Jenseits der Knappheit
Einleitung: Jenseits der Knappheit
1
Wachsen
1
Wachsen
2
Bauen
2
Bauen
3
Regieren
3
Regieren
4
Erfinden
4
Erfinden
5
Anwenden
5
Anwenden
Fazit: Auf zum neuen Wohlstand
Fazit: Auf zum neuen Wohlstand
Dank
Dank
Anmerkungen
Anmerkungen
Vorbemerkung der Autoren
Einige der in diesem Buch enthaltenen Informationen und Texte sind vorab in Form von Kolumnen, Artikeln, Newslettern und Gesprächen erschienen, verfasst und produziert für The New York Times und The Atlantic.
Einleitung: Jenseits der Knappheit
Es dämmert. Sie öffnen die Augen und strecken sich. Im Zimmer ist es angenehm kühl. Wenige Meter über Ihrem Kopf, in den Solarpaneelen auf dem Dach, spiegelt sich die Morgensonne. Die dort produzierte Energie fließt in den Strommix ein, den Sie aus diversen sauberen Energiequellen beziehen: hoch aufragenden Windturbinen im Osten, kleinen Atomkraftwerken im Norden, tiefen Geothermiebrunnen im Süden. Vor vierzig Jahren kühlten Ihre Eltern die Wohnung noch mithilfe von Energie, die aus Kohlegruben und Erdölbohrungen stammte. Damals schürfte und verfeuerte man feste Brennstoffe, kleisterte sich die Lunge mit deren Nebenprodukten zu, schloss die Welt – Ihre Welt – in einer chemischen Hitzefalle ein. Heute erscheint das barbarisch. Sie leben in einem Kokon aus Energie, so sauber, dass sie fast gar keinen CO2-Fußabdruck hinterlässt, und so billig, dass die Kosten auf Ihrer monatlichen Abrechnung kaum ins Gewicht fallen.
Es ist das Jahr 2050.
Sie gehen zur Küchenspüle und drehen den Wasserhahn auf. Was Ihnen so frisch und klar in die Hände sprudelt, kommt aus dem Ozean. Es wird aus einer Entsalzungsanlage, in der das Meersalz mithilfe von Membranfiltration abgeschieden wird, zu Ihnen gepumpt. Solche Anlagen decken heute mehr als die Hälfte des landesweiten Trinkwasserbedarfs. Vormals völlig übernutzte Flüsse wie der Colorado strömen jetzt, da wir sie nicht mehr brauchen, um unsere Farmen zu bewässern und unsere Kaffeebecher zu füllen, wieder in alter Stärke. Phoenix und Las Vegas sind keine verdorrten Betonwüsten mehr – überall sprießt frisches Grün.
Sie öffnen den Kühlschrank. In den Behältern für Obst und Gemüse liegen Äpfel, Tomaten und eine Aubergine, geliefert von der nahe gelegenen Farm. Sie wachsen dort nicht horizontal auf Feldern, sondern vertikal, in mehrstöckigen Regalen, die in einem hohen, schlanken Gewächshaus stehen, wo LED-Module die Pflanzen in festgelegten Intervallen mit genau der richtigen Menge Licht versorgen. Die moderne Landwirtschaft wird in solchen Hochhausfarmen betrieben, sodass unzählige Quadratkilometer Ackerfläche in Wälder und Parks umgewandelt werden konnten. Geflügel- und Rindfleisch kommen größtenteils aus In-vitro-Kulturen, wo Hühnerbrüste und Rib-Eye-Steaks aus Tierzellen gezüchtet werden, es braucht also keine Massentierhaltung und keine Schlachtung mehr. Einst war solches Fleisch sündhaft teuer, heute kann es sich wegen der Menge des zur Verfügung stehenden billigen Stroms jeder leisten. Als Ihre Eltern jung waren, wurde knapp ein Viertel der Landfläche der Erde für die Haltung von Tieren genutzt, die zum menschlichen Verzehr bestimmt waren. Das ist heute unvorstellbar. Die meisten dieser Flächen sind jetzt wieder Wildnis.
Beim Blick aus dem Fenster sehen Sie, wie gegenüber gerade per Drohne eine Bestellung Star Pills ausgeliefert wird. Noch vor wenigen Jahren galt ihre tägliche Einnahme zur Regulierung von Übergewicht, Bekämpfung von Abhängigkeiten und Verlangsamung der Zellalterung als Wundermittel für die Reichen, vor allem, nachdem wir erkannt hatten, dass die wirkentscheidenden Moleküle sich am besten unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit synthetisieren ließen, also im All. Heutzutage umkreisen uns die automatisierten Fabriken, in denen sie hergestellt werden, auf einer erdnahen Bahn. Preisgünstige Raketentechnik bringt die Medikamente zur Erde, wo sie bereits Millionen von Leben gerettet und uns Milliarden gesunder Lebensjahre geschenkt haben.
Sie gehen nach draußen. Die Luft ist sauber und frisch, durchtränkt vom leisen Surren elektrischer Maschinen, die überall um Sie herum im Einsatz sind. Auf der Straße gleiten, sanft wie eine leichte Brise, elektrisch betriebene, überwiegend selbstfahrende Autos und Lastwagen an Ihnen vorüber, gefolgt von Schulkindern und Pendlern auf E-Bikes und E-Scootern. Manche davon sind Privateigentum, andere gehören städtischen Leihfirmen. Wieder schwebt eine Drohne für die letzte Liefermeile aus den Baumkronen nach unten, hält sirrend über dem Vorgarten eines Nachbarn inne wie ein Kolibri und wirft ein Paket ab. Diese E-Bots stellen inzwischen einen Großteil der Online-Käufe zu, wodurch die Anzahl der Menschen mit ermüdenden, eintönigen Lieferjobs erheblich gesunken ist.
Ihr Mikro-Hörgerät pingt: eine Sprachnachricht von einem Freund, der mit seiner Familie auf dem Weg ins nächste Urlaubswochenende ist. Überall hat die Kombination von künstlicher Intelligenz, Arbeitnehmerrechten und Wirtschaftsreformen Armut verringert und die durchschnittliche Arbeitszeit verkürzt. Dank höherer Produktivität durch KI können die meisten Menschen das Soll einer Arbeitswoche nun in wenigen Tagen schaffen, was sich in verlängerten Urlaubszeiten, Wochenenden und Ferien niederschlägt. Weniger Arbeit bedeutet aber nicht weniger Verdienst. Fundament der KI ist das kollektive Wissen der Menschheit, also werden die mit ihrer Hilfe generierten Gewinne geteilt. Ihre Freunde fliegen von New York nach London und werden dafür nur etwas mehr als zwei Stunden brauchen. Moderne Jetliner erreichen jetzt routinemäßig Mach 2, doppelte Schallgeschwindigkeit also, und stoßen dank eines Gemischs aus herkömmlichen und grünen synthetischen Treibstoffen viel weniger CO2 aus.
Die Welt hat sich verändert. Nicht nur die virtuelle, dieser Pixeltanz auf unseren Bildschirmen. Nein, auch die materielle: ihre Gebäude, ihre Energie, ihre Infrastruktur, ihre Medizin, ihre harten Technologien. Wie sehr unterscheidet sich doch diese Epoche von den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, in denen eine Krise die andere jagte. Immobilienkrise. Finanzkrise. Pandemie. Klimakrise. Politische Krisen. Viele Jahre lang hatten wir Obdachlosigkeit und Armut, unbehandelte Krankheiten und schwindende Lebenserwartung hingenommen. Viele Jahre lang war uns klar, was es brauchte, um den Knappheiten zu begegnen, die so viele Menschen plagten, und die Möglichkeiten zu schaffen, nach denen sich so viele von uns sehnten, aber wir gingen es einfach nicht an. Viele Jahre lang versäumten wir es, Technologien zu erfinden und zu implementieren, die die Welt sauberer, gesünder und reicher machen würden. Viele Jahre lang schränkten wir selbst unsere Fähigkeit ein, die drängendsten Probleme zu lösen. Warum?
Knappheit ist stets eine bewusste Entscheidung
Die Idee, um die es in diesem Buch geht, ist simpel: Damit wir die Zukunft bekommen, die wir uns wünschen, müssen wir mehr von dem schaffen und erfinden, was wir brauchen. Punkt. Das ist die These.
Selbst uns erscheint sie zu einfach. Dabei ist die Geschichte der USA im 21. Jahrhundert eine Geschichte bewusst herbeigeführter Knappheiten. Die Erkenntnis, dass all diese Knappheiten das Ergebnis bewusster Entscheidungen sind – dass wir uns also anders entscheiden könnten –, ist elektrisierend. Sich den Gründen dafür zu stellen, warum wir das nicht tun, treibt einen in den Wahnsinn.
Wir sagen, wir wollen den Planeten vor dem Klimawandel retten. Doch im wahren Leben stemmt sich ein Großteil unserer Bevölkerung mit aller Kraft gegen den Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Selbst liberal geführte Bundesstaaten legen Atomkraftwerke still, die nicht ein einziges Gramm CO2 ausstoßen, und erleben Proteste gegen Solarprojekte. Wir sagen, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Doch unsere reichsten Städte haben es beinahe unmöglich gemacht, neue Häuser und Wohnungen zu bauen. Wir sagen, wir wollen eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Medizin und mehr Heilmittel für schreckliche Krankheiten. Doch wir tolerieren ein Forschungs-, Finanzierungs- und Regulierungssystem, das Forschende von ihren vielversprechendsten Arbeiten weglockt oder abhält, und enthalten so Millionen von Menschen die wissenschaftlichen Entdeckungen vor, die ihr Leben verlängern oder verbessern könnten.
Manchmal spiegeln diese Blockaden unterschiedliche Überzeugungen und Interessen wider. Hunderte Hektar große Solarfarmen können ein Segen für die Stadt sein, die sie versorgen, zugleich aber ein Fluch für die angrenzenden Gemeinden. Ein siebenstöckiges Haus mit bezahlbaren Wohnungen in San Francisco bietet Menschen eine Bleibe, die ansonsten stundenlange Arbeitswege in Kauf nehmen müssten, verstellt aber zugleich die schöne Aussicht und erschwert die Parkplatzsuche für jene, die schon vorher in der Gegend lebten.
Mitunter zeigen unsere Krisen auch, wie die Vergangenheit in die Gegenwart hineinwirkt. Von einer Generation entwickelte Lösungen können für die nächste zum Problem werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg profitierte das Land von enormen Steigerungen beim Bau von Wohnungen, Häusern und Infrastruktur. Fehlende Vorschriften zur Reinhaltung von Luft und Wasser führten allerdings zu einem Raubbau an der Umwelt durch die Bauherren dieser Ära. Der Staat reagierte darauf mit einer Flut von Umweltgesetzen, doch diese gut gemeinten Regularien zum Schutz der Natur im 20. Jahrhundert verhindern heute die Projekte zur Erzeugung sauberer Energie, die wir für das 21. Jahrhundert brauchen. Gesetze, die sicherstellen sollten, dass der Staat die Folgen seines Handelns bedenkt, erschweren heute sein konsequentes Handeln. Die Erneuerung von Institutionen ist eine Aufgabe, der sich jede Epoche aufs neue stellen muss.
Einiges davon deutet aber auch auf eine Art ideologisch geprägtes Komplott im Herzen unseres Politikbetriebs hin. Wir sind einer Erzählung vom Niedergang Amerikas verhaftet, die sich im Kern um ideologischen Dissens dreht. Sie vernebelt nur allzu leicht den Blick auf die krankhaften Zustände, die in ideologischer Komplizenschaft wurzeln. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich in den USA eine Rechte entwickelt, die den Staat bekämpfte, und eine Linke, die ihm Fußfesseln anlegte. Das schwindende Leistungsvermögen der Regierung wurde von Debatten um die Größe des Parlaments verdeckt. Eine Überfülle an Konsumgütern lenkte uns davon ab, dass es an Wohnraum und Energie, an funktionierender Infrastruktur und an wissenschaftlichen Durchbrüchen mangelte. Es rührt sich Widerstand, aber er ist noch sehr schwach.
Der Angebotsfehler
In den Wirtschaftswissenschaften dreht sich alles um Angebot und Nachfrage. Angebot meint, wie viel es von etwas gibt, Nachfrage meint, wie viel von diesem Etwas die Menschen wollen. Volkswirtschaften sind im Gleichgewicht, wenn Angebot und Nachfrage einander entsprechen. Läuft hier etwas auseinander, geraten sie ins Schleudern. Eine übergroße Nachfrage, die auf ein zu geringes Angebot trifft, führt zu Knappheiten, Preissteigerungen und Rationierung. Ein übergroßes Angebot, das auf wenig Nachfrage trifft, führt dazu, dass der Markt überschwemmt wird und zieht Entlassungen und Wirtschaftskrisen nach sich. Beide, Angebot und Nachfrage, hängen untrennbar miteinander zusammen, zumindest in der realen Welt. Auf der politischen Ebene hat sich zwischen ihnen allerdings eine tiefe Kluft aufgetan. Demokraten und Republikaner haben sie auseinanderdividiert.
Der Begriff »angebotsseitig« gilt als rechts. Er ruft Erinnerungen an die Verlaufskurve wach, die der konservative Wirtschaftswissenschaftler Arthur Laffer in den 1970er Jahren auf eine Serviette kritzelte. Sie zeigt, dass Volkswirtschaften lahmen und Gewinne paradoxerweise fallen, wenn die Steuern zu hoch sind.[1] Dies führte unter anderem zu dem jahrzehntelangen republikanischen Versprechen, Steuersenkungen für die Reichen würden die frustrierten Arbeitereliten des Landes ermutigen, cleverer und härter zu arbeiten, was eine boomende Wirtschaft und steigende Gewinne zur Folge hätte.
Steuersenkungen sind ein nützliches Instrument, und ja, hohe Steuern können die Wirtschaft abwürgen. Die Vorstellung jedoch, dass Steuersenkungen automatisch zu höheren Gewinnen führen, ist, um es mit den Worten von George H.W. Bush auszudrücken, »Voodoo-Ökonomie«. Man hat es probiert. Es hat nicht funktioniert. Man hat es wieder probiert. Es hat wieder nicht funktioniert. Dieses Scheitern und die stumpfsinnige Weigerung der Republikanischen Partei, damit aufzuhören, immer und immer wieder dasselbe zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, machten es irgendwie anrüchig, sich um die Angebotsseite der Wirtschaft zu sorgen. Es war, als hätte der Unfug namens Phrenologie Ärzten verleidet, Erkrankungen des Gehirns zu behandeln.
Doch die konservative Agenda bewirkte auch noch etwas anderes: Sie erweckte den Eindruck, als wäre Produktion eine Funktion uneingeschränkter Märkte. Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik sollte dafür sorgen, dass der Staat dem Privatsektor nicht in die Quere kam. Sie sollte Steuern senken, damit die Leute mehr arbeiteten, und Regulierungen abschaffen, damit Unternehmen mehr produzierten. Doch was war mit den Stellen, wo die Gesellschaft etwas brauchte, das der Markt nicht von sich aus bereitstellen konnte oder wollte?
An diesem Punkt hätten doch eigentlich die Demokraten auf den Plan treten müssen. Die aber, eingeschüchtert von der Reagan-Revolution und geplagt von der Angst, als Sozialisten zu gelten, beschränkten sich mehr oder weniger darauf, an der Stellschraube »Nachfrage« zu drehen. Als die Bevölkerung 1978 zu hören bekam, dass »die Regierung weder unsere Probleme lösen noch unsere Ziele setzen noch unsere Vision definieren« könne, da kamen diese Worte nicht von Ronald Reagan oder irgendeinem anderen Republikaner oder Konservativen. Nein, Jimmy Carter sagte sie, ein Demokrat, und zwar in seiner Rede an die Nation.[2] Es war ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte. Im Jahr 1996 verkündete Bill Clinton, der nächste demokratische Präsident: »Die Ära des Big Government ist vorüber.«[3] Die Auffassung, dass die US-Regierung nicht in der Lage sei, die Probleme des Landes zu lösen, wurde nicht einseitig von Reagan und der Grand Old Party aufgebracht. Nein, sie wurde von beiden Parteien gemeinsam geschaffen und von ihren Anführern immer wieder bestärkt.
Die Versprechen und Politikansätze des Progressivismus kreisten jahrzehntelang darum, Menschen Geld oder Gutscheine zukommen zu lassen, damit sie Dinge erwerben konnten, die der Markt zwar produzierte, die für die Armen aber unerschwinglich waren. Das Affordable Care Act bezuschusst Krankenversicherungen, die abgeschlossen werden, um medizinische Leistungen bezahlen zu können. Lebensmittelmarken versetzen Menschen in die Lage, sich etwas zu essen zu kaufen. Wohn-Gutscheine erleichtern ihnen das Anmieten einer Wohnung. Studienförderprogramme stellen ihnen Geld für einen Hochschulbesuch zur Verfügung. Steuergutschriften ermöglichen es ihnen, die Betreuung ihrer Kinder zu bezahlen. Sozialversicherungen geben ihnen Geld fürs Alter. Mindestlohn und Nachlässe bei der Einkommenssteuer geben ihnen generell mehr Geld in die Hand, wofür auch immer.
Dies alles sind wichtige politische Instrumente, und wir unterstützen sie. Doch die Demokraten haben sich auf sie fixiert und dabei das Angebot an Gütern und Dienstleistungen, die ihrer Meinung nach allen Menschen zustehen sollten, immer mehr aus den Augen verloren. Unsummen an Steuergeldern wurden für Krankenversicherungen, Wohn-Gutscheine und Infrastruktur ausgegeben, ohne einen gleichermaßen energischen Fokus darauf zu legen, was eigentlich mit diesem Geld gekauft und gebaut wurde. Manchmal fehlte der Fokus auch völlig.
Die Marktgläubigkeit, die darin zum Ausdruck kam, war auf ihre Weise nicht weniger rührend als die der Republikaner. Sie ging davon aus, der Privatsektor könnte und würde soziale Ziele erreichen, solange man ihm nur mit genügend Geld vor der Nase herumwedelte. Sie offenbarte ein Desinteresse daran, wie Regieren funktioniert. Regulierungen galten als weise, politische Entscheidungen als wirksam. Warnungen, der Staat behindere Produktion oder Innovation, stießen in der Regel auf taube Ohren. Ein blinder Fleck entstand. Politische Bewegungen denken dort über Lösungen nach, wo ihren Erkenntnissen zufolge die Probleme liegen. Also lernten die Demokraten, nach Möglichkeiten für staatliche Subventionen Ausschau zu halten. Den Schwierigkeiten auf der Produktionsseite widmeten sie kaum einen Gedanken.
Das Problem ist nur: Subventioniert man die Nachfrage nach etwas, das knapp ist, führt dies entweder zu Preissteigerungen oder zu Zwangsrationierung.[4] Zu viel Geld, mit dem zu wenige Eigenheime gekauft werden sollen, spült Hauseigentümern unverhoffte Gewinne in die Kasse, zieht aber auch eine Erschwinglichkeitskrise für Käufer nach sich. Zu viel Geld, mit dem zu wenige Ärztinnen bezahlt werden sollen, führt zu langen Wartezeiten oder macht Arztbesuche zu einer kostspieligen Angelegenheit. An dieser Stelle folgt mit schöner Regelmäßigkeit die Standardentgegnung der Republikaner: Dann subventioniert doch die Nachfrage nicht! Haltet den Staat da raus. Lasst einfach den Markt seine Wunder wirken. Das ist auch in Ordnung, und zwar dann, wenn der Zugang zu einem Gut keine Frage von Gerechtigkeit ist. Sind VR-Kopfhörer teuer, na ja, dann ist das eben so. Kann sich ein Großteil der Haushalte solche Geräte nicht leisten, ist das kein Problem, um das der Staat sich kümmern muss. Für Wohnen gilt das aber nicht und ebenso wenig für Bildung und medizinische Versorgung. Um den Zugang zu diesen Gütern und Dienstleistungen kümmert sich die Gesellschaft, und das muss auch so sein. Demokraten wie Republikaner haben politische Strategien in Gesetze gegossen, die in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass Billionen von Dollar aufgewendet werden, um sicherzustellen, dass Menschen diese Güter und Dienstleistungen bezahlen können. Dabei gleicht die Subventionierung von Dingen, deren Angebot gedrosselt ist, dem Bau einer Leiter, mit der ein Aufzug erreicht werden soll, der immer schneller nach oben fährt.
Die Resultate dieses Irrtums sind überall zu sehen. Im Jahr 1950 lag der mittlere Preis für ein Eigenheim beim 2,2-Fachen des durchschnittlichen jährlichen Einkommens, 2020 beim 6-Fachen.[5] Zwischen 1999 und 2023 stieg die durchschnittliche Prämie für Familienversicherungen über den Arbeitgeber von 5791 auf 23968 Dollar (eine Steigerung um mehr als 300 Prozent), und der Arbeitnehmeranteil an dieser Prämie hat sich mehr als vervierfacht.[6] Die durchschnittlichen Studiengebühren betrugen 1970 an staatlichen Hochschulen 394 Dollar und an privaten Hochschulen 1706 Dollar. Bis 2023 waren sie auf 11310 Dollar für im Bundesstaat ansässige Studierende an staatlichen Hochschulen bzw. 41740 Dollar für Studierende an privaten Hochschulen gestiegen.[7] Eine Familie mit einem Kleinkind und einem vierjährigen Kind muss im Durchschnitt in Massachusetts jährlich 36008 Dollar, in Kalifornien 28420 Dollar und in Minnesota 28338 Dollar für die Kinderbetreuung aufbringen.[8]
Die Wirtschaftsform, die wir heute haben, ist seltsam: Ein sicheres Leben in der Mittelschicht ist für viele außer Reichweite, während die angeblichen Statussymbole eines erfolgreichen Mittelschichtlebens für die meisten Menschen erschwinglich sind. In den 1960er Jahren war ein vierjähriges Hochschulstudium ohne Verschuldung möglich, der Kauf neuester hochwertiger technischer Geräte nicht. Anfang der 2020er Jahre ist es mehr oder weniger umgekehrt.
Wir haben die Erschwinglichkeitskrise[9] mit Niedrigpreisen für Konsumgüter, galoppierenden Aktienwerten, die reichere US-Bürger bei Laune hielten, und Schuldenbergen übertüncht: Hauskrediten, Studienkrediten und Krediten für medizinische Behandlungen, die die arbeitende Bevölkerung gerade so über die Runden kommen ließen. Was zum Teil die ökonomischen Debatten der letzten Jahrzehnte erklärt: eine Immobilienkrise, ein gewaltiges neues Programm zur Subventionierung von Krankenversicherungen, Diskussionen um eine kostenlose Hochschulbildung und den Erlass von Studienkrediten, endlose Steuersenkungsrunden, Vorschlag auf Vorschlag, die Regierung möge die Kosten für Kinderbetreuung und Vorschule übernehmen, und eine Kryptowährungsblase, die auch deshalb so viele Investoren anzog, weil es eine Möglichkeit zu sein schien, in Lichtgeschwindigkeit reich zu werden.
Doch dann kam die Inflation. Über Jahre war das zentrale Problem der US-Wirtschaft die Nachfrage. Wir beide haben ausführlich über die Finanzkrise berichtet, und jedes Gespräch mit den Wirtschaftssachverständigen der Obama-Administration drehte sich darum, wie man Arbeitgeber veranlassen könnte, mehr Leute einzustellen, und wie man Konsumenten dazu bringen könnte, mehr Geld auszugeben. Die 2009 gesetzten Anreize waren jedoch zu gering; es gelang zwar, eine zweite Große Depression zu verhindern, dafür blieben wir aber in einer schmerzhaft langsamen Erholungsphase stecken. Demokraten trugen diese Lektionen hinüber in die Covid-Pandemie und begegneten dieser neuerlichen Krise mit einer gewaltigen fiskalischen Kraftanstrengung. Gemeinsam mit der Trump-Administration verabschiedeten sie das 2,2 Billionen Dollar schwere CARES Act, gefolgt vom American Rescue Plan im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Und obendrauf packten sie noch ein billionenschweres Infrastrukturgesetz. Damit machten sie klar, dass sie die Risiken einer überhitzten Wirtschaft (wie etwa Inflation) einer drohenden Massenarbeitslosigkeit vorzogen.
Sie hatten Erfolg. Doch indem sie das Problem der pandemiebedingten Wirtschaftskrise lösten, beschworen sie für die Post-Corona-Ökonomie eine neue Krise herauf: zu hohe Nachfrage. Lieferketten, die bereits durch die Pandemie und den Einmarsch Russlands in die Ukraine beschädigt waren, begannen zu reißen. Die Inflation kehrte mit aller Macht zurück. Die Gespräche, die wir mit den Wirtschaftssachverständigen der Biden-Administration führten, waren ganz anders als jene mit den Expertinnen und Experten der Obama-Regierung, sogar dann, wenn es sich um dieselben Personen handelte. Aus ihrer Sicht war es nötig, dass die Unternehmen mehr und schneller produzierten, und dass mehr Chips verfügbar waren, um mehr Autos und mehr Computer bauen zu können. Es war nötig, dass Häfen mehr Schiffsladungen abfertigten, Pfizer mehr antivirale Medikamente herstellte, Logistikunternehmen mehr Fernfahrer anheuerten und Schulen ihre Belüftungssysteme modernisierten. Sie brauchten mehr Angebot, und, falls sich das nicht machen ließ, weniger Nachfrage.
»Wenn die Autopreise derzeit zu hoch sind«, so Präsident Joe Biden, »dann gibt es zwei mögliche Lösungen: Entweder erhöhen wir das Angebot, indem wir mehr Autos produzieren, oder wir reduzieren die Nachfrage, indem wir die Bevölkerung ärmer machen. Das sind die Alternativen.«[10]
Bis 2024 hatte sich der Preisanstieg dann verlangsamt. Die Inflationsrate, die Ökonomen nutzen, um ihn zu messen, war gesunken. Doch die breitere Erschwinglichkeitskrise, die älter war als die Inflationswellen, dauerte an. Die Angst, dass wir nicht genug von alldem hatten oder haben würden, was wir brauchten, lastete schwer auf allen, die politische Verantwortung trugen. Sie begannen noch einmal neu über die Globalisierung nachzudenken und warnten davor, dass wir nicht von kritischen Importen aus China abhängig sein dürften, falls es zu einem Konflikt oder einer Krise zwischen den beiden Ländern kommen sollte. Gouverneurinnen und Bürgermeister richteten angesichts wachsender Obdachlosenzahlen ihre Aufmerksamkeit auf den Bau neuer Häuser und Wohnungen. Das Inflation Reduction Act gab den Startschuss für den Bau der grünen Infrastruktur, die wir brauchen, damit unsere Wirtschaft die Wende hin zu sauberer Energie vollziehen kann. Das CHIPS and Science Act wedelte mit zig Milliarden Dollar, um die einheimische Halbleiterproduktion wieder anzukurbeln. Wie tragfähig diese politischen Entscheidungen sind, muss sich noch zeigen. Dass sie aber einen Bruch mit der Politik vergangener Jahrzehnte darstellen, lässt sich nicht leugnen.
Bei Politik geht es nicht nur um die Probleme, die wir haben. Es geht um die Probleme, die wir sehen. Das Angebotsproblem hängt seit Jahren über uns wie ein Damoklesschwert, aber es stand nicht im Zentrum unserer Politik. Das ändert sich jetzt. Eine neue Angebotstheorie ist im Entstehen begriffen und mit ihr eine neue Art des Nachdenkens über Politik, Wirtschaft und Wachstum.
Die Gesellschaft ist kein Kuchen
Ihnen ist vielleicht schon einmal das Klischee begegnet, dass die Volkswirtschaft ein Kuchen sei, den wir größer machen müssten, statt ihn zu zerteilen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, um aufzuzählen, was mit diesem Bild alles nicht stimmt, denn eigentlich stimmt daran gar nichts. Würde es Ihnen gelingen, einen Blaubeerkuchen wachsen zu lassen, dann hätten Sie mehr Blaubeerkuchen. Ökonomisches Wachstum entsteht aber nicht durch eine Anhäufung des immer Gleichen. Der Unterschied zwischen einer Volkswirtschaft, die wächst, und einer Volkswirtschaft, die stagniert, liegt im Wandel. Veranlassen Sie eine Volkswirtschaft, zu wachsen, beschleunigen Sie eine andere Zukunft. Je mehr Wachstum es gibt, desto radikaler unterscheidet sich diese Zukunft von der Vergangenheit. Wir dagegen haben uns auf eine Metapher für Wachstum eingeschossen, die dessen wichtigstes Wesensmerkmal ausblendet.
Wenn man etwas genauer überlegt, was modernes Wirtschaften antreibt, dann stellt man fest, dass Wachstum nur aus sehr wenigen Quellen entspringt. Eine Wirtschaft kann wachsen, weil sie mehr Menschen, mehr Land oder mehr natürliche Ressourcen hinzufügt. Sind diese Mittel aber ausgeschöpft, muss sie mehr aus dem machen, was sie hat. Menschen müssen neue Ideen haben. Fabriken müssen innovativ sein und neue Verfahrensweisen erfinden. Diese neuen Ideen und Verfahrensweisen wiederum müssen in neue Technologien gegossen werden. All das wird unter dem sterilen Etikett »Produktivität« zusammengefasst: Wie viel mehr können wir mit derselben Anzahl von Menschen, derselben Menge an Ressourcen produzieren? Steigt die Produktivität, dann bekommen wir nicht mehr von dem, was wir schon hatten, sondern neue, bisher unvorstellbare Dinge.
Angenommen, Sie gehen im New York City des Jahres 1875 zu Bett und wachen erst dreißig Jahre später wieder auf. Wenn sie die Augen schließen, gibt es weder elektrisches Licht noch Coca-Cola, weder Basketball oder Aspirin. Auch keine Autos oder »Sneakers«. Und das höchste Gebäude in Manhattan ist eine Kirche. Wachen Sie 1905 wieder auf, erkennen Sie die Stadt nicht wieder. Es gibt jetzt himmelhohe Stahlskelettgebäude, die man »Wolkenkratzer« nennt. Die Straßen quellen über von Novitäten: Automobilen, die von neuartigen Verbrennermotoren angetrieben werden, Menschen, die in Schuhen mit Gummisohle Fahrrad fahren – alles brandneue Erfindungen. Weitere Neuankömmlinge sind der Warenhauskatalog, der Pappkarton und das Aspirin. Die Menschen haben sich ihren ersten Schluck Coca-Cola schmecken lassen und den ersten Biss von etwas genossen, das wir heute American Hamburger nennen. Die Gebrüder Wright haben ihr erstes Flugzeug geflogen. Als Sie einschlummerten, hatte noch niemand ein Foto mit einer Kodak-Kamera geschossen oder Geräte benutzt, mit denen man Filme drehen oder Musikaufnahmen abspielen konnte. Im Jahr 1905 gibt es die ersten kommerziellen Versionen von allen drei Novitäten: die einfache Boxkamera, den Cinematographen und den Phonographen.
Nun stellen Sie sich vor, Sie dösen erneut weg. Auch dieses Mal halten Sie ein dreißigjähriges Schläfchen, von 1990 bis 2020. Natürlich würden Sie sich beim Aufwachen angesichts der überwältigenden Genialität, die in unseren Smartphones und Computern steckt, verwundert die Augen reiben. Aber die physische Welt würde sich immer noch recht ähnlich anfühlen. Dies zeigen die Produktivitätsstatistiken, denn sie bilden im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine Verlangsamung des Wandels ab. Das wiederum ist nicht nur ein Problem für unsere Volkswirtschaft, sondern auch eine Krise für unsere Politik. Es ist kein Zufall, dass ein so großer Teil der heutigen Rechten und kein geringer Teil der heutigen Linken von Nostalgie ergriffen sind. Wir haben den Zukunftsglauben verloren, der einst unseren Optimismus befeuerte. Stattdessen kämpfen wir miteinander um das, was wir haben oder hatten.
Unserer Epoche mangelt es an Utopien. Eine rühmliche Ausnahme gibt es aber doch: Aaron Bastanis Fully Automated Luxury Communism, ein linksgerichteter Traktat, der die aktuell sich entwickelnden Technologien – künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Asteroidenbergbau, pflanzen- und zellbasiertes Fleisch sowie die Genschere – ins Zentrum einer Post-Arbeits-, Post-Knappheitsvision stellt.[11] »Was, wenn sich alles ändern könnte?«, fragt er. »Was, wenn wir, anstatt uns den großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, Ungleichheit, Altern – lediglich zu stellen, weit darüber hinausgingen und die Probleme von heute genauso hinter uns ließen wie einst die großen Raubtiere und die meisten Krankheiten? Was, wenn wir, statt blind zu sein für eine andere Zukunft, uns darauf einigen würden, dass die Geschichte eigentlich noch gar nicht begonnen hat?«[12]
Es ist eingeübte politische Routine, sich eine gerechte Gegenwart vorzustellen und daraus Sozialversicherungsprogramme abzuleiten, die diese herbeiführen. Genauso wichtig ist es, sich eine gerechte, ja sogar herrliche Zukunft vorzustellen und daraus die technologischen Fortschritte abzuleiten, die deren Eintreten beschleunigen würden. Bastanis Vision ist erfrischend, weil sie davon ausgeht, dass diejenigen unter uns, die an eine fairere, sanftere, nachhaltigere Welt glauben, ein Interesse daran haben, Technologien voranzubringen, die diese Welt ermöglichen werden. Das wiederum ist eine gleichermaßen politische wie technologische Frage, denn dieselben Technologien könnten zu Brandbeschleunigern für Ungleichheit und Verzweiflung werden, wenn sie nicht in gerechtes politisches Handeln und davon geprägte politische Institutionen eingebettet sind. Bastani hat erkannt, dass es zur Erschaffung der Welt, die wir uns wünschen, mehr braucht als nur die Umverteilung dessen, was schon da ist.
Neue Technologien kreieren neue Möglichkeiten und versetzen uns in die Lage, einst unlösbare Probleme zu lösen. Viele der Länder mit den höchsten Treibhausgasemissionen sind Nationen mit mittlerem Einkommen, wie etwa Indien und China.[13] Angesichts dessen besteht die einzige Möglichkeit für die Menschheit, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen und gleichzeitig Armut zu bekämpfen, darin, mit Hilfe neuer Erfindungen den Weg hin zu grüner Energie zu ebnen, die sauber und in großen Mengen verfügbar ist und anschließend genügend Geld in die Hand zu nehmen, um sie überall hinzubringen. Dass überhaupt noch Hoffnung besteht, eine katastrophale Erderwärmung verhindern zu können, liegt einzig und allein daran, dass innerhalb von zehn Jahren die Kosten für Solarstrom um 89 Prozent und die für onshore produzierte Windenergie um knapp 70 Prozent gefallen sind.[14] Die Entscheidung des Bundesstaates Kalifornien, den Verkauf neuer Verbrennerautos nach 2035 vollständig zu verbieten,[15] wäre ohne die rasanten Fortschritte in der Batterietechnologie undenkbar.
Bei vielem, was wir für die Welt, die wir uns wünschen, brauchen, wissen wir schon, wie man es baut. Vieles muss aber auch erst noch erfunden oder verbessert werden. Grüner Wasserstoff und grüner Zement. Kernfusion. Medikamente zur Behandlung tödlicher Krebserkrankungen, denen wir mit unseren heutigen Therapiemöglichkeiten nicht gewachsen sind, sowie von mysteriösen Autoimmunerkrankungen, die Ärztinnen und Ärzte nach wie vor ratlos machen. KI, die sich den Bedürfnissen von Kindern anpasst, die anders denken und lernen. Einige dieser Fortschritte, so hoffen wir jedenfalls, werden die Märkte erzeugen. Aber das wird nicht annähernd ausreichen. Der Markt ist nicht aus sich selbst heraus in der Lage, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Profiten, die aus dem Verbrennen von Kohle kommen, und Reichtum, der aus verbesserten Batteriespeicherkapazitäten entsteht. Der Staat kann es. Der Markt wird nicht aus sich selbst heraus riskante Technologien finanzieren, deren Einsatz sich eher auf sozialer Ebene auszahlt als auf wirtschaftlicher. Der Staat muss es.
Doch wir sollten nicht naiv sein. Den Staat zum Problem zu erklären, ist kindisch. Und ebenso kindisch ist es, ihn zur Lösung zu erklären. Der Staat kann entweder das Problem sein oder die Lösung, und häufig ist er beides. Kernkraft ist in mancher Hinsicht sicherer als Wind und sauberer als Solarenergie. Unbestreitbar ist sie sicherer als das Verbrennen von Kohle und Gas. Trotzdem haben die USA im Angesicht der Erderwärmung den Bau von Kernreaktoren und Atomkraftwerken nahezu vollständig eingestellt. Zwischen 1973 und 2024 hat das Land nur drei neue Kernreaktoren fertiggestellt. Und zu Lebzeiten der meisten von uns wurden hierzulande mehr Atomkraftwerke stillgelegt als in Betrieb genommen.[16] Dies ist kein Versagen des privaten Marktes, verantwortungsvoll ins Risiko zu gehen, sondern ein Versagen der Regierung, die es nicht schafft, eine angemessene Risikoabwägung vorzunehmen.
Technologien als Kräfte des Wandels ernst zu nehmen heißt, zu begreifen, dass sie von Werten und, ja, auch von Politik durchdrungen sind. Die Beziehung ist bidirektional: Die politischen Strategien, die wir verfolgen, werden die Technologien beeinflussen, die wir entwickeln, und umgekehrt. In einer Welt, in der erneuerbare Energie billig und in reichlichem Maß vorhanden ist, kann eine andere Politik gemacht werden als in einer Welt, in der sie teuer und knapp ist. In einer Welt, in der modulare Bauweise die Baukosten gesenkt hat, eröffnen sich andere Möglichkeiten für den Staatshaushalt und die Gemeindekassen.
Im Jahr 1985 schrieb der große Technologiekritiker Neil Postman: »Wer verkennt, dass eine neue Technik ein ganzes Programm des sozialen Wandels in sich birgt, wer behauptet, die Technik sei ›neutral‹, wer annimmt, die Technik sei stets Freund der Kultur, der ist zu dieser vorgerückten Stunde nichts als töricht.«[17] Die Konsequenz ist ebenfalls klar: Wer kein Programm dafür hat, Technologien in den Dienst des gesellschaftlichen Wandels zu stellen, ist auf seine Weise blind.
Die Rechte hat nur allzu oft eine eingebildete glorreiche Vergangenheit im Blick, die Linke bloß die Ungerechtigkeiten der Gegenwart. Unsere Sympathie gilt in diesem Punkt der Linken, doch ist das keine Debatte, die wir zu einem befriedigenden Ende führen können. Was beide Seiten häufig vermissen lassen, ist eine klar formulierte Vision der Zukunft und davon, wie sich diese Zukunft von der Gegenwart unterscheidet. Dieses Buch skizziert eine solche Vision und liefert die entsprechenden Argumente.
Ein Liberalismus, der schafft
Wir beide sind Liberale im Sinne der US-amerikanischen Tradition. Ein Großteil der Probleme, die wir zu lösen versuchen, liegt innerhalb der liberalen Interessensphäre. Wir machen uns Sorgen wegen des Klimawandels und der ungerechten Gesundheitsversorgung. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum und höhere Durchschnittslöhne. Kinder sollen sauberere Luft atmen und Pendler mit Hilfe von Massentransportsystemen leicht von A nach B kommen. Wir haben zahlreiche Differenzen mit der modernen Rechten in unserem Land. In diesem Buch nehmen wir jedoch vor allem die Pathologien der breiteren Linken in den Blick.
Das tun wir unter anderem deshalb, weil wir uns nicht als effiziente Überbringer von Botschaften an die Rechte sehen. Es gibt durchaus Leute, die in dieser Koalition nach ergänzenden Reformen streben, wie zum Beispiel James Pethokoukis, Autor von The Conservative Futurist, oder der Ökonom Tyler Cowen, der einen »State Capacity Libertarianism«[18] gefordert hat, dazu eine Reihe von Politikexpertinnen und -experten im Niskanen Center. Wir wünschen ihnen alles Gute.
Dass wir unseren Fokus auf die Linke richten, hat aber umfassendere Gründe. Eine wesentliche Motivation für dieses Buch kommt aus unserer Überzeugung, dass die globale Wirtschaft dekarbonisiert werden muss, um die Gefahr eines Klimawandels abzuwenden. Und da die Rechte – zumindest in den USA – das einfach nicht glaubt, finden wir es ziemlich naiv, politische Strategien aufzuzeigen, die den Republikanern helfen würden, schneller eine grüne Infrastruktur aufzubauen. Es ist Unsinn, zu erwarten, dass eine Koalition, die unsere Ziele nicht teilt, das Notwendige tun würde, um sie zu erreichen. Viel interessanter scheint uns die Frage zu sein, warum es häufig einfacher ist, erneuerbare Energien in roten Staaten zu etablieren als in blauen, obwohl die Republikaner die Auffassung, dass der Klimawandel menschengemacht sei, ablehnen.
Und dann ist da noch die Wut, die alle Liberalen empfinden sollten, wenn sie sich die Bundesstaaten und Städte anschauen, die von Liberalen regiert werden. Einer von uns beiden stammt aus Kalifornien und hat auch dort gelebt, während dieses Buch entstand. Die bevölkerungsreichsten Städte dieses Bundesstaates werden von Demokraten regiert.[19] Die überwiegende Mehrzahl der gewählten Regierungsbeamtinnen und -beamten sind Demokraten.[20] Beide Kammern der Regierung werden von Demokraten geführt. Und Kalifornien ist das Land der Wunder. Es ist der weltweit führende Technologiestandort. Es schafft Kultur, die auf der ganzen Welt konsumiert wird. Es ist beeindruckend und atemberaubend schön. Wäre es ein eigener Staat, hätte dieser das fünfthöchste BIP der Welt.
Liberale sollten sagen können: Wählt uns, und wir werden das ganze Land so regieren wie Kalifornien! Stattdessen können Konservative sagen: Wählt sie, und sie werden das ganze Land regieren wie Kalifornien! Kalifornien scheitert seit Jahrzehnten an dem Versuch, ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz zu bauen. Kalifornien hat das schlimmste Obdachlosenproblem und die unerschwinglichsten Preise für Wohnraum in den gesamten USA. Bei den Lebenshaltungskosten muss es nur Hawaii, Washington, D.C., und Massachusetts den Vortritt lassen.[21] Ergebnis: Es verliert Hunderttausende Einwohner pro Jahr an Texas und Arizona.[22] Was ist da schiefgelaufen?
Die Probleme, die wir in Kalifornien sehen, sind ihrer Schwere nach zwar häufig einzigartig, nicht aber von ihrer Struktur her. Dieselben Dynamiken finden sich auch in anderen blauen Bundesstaaten und Städten. Jetzt, in einer Epoche des aufsteigenden Rechtspopulismus, besteht unter Liberalen ein gewisser Druck, sich ausschließlich auf die Sünden der MAGA-Rechten zu fokussieren. Dabei wird allerdings übersehen, wie auch liberales Regieren zum Aufstieg des Trumpismus beigetragen hat. In ihrem Buch Presidents, Populism, and the Crisisof Democracy schreiben die Politikwissenschaftler William Howell und Terry Moe: »Populisten nähren sich nicht allein von sozioökonomischer Unzufriedenheit, sondern von ineffizientem Regierungshandeln. Und am attraktivsten werden sie durch ihre Behauptung, sie könnten es durch ein effizienteres ersetzen, das auf ihrer eigenen autokratischen Macht beruht.«[23]
Donald Trump hat die Präsidentschaftswahlen 2024 gewonnen, indem er beinahe ganz Amerika nach rechts verschob. Was den Demokraten aber wirklich Sorgen machen sollte, ist die Tatsache, dass diese Verschiebung in den blauen Staaten und Städten am größten war, jenen Orten also, an denen die Wählerinnen und Wähler den alltäglichen Realitäten liberalen Regierens am stärksten ausgesetzt waren. In Kalifornien gewann Trump in beinahe allen Wahlkreisen Stimmen dazu,[24] wobei sich allein in Los Angeles County die Stimmanteile um 11 Prozentpunkte zugunsten der GOP verschoben. In den »Blue Wall«-Staaten und deren Umgebung sieht es ähnlich aus: Philadelphia County rutschte 4 Prozentpunkte nach rechts, Wayne County (Detroit) 9 Prozentpunkte und Cook County (Chicago) 8 Prozentpunkte. In der Metropolregion New York City waren es 9 Prozentpunkte in New York County (Manhattan), 12 Prozentpunkte in Kings County (Brooklyn), 21 Prozentpunkte in Queens County und 22 in Bronx County.[25]
Wahlen bieten den Leuten Gelegenheit, ihrem Ärger billig Luft zu machen. Umziehen ist teuer. Aber auch das tun die Einwohnerinnen und Einwohner blauer Staaten und Städte. Kalifornien verlor 2023 in Summe 342000 Einwohner mehr, als es hinzugewann. In Illinois betrug der Nettoverlust 115000, in New York 284000.[26] Das US-Wahlsystem ist so gestaltet, dass der Verlust von Einwohnern zum Verlust politischer Macht führt. Setzt sich der aktuelle Trend fort, wird der Zensus 2030 das Electoral College scharf nach rechts verschieben. Selbst wenn man Michigan, Pennsylvania und Wisconsin zu den Staaten rechnet, in denen Kamala Harris das Rennen gemacht hat, wäre das für die Demokraten zu wenig, um künftige Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.[27]
Und das Problem ist nicht nur ein politisches. Junge Familien verlassen die großen urbanen Metropolregionen so schnell, dass verschiedene Countys – darunter die, die Manhattan, Brooklyn, Chicago, Los Angeles und San Francisco umfassen – auf dem besten Weg sind, innerhalb der nächsten zwanzig Jahre 50 Prozent ihrer Bevölkerung im Alter von unter fünf Jahren zu verlieren.[28] Demokraten können nicht behaupten, die Partei der Mittelschichtfamilien zu sein, während sie über Teile des Landes herrschen, die von diesen verlassen werden.
Eine gute Möglichkeit, die gefährlichsten politischen Bewegungen zu marginalisieren, besteht darin, den Erfolg der eigenen unter Beweis zu stellen.
Wenn Liberale nicht wollen, dass die amerikanische Bevölkerung den falschen Versprechungen starker Männer hinterherläuft, müssen sie ihr die Früchte effizienten Regierens schmackhaft machen. Umverteilung ist wichtig. Aber sie allein reicht nicht aus.
Die wohlhabende Gesellschaft
Es gibt ein Wort, das die Zukunft beschreibt, die wir uns wünschen: Wohlstand. Anstatt uns den verführerischen Ideologien des Mangels zu verschreiben, stellen wir uns eine Zukunft des Mehr vor, nicht des Weniger. Wir werden nicht mehr oder bessere Jobs bekommen, wenn wir unsere Tore vor Immigranten verschließen. Wir werden den Klimawandel nicht zurückdrehen, indem wir die Welt dazu bringen, auf Wachstum zu verzichten. Nicht nur, dass solche Vorstellungen unrealistisch sind. Sie sind sogar kontraproduktiv. Sie werden nicht dafür sorgen, dass die von ihnen angestrebte Zukunft Wirklichkeit wird. Sie werden mehr Schaden stiften als Nutzen.
Der Wohlstand, den wir uns vorstellen, ist kein willkürlicher. Es geht dabei nicht um ein undifferenziertes Mehr von allem. Wir beziehen unsere Inspiration aus dem brillanten Buch People of Plenty des Historikers David M. Potter von 1954. Darin beschreibt er, wie Wohlstand das amerikanische Denken und die amerikanische Kultur geformt hat. »Wer Wohlstand richtig verstehen will, stellt ihn sich nicht als Lagerhalle voller Regale mit genormten, universell erkennbaren Gütern vor, die darauf warten, dass die Menschheit in einem Prozess der Wegnahme alles leerräumt.« Vielmehr sei Wohlstand, so Potter, »eine physikalische und kulturelle Größe, die das Zusammenspiel des Menschen, der selbst eine geologische Kraft ist, mit der Natur einschließt«.[29]
Der Wohlstand, den wir anstreben, ist ein anderer als der, den unsere Generation bisher erlebt hat. Potter hat detailliert beschrieben, wie die Vereinigten Staaten »neu ausgerichtet« wurden, um sie »von einer Produzentenkultur in eine Konsumentenkultur zu überführen«, und wie sich dieser Bruch in den darauffolgenden Dekaden vertiefte.[30] Amerikanische Politik hat sich darauf konzentriert, ins Werk zu setzen, was die Historikerin Lizabeth Cohen eine »Konsumentenrepublik« nennt.[31] Darin waren unsere politischen Führer bemerkenswert erfolgreich. Katastrophal erfolgreich. Wir haben heute eine unglaubliche Vielfalt an Gütern, mit denen sich ein Haus füllen lässt, und einen Mangel an allem, was gebraucht wird, um sich ein gutes Leben aufzubauen.
Wir fordern eine Korrektur. Wir interessieren uns mehr für die Produktion als für die Konsumtion. Wir sind überzeugt, dass das, was wir bauen können, wichtiger ist als das, was wir uns kaufen können.
Wohlstand, wie wir ihn definieren, ist ein Zustand. Ein Zustand, in dem es genug von allem gibt, was wir brauchen, um uns ein besseres Leben aufzubauen. Also rücken wir die Bausteine der Zukunft ins Zentrum unserer Betrachtungen: Wohnen, Transport, Energie, Gesundheit, dazu die Institutionen und die Menschen, die diese Zukunft bauen und erfinden müssen.
Fangen wir an.
1Wachsen
»Geh in den Westen, junger Mann, geh in den Westen. Das Land dort ist gesund, und man ist weit weg von den Müßiggängern und Dummköpfen, die sich hier in Massen tummeln.«
Es ist nicht klar, ob Horace Greeley, Zeitungsverleger und liberaler Präsidentschaftskandidat, diesen berühmten ihm zugeschriebenen Ratschlag wirklich ausgesprochen hat. Was aber klar ist: Er selbst hat ihn niemals befolgt. Greeley kam 1811 als Kind armer Eltern in Amherst im ländlichen New Hampshire zur Welt.[32] Anstatt sein Glück in den endlosen Weiten des amerikanischen Westens zu suchen, ging er 1831 nach New York City. Dort, im brodelnden Hexenkessel des urbanen Amerika, wurde er reich und machte sich einen Namen, indem er die New-York Tribune gründete, in den Kongress gewählt wurde und die Präsidentschaftswahl gegen Ulysses S. Grant verlor.
Das Spannungsverhältnis zwischen Greeleys Leben und dem eingangs erwähnten Ausspruch spiegelt die Zerrissenheit des Landes wider, das er so liebte: Wir Amerikaner haben immer vom Wilden Westen geschwärmt, aber unsere Zukunft wurde vor allem in den Städten gemacht. Dass uns Wildwestromantik lieber war als kühl geplante Mietskasernen, ist keine neue Erkenntnis. »Wir vergessen oft, dass das Land als Ganzes Wohlstand bot, einerseits in Form von Öl- und Erzlagerstätten, Rekordernten, Industriekapazitäten und so weiter, andererseits in Form der Stadt, die zu einem Ort wurde, an dem die Transformation dieses Wohlstands in Mobilität stattfinden konnte«, erinnerte Potter seine Leserschaft in People of Plenty. »Es haben mehr Amerikaner ihren gesellschaftlichen Status verändert, indem sie in die Stadt zogen, als durch ihren Weggang in den Westen.«[33]
Doch die Geschichte, die Amerika sich selbst erzählte, ist eine andere. Stets hatten wir die Weite des Westens als den wahren Garanten unserer Prosperität im Hinterkopf. Seine Besiedlung löste eine Art psychisches Trauma aus. Große Städte gab es in Europa auch. Amerika aber hatte offenes – häufig geraubtes – Land. Würden wir ohne dieses nicht ebenfalls in Stagnation verfallen? Diese Angst hielt sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, und ist, wie sich herausstellte, auch ein Teil der Erklärung für die Große Depression. Senator Lewis Schwellenbach, ein Vertreter des New Deal, der später unter Präsident Harry Truman Arbeitsminister werden sollte, warnte: »Solange wir einen unentwickelten Westen hatten – neues Land, neue Ressourcen, neue Möglichkeiten –, bestand kein Grund zur Sorge.«[34] Doch diese Zeiten seien vorbei. Der einflussreiche Ökonom Alvin Hansen offerierte eine etwas komplexere Version dieser Sichtweise, als er schrieb: »Mit der schweren Aufgabe, den Kontinent mittels gigantischer Investitionen zu erschließen, sind wir mehr oder weniger fertig.«[35] Seiner Darstellung zufolge läutete die Große Depression eine neue Normalität ein: Ein gereiftes Amerika konnte nicht mehr mit dem exorbitanten Wachstum eines expandierenden Amerika rechnen.
Allerdings sind Volkswirtschaften nicht durch den zur Verfügung stehenden Grund und Boden gebunden. Die äußeren Grenzen ihres Wachstums werden von Ideen sowie den von ihnen getriebenen Technologien, Unternehmen und Produkten gezogen. Der wichtigste Grund und Boden ist der, auf dem die unermüdliche Schaffung von Neuem stattfindet. Und er liegt im Herzen unserer Städte, nicht an den Rändern unserer Siedlungsgebiete. Genau hier tritt das Problem zutage, dem sich die USA heute gegenübersehen. Eine junge Familie kann immer noch Horace Greeleys Ratschlag befolgen und im ländlichen Westen billigen Wohnraum finden. Was sie aber im Normalfall nicht tun kann, ist, seinem Beispiel zu folgen und sich ein Leben in Manhattan aufzubauen, wo der durchschnittliche Kaufpreis einer Eigentumswohnung heute bei 1,1 Millionen Dollar liegt. Oder in San Francisco, wo sie im Durchschnitt 1,3 Millionen Dollar dafür hinblättern müsste. Oder in Los Angeles, wo die Hauspreise bei etwa einer Million Dollar liegen. Oder in Seattle, wo 900000 Dollar aufgerufen werden. Oder in Boston, wo es 830000 Dollar sind.
Wohnraum folgt dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ist das Angebot mehr als ausreichend und die Nachfrage nicht so hoch, gehen die Preise zurück: In Cleveland geht ein durchschnittliches Eigenheim für 115000 Dollar weg. Ist das Angebot ungenügend und die Nachfrage hoch, steigen die Preise. Und ebendas geschieht in den gerade genannten hochpreisigen blauen Städten. Früher war unser Land gut in der Schaffung neuen Wohnraums. Einem Bericht des US Census Bureau von 1950 lässt sich entnehmen, dass in den zehn Jahren davor ungeachtet der Verwerfungen durch einen Weltkrieg 8,5 Millionen neue Wohneinheiten entstanden waren. »Dies ist der größte jemals verzeichnete zahlenmäßige Zuwachs«, so die Autoren.[36] Doch in den späten 1970er Jahren wendete sich das Blatt. Der Wohnungsbau hielt nicht mehr Schritt mit dem Bevölkerungswachstum. Die Zahl der Baugenehmigungen pro Kopf ging in den 1980er und nochmals in den 1990er Jahren zurück. Die Große Rezession führte zu einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes, und in den 2010er Jahren kam der Bau neuer Häuser und Wohnungen praktisch vollständig zum Erliegen. Heute liegt laut OECD (Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit) die Anzahl der Wohnstätten pro tausend Einwohner in den Ländern der entwickelten Welt bei etwa 470. Frankreich und Italien haben knapp 600, Japan und Deutschland um die 500. In den USA sind es nur rund 425.[37] Wo sind all die Häuser und Wohnungen geblieben? Antwort: Sie wurden nie gebaut.
Das Ergebnis ist eine exorbitante Wohnungskrise. Knapp 30 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung sind »wohnarm«, das heißt, diese Menschen geben fürs Wohnen 30 Prozent oder mehr ihres Einkommens aus.[38] Doch damit nicht genug. Am höchsten sind die Wohnkosten in den Superstar-Citys, die heute unsere Wirtschaft antreiben. Millionen Menschen nehmen entweder stundenlanges Pendeln oder sehr viel schlechtere Jobs in Kauf, um in einer weit abgelegenen Stadt zu wohnen, wo sie es sich leisten können. Solche Entscheidungen fließen nicht in Grobschätzungen zur Erschwinglichkeit ein, dabei sind sie ebenso Ballast für die Wirtschaft wie für die betroffenen Menschen.[39]
Wer sich in Analysen über den US-amerikanischen Wohnungsmarkt vertieft, versinkt in einer Flut von Daten. Doch manchmal stechen einzelne Zahlen heraus. Hier ist so eine: Der Ökonom Ed Glaeser hat errechnet, dass die Löhne in New York City bis Anfang der 1980er Jahre ungewöhnlich hoch waren, selbst wenn er sie um die lokalen Lebenshaltungskosten bereinigte.[40] Die Stadt hatte zwar ihre Probleme, aber die meisten Menschen konnten mehr verdienen, wenn sie dorthin zogen. Das hat sich komplett gedreht. Im Jahr 2000 ging ein Umzug nach New York für die meisten Menschen mit einem Einkommensverlust einher. Und zwar nicht, weil sie weniger verdienten, sondern weil die Wohnkosten gestiegen waren. Heute bezahlen Menschen dafür, in dieser Stadt leben zu können, statt dafür bezahlt zu werden, dass sie dort leben.
»Wäre New York City ein Geschäft, dann sicher nicht Wal-Mart. Es versucht nicht, das billigste Produkt am Markt zu sein«, erklärte Michael Bloomberg, der damalige Bürgermeister von New York City, im Jahr 2003. »Es ist ein High-End-Produkt, vielleicht sogar ein Luxusprodukt.«[41] Einst war New York die Stadt, in die man ging, um ein Vermögen zu machen; jetzt ist es ein Ort, an den man geht, um ein Vermögen auszugeben.
Kommentare wie der von Bloomberg sind typisch: Wenn du es dir nicht leisten kannst, in unserer Stadt zu wohnen, dann mach’s halt einfach nicht. In den sozialen Medien bricht mit schöner Regelmäßigkeit Aufregung über Stadtbewohner aus, die sich darüber beschweren, dort mit ihrem Verdienst von jährlich 450000 Dollar oder einer ähnlich hohen Summe kein normales Mittelschichtleben führen zu können. Eine übliche Entgegnung, sogar unter selbst erklärten Progressiven, lautet, diejenigen, die sich derart beschwerten, hätten sich in dem Moment gegen den Mittelschicht-Lifestyle entschieden, in dem sie sich ein Apartment an der Upper West Side gönnten. Denn damit hätten sie sich entschlossen, ihr Geld für ein unerschwingliches Luxusgut auszugeben – das wäre genauso, als hätten sie sich eine Yacht gekauft oder damit begonnen, teure Kunst zu sammeln.
Zu viele haben sich in das perverse Gegenteil dessen eingekauft, was Stadt eigentlich sein sollte. Städte sind Orte, an denen Reichtum geschaffen statt nur zu Schau gestellt wird. Sie sollen Aufstiegschancen in die Mittelschicht bieten, nicht Penthäuser für die Upperclass. Doch eine schlechte Politik und noch schlechtere politische Maßnahmen haben dazu geführt, dass wir im 21. Jahrhundert genau das tun, wovor wir uns im 19. Jahrhundert so gefürchtet haben: Wir legen den Wilden Westen zu den Akten.
Warum Städte heute wichtiger sind als je zuvor
Die letzten paar Jahrhunderte Transportwesen und Kommunikationstechnologie ließen sich im Grunde so zusammenfassen: Wir kämpften mit der Entfernung, und wir haben gewonnen. Im Jahr 1800 dauerte eine Reise von New York City nach Chicago anderthalb Monate. 1830 waren es drei Wochen und 1850 nur noch zwei Tage. Heute dauert ein Flug zwei bis drei Stunden. Telegraph, Telefon, E-Mail und Bildschirmkonferenzen machten räumliche Entfernungen noch irrelevanter. Mittlerweile dauert es länger, bei den Nachbarn gegenüber zu klingeln, als via FaceTime mit der Familie auf der anderen Seite des Kontinents zu sprechen.
Was sind Städte auf elementarster Ebene? »Städte sind die Abwesenheit physischer Entfernung zwischen Menschen und Unternehmen«, schreibt Ed Glaeser in Triumph of the City. Sie seien eine uralte Antwort auf die Herausforderungen, die Entfernung mit sich bringe. Technologie habe allerdings ihre offensichtlichen Vorteile erodieren lassen. Eigentlich hätten sie verkümmern müssen, und oft habe man damit gerechnet, dass sie es tun. Aber die Städte hätten sich stur geweigert, ihr Schicksal zu akzeptieren. Stattdessen seien sie weiter aufgeblüht und hätten sich in der Moderne eine zentrale Stellung erobert, wie sie sie noch nie zuvor hatten. Dies, so Glaeser, sei »das Kernparadox der modernen Metropole: Weil die Kosten für Verbindungen über weite Entfernungen hinweg gesunken sind, ist Nähe immer wertvoller geworden.«[42]
Enrico Moretti, Wirtschaftswissenschaftler an der University of California in Berkeley, erklärt in seinem Buch The New Geography of Jobs, warum es dazu kam. Noch vor hundert Jahren produzierte die US-Wirtschaft vor allem physische Güter. Heute sind es Ideen und Dienstleistungen. Manche davon sind physischen Gütern eingeschrieben, doch selbst in diesen Fällen findet die Herstellung oftmals anderswo statt. Das iPhone machte Apple mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Dabei werden zwei Drittel dieser Mobilfunkgeräte in Foxconn-Fabriken im chinesischen Shenzhen zusammengebaut.[43] Microsoft und Alphabet verkaufen vor allem immaterielle Algorithmen-Schnipsel. Der Wert von Tesla liegt in der Software und der fortgeschrittenen Batterietechnik, die aus Elektrofahrzeugen, diesen Müsli-Äquivalenten des Automobilsektors, schnittige Zukunftsgefährte gemacht haben.
Wir sind beide keine Anhänger des trügerischen Glaubens, Fabrikation und Innovation seien weit auseinanderliegende Sphären. Taiwan stellte anfangs Allerwelts-Halbleiter-Chips her, die Intel ziemlich egal waren. Mit der Zeit erlaubte die Stellung als Hauptproduzent dem Land, verbesserte Chips zu entwickeln, die US-Unternehmen auch heute noch nicht replizieren können und von denen unsere politischen Entscheidungsträger befürchten, sie könnten den Chinesen in die Hände fallen. Amerika hat seine Führungsrolle als Innovator im Halbleiterbereich verloren, weil sich in Herstellungsprozessen sehr viel lernen lässt – ein Thema, auf das wir zurückkommen werden. Neue Entdeckungen, die zur Herstellung neuer Dinge führen, die sich an noch mehr Menschen verkaufen lassen, werden im ökonomischen Grenzland gemacht.
Die steigenden Erträge aus Innovationen sind das Ergebnis derselben technologischen Kräfte, die eigentlich den Niedergang der Städte hätten befördern müssen. Mit dem Zusammenbruch von Entfernungen dehnten die Märkte sich aus. Einst war es für Unternehmen schwierig, in eine andere Region zu expandieren. Der Versand der Waren war kostspielig und die Kommunikation eine Herausforderung. Dadurch hatten lokale Hersteller einen moderaten Vorteil. Die nächstgelegene Fabrik mochte nicht die beste sein, aber sie war nicht weit entfernt, und das machte ihre Erzeugnisse häufig billiger. Heute ist es für viele Unternehmen normal, ihre Produkte über die Grenzen von Bundesstaaten und Ländern hinweg zu verkaufen. Güter, die überall produziert werden können, können auch überall gekauft werden. Und digitale Produkte haben es in Sachen Omnipräsenz noch leichter, denn für sie braucht es nur einen Download oder eine kurze Werbeeinblendung in einer Internet-Suchmaske. Apple zum Beispiel generiert weniger als die Hälfte seines Gewinns in Nordamerika.[44] Knapp über die Hälfte des Gewinns von Alphabet ist international.[45] Dasselbe gilt für Tesla.[46]
Städte sind Motoren der Kreativität, weil wir in Gemeinschaft kreativer sind. Wettbewerb stachelt uns an. Es gilt, genau die Kolleginnen und Freunde und Konkurrentinnen und Widersacher zu finden, die unsere Genialität entfesseln und um ihre eigene ergänzen. »Amerikanerinnen und Amerikaner, die in Metropolregionen mit mehr als einer Million Einwohnern leben, sind im Durchschnitt mehr als 50 Prozent produktiver als solche, die in kleineren Metropolregionen leben«, schreibt Glaeser. »Dieses Verhältnis bleibt auch gleich, wenn wir Ausbildung, Erfahrung und Branche der Arbeitskräfte einbeziehen. Es bleibt sogar dann gleich, wenn wir den individuellen IQ der Arbeitskräfte berücksichtigen.«[47]