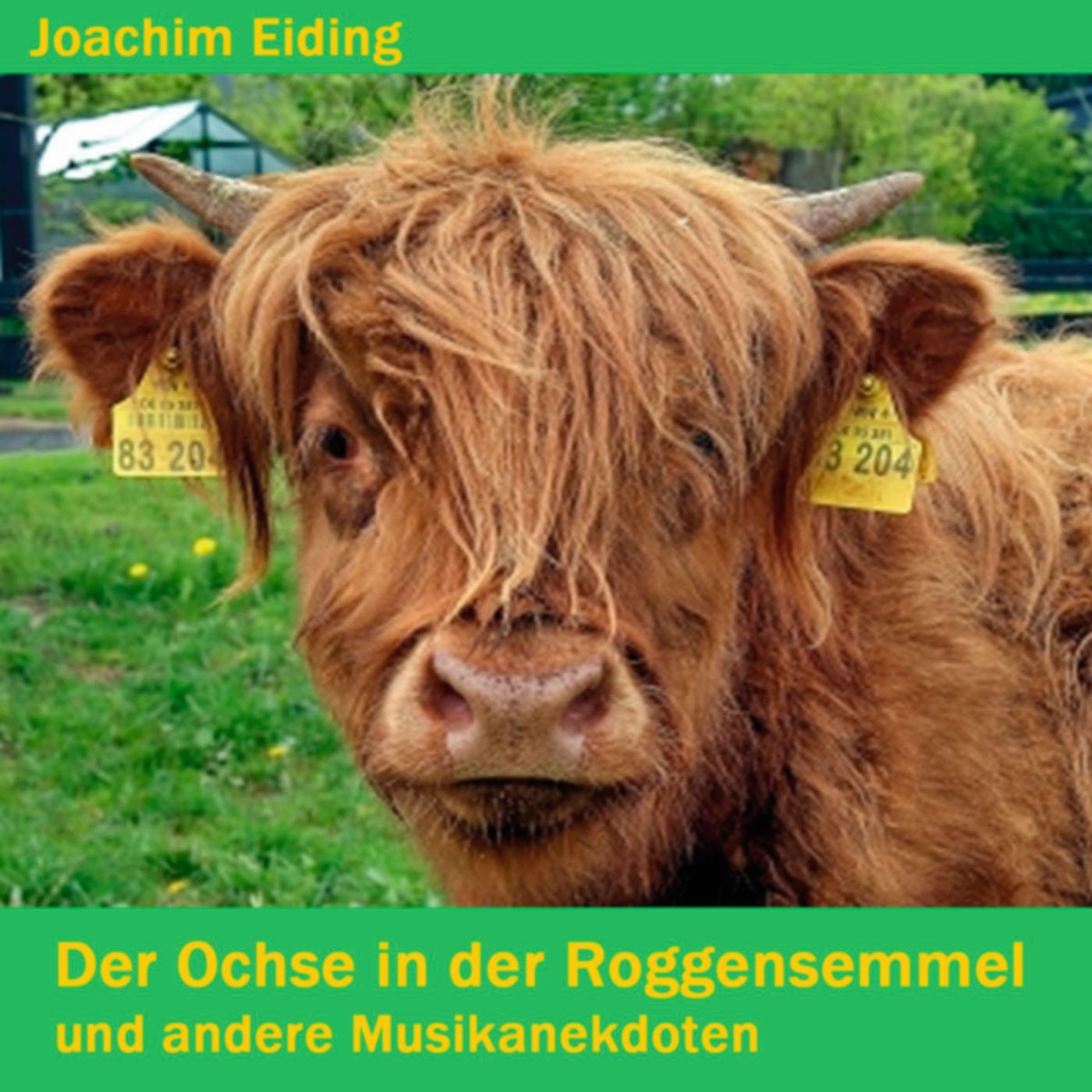
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch versucht gar nicht erst, das Rad neu zu erfinden. Stattdessen gleicht es einem Sammler: Aus allen Ecken kramt es Anekdoten der Pop- und Rock-Musik aus und stellt sie unter geeigneten Gesichtspunkten liebevoll zusammen. Auf diese Weise wagt das Buch einen Blick hinter die Kulissen. Der Reigen spannt sich von den Fab Four über prägende Musik-Festivals und -Trends bis zu mysteriösen Themen wie dem (angeblichen) Doppelgänger von Paul McCartney und dem merkwürdigen Phänomen namens Backmasking. Der Autor erzählt nette Geschichten, Episoden und Anekdoten rund ums harte Musik-Business. Wohl dem, der sie nicht einzeln suchen muss, sondern hier als geschmacklich ausgefeilten Cocktail genießen darf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
I) Die FAB FOUR
Klaatu – die Band mit dem Beatles-Joke
John Lennon und das „Lost Weekend“
George Harrison – der geheimnisvolle Beatle
Gebackene Bohnen für Ringo
II) Die Festivals
Woodstock – gute 40 Jahre und kein bisschen leise
The High Numbers! – The Who?
10cc und der Ochse in der Roggensemmel
III) Die Mystik
Jimmy Page und das Geisterhaus
Backmasking – wenn die Platten rückwärts laufen
Paul McCartney ist tot – es lebe Paul McCartney!
Nomen ist Omen – die Herkunft von Bandnamen
IV) Die Kings of Sound
Michael Jackson – zwischen Genie und Wahnsinn
Elvis Presley – Bananensandwich mit Erdnussbutter
Eric Clapton – „Old Slowhand”
Jeff Lynne – Kopf des ELO
Udo Jürgens – der steinige Weg zum Erfolg
V) Die Individualisten
David Bowie – die Berlin-Ära
Leonard Cohen und die seltsame Heilige
Manfred Mann – der Klangkünstler aus Johannesburg
Joe Cocker und seine 862 Dollar aus Amerika
VI) Die Trends der 70er
Glitzerfummel, Lipstick und Nietenstiefel
Carl Douglas und der Kung Fu
Billy Swan – von Elvis’ Pförtner zum Plattenmillionär
George McCrae – Rock Your Baby
Sparks – zwischen Hitler und Chaplin
VII) Die Macher und der Markt
Mickie Most und sein „Gemischtwarenladen“
Weiße beim schwarzen Label
England machte Schotten dicht
Geisterbands in den Charts
Die vielen Geschichten des Mal Sondock
Impressum
Vorwort
„Der Ochse in der Roggensemmel“ – welch ein merkwürdiger Titel für ein Buch über Rock- und Pop-Musik, mag mancher denken. Doch schon im zweiten Teil des Werkes klärt sich alles: An einem denkwürdigen Sommerabend im bayerischen Freising brennt sich während eines Rock-Festivals ein solches Verkaufsschild ins Auge des Autors, worauf dieser besagte Speise an einem gutbesuchten Stand genießt. Und freut sich auf den Auftritt der legendären britischen Band „10cc“, die nach Lage der Dinge hier und heute gratis spielt.
Solche und ähnliche Ereignisse stehen im Fokus des vorliegenden Buches. Einerseits geht es um persönliche Erlebnisse, andererseits sucht es nach teils vergessenen, teils vergrabenen Geschichten, die noch heute die Seele des Rock-Fans berühren. Zu tief graben möchte der „Ochse“ allerdings nicht. Der Mythos, welcher sich um Ikonen, Superstars und Typen wabert, soll nicht entzaubert werden. Vielmehr möchte das Buch einfach nur schöne Geschichten erzählen und den Glanz alter, ruhmreicher Epochen – vorwiegend von den 60ern und 70ern – ins neue Jahrtausend hinüberretten.
Im ersten Teil dreht sich alles um die „Fab Four“ – jene vier Jungens aus dem englischen Liverpool, welche tatsächlich die Welt verändern sollten. Lesen Sie auch, wie drei völlig unbekannte Musiker aus Toronto, die sich „Klaatu“ nannten, einst geschickt den Ruhm der Pilzköpfe für sich nutzen konnten und ihr Debüt-Album hoch in die Charts katapultierten. Oder wie John Lennon während seines so genannten „Lost Weekend“ orientierungslos durch L.A. streifte. Und sein alter Kumpel Ringo 1968 das geheimnisvolle Indien verließ, nur weil ihm die Bohnen ausgegangen sind.
Was die eingangs erwähnten Festivals angeht, erinnert der „Ochse in der Roggensemmel“ an die Mutter aller Konzerte – Woodstock. Wie der noch sehr unerfahrene Organisator des Events die Musiker von „The Who“ auf der Bühne erpresste, weil diese als einzige nur bei Vorkasse spielen wollten. Reichlich mysteriös wird es im Teil, der sich mit Okkultem in der Rock-Musik beschäftigt. Hier schickt das Buch rückwärts laufende Platten mit geheimnisvollen Botschaften sowie einen Doppelgänger von Paul McCartney ins Rennen.
Unvergesslich jener 16. August 1977, als Elvis diese Welt verließ. Wussten Sie, dass der „King“ auf der britischen Insel insgesamt mehr Vinyl verkauft hat als fast jeder Engländer? Nur Cliff Richard schafft es, ihm den Rang streitig zu machen. Während Michael Jackson einfach nur den Wunsch verspürte, ernst genommen und nicht als Clown verlacht zu werden. Ganz anders der merkwürdige Brite David Bowie, der sich ab Mitte der 70er mit Iggy Pop in Berlin eine kleine Wohnung teilte und hier mit Blick auf die Mauer von „Helden“ sang. Wogegen Joe Cocker und Manfred Mann nach ihren mörderischen Amerika-Tourneen frustriert je mit einem Taschengeld nach Europa zurückkehrten.
Oder wie wäre es mit einem Blick zurück auf die guten alten Zeiten des Glam-Rock, als eine Betreuerin dem schmächtigen Vokal-Idol Marc Bolan vor einem Konzert bunte Glitzer-Sternchen ins Gesicht streute und auf diese Weise der Begriff „Glitter“ prägte? Ebenfalls interessant, dass der US-Country- und Pop-Sänger Billy Swan einst als eine Art Pförtner für Elvis seine Brötchen verdiente. Erinnern will das Buch auch an das britische Platten-Genie Mickie Most, der mit seinen „RAK Records“ den Single-Markt eroberte und so unterschiedliche Interpreten wie Hot Chocolate, Suzi Quatro, Mud und Smokie unter Vertrag nahm.
Das Schlusswort gehört Deutschlands wohl berühmtesten DJ und Radiomoderator Mal Sondock, der Juni 2009 von uns gegangen ist. Seine persönlichen Erlebnisse füllen das letzte Kapitel des vorliegenden Werkes. Dies nur als Appetithäppchen für die vielen Geschichten, Episoden und Anekdoten, die der „Ochse in der Roggensemmel“ erzählt. Wohl dem, der sie nicht einzeln suchen muss, sondern hier als geschmacklich ausgefeilten Cocktail genießen darf.
Besonderer Dank gehört allen, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Vor allem Wolf-Dieter Eiding für seine Mitarbeit beim Bohnen-Text über Ringo Starr und Wolf-Dieter Roth, der dieses Projekt hilfreich betreute.
Joachim Eiding
I) Die FAB FOUR
Klaatu – die Band mit dem Beatles-Joke
Mancher mag sich erinnern, andere stolpern über den Namen „Klaatu“. Wer oder was soll das sein? Etwa finnische Kernseife oder eine japanische Stadt? Weit gefehlt! Tatsächlich verbirgt sich hinter dem seltsamen Namen eine kanadische Band aus Toronto. Genauer gesagt, die drei Studiomusiker John Woloschuk, Dee Long und Terry Draper. Welche Aufregung einst im Jahre 1977! Hieß es doch, die Beatles seien wiederauferstanden und hätten ein neues Album veröffentlicht, mit dem Abbild der Sonne. Und die vier Liverpooler schwiegen und schwiegen. Niemand ahnte, wer sich hinter „Klaatu“ verbarg. Doch als die Bombe schließlich 1980 platzte, wollte niemand die drei Kanadier mehr hören. Es schien, als hätten die Musikfans weltweit an einem regelrechten „Sonnenstich“ gelitten und als sei der Traum nun zerplatzt.
Doch von Anfang an: Gelangweilt hörte sich im Februar 1977 ein junger amerikanischer Reporter mit dem Allerweltsnamen Steve Smith aus Providence, Rhode Island, eine Platte an, auf derem Cover ihn eine riesige Sonne anlachte. Den Namen der Interpreten „Klaatu“ hatte er bis dato noch nie gehört 1. Aber der Sound erinnerte ihn fatal an jene Jahrhundert-Band aus dem englischen Liverpool. Schon nach den ersten Liedern schien ihm klar zu sein: Hier waren John, Paul, George und Ringo am Werk. Allzu sehr erinnerten ihn Songs wie „Calling Occupants“ und „Sub-Rosa Subway“ an das Erfolgsalbum „Sgt. Pepper“ 2.
Beatles oder doch nicht?
Entgeistert rief er bei der Schallplattenfirma Capitol an, erkundigte sich nach dieser Gruppe. Damit brachte er den Stein ins Rollen, der eine Lawine auslösen sollte. Doch nun geschah zunächst etwas Merkwürdiges: Das Label hüllte sich in Schweigen, gab Steve zur vage Auskünfte. Da hieß es, sie wüssten selbst nicht so genau, wer „Klaatu“ eigentlich sei. Fest stehe nur, die „Bänder seien aus Kanada gekommen“. Aber nichts Genaues sei bekannt.
Mit dieser Information sichtlich unzufrieden, spielte Steve nun selbst Detektiv und sammelte Beweise, dass es sich hier nur um die Beatles handeln konnte. Er verbiss sich regelrecht in diese These. Die Hinweise, die seine Überzeugung untermauern sollten: Die Langspielplatte mit dem seltsamen Namen „3:47 EST“ wurde 1976 in Toronto aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lebten tatsächlich alle vier Ex-Beatles in dieser Metropole. Steve mutmaßte, sie hätten ihr mögliches Comeback-Album unter Pseudonym aufgenommen. Weil es ungewiss schien, wie die Platte beim Publikum ankam. Außerdem hatte Paul McCartney kurz vorher in einem Interview erklärt: „Wir sehen uns wieder, wenn die Erde stillsteht.“ Damit ergab sich ein Hinweis auf den Gruppennamen „Klaatu“. Denn so hieß der Außerirdische im Science-Fiction-Film „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ von Robert Wise 3.
Als weiteren Beleg für seine These wertete der junge Journalist aus Rhode Island, dass Ringo Starr im Jahr 1975 aus Anlass seines Albums „Goodnight Vienna“ Sticker mit der Aufschrift „Klaatu“ verteilen ließ. Außerdem nahm Ringo auf dem Plattencover selbst den Platz von Klaatu ein. Ein letzter Hinweis für Steve Smith: Seine Kontaktperson zur Gruppe war zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Frank Davies. Und er war bis zur Auflösung der Beatles kein Geringerer als deren US-Pressemanager. All dies beeindruckte den jungen Schreiberling sehr. Und kurz später sollte ihm nahezu die ganze Welt folgen.
Hope – Grandioses Meisterwerk
Dem grandiosen ersten Werk folgte 1977 ein noch besseres: „Hope“ – ein Konzeptalbum, das über eine Reise durchs Sonnensystem berichtete. In fernen Tagen schweben die Menschen in monströsen Raumschiffen zum Asteroidengürtel, zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Dort treffen sie auf den „Leuchtturmwärter“ – den letzten Zeugen einer untergegangenen Zivilisation. Und er warnt die Menschheit vor unbekannten Gefahren. Mit starken Gitarrensoli, klangvollen Keyboard-Einsätzen, spritzigen Chorgesängen sowie der tatkräftigen Hilfe des London Symphony Orchestra war ein geniales Opus entstanden. Kritiker und Fans verglichen es nur mit „The Wall“ von Pink Floyd.
Auf diese Weise hatten die drei Kanadier John Woloschuk, Dee Long und Terry Draper, deren Namen nach wie vor geheim gehalten wurden, rein künstlerisch ihren Zenit beschritten. Das Problem: Dummerweise hatten sie versäumt, aus diesem Album zur rechten Zeit eine gute Single auszukoppeln und einen Chart-Hit zu produzieren. Resultat: Ihr Name tauchte nach wie vor in den internationalen Hitparaden nicht auf. So dass sie auf Druck ihres Labels Capitol mit dem dritten Album „Sir Army Suit“ 1978 nette Popliedchen veröffentlichten 4. Weiche Songs wie „Dear Christine“ wechselten sich mit durchaus interessanten Arrangements wie bei „A Routine Day“ ab. Die Platte erreichte also nicht die intellektuelle Höhe vom „Hope“. Trotzdem lieben ihre Fans auch dieses Album bis heute sehr.
Abstieg in den Keller
Aber auch diesmal blieb der kommerzielle Erfolg leider aus. Erst 1980 entschloss sich ihre Schallplattenfirma, endlich die Namen der Musiker bekannt zu geben. Doch es war wohl zu spät. Nahezu niemand wollte nun mehr wissen, wer sich hinter „Klaatu“ verbarg. Die Musikfans fühlten sich nach der ewigen Geheimniskrämerei wohl reichlich verschaukelt. Jedenfalls waren Woloschuk, Long und Draper schnell aus dem Gedächtnis der Popfans verschwunden. Und kurz später „Klaatu“ auch. Die Produzenten schoben noch das Album „Endangered Species“ nach und setzen die Musiker brutal unter Druck: Entweder käme jetzt der kommerzielle Erfolg oder dies sei ihre letzte Platte. Aber als ob der Name des Albums Programm gewesen wäre: Es sollte bei dieser Plattenfirma tatsächlich ihr letztes sein. Schließlich erbarmte sich noch die kanadische Tochterfirma Capitol Canada mit dem fünften, absolut letzten Album „Magenta Lane“. Zumindest konnten die drei wieder künstlerisch an alte Zeiten anknüpfen. Aber es war alles zu spät: Von den Streitereien mit Capitol zermürbt, warfen sie 1982 genervt das Handtuch und lösten sich auf 5.
Woloschuk zog sich ins Privatleben zurück, hatte vom knüppelharten Musikbusiness wohl endgültig genug. Während Draper und Long der Branche treu blieben: Long begleitete als Produzent und Studio-Musiker weiterhin zahlreiche Bands, auch die bekannte „Blue Man Group“. Sein Ex-Kompagnon Draper widmete sich diversen Solo-Projekten. Aber der Name „Klaatu“ verschwand von der großen Bühne – zumindest bis Mai 2005. Zur Freude der vielen Fans trat das Trio am 7. Mai des Jahres in Toronto im Rahmen einer „Klaatu Konvention“ erstmals nach 23 Jahren wieder live auf 6.
Es bleibt schon ein Geheimnis um diese „Geisterband“ – wie sie anfangs viele nannten. Erst der kometenhafte Aufstieg innerhalb nur weniger Monate; dann knallte „Klaatu“ schließlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Mancher mag sich fragen, wie sich die Beatles-Gerüchte überhaupt so lange haben halten können. Offen bleibt auch, wer letztendlich wirklich hinter den drei begabten Musikern stand. Aber auf jeden Fall ereilte die Gruppe das Schicksal vieler neuen Künstler, die mit ihren hervorragenden Werken die Popwelt aufgeschreckt haben: Werden sie von der Konkurrenz als eine Bedrohung aufgefasst, sind sie schnell weg vom Fenster.
1http://people.freenet.de/erdbeerfelder/klaatu.html
2http://people.freenet.de/erdbeerfelder/klaatu.html
3http://people.freenet.de/erdbeerfelder/klaatu.html
4http://www.ragazzi-music.de/klaatu.html
5http://www.ragazzi-music.de/klaatu.html
6http://www.klaatu.org
John Lennon und das „Lost Weekend“
Als die Beatles am 7. Februar 1964 anlässlich ihrer ersten Amerika-Tournee auf dem New Yorker Flughafen landeten, beantwortete John Lennon die Frage eines Reporters, wie er denn Amerika gefunden habe, mit: „Wir sind bei Grönland links abgebogen“ 1. Von da an blieb dem Beatle John das Image des skurrilen Spaßmachers – eine Rolle, die ihm lag. Hatte er doch schon kurz zuvor das Konzert am 4. November 1963 – in Anwesenheit der königlichen Familie – genutzt, als Possenreißer versteckte Sozialkritik zu üben: Gänzlich unbeeindruckt von der Queen hatte Lennon den Song „Twist And Shout“ auf folgende Weise angekündigt: „Für unsere nächste Nummer brauchen wir Ihre Hilfe. Die Leute auf den billigen Plätzen klatschen bitte in die Hände, der Rest rasselt einfach mit dem Juwelen!“ 2
Beatles populärer als Jesus?
Während John hier noch lustig rüberkam, zeigten weitere Zitate, wie sehr er zum Stachel der westlichen Gesellschaft mutierte. So äußerte er sich in einem Interview der Zeitung „The Evening Standard“ am 4. März 1966: „Wir sind jetzt beliebter als Jesus; ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird – Rock and Roll oder das Christentum.“ Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie konservative Kräfte nun reagiert haben: Wütende Proteste, besonders in den USA, machten die Runde. Mehr noch, in den Südstaaten verbrannten Musikfans gar Beatles-Platten auf öffentlichen Scheiterhaufen. Als sicher gilt: Lennon war sich über die Folgen wohl nicht ganz im Klaren, musste sich später für diesen Satz entschuldigen. Ein anderer, nämlich: „Ich weiß genau, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau – denn für diesen Erfolg habe ich dem Teufel meine Seele verkauft“ 3, gilt in Musikkreisen allerdings als Fälschung.
Besonders seit sich die „Fab Four“ 1970 auflösten, mischte sich John mehr und mehr in die Politik ein, nutzte seine privilegierte Position, um öffentlich Missstände anzuprangern. So schickte er beispielsweise der Queen im November 1969 seinen MBE-Orden erbost zurück, noch dazu in braunem Packpapier. Dazu legte Mr. Lennon einen Zettel, auf dem er gegen Großbritanniens Rolle im Biafrakrieg protestierte und bemängelte, seine aktuelle Single-Platte „Cold Turkey“ (roh übersetzt: „Kalter Entzug“) sei in jener Woche zu Unrecht auf Platz 14 der BBC-Charts hängen geblieben. Seiner Ansicht nach müsse sie weiter oben landen. Damit zog sich der britische Gitarrist noch mehr Feinde zu als bei seinem anfänglichen Zögern, diesen Orden im Jahr 1965 überhaupt anzunehmen. „Ausgerechnet der MBE. Ich dachte immer, dafür müsse man Panzer fahren und Kriege gewinnen“, witzelte Lennon einst vor der Verleihung 4.
Kampf um die Green Card
Wer aber war dieser Mann, der als der intellektuelle Beatle galt, und mal sanft, mal zornig mit den Medien umging? Und was hat es mit dem so genannten „Lost Weekend“ auf sich? Fragen über Fragen! Seit 1968 verkroch sich John Lennon mit seiner Traumfrau – der japanischen Aktionskünstlerin Yoko Ono – in Hotelbetten, mal in Toronto, mal in Amsterdam, um für den Frieden zu demonstrieren. Dazu dann noch das provokante Plattencover ihrer gemeinsamen ersten Langrille „Unfinished Music No. 1: Two Virgins“ von 1968, das beide nackt zeigte. Natürlich wurde das Werk in dieser Form verboten, um bei einem anderen Label in dezentem Braun erneut auf den Markt zu kommen. All diese Aktionen ließen den zunehmend aggressiven Musiker lächerlich erscheinen. Aber er nahm klar dazu Stellung, machte deutlich, sich nur auf diese Art und Weise vom allzu braven Beatles-Image lösen zu können. Und ein politischer Mensch sei er schließlich immer schon gewesen. Stimmt.
Schließlich entschloss sich das Ehepaar Ono-Lennon, 1971 in die USA auszuwandern und der Heimat des Ex-Beatle, England, für immer den Rücken zu kehren. Der streitbare John liebte die anonyme Großstadt New York, wo er bis zu seinem Tod 1980 im Dakota-Haus, nahe dem Central-Park, lebte. Allerdings kämpfte er, trotz seines Weltruhms, fast sechs Jahre um die so genannte Green Card – der Erlaubnis für den unbefristeten Aufenthalt in den Staaten. Bis dahin erwies sich der Weg als kantig, steinig. Lag vielleicht auch daran, dass seine Botschaften zunehmend radikaler wurden – Songtitel wie „Power To The People“ und „Woman Is The Nigger Of The World“ gefielen den US-Behörden nicht so recht. So versuchte die Nixon-Regierung, ihren ungeliebten Gast zweimal rauszuekeln. Der als paranoid geltende Präsident 5 befürchtete, Lennon könne bei der nächsten Wahl seinen Gegner George McGovern unterstützen. Doch John ließ sich selbst von allerhöchster Stelle nicht einschüchtern, war er doch aus seiner englischen Zeit gewohnt, zu kämpfen. Schließlich ergatterte er dann 1976 das ersehnte „grüne Kärtchen“.
Ray Milland und das Lost Weekend
Und genau in diese Zeit fällt eine äußerst merkwürdige Episode im Leben des John Lennon – das so genannte „Lost Weekend“. Diese Periode bekam ihren Namen nach einem schweren, düsteren Alkoholiker-Film von 1945 mit dem Hollywood-Star Ray Milland in der Hauptrolle. Allerdings dauerte sie für den englischen Musiker bei weitem länger als nur ein simples Wochenende an, nämlich ganze 18 Monate 6, und beschreibt eine Phase des Ex-Beatle, als ihn Yoko eines schönen Tages im November 1973 vor die Tür setzte. „Das was die Leute nicht verstehen – sie hatten wirklich Probleme in ihrer Beziehung“, erklärt May Pang, die persönliche Assistentin des Paares, Jahre später in einem Interview 7. Total geschockt rastete Lennon erst mal aus, schnappte sich Frau Pang und reiste mit ihr ins sonnige Kalifornien. Auf diese Weise bekam er den nötigen Abstand zu seiner Ehefrau an der Ostküste. Und es begann eine geheimnisumwitterte, wilde Zeit, die erst im Februar 1975 endete, als John reumütig in die Arme seiner Yoko zurückkehrte.
Während jener Tage entwickelte er zur jüngeren May Pang starke Gefühle. Kein Wunder, kam diese doch witzig und selbstbewusst rüber – eine Frau nach Lennons Geschmack! 8 Und, was manchen verwundert, alles unter „Aufsicht“ von Yoko Ono, die laut May Pang fast täglich aus dem fernen „Big Apple“ anrief. In jenen Tagen traf er vor Ort alte Kumpel wie seinen Ex-Kollegen Ringo Starr und den US-amerikanischen Sänger Harry Nilsson. Das flotte Trio machte gemäß diversen Quellen nachts Los Angeles unsicher 9, ließ sprichwörtlich die Puppen tanzen. Einige Zeitzeugen berichten gar von kulinarischen Eskapaden, Saufgelagen und exzessivem Drogengenuss.
Rauswurf in Hollywood
Einer speziellen Anekdote zufolge besuchte Lennon mit Nilsson eines Abends den Club „Troubadour“ in West Hollywood, wo das US-Komikerduo „Smothers Brothers“ auftrat. Als vor allem der Beatle die Darbietung durch beleidigende Zwischenrufe störte, setzten Saalordner die zwei Herren kurzerhand wieder vor die Tür 10. Peinlich: Einer der zwei Comedians – Tom Smothers – wirkte einst bei Lennons Bed-In-Aufnahme „Give Peace A Chance“ mit. Diese Episode sollte aber nicht überbewertet werden; hier mochte es eine persönliche Differenz gegeben haben. Ferner standen John und Harry unter Alkoholeinfluss.
Es jedoch bei diesen Exzessen belassen zu wollen, würde heißen, diese Ära – diplomatisch ausgedrückt – nur verkürzt wiederzugeben. Denn auch musikalisch ging es für Lennon und seine Freunde weiter: Erst half er seinem alten Beatle-Spezi Ringo bei seinen Solo-Alben „Ringo“ (1973) und „Goodnight Vienna“ (1974); für letzteres schrieb er sogar den Titelsong. Für seinen Freund Harry Nilsson, der bekanntlich niemals live auftrat, produzierte John von März bis April des Jahres 1974 das legendäre Album „Pussy Cats“, mit dabei hier auch Ringo und Keith Moon – der Drummer von „The Who”. Doch Harry strapazierte sich über alle Maßen, erlitt prompt einen Riss des Stimmbandes. Um die Aufnahmen nicht zu stören, teilte er Lennon dies nicht mit. Ein Fehler, denn am Ende der Sessions verlor Nilsson seine Stimme fast ganz. Monate später kehrte sie zurück, aber ohne den Glanz alter Zeiten 11.
Mauern und Brücken
Berauscht von der Studioatmosphäre, nahm der Ex-Beatle daraufhin von Juni bis Juli mit seinen Musikerkollegen auch ein eigenes Album auf: „Walls And Bridges“, das daraufhin im Oktober desselben Jahres offiziell erschien. Als Single koppelte die Plattenfirma zwei Songs aus: das rhythmisch schnelle „Whatever Gets You Thru The Night“ und das traumhaft schöne „#9 Dream“. Dabei blieb es nicht; Lennon setzte noch eins drauf: Im Anschluss an die Aufnahmen für „Walls And Bridges“ spielte er mit der gleichen Band einige Songs für das folgende Werk „Rock’n’Roll“ ein. Tracks wie „Be-Bop-A-Lula“, „Peggy Sue“ und „Sweet Little Sixteen“ kündeten als eine Art Flashback alter Hamburger Zeiten. Als sehr erfolgreich erwies sich die Single „Stand By Me“ – in den USA 1975 immerhin ein Top-20-Hit.
Ja, es war eine wilde Zeit damals, aber auch eine Chance für John Lennon, sich künstlerisch und menschlich zu besinnen. Irgendwie spürte er, dass ihm Yoko fehlte. Leise vermehren sich Gerüchte, Lennon habe während dieser 18 Monate tatsächlich für einige Tage sein Gedächtnis verloren, könne sich an rein gar nichts mehr erinnern. Doch finden sich in dieser Richtung nur wenige konkrete Hinweise. Rätselhaft auch, warum er zwischen 1975 und 1980 – also nach dem berüchtigten „Lost Weekend“ – kein einziges musikalisches Lebenszeichen von sich gegeben hat. Diese fünf Jahre verbrachte er komplett als Privatmann. Auch hier kursieren Gerüchte: Einmal bemerkte der Musiker dazu, er habe sein ganzes Leben lang im Rampenlicht gestanden, brauche nun eine wohlverdiente schöpferische Pause. Erst sein kleiner Sohn Sean habe ihn da wieder rausgeholt, weil er eines Tages nicht glauben wollte, dass die Musik aus dem Radio von seinem Vater stammte. So kam es zur Comeback-Platte „Double Fantasy“ von 1980.
Offene Fragen
Ehrlich, es mutet schon seltsam an, exakt wenige Tage nach Erscheinen dieses Albums von Lennons Tod zu hören. Mit dem Wissen, dass das Liverpooler Musik-Genie zeitweise gar zwei Geheimdienste im Nacken hatte, bleibt Raum für Spekulationen. Ob die amerikanischen Behörden Lennon die „Green Card“ nur mit der Auflage übereichten, sich dafür mucksmäuschenstill zu verhalten? Oder hat Lennon irgendetwas gewusst, was nicht fürs Volk bestimmt war? Diese Fragen bleiben wohl für alle Zeiten offen. Wie auch immer, John Lennon ist ein Idol, das so viel Mumm besaß, sich für wichtige Ziele einzusetzen, und nicht davor zurückscheute, sich auch mit der Obrigkeit anzulegen. Zudem verzichtete er bis zum Schluss auf Bodyguards, was ihn zu einem Menschen aus Fleisch und Blut machte, ihm aber an seinem Todestag – dem 8. Dezember 1980 – zum Verhängnis wurde, als ihn ein gefährlicher Irrer von hinten erschoss. Komisch allerdings, wie John Lennon auf einer Fanseite zitiert wird: „Hört zu, falls Yoko und mir irgendetwas passiert, war es kein Unfall.“ 12
1http://www.thebeatleswebsite.com/quotes.html
2http://home.arcor.de/u.paulusch/Beatles/Geschichte.htm
3 angeblich nach Tony Sheridan
4http://www.frambach.com/id7.html
5 Alan Posener, John Lennon, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH (1987)
6http://www.johnlennon.com/html/history.aspx
7http://classicrock.about.com/od/johnlennon/a/may_pang.htm?p=1
8http://classicrock.about.com/od/johnlennon/a/may_pang.htm?p=1
9 Alan Posener, John Lennon, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH (1987)
10 Alan Posener, John Lennon, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH (1987)
11http://www.jpgr.co.uk/col_apl10570.html
12http://www.john-lennon.com
George Harrison – der geheimnisvolle Beatle
Aufmerksame Leser dieses Buches wissen es längst: Die Popwelt erlebt die Beatles als eine unerschöpfliche Quelle für Anekdoten aller Art; schräge Geschichten pflastern den Weg der „Fab Four“. So hatten wir gerade über das „verlorene Wochenende“ des John Lennon berichtet 1; an späterer Stelle präsentieren wir noch einen (möglichen) Doppelgänger von Paul McCartney 2. Doch gibt es einen Beatle, über den die Musik-Fans immer noch recht wenig wissen, weil dieser sein Privatleben nicht gern auf dem Präsentierteller legte: George Harrison, der am 25. Februar 1943 in Liverpool das Licht der Welt erblickte und am 29. November 2001 in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben war. Von vielen als der „stille Beatle“ bezeichnet, bekam er lange Jahre nicht den gleichen Anteil vom Kuchen wie seine Kollegen John Lennon und Paul McCartney. Obwohl er gerade der wichtigste Musiker der Gruppe war: Als Gitarrenvirtuose prägte er seinen eigenen Stil, der von anderen oft kopiert wurde. Grund genug, dem unbekannten George ein Kapitel zu widmen.
Rock’n’Roll im knallgelben Dressing
Wie seine drei Band-Kollegen wuchs George in Liverpool auf, als Sohn des Busfahrers Harold Harrison und als jüngstes von vier Kindern. Der junge George litt arg unter seinen – mit Verlaub – abstehenden Ohren, weshalb er in seiner Klasse mit provokanter Kleidung auffiel: So verwirrte er Lehrer und Mitschüler beispielsweise gern mit seinem knallgelben Dressing. Es war die Zeit von Elvis Presley und Bill Haley. Und so dauerte es nicht lange, bis er eines Tages im örtlichen Schulbus einen Jungen kennen lernte, der sich wie er für Musik interessierte. Sein Name: Paul McCartney. Und ein gewisser John Lennon besuchte die gleiche Grundschule wie der kleine George, allerdings drei Klassen über ihm.
Als der Rock’n’Roll aus den Vereinigten Staaten schließlich England erreichte, entschloss er sich, ebenfalls ein Rockstar zu werden. Zu dieser Zeit hatte John gerade eine Gruppe namens „Quarrymen“ gegründet. Auf Vermittlung von Paul durfte George trotz seines jungen Alters mitmischen. Aber aller Anfang ist schwer und es war John, der oft auf dem Kleinen herumhackte. Dennoch: Diese Combo bildete den Kern der späteren Beatles. Von da an war George trotz aller Hindernisse bis zum bitteren Ende dabei – bis zu jenem schicksalhaften Tag, als die Beatles sich auflösten. Das haben nicht alle geschafft. Denken wir zum Beispiel an den Schlagzeuger Pete Best.
Harrison füllte bei den Beatles den Raum aus, den John und Paul ihm ließen. „Sie ignorierten mich“, beklagte er noch Jahre später 3. Oft fühlte er sich nach eigener Angabe als „Sessionmann für Paul“ 45. Was nur wenige wissen: Der begabte Lead-Gitarrist komponierte ebenso viel wie Lennon und McCartney. Aber er konnte sich nicht durchsetzen und bekam nicht die großen Stücke vom Geldkuchen wie seine zwei Kollegen. Was durchaus nicht hieß, dass er bei den Fans unbeliebt gewesen wäre. Ganz im Gegenteil: Wenn er sich mal bei den unzähligen Bühnenauftritten den Weg ans Mikrofon erkämpfte und einen Titel sang, flippte das Publikum immer besonders aus. Ja, er hatte seine Fans und viele schätzten seine eher ruhige Art. Zeitgenossen sahen ihn als den „ausgeglichenen Beatle“, der in gewisser Weise harmonisierend wirkte.
George und seine Sitar
Aufgrund dieses Wesenszugs verwundert es nicht, dass sich George Mitte der 60er Jahre dem östlichen Kulturkreis zuwandte und zum Hinduismus konvertierte. Im Jahr 1966 reiste er nach Indien, um beim renommierten Musiker Ravi Shankar das Spielen der Sitar zu erlernen. Kurz darauf war dieses indische Zupfinstrument bereits Teil der Beatles-Musik: Stücke wie „Norwegian Wood“ (vom Album „Rubber Soul“) und „Within You Without You“ (vom Album „Sgt. Pepper“) stellten Harrison spätestens zu diesem Zeitpunkt künstlerisch auf eine Ebene mit Lennon und McCartney. Auch die gemeinsame Reise aller vier Beatles nach Indien 1968 gab ihm mächtig Rückhalt in der Truppe, war dies doch ursprünglich Georges Idee. Um es auf den Punkt zu bringen: Harrisons Kompositionen „Here Comes The Sun“ und „Something“ (beide aus „Abbey Road“) gelten als Meilensteine der Popmusik, aus dem Beatles-Gesamtwerk nicht mehr wegzudenken. Aber letztlich gelang ihm mit seinem Solo-Dreifach-Album „All Things Must Pass“ 1970 der Aufstieg in den ewigen Rock’n’Roll-Himmel. Das Opus enthielt auch dem Millionen-Seller „My Sweet Lord“. Fazit: George Harrison – der gleichgestellte Beatle.





























