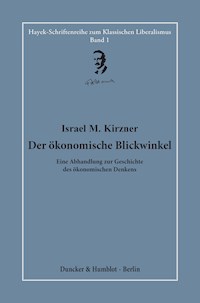
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der ökonomische Blickwinkel ist die Erstübersetzung von Israel Kirzners Buch The Economic Point of View. Kirzner, ein Schüler Ludwig von Mises', ist hierzulande vor allem als Ökonom bekannt, der bahnbrechende Beiträge zur Rolle des Unternehmers im Markt geleistet hat. In Der ökonomische Blickwinkel geht er einer ganz anderen Frage nach, der nach dem Forschungsgegenstand der Ökonomie. Für Kirzner ist klar, dass eine Antwort auf die Frage nach dem Selbstverständnis der Ökonomie, nach dem ökonomischen Blickwinkel, methodologische und historische Reflektionen voraussetzt. So ist sein Buch sowohl eine methodologische Analyse als auch ein historischer Abriss der zahlreichen Definitionen von Ökonomie und dem, womit diese befasst ist oder befasst zu sein glaubt. Nach Wettbewerb und Unternehmertum (Competition and Entrepreneurship) und Unternehmer und Marktdynamik (Perception, Opportunity, and Profit) ist Der ökonomische Blickwinkel das dritte Buch Kirzners, das auch in deutscher Sprache vorliegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ISRAEL M. KIRZNER
Der ökonomische Blickwinkel
Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus
Band 1
Israel M. Kirzner
Der ökonomische Blickwinkel
Eine Abhandlung zur Geschichte des ökonomischen Denkens
Herausgegeben und übersetzt von
Hardy Bouillon
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISSN 2510-2893 ISBN 978-3-428-15122-6 (Print) ISBN 978-3-428-55122-4 (E-Book) ISBN 978-3-428-85122-5 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾ Internet: http://www.duncker-humblot.de
B’ezras Hashem Unseren Eltern
Vorwort der Herausgeber
Mit der Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus sollen einschlägige Schriften, die in der Tradition des Klassischen Liberalismus und in geistiger Nähe zu Friedrich August von Hayek stehen, einer deutschsprachigen Leserschaft nähergebracht werden. Zu diesem Zweck werden Schlüsselwerke bedeutender Autoren übersetzt und in deutscher Erstausgabe herausgegeben. Gleichwohl ist die Schriftenreihe nicht auf Übersetzungen beschränkt, sondern auch offen für Arbeiten gegenwärtiger Autoren, die sich der Schule des Klassischen Liberalismus und dem freiheitlichen Denken Hayeks eng verbunden fühlen. Auf den Autor des ersten Bandes trifft beides gleichermaßen zu. Israel M. Kirzner zählt zu den führenden Vertretern der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, die die Gegenwart kennt. Seine Schriften gehören zu den wichtigsten Werken, die diese Schule hervorgebracht hat.
Der ökonomische Blickwinkel (im Original: The Economic Point of View) ist eine Abhandlung zum Selbstverständnis der Ökonomie. Der Autor geht in ihr der Frage nach, womit sich die Ökonomie vornehmlich befasst und befassen sollte. Er betrachtet diese Frage sowohl aus historischer wie auch aus systematischer Perspektive und gelangt zu einem Bild der Ökonomie, das sich eng an die Praxeologie seines Lehrers Ludwig von Mises anlehnt.
Israel M. Kirzner wurde 1930 als Sohn eines Rabbiners geboren. Die Kinderjahre verbrachte er in London, seine Jugend in Kapstadt. Hier begann er auch das Studium der Ökonomie. Nach einem kurzen Zwischenspiel an der University of London wechselte er schließlich an die New York University (NYU). Dort lernte er Mises kennen, wurde dessen Schüler und später Professor an der NYU. Zu Kirzners wichtigsten Werken zählen Competition and Entrepreneurship (1973), Perception, Opportunity, and Profit (1979), Discovery, Capitalism, and Distributive Justice (1989), und The Meaning of Market Process (1992).
Der ökonomische Blickwinkel von Israel Kirzner ist der erste Band der Reihe. Weitere Bände anderer Autoren sind bereits in Planung und sollen im Jahresrhythmus erscheinen. Die Hayek-Schriftenreihe zum Klassischen Liberalismus wird unterstützt von der Friedrich August von Hayek-Stiftung, Berlin.
Prof. Dr. Hardy Bouillon
Prof. Dr. Gerd Habermann
Prof. Dr. Erich Weede
Einleitung des Herausgebers und Übersetzers
Israel Kirzner, ein Schüler Ludwig von Mises’, ist in Deutschland kein Unbekannter. Dennoch sind seine Beiträge zur Ökonomie wenig bekannt. Das gilt auch für seine Bücher, von denen bislang nur zwei ins Deutsche übersetzt wurden, nämlich Wettbewerb und Unternehmertum (Competition and Entrepreneurship) und Unternehmer und Marktdynamik (Perception, Opportunity, and Profit). In beiden geht es um die Rolle des Unternehmers, um Nutzung und Schöpfung von Informationen und deren Nutzung in dynamischen Märkten, aber auch um deren Auswirkungen auf das Marktgleichgewicht. Sie haben wesentlich zu dem Ruf beigetragen, den Kirzner heute über die engen Fachgrenzen hinaus genießt, nämlich einer jener Ökonomen zu sein, die das Bild des Unternehmers nachhaltig geprägt haben.
The Economic Point of View ist Kirzners erstes Hauptwerk. Es zeigt den jungen Kirzner, dem es noch nicht um die o. g. speziellen Themen ging, sondern um eine, um die grundsätzliche Frage, der sich jeder Ökonom von Zeit zu Zeit ausgesetzt fühlt. Gemeint ist die Frage nach dem Selbstverständnis der eigenen Disziplin. Was ist, was treibt die Ökonomie? Für Kirzner ist klar, dass diese Frage nur eine Antwort findet, wenn der Ökonom sagen kann, womit er sich befasst. Was ist sein Forschungsgegenstand? Nicht alle Ökonomen haben zu dieser Frage dezidiert Stellung bezogen, und nicht alle Stellungnahmen sind gleich ausgefallen. Im Gegenteil, die Positionen sind vielfältig und haben im Laufe der Zeit an Zahl hinzugewonnen. Für Kirzner ist daher auch klar, dass eine Antwort auf die Frage nach dem Selbstverständnis der Ökonomie, nach dem ökonomischen Blickwinkel, methodologische und historische Reflexionen voraussetzt. So ist sein Buch sowohl eine methodologische Analyse als auch ein historischer Abriss der zahlreichen Definitionen von Ökonomie und dem, womit sie befasst ist oder befasst zu sein glaubt.
Das Thema bringt es mit sich, dass Kirzners Buch auch Meta-Ökonomie zum Inhalt haben muss, ein Umstand, der hohe Anforderungen an die zu wählende Terminologie stellt. Das wiederum stellt jeden Übersetzer, der den Absichten des Autors so nahe wie möglich kommen will, vor eine zusätzliche Herausforderung. Es ist zu hoffen, dass die vorliegende Übersetzung dieser Herausforderung gerecht geworden ist. Es wurde versucht, Stil, Syntax und Terminologie des Autors so authentisch wie möglich zu bewahren, und zwar mit all den Möglichkeiten, die das Deutsche bietet. Stellen, an denen eine allzu sklavische Übersetzung womöglich einen holprigen Eindruck hinterlassen hätte, wurden äußerst behutsam mit kleinen, aber keineswegs den Sinn entstellenden Füllwörtern geglättet, um den Lesefluss zu erleichtern.
Größere Zitate, etwa von Marx, Mises oder Weber, wurden nicht aus dem Englischen rückübersetzt, sondern nachgeschlagen und aus den Originalquellen, so[10] weit zugängig, übernommen, um etwaige Irritationen beim Leser zu vermeiden. Die Zitatangaben und Zitiermodi wurden vom Autor übernommen. Zu groß ist die Gefahr, dass gutgemeinte Ergänzungen oder Verbesserungen des Übersetzers in den Anmerkungen zu Verschlimmbesserungen führen können. Offensichtliche Druckfehler, z.B. bei Umlauten, wurden verständlicherweise korrigiert. Ansonsten wurde von gutgemeinten Korrekturen Abstand genommen und alles vom Autor übernommen. Lediglich die Setzung der Anmerkungen entspricht den Vorgaben des Verlags, der dieses Werk dankenswerterweise in sein Programm aufgenommen hat. Um den Vorgaben zu entsprechen, erwies es sich als notwendig, die vielen umfangreichen bibliographischen Angaben, die ursprünglich in die Anmerkungen eingebunden waren, in ein eigens dafür erstelltes Literaturverzeichnis zu übertragen. Dies wiederum ersparte das wiederholte Zitieren der Werke in den Fußnoten. Die stattdessen eingesetzten Kürzel aus Autor und Jahr beziehen sich auf die Angaben im Literaturapparat. Um Verwechslungen auszuschließen, die hier und da aufgrund mehrerer Publikationen eines Autors im selben Jahr denkbar gewesen wären, wurde gelegentlich der passende Titel der Veröffentlichung ergänzend genannt. Gleiches gilt, wo derlei Verwechslungen aus anderen Gründen möglich gewesen wären oder die Nennung des Titels sonstwie sinnvoll erschien.
Bleibt mir noch, dem Institute for Humane Studies (IHS), dem Rechtsnachfolger des Volker Funds und Inhaber des Copyrights, für die freundliche Genehmigung zu danken, eine deutsche Erstausgabe von Israel Kirzners Economic Point of View herauszubringen. Danken möchte ich auch Liberty Fund, Inc., dessen Index und editorische Ergänzungen zur 2. englischen Auflage meine Übersetzer- und Herausgeberaufgabe erleichtert haben. Der letzte und größte Dank gebührt indes dem Urheber dieses Werkes, Professor Israel Kirzner, durch dessen Zustimmung die vorliegende Übersetzung erst möglich wurde.
Hardy Bouillon
Vorwort von Ludwig von Mises
Die Einführung einer systematischen Wirtschaftswissenschaft – eine Errungenschaft der Gesellschaftsphilosophie der Aufklärung, die auch die Konzeption der Volkssouveränität hervorgebracht hat – war für die in jener Zeit aufkommenden Mächte eine Herausforderung. Wie die Ökonomie zeigt, herrscht infolge von Marktphänomenen und deren Interdependenzen eine unvermeidbare Gesetzmäßigkeit, die der Mensch vollständig berücksichtigen muss, um seine angestrebten Ziele zu erreichen.
Auch die mächtigste Regierung, die mit größter Strenge vorgeht, kann nicht erfolgreich sein, wenn ihre Anstrengungen dem zuwiderlaufen, was man das „Gesetz der Ökonomie“ genannt hat. Es liegt auf der Hand, warum sowohl die despotischen Herrscher als auch die Anführer revolutionärer Massen solche Gesetze gleichermaßen nicht mochten. Für sie war die Ökonomie eine „trostlose Wissenschaft“ (dismal science), die sie ohne Unterlass bekämpften.
Wie auch immer, nicht die Feindseligkeit der Regierungen und der mächtigen politischen Parteien schürte die langwierigen Diskussionen über den epistemologischen Charakter und die logische Methode der Ökonomie, in denen die Existenz und Bedeutung dieses Wissenszweiges immer und immer wieder in Frage gestellt wurden. Was jene Debatten hervorrief, war die Vagheit, mit der die frühen Ökonomen ihre Disziplin zu definieren pflegten. Es wäre absurd, ihnen den fehlenden Wunsch nach Klarheit vorzuwerfen. Sie hatten Grund genug, sich auf jene Probleme zu konzentrieren, die sie lösen wollten, und andere darüber zu vernachlässigen. Gewisse Themen der politischen Kontroversen jener Zeit hielten sie dazu an. Ihre große Leistung lag in der Entdeckung der gleichförmigen Ordnung, die bei jener Entstehung von Ereignissen herrscht, die man zuvor für chaotisch hielt. Erst spätere Generationen von Ökonomen gerieten über die damit verbundenen erkenntnistheoretischen Probleme ins Grübeln.
Dr. Kirzners Buch gibt einen historischen Überblick über alle Lösungen, die in dieser Debatte vorgeschlagen wurden. Es ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Ideengeschichte, der den Weg der Ökonomie von einer Wissenschaft des Wohlstands zu einer Wissenschaft menschlichen Handelns beschreibt. Der Autor ergeht sich nicht, wie es neuerdings unter einigen Historikern der Nationalökonomie Mode geworden ist, in Werturteilen und paradoxen Beobachtungen. Lieber folgt er den nüchternen Methoden der besten Historiker der Nationalökonomie, nämlich denen von Böhm-Bawerk und Edwin Cannan. Jeder Ökonom – und eigentlich jeder an Problemen der allgemeinen Erkenntnistheorie Interessierte – wird Dr. Kirzners Analysen mit großem Gewinn lesen; vor allem seine Darlegung der berühmten Debatte zwischen Benedetto Croce und Vilfredo Pareto und die kritische Untersuchung zu den Ideen von Max Weber und Lionel Robbins.
[12] Aufsätze zur Ideengeschichte der Ökonomie sind nicht nur von historischem Wert. Nicht weniger wichtig ist die Tatsache, dass sie uns den gegenwärtigen Stand der Nationalökonomie im Lichte aller Versuche, die frühere Generationen zur Lösung der Probleme unternommen haben, erneut prüfen lassen.
Im Vergleich unserer Sichtweisen mit den Errungenschaften und Irrtümern der Vergangenheit können wir entweder Fehler in unseren eigenen Theorien oder neue und bessere Gründe für deren Bestätigung finden. Dr. Kirzners umsichtige Abhandlung ist eine wahre Hilfe bei einer solchen Neubewertung. Genau darin besteht ihr großes Verdienst.
Ludwig von Mises
Vorwort des Autors
Die vorliegende Abhandlung ist der Versuch, mit einer gewissen Gründlichkeit ein extrem kleines Feld der ökonomischen Ideengeschichte zu untersuchen. Trotz ihrer geringen Größe verdient dieses Gebiet eine über die Maßen ausgedehnte Untersuchung und Einbeziehung all jener Grundgedanken, um die sich der Kanon des ökonomischen Denkens der letzten zwei Jahrhunderte gedreht hat. Damals wie heute wird die Richtung der Nationalökonomie weitgehend vom „Blickwinkel“ bestimmt, den der Ökonom für seine spezielle Betrachtungsweise einnimmt. Genau zu diesem Zusammenhang will die vorliegende Untersuchung einen Beitrag leisten, indem sie das Problem in den ihm gebührenden Kontext einordnet, nämlich als ein Kapitel zur Ideengeschichte.
In diesem Fall hat die Natur des Untersuchungsgegenstands die Gründlichkeit der Erforschung erheblich erschwert; Vollständigkeit war schier unmöglich. Dabei war es mein Ziel, eine sorgfältige Übersicht der relevanten Literatur zu jedem der behandelten Themen zu erstellen und zugleich entschieden der sklavischen Versuchung zu widerstehen, die mein Buch in eine kommentierte Bibliographie verwandelt hätte. Das ließ mich immer wieder auch Werke von erheblicher Bedeutung ignorieren, um überflüssige Wiederholungen der bereits aus anderen Quellen zitierten Ideen zu vermeiden. Ungeachtet dieser Selbstbegrenzung hielt ich es für angebracht, alle Anmerkungen und Verweise ans Ende des Buches zu setzen, um den Lesefluss des Haupttextes zu erleichtern.
Meine Untersuchung des in diesem Buch behandelten Themas begann vor vielen Jahren, als ich bei Professor Mises meine Dissertation schrieb. Vieles von dem Material, das ich für die Arbeit an jenem Projekt gesammelt hatte, erwies sich als nützliche Grundlage für die umfassendere Untersuchung, die zur Vorbereitung des vorliegenden Bandes durchgeführt wurde. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank für all die Unterstützung ausdrücken, die mir seinerzeit die Verfolgung meiner Forschungsinteressen erlaubte; zunächst als Volker Fellow und anschließend als Earhart Fellow an der New York University.
Was ich den einzigartigen Beiträgen, die Professor Mises zu den in meinem Buch diskutierten epistemologischen Problemen beigesteuert hat, in geistiger Hinsicht schulde, dürfte, wie ich glaube, in hinreichendem Maße und überall aus meiner Arbeit ersichtlich sein. Es ist mir eine besondere Freude, ihm hier meinen Dank für die freundliche Geduld und herzliche Ermunterung, mit der er mich während des gesamten Projekts überhäuft hat, auszusprechen; dafür und für die Inspiration, die ich seinem Enthusiasmus und seiner eindringlichen geistigen Redlichkeit verdanke, die er in unzähligen Diskussionen, ob im privaten Gespräch oder im Seminar, entfaltete.
[14] Von den äußerst wertvollen Diskussionen, die ich mit meinen Kollegen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der School of Commerce der New York University zu den unterschiedlichsten Themen meiner Studie führte, habe ich weit mehr als einmal profitiert. Darüber hinaus stehe ich in der Schuld des Dekans T. L. Norton und des Vorsitzenden des Fachbereichs, Professor T. J. Anderson, die mir während einer Phase der Forschungsarbeit die Erfüllung meiner Lehrverpflichtungen mit besonderen Arrangements erleichterten. Das gilt auch für ihre stetigen Ermunterungen bis zum Abschluss des Projekts. Was Fragen des Stils und Klarheit des Ausdrucks angeht, so habe ich dankenswerterweise wertvolle Hilfe von Dr. Arthur Goddard erfahren. Die Verantwortung für alle Unzulänglichkeiten dieser Arbeit liegt indes einzig bei mir.
Zu guter Letzt habe ich die erfreuliche und zugleich etwas heikle Aufgabe, meiner Frau für ihre Mitwirkung, der materiellen wie der ideellen, am Erscheinen dieses Bandes zu danken. Allein der Dank (und die Schwierigkeit, ihn auszudrücken), den ich ihr in dieser Hinsicht schulde, reichen noch tiefer. Das gründet in einer Besonderheit, nämlich der, dass diese Mitwirkung ihrer Natur gemäß zum großen Teil unter Umständen erfolgte, die sie für sich genommen schon außergewöhnlich verdienstvoll machen.
New York, N.Y., im März 1960
Israel M. Kirzner
Dank
Der Autor steht tief in der Schuld folgender Institutionen, Gesellschaften und Verlage für deren Entgegenkommen und die Erlaubnis aus deren Veröffentlichungen wie folgt zu zitieren:
The American Economic Association (für Zitate aus ihren Veröffentlichungen, Survey of Contemporary Economics, 1949, eingeschlossen); George Allen and Unwin Ltd. (für Zitate aus N. Senior, Outline of Political Economy, und J. Bentham, Economic Writings, hg. von Stark); Jonathan Cape Limited (für Zitate aus L. Mises, Socialism, und L. Robbins, The Economic Causes of War); Columbia University Press (für Zitate aus E.R.A. Seligman, Economic Interpretation of History, 1902, und aus Political Science Quarterly, 1901); die Herausgeber von Economica (für Zitate aus Economica, 1933, 1941); der Herausgeber von Economic Record und der Melbourne University Press (für Zitate aus Economic Record, Nr. 61, November, 1955); The Free Press (für Zitate aus Max Weber on the Methodology of the Social Sciences); Harper and Brothers (für Zitate aus F.H. Knight, The Ethics of Competition); Harvard University Press (für Zitate aus Quarterly Journal of Economics und aus H. Myint, Theories of Welfare Economics, 1948); William Hodge and Co. Ltd. (für Zitate aus Max Weber, Theories of Social and Economic Organization); Howard Allen, Inc. (für Zitate aus K. Boulding, The Skills of the Economist); Richard D. Irwin, Inc. (für Zitate aus T. Scitovsky, Welfare and Competition); Kelley and Millman, Inc. (für Zitate aus W. Mitchell, The Backward Art of Spending Money); Alfred A. Knopf, Inc. (für Zitate aus S. Patten, Essays in Economic Theory, hg. von R. Tugwell); Longmans, Green and Co., Ltd. (für Zitate aus R. Hawtrey, The Economic Problem); The Macmillan Company, New York (für Zitate aus L. Haney, History of Economic Thought, 1949, F.S.C. Northrop, Logic of the Sciences and Humanities, 1949, A. Marshall, Principles of Economics, 1920); Macmillan and Co. Ltd., London (für Zitate aus Economic Journal, International Economic Papers und aus Werken von Croce, Hutchinson, Jevons, Macfie, Marshall, Robbins und Pigou; für die Werke von Pigou gilt der Dank auch der St. Martin’s Press, Inc., New York); Oxford University Press und Clarendon Press, Oxford (für Zitate aus Proceedings of the British Academy und aus I. Little, Critique of Welfare Economics); Routledge and Kegan Paul Ltd. (für Zitate aus P. Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, F.A. Hayek, Road to Serfdom, und G. Myrdal, Value in Social Theory); Staples Press (für Zitate aus E. Cannan, Wealth, E. Cannan, Theories of Production and Distribution, D.H. Robertson, Economic Commentaries); University of Chicago Press (für Zitate aus F.A. Hayek, Road to Serfdom, F.H. Knight, History and Method of Economics, und aus Journal of Political Economy); The Viking Press, Inc. (für Zitate aus T. Veblen, The Theory of the Leisure Class, The Place of[16] Science in Modern Civilization, Essays in Our Changing Order, und W. Mitchell [Hrsg.], What Veblen Taught); Yale University Press (für Zitate aus L. Mises, Human Action).
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
Zur Definition des ökonomischen Blickwinkels
Der ökonomische Blickwinkel und der Geltungsbereich der Ökonomie
Die Vielfalt der ökonomischen Blickwinkel
Die Kontroverse über die Nützlichkeit der Definition
Eine Interpretation der Kontroverse
Die Ökonomen und ihre Definitionen: die Ökonomen der Klassik
Der ökonomische Blickwinkel: der Hintergrund des Methodenstreits
Ökonomische Blickwinkel des 20. Jahrhunderts
2. Kapitel
Die Wissenschaft von Wohlstand und Wohlfahrt
Das Auftreten der politischen Ökonomie als Wissenschaft vom Wohlstand
Die Wissenschaft vom materiellen Wohlstand
Die Wissenschaft vom Lebensunterhalt
Die Wissenschaft von der Besitzstandswahrung
Mensch gegen Natur
Vom Wohlstand zum Wohlergehen
Die Wissenschaft von den niederen Bedürfnissen der menschlichen Natur
3. Kapitel
Die Wissenschaft von der Habgier; wie man aus so wenig wie möglich so viel wie möglich macht
Die Wissenschaft von der Habgier
Das ökonomische Prinzip
Der „ökonomische Impuls“
Selbstsucht und „Non-Tuismus“
Ökonomie und Mechanik
4. Kapitel
Ökonomie, Markt und Gesellschaft
Ökonomie und Katallaktik
Der Tausch und die Neigung, zu handeln
Tausch und Arbeitsteilung
Das „rein formale“ Tauschkonzept
Tausch und ökonomisches System
Ökonomie, Wirtschaft und Volkswirtschaft
Wirtschaft und Gesellschaft
5. Kapitel
Ökonomische Angelegenheiten, Geld und Messung
Geld, Wohlstand und Tausch
Geld als Maßstab
Geld als universaler Maßstab
Messen und Ökonomie
Geld und Preis-Ökonomie
Geld als ökonomische Institution
6. Kapitel
Ökonomie und Wirtschaften
Die Ökonomie von Professor Robbins
Knappheit und Ökonomie
Wirtschaften und Maximierung
Der Charakter von Robbins’ Definition
A.
Die „Weite“ von Robbins’ Definition
B.
Der „Formalismus“ in Robbins’ Definition
Die Natur der Ziele und Mittel
„Gegebene“ Ziele und Mittel
Einzelziel und mannigfache Ziele
Ökonomie und Ethik: das Positive und das Normative
Die Natur der Wirtschaftswissenschaft und die Bedeutung der Makroökonomie
7. Kapitel
Die Ökonomie als eine Handlungswissenschaft
I.
Die Handlungswissenschaften
Das Auftauchen der praxeologischen Sichtweise der Ökonomie
Max Weber und die menschliche Handlung
Handelnder Mensch und wirtschaftender Mensch: Mises und Robbins
II.
Praxeologie und Zweck
Praxeologie und Rationalität
Die Annahme konstanter Wünsche – der praxeologische Kontext
Praxeologie, Apriorismus und Operationalismus
Der ökonomische Blickwinkel und die Praxeologie
Literaturverzeichnis
Personen- und Sachregister
1. Kapitel
Zur Definition des ökonomischen Blickwinkels 19
… womit wirtschaftet der Ökonom? „Es ist die Liebe, es ist die Liebe“, sagte die Herzogin, „die die Welt dreht.“ „Irgend jemand sagte“, flüsterte Alice, „dass es geschieht, indem jeder seinen eigenen Geschäften nachgeht.“ „Genau“, antwortete die Herzogin, „das ist so ziemlich dasselbe.“ Vielleicht nicht ganz genau so dasselbe, wie Alices Zeitgenossen dachten. Aber wenn wir Ökonomen unserem eigenen Geschäft nachgehen und dieses Geschäft gut machen, dann können wir, so glaube ich, erheblich zum Wirtschaften beitragen, d.h. zur vollständigen, aber sparsamen Nutzung der knappen Ressource Liebe – von der wir wie jeder andere auch wissen, dass sie das Wertvollste auf der Erde ist.
Sir Dennis H. Robertson
Man kann unmöglich eine klare Grenze um jene Sphäre oder Domäne menschlicher Handlungen ziehen, die zur Wirtschaftswissenschaft gehören.
Frank H. Knight
Mit gesellschaftlichen Phänomenen ist es wie mit anderen interessanten Sachverhalten auch, die in der realen Welt vorzufinden sind: man kann sie in vielen Disziplinen untersuchen. Ein und dieselben Rohdaten können auf vielerlei Wegen klassifiziert und erklärt werden, wobei jeder Datensatz die anderen ergänzt und so dazu beiträgt, das fragliche Phänomen voll zu erfassen. Im Interesse der zu erntenden Vorteile, die mit der Arbeitsteilung einhergehen, kann man in einer Sequenz von Ereignissen die Wiedergabe gleichzeitiger Abläufe mehrerer verschiedener Ursache- Wirkungs-Ketten sehen. Jede dieser Ketten kann dann zum Mittelpunkt der Untersuchung werden und die aus der Arbeitsteilung fließenden Vorteile mehren und so darlegen, auf welche Weise jede dieser Kausalketten ein potentiell fruchtbares Thema einer separaten Untersuchung darstellt.
Eine derartige Klassifikation jener Faktoren des beobachteten Phänomens, die der Erklärung bedürfen, gibt natürlich die jeweilige Sichtweise wieder, von der aus der Beobachter die Daten betrachtet. Letzten Endes läuft die Festlegung des jeweiligen Untersuchungsfeldes auf die Darlegung des Blickwinkels hinaus, den der Forscher gewählt hat.
Im Hinblick auf die Ökonomie und den „ökonomischen Blickwinkel“ wurden viele Versuche sehr unterschiedlicher Prägung unternommen, um das besondere Untersuchungsfeld zu beschreiben. Einige Autoren haben das Nomen „Ökonomie“ definiert; sie haben sich dabei langatmig zur genauen Abgrenzung des Bereichs der Ökonomie geäußert und sich in ausschweifenden Abhandlungen zu den Eigen[20]schaften wirtschaftlicher Tätigkeiten und der Natur ökonomischer Interpretationen ergangen. Mehr als zu Genüge haben sie das Verhältnis der Ökonomen zu den Soziologen, den Psychologen, den Moralpredigern, den Theologen und den Juristen diskutiert. Und darüber hinaus haben sie sich in hitzige und langwierige Debatten über den Nutzen eben jener Definitionen, Abhandlungen und Diskussionen eingelassen.
Kurz gesagt, sie haben zahlreiche Versuche unternommen, den genauen Blickwinkel des Ökonomen zu bestimmen, dazu bestehende Darlegungen zu hinterfragen oder dem Ökonomen schlichtweg das Recht abzusprechen, sich am eigenen Standpunkt zu erfreuen. In der Summe haben diese Unternehmungen im Verlaufe der letzten beiden Jahrhunderte eine unüberschaubare Menge an faszinierender Literatur hervorgebracht. Die Betrachtung und anschließende Verarbeitung dieser Literatur hat eine Reihe von Umschreibungen des ökonomischen Blickwinkels zu Tage gefördert, die in ihrer Vielfalt Erstaunen hervorruft. Die vorliegende Abhandlung versucht, jene Literatur zu sichten und in historischer Perspektive den breiten Bogen an Umschreibungen aufzuarbeiten. Als ein Kapitel zur Ideengeschichte richtet die vorliegende Untersuchung zur unentwegten Suche nach der exakten Bezeichnung des ökonomischen Blickwinkels ihr Augenmerk auf jene besonderen Wege, auf denen die Suche stattfand, sowie auf deren erstaunliche Heterogenität.
Obwohl die vorliegende Darstellung historisch ausgerichtet ist, werden wir die thematische, nicht die historische Vorgehensweise vorziehen. Wir werden nicht die verschiedenen Umschreibungen in der Reihenfolge präsentieren, in der sie Schritt für Schritt in die Ideengeschichte eingegangen sind. Stattdessen werden wir jede Grundgruppe an Definitionen, die man in der Literatur findet, eine nach der anderen aufgreifen und für sich so vollständig wie möglich abhandeln. Die Rolle, die jede der Gruppen in der Problemgeschichte spielte, wird durch die Erörterung der jeweiligen Definitionen offenkundig werden. Wir werden so offenlegen, dass in der Regel zu jeder Zeit eine Reihe von sehr verschiedenen Formulierungen anzutreffen war. Es erweist sich dabei als praktisch, jeder dieser Formulierungsgruppen eine Erörterung ihrer Entwicklung zu widmen, die in sich abgeschlossen ist – ohne dabei durch den Hinweis auf simultane Parallelentwicklungen anderer Definitionen vom Thema ablenken zu müssen.
In diesem Einleitungskapitel werden wir versuchen, unsere Probleme allgemeinverständlich darzustellen. In diesem Zusammenhang wird es hilfreich sein, die Bedeutung zu erörtern, die der Aufgabe zufällt, die Natur des ökonomischen Blickwinkels zu erhellen; klarzustellen, welche Verfahren unser Interesse finden und welche ähnlich gearteten Verfahren es nicht tun; und kurz zu umreißen, welchen Platz die Versuche, den ökonomischen Blickwinkel zu erläutern, in der ökonomischen Ideengeschichte eingenommen haben.
[21]Der ökonomische Blickwinkel und der Geltungsbereich der Ökonomie
Die Umschreibung der Natur des ökonomischen Blickwinkels ist selbstredend eng mit der Diskussion über den Geltungsbereich der Ökonomie verknüpft. Gleichwohl hat die Frage nach dem Anwendungsbereich der Ökonomie immer wieder Fragen aufgeworfen, mit denen diese Abhandlung nichts zu tun hat, und es ist wohl der Mühe wert, dies von Anfang an klarzustellen. Marshall schrieb einmal an John Maynard Keynes: „Es gilt wohl für jede Wissenschaft, dass ihr Geltungsbereich immer größer erscheint, je länger man sich mit ihr beschäftigt, obwohl in Wahrheit ihr Geltungsbereich unverändert geblieben ist. Die Angelegenheiten der Ökonomie wachsen jedenfalls wie Unkraut …“1
Jenes Wachstum des Gegenstandsbereichs der Ökonomie, von dem Marshall schreibt, ist typisch für jene Aspekte, die unser thematisches Interesse finden. Ein Blick in das Vorlesungsverzeichnis des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft einer jeden Universität oder die flüchtige Durchsicht des wirtschaftswissenschaftlichen Fachkatalogs einer großen Bibliothek werden jeden im Handumdrehen von der Üppigkeit dieses Wachstums überzeugen. Gewiss, die „Ökonomie“ umspannt eine Menge an Fakten, Zahlen, Theorien und Meinungen, die ein gewaltiges Ausmaß an Phänomenen umfasst, die nur spärlich miteinander verbunden sind – oft nur aufgrund historischer Zufälle. Immerhin hat einmal jemand, der die Kontroversen über den Geltungsbereich der Ökonomie von außen verfolgt hat, zumindest andeutungsweise angemerkt, dass sie bloß eine Art darstellen, Exklusivrechte für die Lehre bestimmter Sachverhalte an den Universitäten einzufordern.2 Und Benedetto Croce, der sich mit der „ökonomischen“ Interpretation der Geschichte befasst hat, schrieb vor mehr als einem halben Jahrhundert:
„Wenn man annimmt, dass wir bei der Interpretation der Geschichte vor allem die ökonomischen Faktoren zu berücksichtigen haben, dann denken wir automatisch an die technischen Bedingungen, an die Verteilung des Wohlstands, an Klassen und Unterklassen, die von gemeinsamen Interessen zusammengehalten werden, und so weiter. Gewiss, diese Bilder können nicht auf einen einzigen Begriff reduziert werden. Das steht ganz außer Frage. Wir bewegen uns hier in einer ganz anderen Sphäre als jener, in der abstrakte Fragen diskutiert werden.“3
In Diskussionen über den Geltungsbereich der Ökonomie kommen diese „unterschiedlichen Bilder“, die nicht auf einen Begriff reduzierbar sind, sehr oft vor. Unsere Untersuchung betrifft indes jene vollkommen andere Sphäre, in der abstrakte Fragen diskutiert werden. Und in dieser Sphäre spielt es sehr wohl eine Rolle, ob man den Terminus „Ökonomie“ so versteht, dass er auf einen einzigen [22] Begriff reduziert werden kann; d.h., ob man meint, er sei mit einem bestimmten „Blickwinkel“ verbunden.4
Unser Thema gilt also nicht dem Umfang des Fachs „Ökonomie“, sondern der „ökonomischen Theorie“. Wenn wir vom Blickwinkel des Ökonomen sprechen, dann haben wir vor allem den Theoretiker oder Anwender der Theorie vor Augen. Für alltägliche Zwecke mag es, wie Cannan einmal feststellte, sehr wohl richtig sein, dass man ökonomische Dinge am besten ökonomisch beschreibt.5 Die aufgekommene umfangreiche Literatur mit Versuchen zur Bestimmung des ökonomischen Blickwinkels sollte dennoch nicht als unfruchtbare Pedanterie abgetan werden. Sie ist vielmehr Ausdruck der Auseinandersetzung mit der erkenntnistheoretischen Beschaffenheit der Wirtschaftstheorie, und zwar in einem Ausmaß, das weit über jenes hinausgeht, das für die üblichen Zwecke reicht.6





























