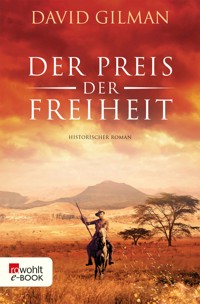
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem vom Krieg zerrissenen Land sucht ein Vater nach seinem Sohn Dublin, 1899 In Irland schwelt die Rebellion. Der Anwalt Joseph Radcliffe und sein Kamerad Benjamin Pierce übernehmen die härtesten Fälle. Doch Radcliffe hadert mit seinen Niederlagen und mit seinem einzigen Sohn, Edward. Der schifft sich nach einem Streit in Richtung Südafrika ein, um sich im Burenkrieg zu beweisen. Südafrika, 1900 Als ehemalige US-Kavalleristen kann Radcliffe und Pierce wenig schrecken. Aber in der weglosen Steppe, achthundert Meilen nördlich von Kapstadt, lernen sie eine neue, blutige Realität des Krieges kennen. Unter Feuer von Burischen Schützen, ohne Rückhalt bei den Briten, suchen die alten Veteranen nach dem verlorenen Jungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
David Gilman
Der Preis der Freiheit
Historischer Roman
Über dieses Buch
In einem vom Krieg zerrissenen Land sucht ein Vater nach seinem Sohn
Dublin, 1899
In Irland schwelt die Rebellion. Der Anwalt Joseph Radcliffe und sein Kamerad Benjamin Pierce übernehmen die härtesten Fälle. Doch Radcliffe hadert mit seinen Niederlagen und mit seinem einzigen Sohn, Edward. Der schifft sich nach einem Streit in Richtung Südafrika ein, um sich im Burenkrieg zu beweisen.
Südafrika, 1900
Als ehemalige US-Kavalleristen kann Radcliffe und Pierce wenig schrecken. Aber in der weglosen Steppe, achthundert Meilen nördlich von Kapstadt, lernen sie eine neue, blutige Realität des Krieges kennen. Unter Feuer von burischen Schützen, ohne Rückhalt bei den Briten, suchen die alten Veteranen nach dem verlorenen Jungen …
Vita
David Gilman, aufgewachsen in Liverpool, lebt heute in Devonshire. Schon als 16-Jähriger kutschierte er in einem zerbeulten Ford Bauarbeiter durch den afrikanischen Busch. Verschiedenste Jobs überall auf der Welt folgten: als Feuerwehrmann, Waldarbeiter und Werbefotograf, als Marketingmanager eines Verlags und Fallschirmjäger in der British Army. Seit 1986 widmet er sich vollständig dem Schreiben. Er ist erfolgreicher Radio- und Drehbuchautor, seine Kinder- und Jugendromane wurden in 15 Länder verkauft. Im deutschsprachigen Raum wurde er mit seiner historischen Romanserie «Legenden des Krieges» um den Schwertkämpfer Thomas Blackstone zur Zeit des Hundertjährigen Krieges bekannt.
Mehr zum Autor und zu seinen Büchern:
www.davidgilman.com
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «The Last Horseman» bei Head of Zeus Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Last Horseman» Copyright © 2016 by David Gilman
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karte © Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg, nach der Originalausgabe von Head of Zeus
ISBN 978-3-644-40459-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Suzy, wie immer
Und im Andenken an meinen Freund James Ambrose Brown, Journalist, Schriftsteller und Theaterautor
«Ein Krieg in Südafrika hätte überaus schwerwiegende Folgen … Er würde Zündstoff für weitere Konflikte bieten, die, wie ich glaube, selbst in Generationen kaum zu überwinden wären.»
Joseph Chamberlain, britischer Kolonialminister, im Jahr 1896
«Aber England darf nicht fallen; das würde sonst eine Überflutung der ganzen Welt mit russischen und deutschen politischen Entartungen bedeuten, die die Erde in ein finsteres Mittelalter und Sklaverei tauchen würden … Obwohl auf einem Irrweg – und es ist auf einem Irrweg –, muss England obsiegen.»
Mark Twain im Jahr 1900
Dublin, Irland
Dezember 1899 – Januar 1900
Kapitel Eins
Es war keine gute Nacht, um einen Mann zu hängen. Der Regen fegte über die Irische See und peitschte gegen die Mauern des Dubliner Gefängnisses Mountjoy. Im Innern des trutzigen Gebäudes standen zwei Wärter vor der Zelle des Verurteilten. Die Nummer des Raums war in eine kleine Metalltafel gestanzt: D1. Von der Zelle waren es kaum ein Dutzend schleppender Schritte über den Gang bis in den Hinrichtungsraum. Dermot McCann war siebenundzwanzig. Ein Schläger und Mörder, der sich weigerte, den Bastarden von Wärtern seine Angst zu zeigen. Die Beschwörungen des Geistlichen nahm er kaum wahr. Die Worte verhallten zwischen den kalten Gefängnismauern, als die Wachen ihm Handschellen anlegten. Sein Körper folgte einem Impuls des Widerstands, seine Armmuskeln spannten sich an.
Der ältere Wächter, der zu den wenigen gehörte, die ihn nicht als verfluchten Fenier beschimpft hatten, legte eine Hand auf seine Schulter. «Ist gut, Junge», sagte er leise. «Es hat keinen Zweck mehr.»
Ein unmerkliches Zögern noch, dann gingen sie durch die Zellentür und über den Flur, gefolgt von dem Geistlichen und einer kleinen Gruppe Beamter, die von Rechts wegen seinen Tod zu bezeugen hatten. Stimmen schallten aus einigen der Zellen, in denen ein halbes Dutzend weiterer Männer einsaßen.
«Was du getan hast, kann dir keiner nehmen, Dermot!»
«Du stirbst als Märtyrer, Dermot McCann!»
«Es ist ein Engländer, der dich hängt, Kumpel! Kein Ire würde das tun!»
Doch in einer der Zellen hockte ein junger Mann, die Knie an die Brust gezogen, den Rücken an die kalten Steine gedrückt, und zitterte vor Angst. Danny O’Hagan war keine siebzehn, und bald schon würden sie auch ihn nach D1 verlegen. Ihm fehlten der Mut und der Stolz, um einem derart gnadenlosen Tod gefasst entgegenzusehen, und das Schlurfen der letzten Schritte seines Mithäftlings presste ihm das Herz schmerzhaft zusammen.
Die Tür der Hinrichtungskammer schloss sich hinter McCann. Mit weit geöffneten Augen betrachtete er das hölzerne, schwarz gestrichene Podest und die gekalkten Steinwände. Der Raum, das Henkerhaus, wie sie ihn nannten, war ein enger, überdachter Hof; parallel verlaufende Balken spannten sich unter dem Dach von einer Giebelwand zur anderen. An ihnen waren Ketten befestigt, von denen das Seil herabhing. Neben dem Podest richteten die Zeugen der Hinrichtung im schwachen, flackernden Schein der Gaslaternen ihren Blick aufwärts, die Augen von den Krempen ihrer Hüte beschattet. Es waren ausschließlich Männer geladen, Polizeibeamte, Juristen und Gefängniswärter, außerdem einige Zivilisten, um seinen Tod zu beglaubigen.
Sein Begleiter hatte ihn, kaum dass es in sein Bewusstsein gedrungen war, zu der bewegungslos in der nasskalten Luft hängenden Schlinge bugsiert. Ein Trommeln, ein Todeswirbel schallte durch den Hof. Er blickte auf und in Richtung der Taktschläge, doch es war nur der Regen, der auf das Glasdach prasselte. Er zitterte, als der schwarz gekleidete Scharfrichter auf ihn zutrat.
«Die Kälte», sagte McCann. «Sonst nichts.»
Einer der Zeugen hatte bereits respektvoll seinen Hut gezogen und betrachtete den Verurteilten aufmerksam. Joseph Radcliffe war ein großer Mann mit einer gebrochenen Nase, strahlenden Augen und großen, von vielen Jahren auf dem Land gekräftigten Händen. Er trug das Haar kurz und war immer glatt rasiert. McCann suchte seinen Blick, um Mut aus Radcliffes Anwesenheit zu schöpfen, der ihn vor Gericht verteidigt, sein Leben aber nicht hatte retten können.
McCann erlebte einen kurzen Moment der Klarheit, doch die Worte, die sich in ihm formten – Gott segne Irland! –, erreichten seine Lippen nicht. Die schwarze Haube wurde ihm über das Gesicht gezogen, und er verschluckte die Worte, als er voller Angst um Atem rang. Rasch fand seine Panik ein Ende. Der Hebel wurde gezogen. Die Falltür gab unter ihm nach. Sein letzter Atemzug blieb ungehört unter dem Trommeln des Regens.
Die Gefängnisglocke von Mountjoy läutete und verkündete den erfolgreichen Vollzug der Hinrichtung.
Am anderen Ende der Stadt stand ein Mann im Gehrock am Fenster und schaute hinaus in das Unwetter. Benjamin Pierce, ein breitschultriger, gedrungener Mann mit grau meliertem Haar und dunkler Hautfarbe, hatte mit seinen neunundvierzig Jahren viel Grausamkeit und Elend auf zwei Kontinenten gesehen. Er wandte sich halb um, als ein hochaufgeschossener, sechzehnjähriger Junge den Raum betrat und hinüber zu dem wärmenden Kamin ging.
«Ist mein Vater noch nicht zurück?», fragte Edward Radcliffe.
Pierce holte seine goldene Taschenuhr aus der Weste, warf einen Blick auf das Ziffernblatt und drückte den Deckel zu. «Nein. Es dauert sicher noch.»
Pierce wusste, dass Radcliffes Sohn die gleiche Unruhe verspürte wie er selbst. Wenn ein Mann durch den Strang starb, begleiteten Joseph Radcliffe die Gespenster des Todes wie ein Schatten. Er betrat dann leise das Haus und zog sich in sein Arbeitszimmer auf einen Brandy zurück, den Pierce für ihn vorbereitet hatte, ebenso wie das Kaminfeuer, das den kalten Schrecken aus seinen Knochen vertreiben sollte. Wenn er sich verspätete, würden auch die Geister noch eine Weile im Exekutionshof von Mountjoy bleiben.
Kapitel Zwei
Der klare Tagesanbruch brachte frostige Luft mit sich, durch die das dröhnende Gebrüll eines Regimental Sergeant Majors schallte. Die in den Royal Barracks stationierte Dubliner Garnison war das Herz des britischen Militärs in Irland. Eine Kompanie Infanteristen marschierte im Takt der Kommandos. Den Rhythmus seiner Befehle unterstrich der Sergeant Major durch das Klicken seines Marschierstocks, dessen Messingspitze er exakt in der gewünschten Schrittlänge aufsetzte.
«Ihr seid Soldaten des Royal Irish Regiment of Foot! Keine Liebesdienerinnen, die den Arsch zusammenkneifen, damit das Höschen nicht runterfällt! Abteilung – kehrt! Links, links, links, rechts, links. Dreißig Zoll, die Damen! Dreißig Zoll pro Schritt, wenn ich bitten darf!»
Die Männer wurden bei ihrer Strafübung von ihrem Kompanie-Sergeant begleitet. Es war die Konsequenz einer nachlässigen Ausrüstungs- und Waffeninspektion, dass sie auf dem Exerzierplatz dem berüchtigten RSM Herbert Thornton ausgesetzt waren. Er stand in einem furchtbaren Ruf, und was noch schlimmer war: Er war Engländer. Ein großer Teil des Regiments bestand aus walisischen und irischen Soldaten.
«Ihr werdet in Südafrika gegen gottesfürchtige Niederländer kämpfen, und zwar in deren Hinterhof, und ihr werdet sterben wie Soldaten, nicht als der syphilisverseuchte Abschaum, der ihr seid!» Thorntons Stimme donnerte.
Irgendwo in den schwankenden Reihen flüsterte ein Infanterist seinem Kameraden zu: «Ich hätte gern alle Syphilis der Welt, wenn ich bloß das Vergnügen erleben dürfte, sie mir einzufangen.»
Der Aufmerksamkeit eines Regimental Sergeant Majors entging nichts. «Der da! Mulraney!» Der Marschierstock wies zielsicher auf einen Punkt in der Masse der Männer. «Sergeant McCory!»
Der Blick des Unteroffiziers folgte der Richtung, die der meistgefürchtete Mann des Regiments anzeigte. «Abteilung – halt!», gab er den Befehl.
Genagelte Stiefel knallten auf den Boden. Mulraney stand bewegungslos. Schweiß tropfte ihm von der Nase, der raue Uniformstoff scheuerte, und er wünschte inständig, dass er nie auf die Idee gekommen wäre, in die Armee einzutreten.
Vom Stall der Dubliner Garnison aus beobachtete ein Soldat die Disziplinarmaßnahme auf dem Platz. Er war nur mit einem Unterhemd bekleidet, wandte sich ab, hustete und spuckte in das dampfende Stroh. Dieser dumme Bauer Mulraney würde es nie begreifen. Wie konnte man so blöd sein, auch nur einen Mundwinkel zu verziehen und den leisesten Mucks von sich zu geben, wenn der RSM die Parade abnahm? Thornton konnte allein mit seinem Gesichtsausdruck Züge zum Halten bringen. Und er konnte aus tausend Metern Entfernung den Arsch einer Fliege zucken sehen.
Er harkte schmutziges Stroh aus dem Pferdestall. «Ich bin Infanterist in einem Infanterieregiment und räume hier deine Scheiße weg», sagte er zu der kastanienbraunen Stute und schob sie mit der Schulter zur Seite, um die durchnässte Einstreu zu entfernen. «Der Colonel wird auf dir reiten, und ich kann mir aus irgendeiner hinteren Reihe dein Hinterteil ansehen. Ist das vielleicht gerecht? Nu beweg dich mal, Mädchen, sonst gibt’s heute keinen Apfel für dich.»
Die Stute schnaubte freundlich und beschnupperte seine Tasche.
Weiter hinten im Halbdunkel des Stalls stand Edward Radcliffe vor einer anderen Box und wartete, während ein Stallbursche einen Fuchswallach für ihn sattelte. Als der Junge den Gurt anzog, blickte Edward über den Widerrist des Pferdes hinweg zu seinem Freund, der einige Jahre älter war als er. Lawrence Baxter sah geduldig zu, wie die Pferde vorbereitet wurden.
«Du klaust Äpfel in der Küche, Flynn, oder was?», fragte Baxter den Burschen.
Der setzte seine Arbeit unbeirrt fort und verlas mit den Zinken der Mistgabel das Stroh auf dem Boden. «Das mach ich, Lieutenant. Sie ist eine anspruchsvolle Stute, nicht? Wie alle schönen Frauen.»
«Und mein Vater sieht über solche Diebstähle hinweg? Es ist ein Dienstvergehen.»
«Bestimmt ist es das, Sir. Aber ich glaube, der Colonel hat ein kleines Problem mit seinem linken Auge. Er sieht nicht mehr gut, seit er in Indien diesen Schlag auf den Kopf bekommen hat.» Der Bursche führte Edwards Pferd durch die gepflasterte Stallgasse. «Heute wird gewettet, nicht, Lieutenant?», wagte Flynn zu fragen.
«Du bist ein frecher Nichtsnutz, Flynn. Ich frage mich, wie du dir in den ganzen Jahren das Wohlwollen des Colonels erhalten hast. Die königlichen Regularien verbieten Offizieren, mit anderen Dienstgraden zu spielen. Das weißt du.»
Flynn neigte bestätigend den Kopf. «Aber Sie sind nicht im Dienst, oder?»
Baxter schaute Edward an und grinste. «Willst du einen kleinen Einsatz wagen?»
«Gern, Sir», antwortete Flynn. «Der Colonel vertraut mir sein Pferd an, weil er weiß, dass es niemanden im Regiment gibt, der die Stute mehr liebt. Ich setze auf Mr. Radcliffe, vielen Dank, Lieutenant.»
Unversehens entfuhr Edward ein lautes Lachen, dann setzte er eine ernstere Miene auf, als Lawrence Baxter ihn mit gespielter Entrüstung ansah.
«Glaubst du, dass Master Radcliffe heute das bessere Pferd hat, Flynn?», fragte Baxter.
Flynn ließ die Forke ruhen und streifte getrockneten Pferdemist von seinen Stiefeln. «Nee, liegt nicht am Pferd, Mr. Baxter, Sir.»
Nach den Maßstäben der britischen Armee war sein Feixen geradezu unverschämt und eine Anmaßung, die ihm einen Strafmarsch mit voller Ausrüstung und hundertsechzig Schritten pro Minute auf dem Paradeplatz einbringen könnte, von dem noch immer die bellenden Befehle des RSM herüberschallten. Aber der junge Mr. Baxter war, anders als die gewöhnlichen Jungoffiziere, kein harter Hund. Der Sohn des Colonels war streng, kein Zweifel, aber unerfahren. Neu im Regiment, musste er noch Fuß fassen; der Alte dagegen griff, was Private Gerald Flynn betraf, umsichtig, aber unnachgiebig durch. Anscheinend hatte er sich den Burschen irgendwann zur Brust genommen und ihm erklärt, was es mit dem Abschaum auf sich hatte, der mit einem zwölf Zoll langen Bajonett am Gewehrlauf an seiner Seite kämpfen würde. Aber Flynn hatte noch viel zu lernen, und Lieutenant Lawrence Baxter war noch grün hinter den Ohren, was dem jungen Soldaten einigen Spielraum ließ, bis er irgendwann zu weit gehen und sich die verdiente Strafe einhandeln würde.
Baxter nahm dem Burschen die Zügel seines Pferdes ab. «Ich werde sicher das Vergnügen haben, dich deinen Einsatz verlieren zu sehen, Flynn. Da wirst du auf eine Menge Ale und eine Hure von der Harcourt Street verzichten müssen.»
Vom Paradeplatz war die Stimme des Sergeants zu hören. «Mulraney! Du bist wohl auf der Ha’penny Bridge aus deiner Mutter und gleich auf den Kopf gefallen! Über Weihnachten machst du Sonderwachdienst, du gottloser Idiot!»
Flynn zog sich in den Stall zurück. Wenn Sonderdienste verteilt wurden, ließ er sich besser nicht blicken. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die mit den Streifen im Abzeichen kannten Flynn als Drückeberger.
Baxter und Edward führten ihre Pferde über die gepflasterte Gasse nach draußen. Sie beobachteten die Kompanie, die eine Kehrtwendung vollzog und auf das andere Ende des Platzes zumarschierte. Ihre exakten Schritte, die Perfektion ihrer Wendung beeindruckten Edward. Für ihn waren diese Soldaten die besten der Welt.
«Ich wünschte, ich könnte dich nach Südafrika begleiten», sagte er.
«Um gegen ein Häufchen Farmer zu kämpfen?», fragte Baxter, der sich am Zaum seines Pferdes zu schaffen machte.
Die nüchterne Bemerkung seines Freundes versetzte seinen Vorstellungen von heroischen Taten einen Dämpfer. «Es sind mehr als fünfzigtausend, Lawrence. Sie haben letzte Woche in Colenso fünfhundert Mann von Harts Brigade abgeschlachtet!»
«Eine solche Woche wird sich nicht wiederholen. Hart ist ein mutiger Mann, aber er hat einen Fehler gemacht und seine Truppe schlecht geführt. Glaub mir, Edward, das Land ist so riesig, dass die fünfzigtausend darin verschwinden wie Ameisen in der Wüste. Es ist ein närrischer Krieg, und ich fürchte, wir werden gar nicht mehr zum Kämpfen kommen.»
«Dennoch … Es ist ein Abenteuer», erwiderte Edward hoffnungsvoll.
Baxter nahm die Zügel auf. «Es wird größere Schlachten als diese geben. Warte ein paar Jahre ab und beende deine Ausbildung. Dann kannst du deinen Vater bitten, seinen Einfluss geltend zu machen, um dich in der Royal Irish unterzubringen.»
«Mein Vater würde niemals seinen Einfluss nutzen.»
«Dann werde ich irgendwann meinen darum bitten. Wir werden zusammen dienen. Als Waffenbrüder. Wie wäre das?»
Vor den Toren versahen zwei Soldaten ihren Wachdienst und ließen die Blicke über die geschäftigen Straßenhändler und die Bettler schweifen. Scharen von Kindern bevölkerten die Szene und versuchten diverse Habseligkeiten an den Mann zu bringen. Die meisten waren Waisen, andere hatten Eltern, die im Gefängnis einsaßen. Die Kinder waren zerzaust, unterernährt und froh über jedes Almosen, das sie einen weiteren Tag in ihren heruntergekommenen Unterkünften überleben ließ. Die Wachen wussten, dass die fenischen Terroristen ein Straßenvolk wie dieses mit Leichtigkeit unterwandern konnten. Ein Straßenkünstler stieß mit seinem Stock einen Schwarzbären an, der einen Maulkorb trug und sich auf den Hinterbeinen aufrichtete – der schnelle, scharfe Schlag gab dem Tier einen Vorgeschmack auf die Heftigkeit, mit der es später in seinen Käfig zurückgeprügelt würde. Der Mann hielt die Kette, die durch den Nasenring des Tiers lief, während ein zerlumpter Junge in der Menge umherging und einsammelte, was er von den Schaulustigen ergattern konnte. Wieder ein Hieb mit dem Stock, und der Bär tänzelte unbeholfen, um auf seinen Hinterbeinen das Gleichgewicht zu halten. Würde ihm das misslingen, brächte es ihm einen weiteren schmerzhaften Schlag ein. Applaus und zustimmende Rufe wurden laut, die Zuschauer öffneten ihre Geldbeutel. Bei jedem Kunststück des gequälten Tiers klatschte und jubelte die Menge, bis ihre enthusiastischen Rufe im klappernden Rhythmus beschlagener Pferdehufe untergingen.
Ohne Zögern bahnten sich die Kavalleristen ihren Weg durch die Ansammlung und drängten die Menschen und den Tanzbären zur Seite. Der Offizier, der die Gruppe anführte – Captain Claude Belmont –, schaute weder rechts noch links, während er sein Pferd durch die protestierende Menge trieb, in exakter Formation gefolgt von zwei nebeneinanderreitenden Männerreihen. Als sie an den Wachen vorbei in den Hof der Garnison eingeritten und die schweren Flügel des Tors hinter ihnen zugeschwungen waren, verlief sich die Menge, hier und da wurden Flüche über die arroganten Engländer ausgestoßen.
Der Bärenbändiger zerrte das misshandelte Tier zu einem anderen, profitableren Platz.
Edward und Lawrence hatten die Stallungen noch nicht verlassen und beobachteten die plötzliche Unruhe, die die Ankunft der Kavalleristen auslöste. Als Belmont und seine Männer von den Pferden stiegen, hielt Edward den Atem an. Das Klirren der Zaumzeuge, das Knirschen von Leder und das Rasseln der Säbel vermischten sich und verliehen den Männern etwas Kriegerisches. Belmont sprang elegant vom Pferd, sein muskulöser Körper zeigte keinerlei Anzeichen von Erschöpfung nach dem vermutlich langen Ritt, der hinter ihm lag. Sein wettergegerbtes Gesicht zierte ein Schnauzbart, wie ihn die Regularien des Militärs seit drei Jahren zuließen. Doch während die meisten Offiziere ihre Bärte sorgfältig gestutzt trugen, hatte Belmont den seinen dick und buschig wachsen lassen und setzte sich damit selbstbewusst vom weichlichen Stil einiger Nachwuchsoffiziere ab. Spöttische Bemerkungen konterte er mit dem Hinweis, dass er sowohl bei der Gesichtsbehaarung als auch beim robusten Einsatz von Gewalt gegen den Feind ganz dem Vorbild des Stabschefs Lord Kitchener folge.
Lawrence Baxter hob die Hand, drehte sich zu Edward um und flüsterte: «Warte einen Moment, bis alle abgestiegen sind. Ich möchte mich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass ich keine Uniform trage und mit dir zusammen bin.»
Edward fügte sich der Bitte seines Freundes und verharrte still. Belmont stand im Halbschatten und sah in den schwach beleuchteten Stall. Einen erschreckenden Augenblick lang fühlte Edward seinen Blick auf sich und Baxter ruhen, bevor der Captain sich abwandte, als sei ihre Gegenwart von keinerlei Bedeutung, und auf die Offiziersmesse zuschritt. Der Kavallerie-Sergeant erteilte Befehle, und die Truppe stellte ihre Wachen auf.
Lawrence Baxter seufzte erleichtert. Zum ersten Mal nahm Edward wahr, wie sehr die unmittelbare Nähe der erfahrenen Soldaten seinen Freund beeindruckte und einschüchterte. Ihn selbst dagegen überlief ein Schauer der Erregung. Vor seinem inneren Auge sah er diese Männer Knie an Knie in großer Formation gegen einen furchterregenden Feind galoppieren und säbelschwingend dessen Reihen durchbrechen.
Als die Freunde mit ihren Pferden den Paradeplatz betraten, schenkte ihnen keiner der Soldaten weitere Beachtung. Es war nicht nötig. Ein einziger abschätziger Blick, der Edward traf, genügte ihm, um zu begreifen, dass er den Kavalleristen nicht mehr bedeutete als einem Pferd eine lästige Fliege. Die kühnen Männer hatten den riesigen Exerzierplatz im Handumdrehen eingenommen, und er war froh, durch das Tor hinaus in das offene Hügelland reiten zu können. Doch in seine Angst und Bewunderung mischte sich eine unerklärliche, schäumende Begeisterung.
Kapitel Drei
Einige Meilen nördlich der Stadt stand Joseph Radcliffe vor einem Grabstein. Bis er das Haus verlassen hatte, um hinaus zu dem kleinen Friedhof am Hang eines Hügels zu reiten, hatte man Dermot McCann bereits in einem anonymen Grab innerhalb der Gefängnismauern bestattet. Doch es musste kein Mann hingerichtet werden, um Radcliffe an seinen eigenen Verlust zu erinnern, und er machte sich jede Woche um die gleiche Zeit auf den Weg hierher, um vor der Grabstätte zu verweilen. Die Worte, die er formte, waren stets unhörbar, seine Schuld aber war, wie er glaubte, für jedermann offensichtlich. Nur wenige seiner Freunde wussten von seiner persönlichen Tragödie, und der wöchentliche Akt der Erinnerung auf dem windumwehten Hügel bot ihm genügend Abgeschiedenheit, um seinen Tränen freien Lauf zu lassen. Es war eine Schwäche, der er sich immer wieder zu widerstehen schwor, doch die Trauer wollte ihren Griff nicht lösen.
Schreie und Hufgetrappel rissen ihn aus seiner Versunkenheit. Die hügelige Landschaft mit ihren darüber verstreuten Waldstücken erlaubte ihm keine Sicht auf die Reiter, deren Stimmen aus der Ferne zu ihm herüberschallten. Mit ein paar Schritten ging er um den niedrigen Vorsprung herum, der das Grab schützend überragte, sodass er das zu seinen Füßen hingestreckte Tal überschauen konnte. Zwei Reiter näherten sich im Galopp, die jungen Männer waren tief über die Hälse ihrer Pferde gebeugt, rhythmisch trieben sie mit ihren Armen die schwitzenden Tiere an. Keiner der beiden benutzte eine Peitsche. Als er die Jungs erkannte, wollte er rufen, schon fuhr er mit dem Arm in die Höhe und griff nach seinem Hut, um sich bemerkbar zu machen. Doch er hielt inne, blieb ruhig stehen und beobachtete, wie Edward seinen Freund Lawrence um mindestens eine halbe Pferdelänge überholte. Der Anblick seines Sohnes, der so gekonnt ritt und sich in perfekter Harmonie mit dem Pferd bewegte, erfüllte ihn mit Freude, und er wünschte, seine Frau könnte diesen Augenblick mit ihm teilen. Der Kummer schnürte ihm das Herz zusammen, und still sah er zu, wie die Reiter aus seinem Blickfeld verschwanden. Er schaute noch einmal auf das Grab und ging zurück zu seinem Pferd. Es rupfte gemächlich an dem frischen Gras; vor Frost geschützt, wuchs es neben den Hecken aus Brombeergestrüpp, die die Ruhestätten umgaben. Den Toten konnte kein Leid mehr geschehen.
Er musste sich von den Erinnerungen an die Hinrichtung der letzten Nacht befreien und machte sich auf den Weg, um seinen Freund Lieutenant Colonel Alex Baxter zu treffen.
Eine Stunde später klapperten die Hufe seines Pferdes über das Kopfsteinpflaster eines Hofes, der dem irischen Landbesitzer Thomas Kingsley gehörte. Ein Mann mit schlitzohrigem Charme, der im Besitz von Informationen war, die sowohl für die britische Armee als auch für die irischen Nationalisten von Interesse waren. Niemand wusste, welcher Seite seine Loyalität wirklich galt. Der Pferdezüchter konnte jemandem einen Esel aufschwatzen und ihn beim Meilenrennen von Irish Oaks als dreijähriges Vollblut an den Start bringen. Mehr noch, er bestimmte den Ausgang des Rennens, das der Esel und sein zweitklassiger Jockey gewannen.
Radcliffe sah Kingsley und Baxter am anderen Ende des Hofes vor den Stallungen stehen, wo ein Bursche ein ungesatteltes Pferd am Halfter hielt. Baxter war ein hagerer Mann und einer der wenigen Berufsoffiziere, die nicht dem Adel angehörten. Er befehligte seine Soldaten mit Autorität, und die Disziplin, zu der er die Männer erzog, dankten sie ihm mit einer Loyalität, wie sie nur aus vielen Jahren gerechter Behandlung erwuchs. Sein Einsatz für das Wohlergehen der Truppe hatte ihm ihren Respekt eingebracht – und die Bereitschaft, ihm in die Schlacht zu folgen, sei sie noch so blutig oder aussichtslos. Nur unerfahrene Neulinge begingen den Fehler, von der schmächtigen Statur des Mannes auf seinen Charakter zu schließen. Missetäter bestrafte er streng, war aber nicht weniger mitfühlend angesichts von Leid und Elend. Ein Zug, den Radcliffe und Baxter teilten, die beide sinnloses Sterben verabscheuten. Wer den Krieg kannte, hasste ihn. Solche Gefühle aber konnten eine Offizierskarriere zerstören. Darin lag womöglich der Grund dafür, dass der achtundvierzigjährige Baxter nicht über den Rang eines Lieutenant Colonels hinausgekommen war und auch der Generalstab nie Anstalten unternommen hatte, ihn in seine Reihen aufzunehmen. Nicht dass sein Freund das überhaupt gewollt hätte, dachte Radcliffe. Stabsoffiziere waren einfach ein eigener Menschenschlag.
Die beiden Männer waren in ihre Unterhaltung vertieft, und Radcliffe, der ihre verstohlenen Blicke auf sich wahrnahm, überlegte, ob er sie bei einem eher persönlichen Austausch störte. Ein Stallbursche kam angelaufen und nahm Radcliffe die Zügel ab, der eine Münze in die schmutzige Hand des Jungen gleiten ließ.
«Mr. Radcliffe, Sie wollen mir doch wohl nicht meine Burschen verziehen? Sie werden von mir mehr Lohn fordern», sagte Kingsley.
Worüber die Männer auch gesprochen haben mochten, sie hatten ihr Thema rasch beendet. Radcliffe trat auf sie zu. Er schüttelte Kingsleys ausgestreckte Hand, dann die seines Freundes. «Kingsley. Alex. Ich bitte, die Verspätung zu entschuldigen.»
Kingsleys Haut war rau wie eine Hufraspel, ein Auge halb geschlossen, und von der Braue bis zum Jochbein verlief eine Narbe, die, wie manche erzählten, von einer Messerstecherei in seiner Jungend herrührte. Andere behaupteten, er habe sich in betrunkenem Zustand an einer Prostituierten vergriffen, die ihm einen Nachttopf auf dem Kopf zerbrochen und ihn niedergestreckt habe, wobei er mit dem Schädel auf einen metallenen Bettrahmen geschlagen sei. Welche Variante auch stimmte – alle Anekdoten verliehen dem großen Mann den Ruf der Gewalttätigkeit, so charmant sein Geschwätz auch sein mochte.
«Wir irischen Landbesitzer halten es mit unseren englischen Kollegen: Karge Löhne mäßigen die Wünsche eines Mannes.»
«Sorgen aber für unmäßige Verzweiflung», antwortete Radcliffe.
«So ist es, so ist es. Bleiben Sie ein bisschen und nehmen einen Drink, wenn der Colonel und ich unser Geschäft besiegelt haben?»
«Nein, vielen Dank. Ich habe einiges zu erledigen», erwiderte Radcliffe.
Kingsley grunzte. «Wie ich hörte, hat man letzte Nacht einen dieser fenischen Mistkerle aufgehängt. Hat er geschrien? Die meisten dieser dreckigen Mörder verlieren am Ende doch die Fassung. Sie scheißen sich in die Hose und rufen nach ihren Müttern.»
«Glauben Sie denn, dass man einen solchen Tod würdig sterben kann?», fragte Radcliffe herausfordernd.
«Ach, kommen Sie, Sie sind Soldat gewesen und haben einiges gesehen. Niemand stirbt mit Würde. Am besten sehen wir zu, dass wir diesen Abschaum loswerden, und gut ist’s.»
Radcliffe und Baxter wechselten einen raschen Blick. Lohnte es sich, mit dem raubeinigen Iren zu diskutieren?
Kingsley zögerte kurz und fügte nachdenklich hinzu: «Und der andere Bursche, der bald dran ist, O’Hagan … Der ist nicht viel älter als Ihr Sohn, oder?»
«Ich habe ein Gnadengesuch eingereicht», erklärte Radcliffe.
«Das heißt, dieses Stück Scheiße von einem Mörder kommt vielleicht davon?»
«Er ist noch ein Kind», sagte Radcliffe.
«Haben die Kerle etwa nicht einen anständigen Mann umgebracht?», polterte Kingsley, wandte sich ab und spuckte auf das Kopfsteinpflaster.
«Er ist noch ein Kind», wiederholte Radcliffe.
«Joseph, wie du weißt, möchte ich einige Pferde für den Feldzug kaufen», warf Baxter ein, der die Auseinandersetzung bereits eskalieren sah. «Ich habe mich noch nicht konkret entschieden, aber der hier scheint mir eine Schönheit zu sein.» Er wandte sich dem Tier zu.
Die meisten Pferde der Engländer wurden von irischen Händlern geliefert, und der Wallach machte einen guten Eindruck. Radcliffe nickte dem Stalljungen zu, der begann, das Pferd über den Hof zu führen. Er betrachtete die Gänge des Tiers und bemerkte, dass es sein Gewicht einseitig verlagerte. «Er scheint einen Sturz gehabt zu haben. Er ist nicht kräftig genug, um dich zu tragen, Alex.»
«Das wollte ich Colonel Baxter auch gerade mitteilen», meinte Kingsley mit einem Lächeln.
Baxter streckte Radcliffe die Hand hin, eine Geste stillschweigenden Danks. «Wir sprechen uns dann noch mal, Kingsley. Ich bin sicher, ich werde in Ihrem Stall noch das Richtige finden», sagte er und fügte hinzu: «Wir schauen mit Sachverstand und Sorgfalt, wenn ich mehr Zeit habe.»
Kingsley winkte einem Stallburschen, damit er Baxters Pferd über den Hof herbeiführte. «Ihre Interessen liegen mir sehr am Herzen, Colonel.»
«Und der Preis sollte der Qualität des Pferdes entsprechen», erwiderte Baxter. Er wandte sich Radcliffe zu. «Reitest du mit mir zurück?»
«Heute nicht, Alex», antwortete Radcliffe ohne weitere Erklärung.
Baxter stieg in den Sattel und nahm die Zügel auf. «Kommst du mit Mr. Pierce zum Regiments-Dinner? Ich erwarte euch.»
Radcliffe schwieg.
Baxter bemerkte sein Zögern. «Keine Ausreden, Joseph.» Er drückte die Absätze in die Flanken des Pferdes und verabschiedete sich mit einem Nicken.
Kingsley überquerte mit Radcliffe den Hof und hielt dessen Pferd am Zaum fest, als dieser aufsaß. «Sie sind ein komischer Kauz, Radcliffe. Ein Witwer aus Amerika mit einem schwarzen Kerl als Sekretär und einem Sohn, der reitet, als wäre der Teufel hinter ihm her, während sein Vater fenische Mörder verteidigt. Es gibt in dieser Gegend einige merkwürdige Leute. Schwer einzuschätzen, mit wem man es da zu tun hat.» Er ließ die Zügel los. «Passen Sie auf sich auf.»
Radcliffe fragte sich, ob das ein freundlicher Rat oder eine Drohung war. Er trieb sein Pferd an und brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass der Mann ihm nachschaute, bis er außer Sicht war.
Kapitel Vier
Benjamin Pierce saß an einem fein gearbeiteten alten Schreibtisch aus Eichenholz, dem der hundertjährige Gebrauch eine warme, honigfarbene Patina verliehen hatte. Radcliffe hatte einiges dafür ausgegeben, als sie in Dublin angekommen waren. Wie lange war das her? Ungefähr sein halbes Leben, wenn er sich richtig erinnerte. Er und Radcliffe waren noch junge Männer gewesen, als sie dem Krieg gegen die nordamerikanischen Prärie-Indianer den Rücken gekehrt hatten und in ein neues Leben aufgebrochen waren. Im Laufe eines Jahres in London hatte Radcliffe sich die Berechtigung zur Anwaltstätigkeit erworben, und sie wären wohl in der Metropole geblieben, wenn Radcliffe nicht einer Frau begegnet wäre, die sein Herz eroberte. Kathleen war schön, das musste Pierce zugeben. Er hatte seinen Freund davon zu überzeugen versucht, dass London ihnen bessere Möglichkeiten eröffnete. Und mehr noch. Die Briten hatten den Sklavenhandel abgeschafft, und Pierce zog als Schwarzer weniger Blicke auf sich als bei ihrer ersten Ankunft in Dublin. Doch Radcliffe folgte seinem Herzen und Pierce, wie immer, seinem Freund.
Die Kratzer und bestoßenen Kanten schmälerten den Wert des Eichentischs, doch Radcliffe hatte ihn trotzdem gekauft und zu viel dafür bezahlt, taub für Pierces Tadel, der ihn für einen Narren hielt. Sie besaßen kaum das nötige Geld, um die Kanzlei zu eröffnen, und ganz sicher keins, das sie für einen Schreibtisch in der Größe eines Bettes verschwenden konnten. Doch innerhalb eines Jahres füllte sich die weite Fläche aus gesägter, handpolierter Eiche mit Schriftstücken, die von roten Bändern zusammengehalten wurden. Die Ungerechtigkeit kannte keine Grenzen, und Radcliffe nahm sich der dringendsten Fälle an, die in der Regel, wenn überhaupt, nur geringe Einnahmen brachten. Landbesitzern und Ladeninhabern stellte er höhere Beträge in Rechnung, um die wirklich Bedürftigen unterstützen zu können. Jetzt aber, da er Fenier verteidigt hatte, blieben die Klienten aus. Glücklicherweise war die Miete für das Stadthaus für sechs Monate im Voraus bezahlt. Als Soldaten hatten Pierce und Radcliffe einige Entbehrungen ertragen, doch die nicht zu vertreibende Kälte und der konstant grau erscheinende irische Himmel, der ihnen immer wieder Überschwemmungen bescherte, machten das Haus abweisend und ungemütlich. Nach einigen Monaten hatten sie beschlossen, so sparsam wie möglich zu leben, und um die Rechnung des Kohlenhändlers begleichen zu können, befeuerten sie nur die Kamine im Wohnzimmer und in Radcliffes Arbeitsraum.
Pierces Finger ragten aus abgeschnittenen Handschuhen, als er nach einem Dokument griff; es war Radcliffes Gnadengesuch für den jungen Daniel Fitzpatrick O’Hagan. Die wortgewandt formulierte Bitte um Milde hatte das Ziel, ein Justizsystem zu überwinden, das für seine harten Strafen für Verbrechen gegen die Krone bekannt war.
Unten wurde eine Tür zugeschlagen. Pierce musste nicht zum Fenster gehen, um zu wissen, dass es die Haushälterin war, die ihrer Kündigung lautstark Nachdruck verlieh. Wer wollte es ihr übelnehmen? Das Geschmier auf der Haustür offenbarte eine Hassbotschaft: Tod den Finiern.
Hass konnte Pierce nachvollziehen, doch als jemand, der von einem gottesfürchtigen Presbyterianer und Anhänger der Sklavenbefreiung erzogen worden war, hatte er für eine Todesdrohung mit Schreibfehler nur Verachtung übrig.
Die Zelle D1 befand sich im Erdgeschoss am Ende des Flügels D; gleich gegenüber war das Henkerhaus. Eine kurze Entfernung zwischen Leben und Tod. Die Zelle war aus der Zusammenlegung zweier kleinerer Räume entstanden und geräumig, bot aber keinerlei Annehmlichkeiten, obwohl sie über zwei Feuerstellen verfügte. Zwei Wärter waren auf ihrem Posten. Sie versahen ihren Dienst in einem System von rotierenden Achtstundenschichten und wachten darüber, dass der Verurteilte nicht Selbstmord beging – und die Gesellschaft damit um ihre Rache betrog. Sie waren verpflichtet, dem Gouverneur über jede Äußerung des Gefangenen Bericht zu erstatten, doch Daniel O’Hagan hatte kein Wort gesprochen, seit man ihn in diese Zelle gebracht hatte. Sein Kopf war leer, sein Bewusstsein verloren in der Stille einer lähmenden Angst. Er erinnerte sich noch nicht einmal an das Vaterunser. Doch wenn es an der Zeit war, würde der katholische Seelsorger kommen und ihm die Beichte abnehmen; die beiden Wachen würden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Zelle aufstellen und nur das schwache Flüstern eines Jungen hören, der sich nicht vorstellen konnte, dass ihm sein eigener Tod bevorstand.
Die Wände des Direktionsbüros bestanden aus den gleichen weiß getünchten Steinen wie der Rest des Gefängnisses. In dem verzierten Kamin glomm ein spärlicher Haufen Kohle, und die Kargheit des Raums zeugte von der Bedürfnislosigkeit eines Mannes, der auf persönlichen Komfort verzichtete und sich auf das Nötigste beschränkte. Es gab keinerlei Dekoration, die die nüchterne Atmosphäre belebt hätte, keinen Teppich auf dem Boden, keine Kissen auf den beiden unbequemen Stühlen, die für Besucher vorgesehen waren. Der Gouverneur lud niemanden ein, länger zu bleiben.
Radcliffe konnte seinen Ärger kaum verbergen. Direktor Havelock, in Gehrock und mit Backenbart, war kaum auf die leidenschaftliche Bitte des Amerikaners eingegangen, O’Hagan wieder zurück in den Gefängnistrakt für jugendliche Straftäter zu verlegen.
«Sie haben kein Recht dazu, ihn in die Todeszelle zu sperren. Sein Fall ist in der Revision.»
Der Direktor war bekannt für seine faire, aber auch unnachgiebige Haltung. «Er ist zum Tode verurteilt.»
«Aber der Junge gehört dort nicht hinein. Die Zelle ist für Männer, die kurz vor der Hinrichtung stehen.»
Havelock zeigte weder Unmut noch Verärgerung; Radcliffes gut gemeinter Einwand war vernünftig. «Durch die Aussetzung seiner Hinrichtung hat er schon zusätzliche Zeit bekommen. Ich bestimme in dieser Sache. Ich werde keine Zusammenlegung mit einem Todeskandidaten zulassen. Die Vollstreckung wurde nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir sind keine Unmenschen. Habe ich mich jetzt klar ausgedrückt?», erwiderte der Gouverneur nicht unfreundlich.
Radcliffe merkte, dass er gegen die mächtige britische Bürokratie auf verlorenem Posten stand und seine Gefühle im Zaum halten musste. Er senkte seine Stimme. Es war wichtig, sich den Mann, der ihm den Zugang zu dem verurteilten Jungen verbieten konnte, nicht zum Gegner zu machen. «Ich bitte um Entschuldigung, Herr Direktor. Ich will ebenfalls nur das Beste für O’Hagans Wohlergehen.»
«Ich verstehe Ihre Sorge, Mr. Radcliffe, und hoffe, Sie verstehen auch meine.» Havelock rückte seinen Federhalter und die Schreibtischunterlage zurecht. «Gut, Sie sollen den Jungen sehen.»
Radcliffe wurde durch das Gefängnis geführt, an der geschwungenen Metalltreppe vorbei, die zu den drei oberen Zellentrakten führte. Jede Zelle hatte einen Eimer als Toilette, der jeden Tag von den Insassen geleert wurde. Das «Auskippen», wie sie es nannten, war der Grund für den immerwährenden Gestank aus einer Mischung von Urin, Exkrementen und karbolhaltigem Desinfektionsmittel.
Radcliffes Begleiter gingen vorweg durch den D-Flügel und öffneten die rote Tür der Todeszelle.
Daniel O’Hagan war nicht gerade ein heller Bursche, und Radcliffe konnte sich gut vorstellen, wie einfach es für Dermot McCann gewesen sein musste, ihn zu überreden, die Waffen zu verstecken.
«Sie können mich doch nicht für etwas aufhängen, was ich nicht getan habe», sagte er und beugte sich so weit zu Radcliffe über den Tisch, wie es die Wärter eben noch zuließen.
«Du warst dabei, als McCann den Polizisten getötet hat, einen Iren wie dich», antwortete Radcliffe.
«Ich hab aber nicht abgedrückt oder so», sagte der Junge. «Ehrlich, Gott ist mein Zeuge, ich hab’s nicht getan. McCann hat den armen Kerl erschossen und ihm obendrein noch ’ne Kugel durch den Kopf gejagt. Nimm sie, Daniel, hat er gesagt, nimm das Ding und versteck’s in deiner Wohnung. Das hab ich dann gemacht. Ich hab den Revolver genommen und ihn versteckt. Das ist alles, was ich getan habe, wirklich, Mr. Radcliffe.»
O’Hagan blickte über die Schulter zur Tür, hinter der sich das Seil des Henkers befand.
«Ich hab solche Angst, Sir. Ich guck jede Minute auf diese Tür und wünschte, ich wär ein blinder Bettler und könnte gar nichts sehen.» O’Hagan langte nach dem Blechbecher mit Wasser, der zwischen ihm und Radcliffe auf dem Tisch stand. Er schaute zu einem seiner Bewacher, der offenbar eingenickt war. Er brauchte beide Hände, um den Becher halbwegs ruhig an seine Lippen zu heben, trotzdem schwappte Wasser über.
Radcliffe streckte wortlos seine Hand aus und beruhigte das Zittern des Jungen. Der trank das ganze Wasser aus.
«Jesus, hab ich einen Durst», murmelte er und konnte die Verzweiflung in seiner Stimme nicht bändigen. «Die können das nicht machen, Mr. Radcliffe, das wäre nicht gerecht.»
Radcliffe würde die Hoffnung nie aufgeben, aber manchmal konnte die Wahrheit alle Zuversicht zunichtemachen. «Du warst der Komplize eines kaltblütigen Mörders, verstehst du das nicht?», sagte er leise.
Für einen Moment schien es, als sei ein Funke Realität im dumpfen Kopf des Jungen erglommen. Da rasselten Radcliffes Begleiter mit den Schlüsseln, standen an der Tür, bereit zu gehen. Radcliffe beugte sich vor und fasste den Jungen bei der Schulter. O’Hagan starrte auf den Tisch, die Handflächen auf der geschrubbten Fläche.
Als Radcliffe ging, hob der Junge den Kopf und sagte im Ton aufrichtiger Zuneigung: «Mr. Radcliffe, Sir, frohe Weihnachten für Sie und die Ihren.»
Radcliffe stand an seinem Tisch und suchte in den Prozessakten nach etwas, das er bei seiner Verteidigung des Sechzehnjährigen übersehen haben könnte. Es war eine sinnlose Suche, und das wusste er.
Pierce faltete ein Blatt Papier zusammen und klemmte es zwischen Fensterflügel und Rahmen, um das ständige Klappern zu unterbinden. Der Wind hatte auf Südost gedreht, und dunkle Wolken fielen über Dublin her, Regen prasselte gegen die Scheiben.
«Wir müssen oben wieder einen Eimer aufstellen wegen des verdammten Dachs», sagte er.
Edward hatte sich neben der verlöschenden Glut des Kohlefeuers in einen Sessel fallen lassen. Er hatte eine Frage an seinen Vater, und Pierce hatte bereits seine Vermutung darüber geäußert, wie dessen Antwort ausfallen würde.
«Mrs. Dalton ist gegangen – ohne schriftlich gekündigt zu haben», sagte Pierce.
«Wir brauchen eine neue Haushälterin», entgegnete Radcliffe.
«Das wäre dann die dritte dieses Jahr», warf Edward ein.
«Eine Köchin haben wir ja noch, so verhungern wir wenigstens nicht», fuhr Pierce fort. «Aber sie sagt, sie könne die Zumutungen nicht länger hinnehmen. Die gute Nachricht ist: Morgen habe ich ein Gespräch mit einer anderen Frau. Sie kocht und erledigt auch den Haushalt, so sparen wir ein Gehalt. Sie hat gehört, dass wir jemanden suchen. Die Zeiten sind hart, und diese Frauen vertrödeln keine Zeit. Sie schlug so verdammt laut an die Tür, dass ich schon dachte, es sei der Gerichtsvollzieher. Ihr Name ist Mrs. Lachlan, und sie sieht aus wie eine Bulldogge, die man auf einen Dornenstrauch gesetzt hat.»
«Wenn sie dich überzeugt, dann ist sie gut genug», sagte Radcliffe.
Pierce zuckte mit den Schultern. «Sie meinte, ich sei zu lange in der Sonne gewesen. Ob sie damit auf meinen Geisteszustand oder meine Hautfarbe angespielt hat, weiß ich nicht. In beiden Fällen hat sie wohl recht.» Er zog ein Blatt Papier aus den vielen, die auf dem Tisch lagen, und gab es Radcliffe. «Da ist noch ein Brief von dieser Mrs. Charteris vom Nothilfefonds für südafrikanische Frauen und Kinder.»
Radcliffe warf einen Blick darauf.
«Wie sollen wir jemanden finden, der hier arbeiten will, wenn du dich für die Fenier stark machst?», fragte Edward.
«Das Recht hat jetzt Vorrang vor bigotten Haushälterinnen», antwortete Radcliffe und richtete seine Aufmerksamkeit weiter auf den Bettelbrief einer Engländerin in Südafrika, die um Unterstützung für ihre unermüdlichen Anstrengungen bat, burischen Frauen und Kindern während des Konflikts beizustehen. «Woher wissen diese Leute von mir?», fragte Radcliffe seinen Freund, der ihm den Brief aus der Hand rupfte.
«Aus Zeitungen, woher sonst?», antwortete Pierce.
«Die Zeitungen berichten, du seist gegen diesen Krieg», warf Edward ein.
«Einige schreiben das», korrigierte Radcliffe und schubste sanft die Beine des Jungen von den Armlehnen, über die er sie gegrätscht hatte.
«Aber du unterstützt diesen Hilfsfonds», sagte Edward.
«Ich unterstütze britische Frauen, die anderen Frauen und ihren Kindern in ihrer Not helfen. Findest du das unpatriotisch?», fragte Radcliffe seinen Sohn. Er zeigte auf den Brief in Pierces Hand. «Bring ihn einer Zeitung, die bereit ist, ihn abzudrucken.»
«Aber trotzdem», sagte Edward in dem vergeblichen Anlauf, seinem Vater zu beweisen, dass er reif genug war, leidenschaftlichen Anteil an weltpolitischen Angelegenheiten zu nehmen. «Die Buren haben uns den Krieg erklärt.»
Radcliffe schenkte sich ein kleines Glas Sherry ein und bot Pierce die Karaffe an. Der schüttelte den Kopf. «Zugegeben, das war dumm genug. Aber ich fürchte, ihnen blieb nichts anderes übrig. Bankiers, Geldgeber und betrügerische Politiker haben diesen Krieg herbeigeführt. Das solltest du dir merken. So werden Reiche aufgebaut, mein Sohn, Schicksale begründet und Vermögen gemacht.» Er warf ein paar Späne Anmachholz in die Kaminglut und fand, dass deren Rauch weniger Wirbel machte als Edward mit seinem angeblichen Interesse an Politik. Er ahnte, was sein Sohn antworten würde, und kam ihm zuvor. «Und wenn ich schon dabei bin, alle Welt gegen mich aufzubringen, will ich dir noch sagen, dass du an dem Rennen nicht teilnehmen wirst.»
Pierce warf Edward einen Blick zu mit einem kaum verhohlenen Lächeln namens «Hab ich dir doch gleich gesagt». «Ich hab mein eigenes Kreuz zu tragen», sagte Pierce und verließ den Raum, bevor Edward ihn um Beistand bitten konnte.
«Es geht um hundert Guineen Siegprämie!», rief Edward außer sich, verärgert darüber, dass die Angelegenheit erledigt sein sollte, bevor er überhaupt seine Bitte aussprechen konnte.
«Und jeder, der denkt, es sei leicht verdientes Geld, will mitreiten», erwiderte Radcliffe.
«Lawrence Baxter sagt, ich kann eins seiner Pferde haben.»
«Junge, du bist ein guter Reiter, einer der besten –»
«Dann lass es mich versuchen», unterbrach Edward.
Radcliffe schüttelte den Kopf und nippte an seinem Glas. «Nein. Das Rennen ist brutal für Mann und Pferd. Du wirst nicht reiten. Das ist mein letztes Wort. Frag mich nie wieder.»
Edward sprang auf. «Du hast viel gefährlichere Dinge getan», empörte er sich.
Radcliffe beobachtete, wie die Späne Feuer fingen. «Und ich habe deiner Mutter versprochen, dafür zu sorgen, dass du da nicht mitmachst.»
«Ich kann das aber!»
«Nein, kannst du nicht. Ich zweifle nicht daran, dass du stark genug dafür wärst, aber diese Männer haben Freude an Gewalt.»
«Ich kann mich gegen sie behaupten», sagte Edward in einem letzten Versuch, seinen Vater umzustimmen.
Radcliffe sah ihn an und sagte mit ruhiger Strenge: «Nein.»
Es war eine ausweglose Situation: der zügellose Tatendrang eines jungen Burschen gegen die tief verwurzelte Liebe und Sorge eines Vaters. Edward schluckte Worte hinunter, von denen er wusste, dass sie seinen Vater verletzen würden. Ohne einen weiteren Versuch, ihn zu überzeugen, verließ er den Raum.
Radcliffe wusste nur zu gut, was den Jungen trieb. Resigniert wandte er sich wieder seinem Schreibtisch zu und begann, verschiedene Briefe und Dokumente durchzusehen, die neben den unbezahlten Rechnungen lagen, alles akkurat sortiert und gestapelt, wie es Pierces soldatischer Büroorganisation entsprach. Radcliffe war gerade dabei, aus der Korrespondenz ein Schriftstück herauszusuchen, das seine Stimmung etwas heben mochte, als er über sich etwas krachen hörte.
Er stieß die Tür zum Dachboden auf und sah, wie Pierce sich wieder aufrappelte. Ein Überseekoffer, der sich normalerweise oben auf dem Kleiderschrank befand, lag jetzt mit offenem Deckel auf den Dielen. In einer Ecke des Raums fing ein Emaille-Eimer unablässig tropfendes Wasser auf.
«Das war eine blöde Idee», sagte Pierce.
«Du hättest um Hilfe bitten sollen», schimpfte Radcliffe und zerrte den schweren Koffer in die Mitte des Raums.
«Ich hatte nicht vor, mir die Knochen zu brechen», entgegnete Pierce und zog daraus zwei sauber zusammengelegte Uniformen der Union Army hervor. Er faltete sie auseinander und reichte eine seinem Freund.
«Ich glaube, ich hatte schon schlechtere Einfälle», befand Radcliffe, hielt sich die Uniform vor die Brust und stellte sich vor den fleckigen Spiegel des Kleiderschranks.
«Aber nicht in den fast dreißig verdammten Jahren, die ich dich kenne», widersprach Pierce.
«Na ja, ich weiß nicht, da gab es einige.»
«Das waren nur dumme Ideen, weil du unser Leben aufs Spiel gesetzt hast; dies ist eine dumme Idee, weil sie uns wie Idioten aussehen lässt. Wir sind schließlich keine Kinder mehr.» Pierce versuchte, seine Uniformjacke zuzuknöpfen, aber es waren zu viele Jahre vergangen, seit er sie zuletzt getragen hatte. Radcliffe zog seinen Bauch ein.
«Ich glaube, ich schaff’s.»
«Eher kriegen Cinderellas Schwestern ihre Ärsche in den gläsernen Schuh gequetscht», sagte Pierce verächtlich und warf seine Jacke zurück in den Koffer.
«Dann gehen wir eben nicht», sagte Radcliffe und gab sich geschlagen.
«Und beleidigen sie? Diese Einladung ist ein verdammtes Privileg, und wir müssen jetzt da hin. Du hast uns doch schon angemeldet. Und du solltest dich besser beeilen und zu O’Rourke gehen.»
«Zu wem?»
«Dem Schneider. Er ist dir was schuldig. Verflucht. Ich habe solche Feiern schon in meinem eigenen Regiment nicht ertragen können, geschweige denn in einem anderen.»
Radcliffe faltete sein Jackett zusammen. «Du wirst langsam ein mürrischer alter Kauz.»
«Wenn ich wenigstens alle Jubeljahre mal die Sonne sehen würde, wäre ich fröhlicher.» Pierce zog einen verstaubten Nachttopf aus einem Haufen Gerümpel und stellte ihn unter eine neue Tropfstelle. «Noch was anderes: Lass den Jungen reiten.»
«Verbündet euch bloß nicht gegen mich», sagte Radcliffe.
«Du hast ihn schon in den Sattel gesetzt, als er nicht einmal laufen konnte!»
«Und sie hat mir dafür die Hölle heißgemacht!»
Pierce atmete tief ein. Ihre Freundschaft hatte schon einigen Streit erlebt, aber in Radcliffes Familie war Pierce oft der Friedensstifter. «Er ist ein junger Mann – er will’s dir beweisen, Himmelherrgott. Nimm ihm nicht die Luft zum Atmen, Joseph. Als wenn die Welt das nicht schon früh genug tun würde.»
Radcliffe war unnachgiebig. «Schluss mit der Debatte, Ben.»
Pierce fummelte an einer goldenen Tresse der Uniform herum und warf sie dann beiseite. «Und wie lange, denkst du, können wir beide die Lüge über seine Mutter noch aufrechterhalten?», fragte er vorsichtig.
Das war eine Frage, die nur selten Gegenstand von Diskussionen war, und eine, auf die es nie eine zufriedenstellende Antwort geben würde.
«Solange es geht», erwiderte Radcliffe. «Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich schon tot, wenn er eines Tages die Wahrheit herausfinden sollte.»
Sie schwiegen. Pierce hob die alte blaue Uniform auf. Es führte zu nichts, weiter in Radcliffes Wunde zu bohren. Er seufzte. «Vielleicht sterbe ich ja vor Peinlichkeit auf diesem verdammten Tanzball und muss mich nicht mehr ständig rechtfertigen.»
Drei Tage später nieselte leichter Regen durch die gelblichen Dunstschleier der Gaslampen. Ein schlecht gekleideter Mann ging zielstrebig durch die von Mietshäusern gesäumten Straßen; er versuchte gar nicht erst, den Kragen seines knappen, abgewetzten Mantels enger zu ziehen. Die Regentropfen rannen ihm den Nacken hinab, was er auch unternahm. Arm zu sein härtete ab, aber Armut unter britischer Knute war für Cavan Leahy schlimmer, als lebendig begraben zu sein.
Er achtete darauf, keinem der Polizisten zu begegnen, die hier Streife gingen und deren Leben bedroht war, heute wie seit über hundert Jahren der Gewalt, durch Meuchelmörder und Leute mit blankem Hass auf die Obrigkeit. Die Gaslampen sorgten nur für schwache Beleuchtung in den nebeligen Durchgängen, in denen der Regen das dürftige Licht der Polizeilaternen vollends wirkungslos machte. Jede Nacht ab neun Uhr drehten die Streifen ihre Runden auf den Hauptstraßen. Um elf, wenn die Wirtshäuser schlossen und die Pferde-Omnibusse nicht mehr fuhren, kehrte auf den Straßen gewöhnlich eine unheimliche Stille ein. Leahy schlich um die Hausecken und dankte dem Himmel, dass die fenischen Brüder stets wussten, wo sich die Polizei aufhielt. Jeder Constable führte ein Buch mit sich, in dem seine spezielle Runde vorgezeichnet war. Und es gab unter den Uniformierten genug Patrioten, die solche Informationen weitergaben.
Eine halbe Stunde später war er allein in einem Zimmer eines der Slumhäuser. Jeder Raum entlang des Flurs, den er hinuntergegangen war, maß nicht mehr als zehn mal zwölf Fuß und beherbergte bis zu einem halben Dutzend Menschen, Erwachsene und Kinder, die das Mietshaus in der Rangordnung ihres Elends gemeinsam nutzten. Der saure Geruch von gekochten Kartoffeln und Kohl vermischte sich mit dem ekelerregenden Gestank aus einem leeren Raum, den alle als Toilette benutzten. Leahy saß an einem wackeligen Tisch und tunkte steinharte Brotrinden in wässrigen Haferschleim. In Reichweite lag ein gestohlener Webley-Revolver der britischen Armee. Obwohl die dürftige Mahlzeit heute seine einzige war, schlang er sie eilig herunter und warf den Blechteller auf den Boden. Es gab dringendere Dinge zu tun, als zu essen. Neben dem Revolver lagen ein halbes Dutzend Dynamitstangen. Leahy zog den Stummel einer selbstgedrehten Zigarette hervor, steckte ihn an und ließ ihn zwischen den Lippen qualmen. Außer einer kleinen Flasche Whisky war der Tisch leer.
Er hörte Schritte im Treppenhaus, schnappte sich den Revolver und entsicherte ihn. Ein Mann öffnete die Tür, zögerte und riss schützend eine Hand hoch. «Jesus, Cavan!», blaffte Pat Malone. Groß und stämmig, überragte er den zerbrechlich wirkenden Leahy um Haupteslänge.
Leahy senkte die Waffe, als Malone eine Rolle Zündschnur auf den Tisch knallte.
«Du blöder Hund. Ich hätte mir vor Schreck fast in die Hose geschissen. Ich dachte, du wärst noch nicht hier. Ist das das Zeug, das du haben wolltest?»
Leahy grinste Malone an und griff nach dem Geschenk. Er schnitt ein Stück von der Schnur ab, hielt es an die schwache Zigarettenglut und warf es auf den Boden. Es zündete sofort und brannte schnell ab. Er nickte zufrieden. Genau so eine schnelle Zündschnur hatte er angefordert.
Leahy sah Malone dabei zu, wie er die Flasche leerte. Der schluckte und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. Aber auch eine volle Flasche hätte nicht gereicht, seine Angst zu bezwingen. In den letzten dreißig Jahren hatte es keine schweren Anschläge der Irischen Republikanischen Bruderschaft mehr gegeben. Es war Zeit, das zu ändern. Er senkte seine Stimme. «Regimentsoffiziere und eine Kompanie zur Standortsicherung. Die Ersatzbataillone sind noch auf den Schiffen. Es gibt Nebel, und der hält sich ein paar Tage. Wir werden sie wie die Ratten im Sack haben. Jetzt oder nie. Morgen Nacht. Die anderen sind bereit.»
«Bist du sicher, dass wir an die Waffenkammer rankommen? Kann man deinem Informanten trauen?», fragte Leahy.
«Ja klar, wie der Bank von England.»
Das Bordell bestand aus zwei Geschossen über einem kleinen Varieté. Für den gemeinen Soldaten war dieser Ort verboten. Schwarzmarkthändler und Geldwechsler mischten sich unter junge aufstrebende Offiziere. Für viele war die britische Herrschaft einträglich, und obwohl ihre Herzen leidenschaftlich für die Selbstbestimmung schlugen, liefen die Geschäfte wie gewohnt weiter, und Varieté und Hurenhaus waren ein guter Ort, sie zu betreiben. Vor über dreißig Jahren hatte hier Nellie Clifden den Prince of Wales verführt, als er bei den Grenadier-Gardisten im Curragh Camp diente. Junge Offiziere und Huren. War das was Neues?
Im Gleichschritt mit den Mädchen, die, begleitet von einem Geigenspieler und einem Klavier, mit ihren Stiefeln auf die dünnen Bretter der Bühne stampften, stieg Sheenagh O’Connor die Holztreppe von ihrem zugigen Dachbodenzimmer herunter. Wie viele andere Prostituierte kam sie vom Land. Das Leben dort war hart geworden, und ihr war keine andere Wahl geblieben, als nach Dublin zu gehen und mit dem, was sie konnte, so viel wie möglich zu verdienen. Die Armut hatte jeglichen Anstand weggewischt, den man ihr als Kind eingetrichtert hatte. Als hübsche achtzehnjährige Analphabetin hatte sie bald gelernt, dass ein Lächeln und Bereitwilligkeit mehr einbrachten, als in der Sackville Street oder an den Toren des Phoenix Parks Blumen zu verkaufen. Einheimische Frauen richteten Bordelle ein und lockten Landmädchen wie Sheenagh mit Unterkunft und Verpflegung. Mrs. Sullivans Etablissement hier in der Gloucester Road im Monto-Viertel war die erste Wahl für Offiziere, die in den verschiedenen Kasernen rund um Dublin stationiert waren. Schon seit drei Jahren übte Sheenagh ihr Gewerbe unter Mrs. Sullivans Dach aus und hatte genug gelernt, um aus dem, was sie sah und hörte, Profit zu schlagen.
Die Huren wurden von den meisten der Offiziere ebenso wenig wahrgenommen wie Diener. Wenn die Musik spielte und der raue Whisky ihre Zungen bis zur Unbesonnenheit lockerte, führten sie beiläufige Gespräche darüber, wer womit beschäftigt war. Die Mädchen, die sie dabei streichelten, hatte das nichts anzugehen. Aber solche Informationen waren wertvoll für die verwegenen und verzweifelten Männer, die in ihren umstürzlerischen Plänen für irgendeine Utopie vollkommen aufgingen. Sollten sie doch rumschwätzen und Dummköpfe bleiben, früher oder später würden etliche von ihnen feststellen, dass ihre Utopie am Strang endete.
Sheenagh wusste sehr wohl, dass sie sich auf gefährlichem Terrain bewegte, und wenn irgendjemand etwas ausplauderte, musste sie mit dem Schlimmsten rechnen: Henkers Schlaufe oder Feniers Messer. Ein Mann hatte sie bezahlt – ein Mann, der bereits in der Vergangenheit mehr als großzügig gewesen war – und ihr zugeflüstert, welche Informationen sie den Attentätern geben sollte. Sie hatte darauf spekuliert, dass derart entschlossene Leute bei einem Anschlag auf eine Garnison niemals geschnappt würden. Ein dummer Fehler. Früher oder später würde eine der beiden Seiten die Spur zu einer gewöhnlichen Hure zurückverfolgen können. Zeit abzuhauen, hatte sie sich gesagt, als sie in einer kalten Nacht voller Bedauern ihr weniges Geld gezählt und so viele Kleidungsstücke und Schuhe wie möglich in einen Koffer gezwängt hatte. Die Royal Irish schifften sich ein, und sie wollte mit.
«Sheenagh!», rief eines der Mädchen ihr auf der Treppe hinterher. «Wo zum Teufel willst du hin? Komm wieder rauf, bevor Mrs. Sullivan was merkt. Sie wird ihre Jungs auf dich ansetzen.»
Sheenagh drehte sich zu ihrer Kollegin um. «Hier ist nichts zu verdienen, Kath. Auf die Soldaten kommt’s an, und die gehen alle von zu Hause weg.»
Das Mädchen schaute sich nervös um. Die Musik würde ihre Stimmen nicht mehr lange übertönen. «Du gehst doch nicht etwa nach Scheißafrika? Zu den verdammten Heiden?»
Aber ihre Freundin war schon durch die Hintertür verschwunden.
«Sheenagh!»
Die Musik war zu Ende. Applaus und Beifallsrufe drangen laut bis ins Treppenhaus. Kathleen O’Riordan hatte eine anstrengende Nacht vor sich. Nur kurz kam ihr die Frage in den Sinn, woher ihre Freundin das Geld für eine Schiffsfahrkarte hatte.
Kapitel Fünf
Die Räume der Kavalleristen in den Offiziersunterkünften der Royal Barracks waren spartanisch, aber durchaus bequem eingerichtet. Der Holzfußboden und die vertäfelten Wände spiegelten nur schwach den Widerschein der Petroleumlampe auf dem kleinen Tisch am Fenster, von dem aus man den Exerzierplatz überblickte. Neben dem Feldbett, auf dem Claude Belmonts Uniform der 21. Dragoner ungefaltet herumlag, stand ein Paar geputzter Stiefel nahe dem Wandhaken, an dem ein Kavalleriesäbel in seiner Scheide hing. Ein auf Hochglanz polierter Sattel lag umgedreht auf dem Boden. Dahinter stand der Offiziersbursche in Habtachtstellung, die Hände fest an der Hosennaht, das Kinn leicht erhoben. Er achtete darauf, Belmonts Blick nicht zu begegnen. Belmont, halb bekleidet, die Hosenträger über dem Unterhemd, nahm einen Schluck Brandy aus einem silbernen Flachmann. Er blickte auf den Sattel, den er auf den Boden geworfen hatte, und sah den Offiziersburschen an. Schweißflecken unter den Achseln, das Haar vom Militärbarbier zur Bürste geschoren. Für Belmont bestand kein Zweifel daran, dass die einfachen Soldaten mit ihrem Mangel an Strebsamkeit und Ehrgeiz zu wenig mehr taugten als zu Bauern.
«Nicht gut genug. Putz ihn noch mal», sagte er und wandte den Blick ab.
Zum dritten Mal an diesem Abend schleppte der Mann den Sattel des Captains aus der Stube, um ihn zu wichsen, obwohl ihm schleierhaft war, wie er ihm noch mehr Glanz verleihen sollte. Er zweifelte nicht daran, dass Offiziere wie Belmont so aggressiv waren, weil sie ihren höheren Rang demonstrieren wollten. In Gottes Namen mochte bald eine Kugel der Dutchies oder eine britische dieser Arroganz ein Ende machen.
Belmont nahm einen weiteren Zug aus der Flasche. Die räumliche Enge machte ihm zu schaffen. Kavalleristen waren nicht wie andere Soldaten. Eine angeborene Energie verlieh Männern wie Belmont ein stürmisches Draufgängertum, das sogar, wie er zugeben musste, den gewöhnlichen Soldaten seiner Truppe zu eigen war. Viele seiner Männer hatten sich nach Ablauf ihrer Dienstzeit weiter verpflichtet, den Feind niederzureiten und mit Karabiner und Säbel Angst und Schrecken zu verbreiten.
Er hatte ein kaltes Abendessen gewählt, es aber kaum angerührt. Das Kasernenleben schmeckte ihm nicht; er hatte Hunger auf Krieg.
Benjamin Pierce hatte seine breite Brust und Schultern nie eingebüßt. Er war geboren worden, neun Jahre nachdem Sklaven die USS Creole übernommen hatten. Das Schiff hätte sie von Virginia nach Louisiana bringen sollen, doch die Sklaven segelten zum britischen Hafen von Nassau und erlangten ihre Freiheit. Diese Geschichte hatte man ihm schon als Kind erzählt, und die Sehnsucht, erlöst zu werden von der Arbeit auf den Baumwollfeldern, wo er geboren war, hatte ihn geleitet wie der Stern, der dieses Schiff in die Freiheit geführt hatte. Als Junge hatte er Baumwollballen und Kornsäcke schleppen müssen, und mit vierzehn war er ein großer drahtiger Bursche von fast sechs Fuß, mit einem größeren Durchhaltevermögen als viele ältere Männer. Die Sklaverei war für ihn Monate vor dem Ende des Bürgerkriegs vorbei gewesen, als die verbitterte Frau des Plantagenbesitzers ihn in eine erzkonservative Missionsschule schickte, wo die Lehrer die Energie des stillen Jungen aufs Lesen, Schreiben und das Studium der Heiligen Schrift lenkten. Die Peitschenhiebe, die er sich einhandelte, als er sich in die junge Tochter des Predigers verliebte, waren eine quälende Erinnerung an die aggressive Behandlung durch die Sklavenhalter. Daraufhin trat der junge Benjamin Pierce der Union Army bei, nachdem er ein bisschen geflunkert hatte, was sein Alter betraf. Im April 1865 ergriff der erst fünfzehnjährige Junge den schweren Schaft seines Gewehrs und stürmte gegen die Linien der Konföderierten in der Dritten Schlacht von Petersburg, dem letzten großen Gemetzel des Krieges.
Vierunddreißig Jahre später betrachtete er sein Spiegelbild im Fenster des Dubliner Stadthauses. Er trug seine alte zweireihige Ausgehuniform für Offiziere, die jetzt umgeändert war auf seine angewachsene Leibesfülle. Mochte sein Bauch im Alter auch dicker geworden sein, dem Eindruck seiner breiten Schultern konnte das nichts nehmen. Der dunkelblaue Wollstoff hatte ein glänzendes schwarzes Innenfutter, und die vierzehn Messingknöpfe waren jetzt wieder blitzblank. Die goldenen Schulterstücke verrieten sein Regiment, die silbernen Querstreifen seinen Rang. In kleinen Schlucken trank Pierce ein Glas Portwein. Die Wärme des Feuers milderte die Erinnerung an die harten Kämpfe zu einer eher wehmütigen Betrachtung dessen, was in den wilden Tagen des Krieges wirklich geschehen war.
Edward betrat den Raum und blieb stehen, als er den engsten Freund seines Vaters in voller Militäruniform sah. «Ben, Vater sagt, die Kutsche ist in ein paar Minuten da.» Er ging auf den düster blickenden Mann zu und betrachtete das dünn gerahmte Foto eines Kavalleristen. «Bist du das?»
«Jaja, hab’s vor ein paar Tagen in ’ner alten Kiste gefunden.»
«Ist das aus dem Bürgerkrieg?», fragte Edward, griff nach dem Foto und musterte den jungen schwarzen Mann, der ihn aus dem Bild heraus ansah, dreckig und zerrauft vor einem Bau, der wie ein Fort im Wilden Westen aussah.
«Jetzt mag ich für dich älter aussehen als Methusalem, aber damals war ich eigentlich noch viel zu jung für all das, was in diesem Krieg passierte. Und das Foto ist nicht lange danach entstanden.» Er füllte ein kleines Glas mit Portwein und reichte es Edward. «Am 6. August 1866 wurde auf Befehl von General William T. Sherman, Kommandant der militärischen Abteilung Mississippi, die zehnte Kavallerie gegründet.» Er stieß mit dem Jungen an.
«Du und mein Vater.»
«Ein wenig später, ja. Es gab nicht viele weiße Offiziere, die bei farbigen Regimentern dienen wollten.»
«Er hat mir nie was aus der Zeit bei der Army erzählt, verstehst du das?»
Pierce nahm das Bild und stellte es zurück auf den Kaminsims. «Einige Männer halten den Krieg durch, überleben ihn und werden gerade deshalb bescheiden und demütig. An das meiste will man sich gar nicht erinnern.» Der alte Soldat schenkte sich nach.
«Hast du ihn gefragt, ob ich beim Rennen mitreiten darf?», fragte Edward.
Pierces Kopfnicken war Edward Antwort genug. Mit kühner Miene stürzte er den Portwein hinunter.




























