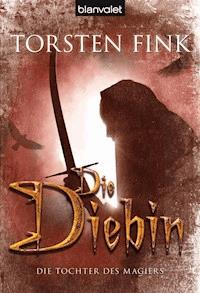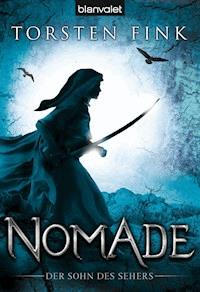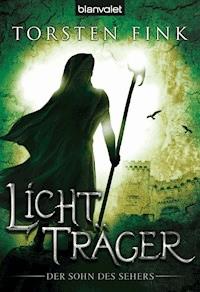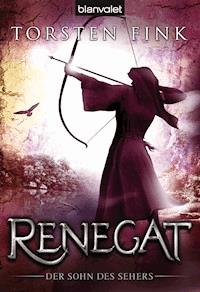9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schattenprinz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Assassine ohne Erinnerung …
Er hat alles vergessen. Er erinnert sich nicht einmal daran, wie er heißt. Doch eines wird dem Namenlosen rasch klar: Der, der er einst war, will er nicht mehr sein. Denn er verfügt über die Fähigkeiten eines Assassinen, und die Vorstellung, jemanden zu ermorden, ist ihm zuwider. Bei den Nachforschungen über seine Herkunft stößt er immer wieder auf eine Gemeinschaft von Mördern, deren Name nur mit Schaudern geflüstert wird – die Bruderschaft der Schatten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Torsten Fink
DERPRINZ
DERSCHATTEN
Roman
Originalausgabe
Apei Ludgar hatte seinen Hut vergessen. Er stand auf der Mitte der Herzogsbrücke, blickte mit verkniffener Miene in den Regen, der schon während der halben Nacht über der Stadt niederging, und Wasser rann ihm kalt aus den Haaren in den Kragen. Die Huren… er hatte den Hut im Hurenhaus vergessen, weil der Regen, gerade als er das Rote Haus so beschwingt verlassen hatte, einen Moment lang ausgesetzt hatte. Der Vollmond war sogar für eine Weile hinter den Wolken hervorgekommen und hatte die Stadt in bleiches Licht getaucht. Aber dann hatten sich die Wolken wieder geschlossen, und jetzt stand Apei sich in Regen und tiefer Finsternis die Beine in den Bauch und wartete. Vielleicht sollte er zurückgehen, wenn das Geschäft erledigt war, nicht nur wegen des Hutes. Aber die Frage war, ob im Roten Haus dann noch jemand wach sein würde. Andererseits– seine Frau würde nach dem Hut fragen. Sie fragte ihn schon gar nicht mehr, wo er die Abende verbrachte, vermutlich, weil es ihr gleich war, aber nach dem Hut, nach dem würde sie fragen.
Apei Ludgar spuckte missmutig in den Bach, der, angeschwollen vom tagelangen Herbstregen, unter der Steinbrücke hindurchtoste. Wenn das Geschäft heute zum Abschluss kam, konnte er sich jede Menge neue und bessere Hüte kaufen. Natürlich würde er die Stadt verlassen müssen, denn man würde bald viele Fragen stellen. Er würde im Süden ein neues Leben anfangen, auf Inseln ohne Regen, und ohne seine Frau– ein Gedanke, der ihm gefiel. Er ging ein paar Schritte auf und ab. Warum nur hatten sie als Treffpunkt die Mitte der Brücke vereinbart? Hier gab es nichts, wo man sich hätte unterstellen können, außerdem schützte nur die Nacht vor neugierigen Blicken. Auf der Neustadtseite der Brücke gab es einen Verschlag. Für gewöhnlich saß dort eine Wache, aber in dieser Nacht nicht, dafür hatte er selbst gesorgt. Apei Ludgar zog es zum wiederholten Male in Erwägung, hinüberzugehen und in diesem Unterstand zu warten, aber er hatte einfach zu viel Angst, seine Verabredung zu verpassen. Er hatte seinen Teil erfüllt, und nun wollte er der Gegenseite unter keinen Umständen einen Vorwand liefern, ihn nicht zu bezahlen. Er nieste. Wasser war durch die Nähte seiner alten Stiefel eingedrungen, und jetzt hatte er nasse Füße. Das Gehalt eines Verwalters in einer so armen Stadt wie Atgath war bescheiden. Neue Stiefel würde er sich ebenfalls machen lassen, wenn er endlich, endlich bekommen hatte, was er sich so mühsam verdient hatte.
Er drehte sich um und zuckte erschrocken zurück. Wie aus dem Boden gewachsen stand eine große, dunkle Gestalt vor ihm, keinen Meter entfernt: ein Mann, ein wahrer Hüne. Apeis Herz setzte einen Schlag aus, und dann pochte es schnell und furchtsam. Der andere überragte ihn um mehr als einen Kopf, und der Regen schlug Apei ins Gesicht, als er zu ihm aufblickte. Er kniff die Augen zusammen, aber er konnte nicht mehr sehen als einen dunklen Umriss in der Nacht.
»Wer…? Ich meine, Ihr seid nicht… Wo ist Ensgar, der Einäugige?«, stotterte Apei.
»Habt Ihr getan, was vereinbart war, Apei Ludgar?«, fragte der Fremde.
»Natürlich, natürlich«, beeilte sich Apei zu versichern. Er wagte nicht noch einmal zu fragen, wo der andere war, der, der ihm sonst immer die geheimnisvollen Befehle überbracht hatte. Der finstere Einäugige erschien ihm jetzt bedeutend harmloser als dieser Hüne. »Seht Ihr hier eine Wache, Herr? Nein, denn ich habe dafür gesorgt, dass sie andernorts ihren Dienst verrichtet.«
»Und in der Burg?«
»Ebenso, Herr, ebenso. Die Mauern sind nicht besetzt, nur die Tore, und mehr könnt Ihr nicht verlangen, Herr, denn wenn niemand an den Toren wäre, das würde doch auffallen.«
»Wir haben auch nicht mehr verlangt.«
»Natürlich nicht, Herr. Ich wollte nur sagen, dass ich mich an unsere Abmachung gehalten habe, Herr, mehr nicht, mehr nicht«, sagte Apei und bemerkte, dass er plapperte. Er versuchte seine Furcht zu unterdrücken, aber es gelang ihm nicht.
»Das war klug von Euch, Verwalter.«
Apei Ludgar fand, dass dieses Lob nicht so beruhigend klang, wie er es erwartet hätte. Er wünschte, die Wolken würden aufreißen, den Mond hindurchscheinen lassen und ihm endlich einen Blick in das Gesicht seines Gegenübers erlauben. »Ich habe eine Menge auf mich genommen, Herr«, stieß er hervor.
»Ihr seid gut bezahlt worden«, kam es kalt zurück.
»Und doch habe ich nichts von dem schönen Silber, wenn man mich in den Kerker wirft, Herr.«
»Das wird nicht geschehen«, sagte die dunkle Stimme gelassen, und Apei fand, dass auch das nicht beruhigend klang.
»Genau, denn ich werde die Stadt verlassen. Sobald Ihr mir gebt, was wir vereinbart hatten, Herr. Schon morgen Nacht, nein, gleich in der Früh bin ich fort. Gebt mir einfach, was mir zusteht. Und nie wird jemand erfahren, was ich für Euch getan habe.«
»Da bin ich sicher«, sagte der Hüne. Er bewegte sich schnell, eine kurze, elegante Geste, beinahe wie eine Verbeugung. Apei spürte einen Schlag gegen die Brust. Dann hörte er ein ersticktes Keuchen und wunderte sich, weil es so fremd klang, obwohl es doch aus seinem eigenen Mund kam. Er spürte, dass es unter seinem durchnässten Wams plötzlich ganz warm wurde. Sein Herz schien nicht mehr zu schlagen. Das war seltsam. Er fasste sich an die Brust, um sich zu vergewissern, und verstand dann endlich, dass es sein Blut war, das dort heiß aus einer tiefen Wunde strömte. Seine Beine wurden schwach, aber er fiel nicht, ganz im Gegenteil, er fühlte sich plötzlich angenehm leicht. Dann begriff er, dass der Hüne ihn hochgehoben hatte. Das Letzte, was er sah, war das weiß schäumende Wasser des Gebirgsbaches, in den sein Mörder ihn warf.
ERSTER TAG
Morgengrauen
Der Schatten kam von Süden. Er schlich über die Straße den Hügel hinauf nach Atgath. Der Wind hatte gedreht, hatte die Wolken auseinandergetrieben und den Regen versiegen lassen. Die Sichel des Mondes kämpfte sich an der einen oder anderen Stelle durch die Wolkendecke und ließ die nassen Dächer von Atgath in unstetem Licht schimmern. Die Stadt lag auf einer Anhöhe über dem schmalen Tal, und dahinter ragten die Berge in die Wolken hinein. Sie war bewacht, schon von weitem konnte der Schatten Fackeln sehen, unruhige Lichtpunkte, jedoch nur in den hohen Türmen, die die steinernen Mauern krönten. Vor der Stadt saßen ein paar Männer an Feuern, die zwischen einigen Zelten und großen, gefällten Baumstämmen brannten. Sie unterhielten sich halblaut und arglos, als der Schatten an ihnen vorüberglitt und lautlos die Mauer erklomm. Der Schatten überwand die Zinnen, keine zehn Schritte von einer ahnungslosen Wache entfernt, die frierend aus einem Turm in die Nacht schaute, überquerte den Wehrgang und verschwand mit einem Sprung in der Dunkelheit. Nur ein dumpfer Laut verriet, dass er sicher auf einem Hausdach gelandet war.
Die Straßen lagen verlassen, und zum kalten Wind, der um die Hausecken strich, gesellte sich der Klang des Wassers, das aus übervollen Regenrinnen auf das Pflaster tropfte. Der Schatten ließ sich vom Dach fallen, zögerte kurz, als sei er sich über den Weg nicht sicher, und folgte der Straße dann ins Innere der Stadt. Er bewegte sich vorsichtig, doch schnell, unter Wolken, deren Säume schon eine erste Andeutung des Morgengrauens zeigten. Einmal überquerte er eine Straßenkreuzung, gerade als das Mondlicht darauf fiel, und für einen Augenblick wurde erkennbar, dass es sich bei dem Schatten um einen schlanken, dunkel gekleideten Mann handelte. Aber niemand war auf den Straßen, bis der Dunkle schließlich zum Marktplatz, dem Herzen der Stadt, gelangte. Auch dort brannten Wachfeuer und beleuchteten ein dichtes Gewirr von Bretterbuden und Zelten, kleinen Bühnen und Verkaufsständen. Der Schatten hielt inne. Ein anderes Geräusch kam aus der Dunkelheit, langsamer Hufschlag, begleitet vom misstönenden Knarren großer Räder. Der Schatten verschmolz mit der Wand. Kurz darauf tauchte ein Pferd auf, das in gemächlichem Schritt einen führerlosen Kohlenkarren hinter sich herzog. Der Gaul schnaubte, als er den im Dunkel verborgenen Mann passierte, blieb aber nicht stehen.
Der Schatten sah dem seltsamen Gespann eine Weile hinterher, dann verschwand er in einer schmalen Seitengasse, blieb einige Zeit unsichtbar und tauchte kurz als Umriss auf dem Dach eines stattlichen Hauses auf. Er legte sich auf die nassen Ziegel und spähte über den Markt. Dort waren Männer, Wachen, die sich mit einem Mann unterhielten, der einen Besen geschultert hatte. Die Morgendämmerung konnte nicht mehr fern sein, und von irgendwoher aus der Nähe mischte sich der Duft von frischem Brot in die kalte Herbstluft. Von der Burg, die die Stadt als abweisend schwarzer Umriss weit überragte, blinkten vereinzelte Lichtpunkte hinüber. Ein Meer von Dächern lag zu ihren Füßen.
Der Schatten nickte, als habe er nun gefunden, was er suchte, und schlich davon. Er überquerte das Dach, sprang leichtfüßig über eine schmale Gasse hinweg auf das nächste, und nicht mehr als ein leises Knirschen der Schindeln kündete von seiner sanften Landung. Er bewegte sich schnell und zielstrebig über das Gewirr von Häusern, die, eingeengt durch die Stadtmauern, dicht zusammen- und bis an die alte Burg herangewachsen waren, die die Stadt überragte. Ihre schwarzen Mauern lagen in der Dunkelheit, und nur in zweien der Türme und vor dem Tor deutete unruhiger Fackelschein auf die Anwesenheit eines Wachpostens hin. Der Schatten schlug einen Weg ein, der ihn fast auf die Rückseite der Burg führte, dorthin, wo sich die wohl schmalsten Häuser der Stadt noch zwischen Mauer und Festung gequetscht hatten, dorthin, wo dieser Wall gemeinsam mit dem Gebirgsbach die Verteidigung der Stadt bildete. Der junge Mann richtete sich auf, griff unter seinen Umhang und wickelte ein langes Seil von der Schulter. Mit einem kaum hörbaren metallischen Klicken entfaltete er die drei Arme eines Wurfankers, nahm ihn zur Hand, betrachtete ihn und murmelte eine leise Beschwörungsformel. Ein Schatten löste sich von seiner Hand, kroch über das Seil und legte sich schließlich über den Anker.
Der Dunkle nickte zufrieden, schätzte die Entfernung ab, schwang das Seil und ließ den Anker fliegen. Der Wurfanker verschwand in der Finsternis, und nur ein gedämpftes Klopfen verriet, dass er zu kurz ging. Der Schwarzgekleidete fluchte leise und rollte das Seil wieder auf. Er versuchte sein Glück erneut, und diesmal fand er sein Ziel. Er zog am Seil, und es straffte sich. Noch einmal spähte er die menschenleeren Straßen entlang, dann sprang er am Seil hinüber zur Mauer und kletterte schnell hinauf. Oben hielt er kurz inne und sah sich um, aber es war keine Wache zu sehen. Er rollte das Seil wieder auf, klappte den Wurfanker zusammen und verstaute ihn wieder in dem breiten Gürtel, den er unter dem Umhang trug. Ein kurzer Schauer ging nieder, und der Mond verschwand abermals hinter schnell ziehenden Wolken, aber der Mann schien seinen Weg auch im Dunkeln zu kennen. Er lief über den Wehrgang, bis dieser an der Mauer eines vielstöckigen Gebäudes endete. Dann kletterte er über die groben Steinquader der Hausecke hinauf bis zum Dach. Es gab keine Regenrinne, und er brauchte eine Weile, bis er einen Punkt fand, der ihm sicher genug schien, um sich daran hinaufzuziehen. Er duckte sich und sah sich vorsichtig um. Am anderen Ende des Daches entdeckte er das, was einst der höchste Turm, der Bergfried, gewesen war. Doch die Platznot in der Burg hatte die Häuser immer weiter in die Höhe wachsen und näher rücken lassen, so dass er inzwischen nur noch wie ein leicht erhöhter Dachgarten herausragte. Es war keine Wache zu sehen. Der Fremde spähte dennoch lange hinüber, weil er etwas Ungewöhnliches entdeckt hatte. Er wartete, bis der Mond wieder hervorkam und enthüllte, dass es sich bei den plumpen Schatten nicht etwa doch um Wachen, sondern um große Tontöpfe handelte, wie sie manchmal für Zierpflanzen verwendet wurden, nur dass sie keine Pflanzen enthielten. Das ließ ihn zögern. Schließlich tastete er sich aber doch vorsichtig über die moosbewachsenen Schindeln voran. Die alten Schieferziegel knirschten unter seinen Schritten. Der Fremde zögerte wieder, murmelte einige leise Worte, und ein schützender Schatten umhüllte seine Gestalt. Erst dann setzte er seinen Weg fort.
Rund um den Bergfried wurde das Moos plötzlich weniger, und der Schatten hielt inne. Er war nur noch drei Schritte von den Zinnen des alten Turms entfernt, und immer noch blieb alles still. Dann trat er auf den Draht. Eine Explosion zerriss die Dunkelheit mit einem dumpfen Knall und einem violetten Blitz. Dem Fremden blieb nicht einmal Zeit, sich zu ducken. Die Druckwelle traf ihn und schleuderte ihn über das Dach und auf den Abgrund zu. Er rollte über die Schindeln, suchte verzweifelt nach Halt und stürzte dann über die Traufe. Irgendwie schaffte er es noch, sich am äußersten Rand einer Schieferschindel festzukrallen. Er keuchte eine Beschwörungsformel hervor. Der Schiefer war alt: Er brach unter dem Gewicht, und der Fremde stürzte viele Klafter tief hinab in die Dunkelheit und in den wild schäumenden Gebirgsbach, der unterhalb der Burg entlangtoste.
Morgen
Einige Meilen oberhalb der Stadt kniete Faran Ured am Rand einer Quelle, die frisch zwischen den Wurzeln von Riesenbuchen hervortrat. Der Tag begann kalt und klar, und der Wind trieb nur noch wenige zerrissene Wolken vor sich her. Der Herbst hatte sich über die Berge gelegt, ihre gewaltigen Flanken glänzten nass vom Regen, und die Schneegrenze war schon ein gutes Stück hinunter ins Tal gewandert. Das Laub leuchtete, und ein steter Regen von Blättern fiel von den Baumriesen auf den schon dicht bedeckten Waldboden. Faran Ured achtete nicht darauf. Er hielt einen verbeulten Blechteller ins kalte Wasser, vorsichtig, so dass das Wasser hinein-, aber nicht wieder herausströmte. Leise summte er ein Lied, und seine wachen Augen starrten gebannt auf die kleine Wasserfläche, in der sich das rote und gelbe Blätterdach und darüber der blasse Himmel spiegelten.
Das Wasser kräuselte sich, dann nahm es verschiedene Farben an, und plötzlich zeigte es in schneller Abfolge ganz unterschiedliche Bilder: erst Bäume, die ihre Zweige ins Wasser hängen ließen, dann einen dahinschießenden Gebirgsbach, der irgendetwas Dunkles mit sich führte. Faran Ured starrte angestrengt hinein. Sah er dort einen menschlichen Körper? Er verschwand mit dem Bach, und stattdessen erschien eine Kutsche ohne Pferde an einem Weiher zwischen hohen Felsen. Einige Bewaffnete saßen an Feuern ganz in der Nähe. Auch dieses Bild schwand. Der Teller zeigte einen klapprigen Karren an einer Furt, im Hintergrund waren die Türme einer Stadt zu sehen, plötzlich aber zerflossen die Mauern zu Wellen, und dann sah er das weite Meer und eine Galeere mit gelbem Segel, die schnell darüberglitt. Das Meer! Die Stirnfalten des Mannes glätteten sich, sein Summen wurde noch sanfter. »Komm«, flüsterte er, »zeig mir etwas anderes, zeig mir Insel und Haus.«
Die Wasserfläche klärte sich, zeigte wieder den Himmel, spiegelte das breite, offene Gesicht Faran Ureds und fallende Blätter, dann endlich enthüllte es schroffe Felsen, an denen sich die Wellen brachen, und dahinter eine Insel in der Morgendämmerung– ein graugrüner Fleck unter schnell ziehenden Regenwolken, mit gebeugten Kiefern und windgepeitschten Büschen bewachsen. Ein wehmütiges Lächeln spielte um die Lippen des Mannes. Ein Haus war zu erkennen, inmitten der Kiefern, aber plötzlich schob sich ein dunkles Segel ins Bild wie eine finstere Wolke, und das Wasser wurde trüb. Faran Ured änderte den Ton seiner Beschwörung, versuchte es noch einmal, aber jetzt blieb das Schiff in seinem Blickfeld und versperrte ihm die Sicht auf die Insel, die er so dringend sehen wollte.
»Was tust du da, Mann?«, fragte eine raue Stimme.
Faran Ured zuckte zusammen. Das kleine Wasserbild kräuselte sich und zerfloss.
»Ich wette, er wäscht Gold– oder Silber«, sagte eine zweite Stimme.
»In diesen Bergen gibt es kein Gold, Bruder«, sagte Ured, drehte sich langsam um und erhob sich, wobei er sorgsam darauf achtete, dass noch etwas Wasser im Teller verblieb. »Und Silber wird nicht aus Flüssen gewaschen«, fügte er hinzu.
Zwei Männer waren in sein Lager gekommen. Einer, ein graubärtiger Kahlkopf, lehnte an einer der Riesenbuchen und schnitt betont lässig mit einem Schwert Furchen in die Baumrinde. Der andere hockte am Feuer und untersuchte Ureds Habseligkeiten. Er trug eine alte Armbrust über der Schulter.
»Also, was machst du da?«, fragte der mit dem Schwert.
»Ich habe mich gewaschen und gebetet, Bruder. Faran Ured ist mein Name, und ich bin ein einfacher Pilger auf dem Weg nach Atgath.«
Der Graubart strich sich über den kahlen Kopf, wohl, weil einer der zahllosen Tropfen, die schwer aus den Zweigen fielen, ihn getroffen hatte.
»Hast du gehört? Er hat sich gewaschen.«
»Viel hat er nicht«, gab ihm der andere, der den Inhalt des Beutels auf dem Boden ausleerte, zur Antwort. »Ein paar Tiegel und Fläschchen, Salben und Tinkturen vielleicht.« Er öffnete ein Fläschchen, roch daran und warf es weg. Dann wühlte er weiter im Beutel. »Trockener Speck, ein Kanten Brot, Käse, ein bisschen Mehl, ein paar Groschen. Eine Mahlzeit für zwei, mehr nicht.«
»Brot und Speck?«, fragte der Graubärtige. »Ist das alles?«
Faran Ured machte ein freundliches Gesicht, aber er ärgerte sich über seine Unaufmerksamkeit, die ihn in diese Lage gebracht hatte. Sein Messer– nicht dass es ihm viel genutzt hätte– steckte unerreichbar fern in dem starken Ast, neben dem er seine Decke ausgebreitet hatte. Er hielt den Teller ruhig in der Hand und versuchte, seine Gegner einzuschätzen. Die beiden Männer sahen abgerissen aus. Ihre Kleidung war löchrig und mangelhaft geflickt, und ihre Gesichter waren hohlwangig, die Not stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
»Nehmt Euch, Brüder, ich habe schon gefrühstückt«, sagte er freundlich.
Der am Feuer gab dem leeren Beutel einen unzufriedenen Tritt. »Du siehst gut genährt aus, Alter, nicht wie einer, der von so karger Kost lebt. Was bist du? Ein Kaufmann? Die Salben, die Tinkturen– sind die wertvoll?«
»Nein, nur Mittel gegen Warzen, Haarausfall und Jucken der Haut, die ich gelegentlich verkaufe oder gegen eine Suppe eintausche. Ich bin nur ein bescheidener Pilger, ein Jünger des Wanderers.«
Der Graubart schnaubte missmutig. »Ein Pilger? Dass ich nicht lache! Ich wette, du bist ein Händler, unterwegs nach Atgath, um beim Jahrmarkt Geschäfte zu machen. Und das heißt, dass du irgendwo unter deiner schönen Kutte eine Menge Silber vor uns versteckst.«
»Silber…«, meinte der andere und schien dem Klang dieses Wortes andächtig nachzulauschen. Er nahm die Armbrust von der Schulter, spannte sie und legte einen Bolzen ein.
Sein Kumpan hörte auf, mit seinem Schwert herumzuspielen, und richtete es drohend auf Ured. »Es ist besser, du gibst es uns freiwillig, bevor wir es dir aus den Rippen schneiden.«
»Aus den Rippen!«, bekräftigte der andere.
Faran Ured seufzte. Die beiden waren nicht so dumm, wie er gehofft hatte. Er hatte tatsächlich einiges an Silber in seinem Gürtel versteckt, neben einigen ziemlich seltenen und kostbaren Kräutern, er dachte jedoch nicht daran, es diesen beiden hergelaufenen Halsabschneidern zu überlassen. Er lächelte freundlich, strich mit der Linken sanft über den Teller und summte eine leise Beschwörung, denn er wollte versuchen, diese Begegnung friedlich enden zu lassen. Ein warmer Wind kam auf, Sonnenlicht tanzte in den leuchtenden Blättern, irgendwo in den Ästen über ihnen schlug hell eine Drossel an. Für einen Augenblick roch es nach Spätsommer– es war, als würde der Morgen sanft auf sie alle herablächeln. Es war eine Einladung, sich zu vertragen, und das Wenige, was dort am Feuer lag, miteinander zu teilen. »Ich bin nur ein Pilger, wie ich sagte, und Ihr haltet schon alles in den Händen, was ich besitze. Nehmt Euch, was Ihr braucht, ich gebe es gerne.«
»Was rührst du da auf dem Teller herum? Den wirst du uns auch geben. Ist Silber, oder?«, stieß der mit dem Schwert rau hervor, und der andere hob seine Armbrust.
Faran Ured seufzte und änderte die Tonlage seiner Beschwörung. Es hatte wohl keinen Zweck. Die beiden Männer waren zu verzweifelt, um für den Zauber der Freundschaft empfänglich zu sein. Sie kamen näher, langsam, drohend, und Ured sah die Not hinter den finsteren Mienen. Plötzlich knackte es laut zwischen den Riesenbuchen.
»Was war das?«, fragte der eine und blieb stehen, die Armbrust unschlüssig in der Hand.
»Nur ein Ast«, brummte der andere, blieb aber ebenfalls stehen und blickte sich misstrauisch um.
Ein kalter Wind fuhr durch das Herbstlaub, wirbelte ein paar Blätter auf, und tief in der Erde lief ein Knarren durch alte Wurzeln. Der mit der Armbrust fuhr herum und schoss. Der Bolzen zischte durch das Laub und wurde mit einem dumpfen Laut vom Waldboden verschluckt. Einer der Büsche zu seiner Linken bog sich raschelnd unter einem Windstoß, der seltsamerweise alle anderen Büsche zu meiden schien. Das durchdringende Hämmern eines Schwarzspechts klang ganz aus der Nähe heran, und dann wurde es still, totenstill. Nicht einmal ein einziger Tropfen schien noch von den regenschweren Blättern zu Boden zu fallen, und selbst das Murmeln der Quelle schien versiegt. Dann brach ein Ast und fiel dem Mann mit dem Schwert genau vor die Füße. Er sprang mit einem leisen Schrei zurück und hob seine Waffe, aber sein Arm zitterte. Jetzt zog ein eiskalter Windhauch zwischen den mächtigen Buchen hindurch, und plötzlicher Frost kroch mit einem Flüstern durch das Laub und färbte es weiß.
»Der Boden, er bewegt sich!«, flüsterte der Graubart und ließ sein Schwert fallen, aber er rannte nicht davon.
Der Frost erreichte ihn, kroch seine Beine empor, umarmte ihn. Ured sah das Entsetzen in seinem Gesicht, als die kalte Angst sein Herz zerdrückte. Mit einem Ächzen fiel er ins Laub. Der andere sah ihn mit vor Schreck geweiteten Augen fallen, und auch für ihn war es zu spät. Gelähmt vor Furcht starrte er auf das plötzlich unter seinen Füßen gefrierende Laub und den Raureif, der sich auf seine Armbrust legte und über Hände und Arme den Weg zu seinem Hals fand. Ein erstickter Laut drang aus seiner Kehle, dann sank auch er tot zu Boden.
Faran Ured schüttelte den Kopf und beendete die Beschwörung. Der Frost verschwand ebenso schnell, wie er ihn gerufen hatte, Laub fiel wieder in farbenfrohen Schauern von den Ästen, und die Drossel sang ihr Lied. Warum ist das Gute immer schwieriger zu bewerkstelligen als das Böse?, fragte er sich. Das Wasser im Teller war grau, und schwärzliche, ölige Flecken trieben darauf. Mit einer unwilligen Bewegung schüttete er es aus. Auch der Teller hatte sich schwarz verfärbt. Er wusch ihn sorgfältig an der Quelle, aber er blieb stumpf und dunkel. Seufzend stellte er ihn zum Trocknen in die Sonne und kümmerte sich um die beiden Toten. Er legte sie hinter einer Buche ins Laub, fügte dem einen mit dem Schwert eine tiefe Wunde in der Brust zu und schoss dann dem anderen einen Armbrustbolzen in den Unterleib. Auf den ersten Blick sah es jetzt so aus, als seien sie sich gegenseitig an die Kehle gegangen. Ured betrachtete sie kritisch und gestand sich ein, dass es nicht genügte. Er schlitzte einem den Bauch auf, so dass die Gedärme hervorquollen, dem anderen schlug er die Armbrust hart ins Gesicht. Jetzt sah es echter aus. Den Rest würde die Verwesung erledigen. Die Quelle lag abseits des Weges, Ured hielt es für gut möglich, dass Wochen vergingen, bevor die beiden gefunden wurden.
Er sammelte seine Habseligkeiten ein, suchte vor allem das Fläschchen, das der Wegelagerer so achtlos fortgeworfen hatte, und brummte unzufrieden, als er es halb leer vorfand. Er suchte den Verschluss und wischte die Flasche vorsichtig mit etwas Laub ab, bevor er sie in die Hand nahm und sorgsam verschloss. »Das hätte dir einen schöneren Tod beschert«, murmelte er mit Blick auf den unglücklichen Räuber, der im Laub lag und ihn aus weit aufgerissenen Augen anstarrte. Ein blutrotes Blatt war ihm auf die Wange gefallen und sah aus wie eine klaffende Wunde. Ured steckte sein Messer in den Gürtel. Er war wütend auf sich selbst: Er hatte nicht aufgepasst, und wenn er sich nicht vorsah, konnten selbst solche armseligen Gestalten wie diese beiden Wegelagerer ihm gefährlich werden. Hätte der eine einfach gleich geschossen, bevor der andere Ured angesprochen hatte, würden die beiden jetzt dort unten sitzen und sich sein Silber teilen. Nun, vielleicht stimmte das aus gewissen Gründen nicht ganz, aber die Begegnung hätte noch weit unangenehmer ausgehen können, als es ohnehin der Fall gewesen war. War er so sehr aus der Übung, dass er die einfachsten Vorsichtsmaßnahmen vergaß? Er wusch den Teller noch einmal, wenn auch ohne Erfolg, trocknete ihn sorgsam ab, wickelte ihn in ein Tuch und steckte ihn in seinen Beutel. Teller und Wasser würden ihm vorerst nichts mehr zeigen, nicht nach diesem Zauber. Tod und Magie, das vertrug sich eben schlecht. Er fluchte noch einmal über seine Unachtsamkeit und fragte sich, ob es vielleicht gereicht hätte, die beiden einfach nur zu erschrecken. Aber dann sagte er sich seufzend, dass sie dann sicher irgendjemandem von dieser Begegnung erzählt hätten, und das hatte er verhindern müssen. Er blickte nachdenklich auf die beiden Leichen und schüttelte den Kopf.
Einst hatte er geschworen, dieses Tal nie wieder zu betreten, aber man hatte ihm keine Wahl gelassen, und nun war er eben hier und konnte nur hoffen, dass es nicht so unglücklich weiterging, wie es begonnen hatte. Er warf sich den Riemen des Lederbeutels über die Schulter und seufzte. Das Wasser hatte ihm wenig genug gezeigt: einen Körper in einem Gebirgsbach, eine pferdelose Kutsche an einem Weiher, ein Schiff auf hoher See. Das alles hing irgendwie zusammen, sonst hätte der Teller es ihm nicht gezeigt, aber noch konnte er das Rätsel nicht lösen. Der klapprige Karren an der Furt, unterhalb jener Stadt, die er dreihundert Jahre lang gemieden, aber sofort wiedererkannt hatte, das war die deutlichste Spur, und er gedachte, ihr nachzugehen. Als er aufbrach, hatte er kurz das Gefühl, als ob er beobachtet würde. Aber er konnte niemanden sehen, also hatte er sich wohl getäuscht.
Heiram Grams schlug die Augen auf und erblickte dicht über seinem Gesicht ein paar gelbliche Blätter, die schlaff am Ast einer Birke hingen. Er schloss die Augen sofort wieder, denn sein Kopf dröhnte, und die Helligkeit des neuen Morgens war schmerzhaft. Er richtete sich stöhnend auf, verfluchte den Zweig, der seine nassen Blätter an seinem Gesicht abstreifte, und blickte sich müde um. Er saß auf der Ladefläche seines Kohlenkarrens, so weit, so gut, aber wo war die Hütte? »Blöder Gaul«, murmelte er, schob sich langsam vom Karren, rutschte auf dem aufgeweichten Boden aus und fiel auf die Knie. Der grobe Sack, auf dem er geschlafen hatte, rutschte nach, und Grams war für einen Moment versucht, ihn ganz herunterzuziehen, auszubreiten und sich daraufzulegen. Er schloss die Augen, denn alles drehte sich. »Schlachten sollte ich dich, Haam, du Mistvieh«, murmelte er. Er zog sich ächzend am Karren hoch und sah sich noch einmal um. Birken und dichtes Unterholz säumten den Pfad, fahles Laub fiel von den Bäumen, und alles war entsetzlich nass, selbst seine eigene Kleidung, wie er missgelaunt feststellte. Zwischen großen Findlingen rauschte der Bach, sein Pferd hatte also an der Furt angehalten, aber Grams war noch zu schlaftrunken– und er war nicht nur vom Schlaf trunken–, um den Grund dafür zu verstehen.
Er rief sich die vergangene Nacht in Erinnerung. Er war im Blauen Ochsen gewesen, wie so oft, mit anderen Handwerksmeistern. Karten hatte man gespielt und über die schlechten Zeiten geklagt. Wie immer war er ein wenig länger geblieben und hatte getrunken, bis er den Schmerz und den Kummer seines Lebens, wenn schon nicht ertragen, so doch wenigstens vergessen konnte. Jemand, vermutlich der Wirt, hatte ihn irgendwann zum Karren gebracht und das Pferd auf den Weg geschickt. Der Gaul war nicht blöd, er fand den Weg zum Stall. Meister Grams erinnerte sich schwach, dass die Wachen am Tor irgendetwas zu ihm gesagt hatten, aber er wusste beim besten Willen nicht mehr, was das gewesen sein könnte. Er zuckte mit den Achseln. Es war doch auch gleich, was sie sagten, was wussten die schon? Auf jeden Fall hatten sie ihn, wie üblich, erst mit dem Morgengrauen hinausgelassen, denn vorher durften sie das Tor nicht öffnen. Also war eigentlich alles so, wie es eben sonst auch war, nur dass Haam nicht zum Stall gelaufen war. Grams blinzelte in den blassblauen Himmel. Seine Kleider waren nass, vermutlich, weil er in den Regen geraten war, und er fror. Er hätte längst zuhause sein müssen. Warum nur war der blöde Gaul stehengeblieben?
Grams hatte einen furchtbaren Geschmack im Mund, seine Kehle war rau, und er verspürte großen Durst. Aber zunächst lehnte er sich an einen der Findlinge und schlug auf schwankenden Beinen sein Wasser ab. Erst dann tastete er sich am Karren vorsichtig nach vorne, um nachzusehen, was Haam aufgehalten hatte. Der Bach führte reichlich Wasser, aber die Furt schien passierbar. Das Pferd wandte den Kopf und blickte ihn stumm an. Er hätte den Gaul gern angeschrien, aber dazu war ihm der eigene Schädel noch zu schwer. Schon das Gurgeln des Baches zwischen den Felsen dröhnte viel zu laut in seinen Ohren. Also begnügte er sich damit, dem Gaul beruhigend auf das Hinterteil zu klopfen. Dann entdeckte er den Schatten. Er lag auf dem schnell fließenden Wasser und gehörte irgendwie nicht dorthin. Heiram Grams blinzelte zweimal. Was warf diesen Schatten? Dort gab es weder Felsen noch einen Busch, außerdem stand die Sonne noch viel zu tief. Sah er nicht recht? Er trat näher heran und hielt sich dabei am Pferdegeschirr fest, denn er fühlte sich immer noch schwach. Er blinzelte noch einmal, und dann war der Schatten verschwunden, und stattdessen lag ein lebloser Körper im flachen Wasser.
Köhler Grams blieb verblüfft stehen. Er blinzelte wieder, aber zu seinem Bedauern blieb der Körper, wo er war, und löste sich nicht etwa in Nichts auf. Er nickte düster. Das hatte ihm noch gefehlt. »Du bist mir keine Hilfe«, murmelte er und meinte sein Pferd. Dann beugte er sich vornüber, um den Regungslosen auf den Rücken zu drehen. Dabei wurde ihm übel, und er übergab sich in den Bach. Er rutschte aus und landete auf allen vieren im kalten Wasser. Einige Sekunden blieb er in dieser Haltung, weil sich der Bach unter ihm zu drehen schien, dann kam er fluchend wieder hoch. Das eiskalte Wasser vertrieb für einen Augenblick die bleierne Schwere aus seinem Körper. Er starrte den Fremden an– es war ein junger Mann, dem das lange schwarze Haar im Gesicht klebte. »Du bist nicht von hier, oder?«, fragte er, aber der Fremde antwortete nicht. Er tastete den Körper ab. Er war kalt, aber Grams spürte einen Herzschlag. Er murmelte wieder einen Fluch, denn jetzt musste er etwas unternehmen. Er drehte den Fremden auf den Rücken, packte ihn und zerrte ihn an einem Arm aus dem Wasser. Erschöpft sank er im Schlamm nieder. Dann richtete er den Oberkörper des jungen Mannes auf und schüttelte ihn. Der Fremde hustete Wasser, aber er erwachte nicht. Grams schlug ihm zweimal leicht ins Gesicht. »Los, wach auf!«, sagte er heiser, aber der Fremde rührte sich nicht. Der Köhler kratzte sich am Kopf. Er konnte ihn zur Stadt zurückbringen, aber er hatte keine Lust, den Weg noch einmal zu fahren, außerdem würden die Wachen Fragen stellen, und er war nicht in Stimmung für Fragen. Aber liegen lassen konnte er den Mann auch nicht.
»Du könntest mir ruhig ein wenig helfen«, murmelte er, als er den Fremden zum Karren zerrte. Am Karrenrad gab er auf. Am einfachsten wäre es gewesen, den schlaffen Körper über die offene Rückseite zu wuchten, aber das schien ihm jetzt zu weit. Also lehnte er den Fremden an das Rad, sammelte sich und hob, stemmte, stieß und rollte den leblosen Körper irgendwie über die hohe Seitenklappe auf die Ladefläche. »Du hast Glück«, keuchte er, als er erschöpft auf die Knie sank, »dass ich mal der beste Ringer von Atgath war.« Er schloss die Augen, weil sich wieder alles drehte und erneut Übelkeit in ihm aufstieg. »Warum ich?«, murmelte er. »Warum immer ich?«
Haam, sein Gaul, hatte wohl das Gewicht im Karren gespürt, und offenbar hielt er es für ein Zeichen, dass sein Eigentümer wieder aufgesessen war und er seinen Heimweg fortsetzen konnte. Und Meister Grams, immer noch schwerfällig im Denken, verstand es erst, als der Karren schon halb durch die Furt war. Fluchend stolperte er hinterher.
Ela Grams wollte weg. Sie hatte den Boden der Hütte gefegt, das Stroh ihrer Bettstellen gewendet, die Kuh gemolken, Wasser aus dem Brunnen geholt und Frühstück auf den Tisch gebracht wie eigentlich jeden Morgen, aber bei allem, was sie tat, begleitete sie der Gedanke, dass sie das nicht mehr lange tun, dass sie bald Haus und Hof verlassen würde. Vielleicht war es wegen des Tellers, der einsam auf dem Tisch stand und mit ihr darauf zu warten schien, dass ihr Vater endlich zurückkehrte. Sie fragte sich, ob sie ihn stehen lassen oder wegräumen sollte. Ihre Brüder waren mit dem Frühstück längst fertig, und sie strichen ums Haus, um sich noch ein wenig vor der Arbeit des Tages zu drücken. Es war unwahrscheinlich, dass ihr Vater etwas essen wollte, wenn er nach Hause kam. Aber wenn doch, konnte er fuchsteufelswild werden, wenn der Tisch nicht gedeckt war. Einmal hatte er sogar verlangt, dass sie sich alle noch einmal zu ihm setzten, obwohl es schon spät gewesen war und die Arbeit sich nicht von selbst erledigte. Da war er schlimm betrunken gewesen, hatte gelallt, dass eine Familie gemeinsam am Tisch sitzen müsse, und war dann über seinem Teller eingeschlafen. Ela nagte an ihrer Unterlippe. Der Gedanke, den Hof zu verlassen, war ihr vor einiger Zeit schon einmal durch den Kopf gegangen, nach einem besonders schlimmen Tag, als ihr Vater sie beinahe geschlagen hätte. Sie hatten gestritten, um ein paar Groschen, die sie nicht hatte herausrücken wollen. Ihr Vater hatte sie in seiner Wut gepackt, schon mit der Rechten ausgeholt, aber dann plötzlich angefangen zu zittern, war zu ihren Füßen zusammengebrochen und hatte sie weinend um Verzeihung angefleht. Hätte er sie geschlagen, wäre sie längst fort. Vielleicht wusste er das ebenso wie sie.
Eine Zeitlang hatte sie gehofft, es würde wieder besser werden, doch in letzter Zeit wurde es eher schlimmer. Wo mochte er jetzt schon wieder stecken? Die dünne Tierhaut im Fenster hatte einen Riss, durch den kalt der Herbstwind in die Stube hineinblies. Sie nahm sich vor, ihn nach dem Frühstück zu flicken, da nicht damit zu rechnen war, dass ihr Vater, der seit Tagen versprach, das zu erledigen, sich je darum kümmerte. Durch den Spalt konnte sie einen kleinen Teil der Welt da draußen sehen. Buntes Laub leuchtete von den Bäumen, die den kleinen Köhlerhof umstanden. Sie war nicht gewillt, sich Sorgen zu machen. Vielleicht war ihr Vater unterwegs vom Karren gefallen, lag jetzt irgendwo im Laub und schlief seinen Rausch aus. Oder er lag, vom Wirt vergessen, in einem Wirtshaus auf dem Fußboden. Eigentlich hoffte sie es sogar. Dann musste sich jemand anders um ihn kümmern.
Asgo steckte den Kopf durch die Tür. »Ich geh mal runter zum See und schaue, was die Meiler dort machen«, erklärte er. Er war fünfzehn und damit der ältere ihrer beiden Brüder.
»Pass nur gut auf, diese Fischer legen gefährliche Netze aus«, erwiderte Ela mit einem Lächeln. Sie wusste, warum Asgo unbedingt zum See wollte.
»Keine Ahnung, was du meinst.«
»Oh, gar nichts, aber wenn du zufälligerweise in die Nähe einer gewissen Fischerhütte kommen solltest, in der zufällig ein bestimmtes Mädchen wohnt, dann sieh, ob du frischen Fisch mitbringen kannst. Aber nicht wieder Aal, den mag Vater nicht.«
»Meister Hegget hat mich gestern gefragt, ob ich nicht mal mit raus auf den See fahren will. Er will mir zeigen, wie sie das mit den Netzen machen.«
Elas Lächeln erstarb. War das mit Meister Heggets Tochter etwa so ernst? Er war doch erst fünfzehn. »Fischer müssen immer früh raus, Asgo, und sie riechen entweder nach Fisch oder nach Räucherkammer.«
»Aber wir riechen immer nach Holzkohle, wo ist da der Unterschied?« Seine Stimme war scharf, selbstbewusst.
Ela fühlte sich beklommen. Wenn er auf das Boot von Meister Hegget ging, die Netze auswarf, und wenn ihm das gefiel, weil seine Ria immer in der Nähe war– was sollte ihn dann noch auf dem Hof halten? War ihm bewusst, dass er daranging, den Hof und damit auch sie zu verlassen? »Du kannst nicht schwimmen.«
»Kann ich wohl«, sagte Asgo und war plötzlich wieder der trotzige Knabe, den sie großgezogen hatte. Er war noch lange nicht alt genug, um zu heiraten. Aber irgendwann schon– was sollte ihn hier noch halten? Und dann wäre sie mit Stig und ihrem Vater allein.
»Ich glaube, er kommt«, meldete Stig, der jüngere der beiden, von draußen.
»Wo sind deine Schuhe?«, fragte sie missbilligend, obwohl sie die Antwort kannte.
»Vater hat sie mitgenommen. Zum Schuhmacher. Aber es ist auch gar nicht so kalt.«
»Ist es schon. Zieh Vaters Filzpantoffel an, wenn du schon unbedingt da draußen herumrennen musst!«
Maulend gehorchte ihr Bruder, und Ela trat seufzend vor die Tür. Der kleine Hof der Grams’ lag inmitten eines Wäldchens von Buchen und Erlen, dem letzten Überbleibsel des Waldes, der sich einst unterhalb von Atgath erstreckt hatte. Heiram Grams war Nachfahre einer sehr langen Reihe von Köhlern, aber keiner seiner Vorfahren, und nicht einmal er selbst, war so dumm gewesen, die schützenden Bäume vor der eigenen Tür abzuholzen. Ela sah den alten Haam, ihren knochigen Wallach, der den Karren in beachtlicher Geschwindigkeit über den aufgeweichten Weg zog. Er hatte wohl Sehnsucht nach seinem Stall, und sie konnte es ihm nicht verdenken. Vermutlich hatte das arme Tier wieder die ganze Nacht im kalten Regen stehen müssen.
»Reibst du ihn gleich trocken?«, fragte sie Stig, der mit den zu großen Pantoffeln nach draußen geschlurft kam.
»Klar«, sagte der Knabe. Er war erst zwölf und war vermutlich sogar erleichtert, wenn er sich um den Gaul kümmern durfte, denn das hieß, dass sich seine Geschwister mit ihrem Vater herumschlagen mussten. Ela wusste, dass Stig litt, wenn er seinen Vater so betrunken sah, auch wenn er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Der alte Haam verlangsamte seinen Schritt und blieb schließlich vor der Hütte stehen. Stig fasste ihn am Halfter und redete beruhigend auf ihn ein. Plötzlich tauchte der Kopf ihres Vaters über der hohen Seitenwand des Kohlenkarrens auf. Sein lockiges Haar hing ihm noch wirrer als sonst im Gesicht. Er stierte sie an, dann rief er: »Helft mir mal eben, Kinder.«
Sie schafften den Fremden zu dritt ins Haus, wobei Heiram Grams eher eine Last als eine Hilfe war, vor allem an der Tür. Sie trugen und schleiften den Bewusstlosen durch die Stube in einen der beiden rückwärtigen Verschläge– jenem, in dem die Männer der Familie ihr Lager hatten– und betteten ihn auf einen der Strohsäcke. Kaum waren sie ihre Last los, als auch Heiram schon niedersank, auf sein Lager fiel und sagte: »Asgo, mein Junge, sei so gut und hol mir den Krug.«
»Warte, Asgo«, hielt Ela ihn auf. »Vielleicht sagst du uns erst, wer dieser Fremde ist, Vater?«
»Was weiß ich. Geh schon, mein Junge, dein Vater hat Durst.«
Ela nickte ihrem Bruder knapp zu. Die Stimme ihres Vaters hatte einen zornigen Unterton angenommen. Es war besser, ihm zu geben, was er verlangte. So wie er aussah, würde er vermutlich gleich einschlafen und nicht vor dem hohen Mittag zu sich kommen. Sie versuchte auch gar nicht erst, ihn dazu zu überreden, sich vorher zu waschen, obwohl er schwarz vom Kohlenstaub des Karrens war. »Er sieht nicht aus wie einer deiner Saufkumpane«, stellte sie fest. Sie nahm sich erst jetzt Zeit, den Fremden näher zu betrachten. Er war ganz in schwarz gekleidet, und sein schulterlanges Haar war ebenfalls tiefschwarz. Er war blass, aber seine Haut wirkte dennoch dunkler als bei den Leuten aus dieser Gegend. Er musste von irgendwo aus dem Süden stammen.
»Hab ihn gefunden. Am Bach«, brummte ihr Vater und starrte auf den Vorhang, der die kleine Schlafkammer der drei Männer der Familie von der Wohnstube trennte, aus der gleich Asgo mit einem Krug Branntwein erscheinen würde.
Kaum hatte er die Schlafkammer betreten, als sein Vater ihm schon mit einer Schnelligkeit, die man ihm kaum zugetraut hätte, den Krug aus der Hand riss.
Ela sah stumm zu, wie er den Krug ansetzte und mit geschlossenen Augen einen tiefen Zug nahm. Aus den Augenwinkeln konnte sie sehen, dass Asgo angewidert das Gesicht verzog.
»Besser«, sagte Heiram nach dem ersten langen Schluck. Er hatte Schwierigkeiten, den Korken zu platzieren.
»Also, was heißt, gefunden?«
Ihr Vater starrte sie stirnrunzelnd an, dann streckte er sich, den Krug fest umklammert, auf seinem Lager aus. »Ich muss nur ein Weilchen die Augen zumachen.«
»Vater, bitte! Was sollen wir denn jetzt mit diesem Fremden anfangen?«
»Frag deine Mutter«, brummte Heiram, und einen Atemzug später begann er zu schnarchen.
Ela starrte ihn an. Wie oft hatte sie das schon mitgemacht? Sie wollte ihn verachten, aber er hatte ihre Mutter erwähnt, als ob sie noch lebte, und das war erschütternd.
»Was machen wir denn jetzt mit dem da?«, fragte Asgo.
»Wir müssen ihm die nassen Sachen ausziehen und ihn dann warm einpacken. Komm, wir legen ihn nebenan in meine Kammer. Es mag sonst was geschehen, wenn Vater aufwacht und diesen Fremden neben sich entdeckt.«
»Und du meinst, es ist besser, wenn er einen nackten Mann in deinem Bett findet?«
Ela konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Asgo fand doch immer die richtigen Worte, um sie aufzuheitern. Ihre gute Laune verflog aber schnell wieder. Es war unmöglich vorherzusagen, in welcher Stimmung ihr Vater später erwachen würde. Vorsichtshalber nahm sie ihm den Krug weg. Er war vermutlich schlecht gelaunt, wenn er nach dem Aufwachen nicht gleich etwas zu trinken bekam, aber sie brauchte ihn halbwegs nüchtern. Sie hatte keine Ahnung, was sie wegen des Fremden unternehmen sollte. Sie seufzte. Es war besser, eines nach dem anderen zu erledigen. Und zunächst mussten sie den jungen Mann in ihr Bett schaffen und von seinen nassen Sachen befreien.
»Und Ihr seid sicher, dass es nicht wieder nur eine Katze war?«, fragte Hochmeister Quent schnaufend, als sie die Treppen des Bergfrieds hinaufstiegen.
Bahut Hamoch murmelte eine Antwort, die der alte Magier nicht verstand, aber das war auch nicht nötig. Sein Adlatus war sicher nicht so dumm, ihn all diese Stufen hinaufzuschleifen, wenn er sich seiner Sache nicht sicher war. Endlich traten sie auf die Plattform hinaus, und ein frischer Wind begrüßte die beiden Zauberer. Nestur Quent schlug sich den weiten Mantel enger um den Leib und blickte sich um. Der alte Bergfried war schon lange mehr ein Dachgarten als ein Wachturm– er selbst hatte zu der Zeit, als ihn Pflanzen noch interessiert hatten, eine ganze Anzahl Kräuter hier oben gezogen und gehegt. Aber das war lange her, und die armseligen Palmen, die der Herzog dennoch so liebte, waren wegen der Herbstkälte schon lange irgendwo anders in der Burg untergestellt worden. Nur auf den Ecken des Turmes standen noch drei bauchige Töpfe. Eigentlich sollten es vier sein, aber einer war in der Nacht offensichtlich explodiert. Tonscherben hatten sich über den Steinboden verteilt.
»Und wie war das mit dem Wachposten?«, fragte der alte Magier.
Der Adlatus räusperte sich. Sein Gesicht war eine ausdruckslose Maske. »Es war, wie ich schon erwähnte, keiner hier oben, Meister Quent.«
»Eigenartig.« Nestur Quent war klar, dass sein Adlatus nun so etwas wie ein Lob erwartete, weil seine Falle doch tatsächlich funktioniert hatte, aber er war nicht in der Stimmung für Freundlichkeiten. »Aber Ihr wisst nicht, wen oder was Eure kleine Spielerei hier erwischt hat, oder?«
Bahut Hamoch hob die Schultern. »Ich habe einige Männer geschickt, um unterhalb der Burg nachzusehen, aber sie haben bislang nichts gefunden.«
Der Hochmeister trat an die Brüstung und blickte hinaus. Früher hätte man hier bis hinunter in den Kristallbach sehen können, aber seit die Gebäude um den Turm gewuchert waren, war das nicht mehr möglich, es sei denn, man kletterte hinaus auf das Dach, und dafür fühlte er sich nun wirklich zu alt. Einer der Soldaten lag bäuchlings dort und hatte sich bis zum Rand vorgetastet. Über die moosbewachsenen Schindeln hatten sich ebenfalls Tonscherben verteilt.
Hochmeister Quent kratzte sich über die weißen Bartstoppeln. »Er könnte in den Bach gestürzt sein. Dann hätte ihn die Strömung mitgerissen, und sie werden ihn irgendwo weiter unten finden«, vermutete er, »wenn es nicht doch eine Katze war.«
Der Soldat auf dem Dach wandte den Kopf. Es war ein junger Mann mit auffallend kleinen, abstehenden Ohren. »Ich denke, es war ein Mensch, Herr, denn ich habe hier etwas schwarzen Stoff gefunden. Außerdem glaube ich, dass er sich hier festhielt, denn von dieser Schindel fehlt ein gutes Stück.«
»So, glaubt Ihr?«, meinte der Hochmeister knapp. Er hatte wenig Lust, sich von einem Soldaten belehren zu lassen.
»Seltsam ist nur, dass er zwischen Burg und Bach hätte aufschlagen müssen, dort unten, wo Hauptmann Fals gerade das Ufer absuchen lässt. Er müsste dort unten liegen, mit zerschmettertem Leib. Aber da ist er nicht«, meinte der Soldat. Quent erinnerte sich jetzt: Es war einer der beiden Leutnants der Burg, aber den Namen wusste er nicht. Er gähnte. Die ganze Nacht hatte er auf dem Nordturm verbracht, weil er, letzten Endes vergebens, gehofft hatte, durch die Wolken einen Blick auf die Sterne werfen zu können. Der Wanderer stand ganz in der Nähe des Sternbilds des Jägers– ein Schauspiel, wie es so nur alle fünfundsiebzig Jahre zu beobachten war. Er hatte sogar darüber nachgedacht, die Wolken auseinanderzutreiben, aber dann hatte er es doch gelassen, denn er pflegte grundsätzlich einen sehr zurückhaltenden Umgang mit der Magie, und erst die kommende Nacht war die entscheidende. Dann würde der Wanderer die Pfeilspitze berühren– wenn seine Berechnungen richtig waren. Unter anderem diese Berechnungen hatte er im Schein einer Öllampe überprüft, wieder und wieder, und dabei auf das Loch in den Wolken gewartet, das nicht kommen wollte. Jetzt brauchte er dringend eine Stunde Schlaf, wollte zuvor aber noch ein paar alte Sterntabellen durchgehen. Die Nachricht von einem geheimnisvollen Eindringling war daher höchst unwillkommen– wie eigentlich alles, was seine Studien störte.
Quent erinnerte sich jetzt sogar dunkel, gegen Morgen einen dumpfen Knall gehört zu haben, aber da es danach ruhig geblieben war, hatte er dem keine weitere Beachtung geschenkt. Er konnte sich schließlich nicht um alles kümmern. Er blickte sich um. Die Aussicht war überwältigend. Unter ihm lag die Burg, darunter waren die dicht gedrängten Häuser der Stadt, durch den Kristallbach in Alt- und Neustadt geteilt, und dahinter das Tal und die hohen Berge, zwischen denen schnelle Wolken dahinzogen. Es würde ein kalter, aber schöner Herbsttag werden, und in der kommenden Nacht würden die Wolken aufreißen, wenn er sich nicht sehr täuschte. Eigentlich täuschte er sich nie, was das Wetter betraf. So gesehen, hätte er die vorige Nacht auch in seiner Kammer verbringen können, denn er hatte doch selbst Regen und eine dichte Wolkendecke vorhergesagt. Andererseits hatte er die Nacht nutzen können, um die Tabellen durchzurechnen und einige seiner Notizen zu sichten und zu übertragen. Die Arbeit hörte eben nie auf.
Er drehte sich um und blickte in die finstere Miene seines Adlatus, der, so nahm er jedenfalls an, immer noch auf ein Lob für seine Falle wartete. Im Grunde genommen war Quent sogar beeindruckt. Er hielt sonst nicht viel von den alchemistischen Spielereien seines künftigen Nachfolgers, weil sie recht wenig mit altehrwürdiger Magie zu tun hatten, und er hätte es nicht für möglich gehalten, diese tückische Falle so fein zu justieren, dass sie ihren Zweck erfüllte, ohne gleichzeitig den halben Bergfried in die Luft zu sprengen. »Wenn er sich dort festhalten konnte, wie dieser Soldat sagt, dann scheint die Explosion ihn nicht getötet zu haben, oder?«
»Das Pulver muss nass geworden sein«, murmelte der Adlatus verlegen.
Meister Quent hob amüsiert die Augenbrauen, und auf seiner breiten Stirn faltete sich die magische Tätowierung, die ihn als einen Zauberer des neunten Ranges auswies, in ein schmales Labyrinth. Der Adlatus hatte seine Bemerkung falsch verstanden, aber Quent hielt ohnehin nicht viel davon, mit Lob großzügig umzugehen, denn er war der Meinung, dass zu viel Anerkennung faul und träge machte. Also sagte er: »Eure Erfindung ist vielleicht doch nicht so ausgereift, wie Ihr dachtet, Hamoch.«
»Auf jeden Fall hat sie Schlimmeres verhindert. Irgendjemand wollte in dieser Nacht über das Dach in die Burg einsteigen. Ihr wisst, dass die Gemächer des Herzogs nicht weit von hier entfernt sind.«
»Habt Ihr Herzog Hado schon informiert, Hamoch?«
»Nein, Meister Quent, ich wollte erst Eure Meinung zu diesem Fall hören.«
»Das war klug von Euch, Hamoch. Ich denke, wir warten noch ein wenig damit. Es geht ihm nicht allzu gut in letzter Zeit, und weitere Aufregung will ich ihm vorerst ersparen.«
»Ihr wollt es Seiner Hoheit verheimlichen?«
»Bis wir Genaueres wissen, Hamoch. Und jetzt entschuldigt mich. Ich werde versuchen, etwas von dem Schlaf nachzuholen, den Ihr mir mit dieser albernen Angelegenheit geraubt habt. Berichtet mir, wenn Ihr etwas Wesentliches erfahrt. Ich werde dann mit dem Herzog sprechen.«
Er schickte sich an, die Treppe wieder hinabzusteigen, blieb aber dann doch noch einmal stehen. »Eines noch, Hamoch. Wenn Eure Falle so funktioniert hätte, wie Ihr sie geplant hattet, was wäre dann eigentlich aus der Wache geworden, die hier oben hätte stehen sollen?«
Der Adlatus blitzte ihn kurz zornig an, senkte dann aber schnell den Blick.
»Soll ich in Erfahrung bringen, warum der Posten hier oben nicht besetzt war, Herr?«, fragte der Leutnant, der vorsichtig über das Dach kroch und offensichtlich nur halb verstanden hatte, was Meister Quent gesagt hatte.
Der Hochmeister nickte widerwillig und verschwand im Turm. Er schob es auf seine Müdigkeit, dass er nicht schon selbst auf diesen Gedanken gekommen war. Er brauchte dringend etwas Schlaf, und er ignorierte die leisen Zweifel, ob sein angehender Nachfolger der Richtige für diese Arbeit war. Im Grunde genommen war der Adlatus nicht untüchtig: Er war fleißig, strebsam und zuverlässig, aber sein Talent für die Magie war eher kümmerlich entwickelt, bestenfalls mittelmäßig. Als Zauberer konnte er Quent nicht das Wasser reichen. Gleichzeitig nahm Hamoch ihm all die lästigen Pflichten ab, die der Posten eines herzoglichen Hofkanzlers mit sich brachte. Genau das waren die Gründe, warum er ihn als Nachfolger ausgesucht hatte.
Eine kalte Windböe fegte über den Bergfried. Bahut Hamoch starrte dem Alten missmutig hinterher. Wieder hatte Quent es fertig gebracht, ihn zu demütigen, und das, obwohl er– die Himmel konnten es bezeugen– mit seiner kleinen Erfindung ganz sicher Schlimmeres verhindert hatte. Ein Fremder war in die Stadt und sogar in die Burg eingedrungen. Er fand das höchst beunruhigend, und jetzt tat der Alte so, als sei es eine Kleinigkeit, und überließ ihm die ganze Arbeit, würde aber selbst mit dem Herzog sprechen, wenn die Sache aufgeklärt war. Es war offensichtlich, wer den Lohn einstreichen würde.
»Soll ich mit Verwalter Ludgar reden, Herr?«, fragte der Leutnant wieder.
»Verwalter Ludgar?«, fragte Hamoch abwesend.
»Apei Ludgar, Herr. Der Erste Verwalter. Er ist auch für die Einteilung des Wachdienstes zuständig.«
»Tatsächlich? Ich dachte, das sei Sache des Quartiermeisters.«
»Der ist vor drei Monaten verstorben, und Ihr habt seine Aufgaben vorübergehend dem Verwalter übertragen, Herr.«
Hamoch sah den jungen Leutnant nachdenklich an. Er schien ein recht heller Kopf zu sein, womit er vermutlich eine Ausnahme unter den Soldaten der Stadt darstellte. Er erinnerte sich jetzt wieder an die Sache mit dem Quartiermeister. »Ihr seid nicht ganz richtig informiert, Leutnant. Ich habe den Verwalter lediglich gebeten, einen geeigneten Bewerber auszuwählen und mit diesem Amt zu betrauen. Ich habe mich schon gewundert, dass ich in dieser Angelegenheit so lange nichts mehr gehört habe.«
Der Leutnant zuckte mit den Achseln. »Vielleicht hielt Ludgar sich selbst für am besten geeignet, Herr. So habt Ihr ihn also nicht ernannt, wie er behauptet hat?«
Der Adlatus starrte über die Stadt, die mit ihrem Gedränge regennasser Schieferdächer unter ihm lag wie ein schwarzes, wirres Garnknäuel. Atgath war nicht groß, aber es bedurfte eines unglaublichen Aufwandes, es zu verwalten. Es war kein Wunder, dass der Alte ihm die Verantwortung dafür übertragen hatte. Dabei wartete unten im Laboratorium so viel weitaus wichtigere Arbeit auf ihn. Aber es ließ sich wohl nicht ändern. Apei Ludgar hatte sich also selbst zum Quartiermeister ernannt? Das war mehr als seltsam. »Bringt den Verwalter ins Wachhaus, Leutnant. Wir treffen uns dort. Vielleicht werden wir sehr schnell eine Erklärung dafür finden, wie der große Unbekannte so weit vordringen konnte.«
Shahila von Taddora saß in ihrer Kutsche und blickte hinaus auf den kristallklaren Weiher, an dem sie die Nacht über gerastet hatten. Dunkle Felsen rahmten ihn, und schwarze Bäume, von denen beständig Herbstlaub in den Weiher rieselte, säumten sein Ufer. Die Kutschpferde grasten in der Nähe, und etwas weiter entfernt brannten zwei Lagerfeuer, um die sich etwa drei Dutzend Männer drängten und ihr Frühstück zu sich nahmen. Es ging munter zu, und der eine oder andere raue Scherz flog zwischen den Feuern hin und her, einer der Gründe dafür, dass die Kutsche, von zwei Männern mit kurzen Speeren bewacht, etwas abseits abgestellt worden war.
Mit ruhigen Bewegungen kämmte die Baronin ihr langes schwarzes Haar, doch innerlich brannte sie vor Anspannung. Sie hatte sich halb aus dem pelzbesetzten Mantel geschält, um sich besser kämmen zu können, und versuchte, die morgendliche Kälte dieses Herbsttages zu ignorieren. Dies war ein kaltes Land, und einmal mehr sehnte sie sich nach der Wärme ihrer Heimat weit im Süden. Sie seufzte, legte den Kamm zur Seite und begann unruhig, ihr Haar mit langen elfenbeinernen Nadeln wieder zu dem strengen Knoten aufzustecken, in dem sie es gewöhnlich trug. Sie schlug den Kragen ihres Mantels hoch, wartete und lauschte dem halblauten Geflüster der beiden Männer, die vor der Kutsche über ihre Sicherheit wachten. Offensichtlich hatten sie Hunger und warteten ungeduldig auf die Ablösung. Aber jetzt zischte der eine den anderen an, er solle schweigen, um auf ein näher kommendes Geräusch zu lauschen. Die Baronin spitzte die Ohren. Tatsächlich, da kam schneller Hufschlag den steinigen Weg herauf. Ein weiterer irgendwo in den Felsen versteckter Posten gab mit einem leisen Pfiff Entwarnung. Dann hörte sie das Pferd schnauben. Es hielt scharf vor der Kutsche an, jemand sprang aus dem Sattel und sagte: »Kümmert euch um das Tier, und dann geht frühstücken.«
»Jawohl, Rahis«, riefen die beiden Männer, und dann hörte die Baronin sie schon davoneilen.
Sie schob den Vorhang im kleinen Fenster der Kutsche zur Seite. Draußen stand ein wahrer Hüne von Mann und verneigte sich ehrerbietig. Sie lächelte und konnte doch ihre Anspannung nicht verbergen. »Du bist endlich zurück, Almisan«, begann sie.
»Der Weg scheint sicher, Hoheit«, antwortete der Rahis förmlich und so laut, dass die beiden Speerträger es gerade noch hören konnten. Dann trat er einen Schritt näher an die Kutsche heran und spähte durch das Fenster herein. »Euer Gemahl, Hoheit?«
Shahila verzog das hübsche Gesicht und deutete mit einem Nicken hinüber in den Wald. »Der Baron ist irgendwo dort drüben und kriecht im Gebüsch umher. Offensichtlich hat er etwas von Belang entdeckt.«
Tatsächlich war am Weiher ein Mann in rot leuchtender Kleidung zu sehen, der eindeutig zutiefst fasziniert eine Pflanze betrachtete. Seine Ehefrau seufzte. »Sieh ihn dir nur an, Almisan. Das ist mein Ehemann. Ich bin Shahila at Hassat, vor drei Jahren war ich noch stolze Prinzessin des größten Reiches der Welt, und Fürsten mächtiger Länder hielten um meine Hand an. Und nun bin ich die Frau eines Barons, der sich für Blumen und Käfer interessiert, und darf mich Herrin von Taddora nennen, eine Baronie, die kleiner ist als der Garten im Palast meines Vaters.«
»So sind wir also ungestört«, stellte der Hüne fest, und sein Gesicht blieb völlig ausdruckslos.
Shahila schätzte ihren Vertrauten und Leibwächter auch deshalb, weil er ihr gelegentliches Lamentieren mit großem Gleichmut ertrug. Sie lächelte und sagte: »Lassen wir das. Du kennst mein Leid, und ich weiß, dass du es teilst, auch wenn du es niemals zeigen würdest. Sag, was bringst du Neues aus Atgath, Almisan?«
»Ich habe unseren Mann getroffen, Hoheit, und mein Dolch hat dafür Sorge getragen, dass er für immer schweigen wird.«
Shahila nickte. Etwas anderes hatte sie nicht erwartet. »Und– die andere Sache?«
»Ich habe versteckt außerhalb der Stadt gewartet, doch der Morgen kam, ohne dass Alarm gegeben wurde. Im ersten Licht des Tages habe ich dann einige Krieger ausrücken sehen, die den Bach nahe der Burg absuchten. Ich kann aber weder sagen, was sie suchten, noch, ob sie es gefunden haben, denn ich musste zurückkehren, bevor meine Abwesenheit hier zu viele Fragen aufwirft.«
»Er hat also versagt«, stellte Shahila nüchtern fest.
Der Hüne verzog wieder keine Miene. »Es ist schmerzlich, doch, ja, ich nehme an, dass er es nicht geschafft hat.«
»Nun, es wäre auch zu einfach gewesen, nicht wahr?«
»Ja, Hoheit.«
»Ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass er es nicht überlebt, es wäre mir allerdings lieber gewesen, er wäre erst nach Erfüllung seines Auftrags gestorben«, sagte Shahila kühl.
»Es ist nicht gesagt, dass er tot ist, Hoheit. Die Mitglieder meiner Bruderschaft verfügen über großes Talent, sich am Leben zu erhalten.«
Die Baronin sah den Hünen nachdenklich an. »Ich hatte immer den Verdacht, dass seine Fähigkeiten nicht so groß waren, wie er selbst allzu gern angenommen hat«, sagte sie dann, »und sie waren schon gar nicht vergleichbar mit den deinen, Almisan.«
Der Hüne wechselte plötzlich den Tonfall. »Jedenfalls kann ich Euch mitteilen, dass der Weg nach Atgath frei von Hindernissen und Gefahr ist, Hoheit. In drei Stunden können wir dort sein.«
»Wie überaus erfreulich, Rahis Almisan«, rief die fröhliche Stimme des Barons von Taddora. »Ich kann es kaum noch erwarten, meine Brüder wiederzusehen.« Er lief durch das feuchte Gras und hielt vorsichtig etwas in den geschlossenen Händen, als habe er Angst, etwas sehr Kostbares zu zerbrechen. »Sieh nur, Liebste, was ich gefunden habe.«
Shahila runzelte die Stirn. Sie war mit ihren Gedanken bei wichtigen Unternehmungen und hatte wenig Sinn für das Grünzeug, mit dem ihr Mann sich lächerlicherweise abgab. Sie setzte dennoch ein freundliches Lächeln auf und fragte: »Was ist es, Beleran?«
Der Baron trat nahe an die Kutsche heran und öffnete die Hände ein wenig. Ein leuchtend bunter Schmetterling saß darin und spreizte die Flügel. »Es ist ein Paradiesfalter, und glaube mir, es ist mehr als außergewöhnlich, um diese Jahreszeit noch einen zu finden.«
Shahila stieß einen leisen Ruf des Entzückens aus. Das Tier war wirklich prachtvoll.
»Es ist schade, dass er schon einen Namen hat, mein Leben, denn sonst würde ich ihn nach dir benennen«, sagte der Baron lächelnd.
Shahila konnte nicht verhindern, dass sie errötete. Sie betrachtete das Tier, dessen samtene Flügel zitterten. Vielleicht war ihm ebenso kalt wie ihr? »Was hast du nun mit ihm vor, mein Gemahl? Wirst du ihn deiner Sammlung hinzufügen?«
Beleran von Taddora schüttelte den Kopf. »Ich könnte kein Tier töten, dessen Schönheit und Anmut mich an dich erinnern, Liebste.« Damit öffnete er die Hände. Der Falter zögerte einen Augenblick, dann spreizte er die bunten Flügel und taumelte davon.