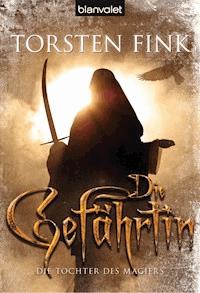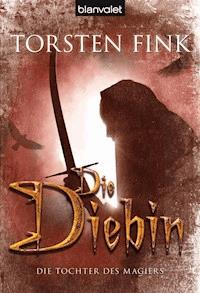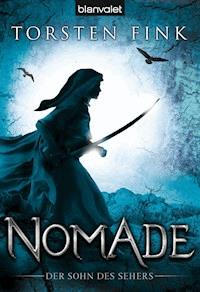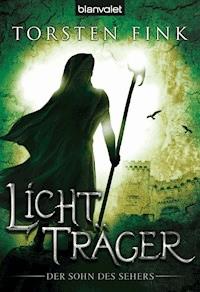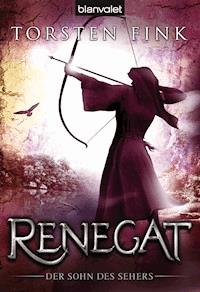Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Replace outdated disclaimer texts as necessary, make sure there is only one instance of the disclaimer.
Originalausgabe Juli 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2009 by Torsten Fink
ISBN 978-3-641-03037-7V002
www.penguin.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Schirqu
Das Dorf im Strom
ERSTER TAG
Das Angebot
Wika
Eschet
ZWEITER TAG
Fakyn
Alldhan
Der Gott und die Bestie
Fragen
Auf Leben und Tod
DRITTER TAG
Isberfenn
Binithaqu
Dwailis
Glossar
Anhang
Copyright
Prolog
Das Land ertrank im Regen. Schauer auf Schauer zog über den schwarzen Fluss, und ferne Blitze zuckten über den Nachthimmel. Mitten im nächtlichen Strom zeichneten sich die Umrisse einer Siedlung ab, Pfahlbauten, die auf einer Insel dem Regensturm trotzten. Es war still in den Hütten. Niemand erzählte Geschichten, und nirgendwo lachten Kinder, die Siedlung schien nur auf den strömenden Regen zu lauschen. Die letzten Lichter wurden gelöscht, und die Finsternis legte sich schwermütig auf das Dorf. Nur in einem Haus brannte noch Licht. Eine einzelne Kerze kämpfte dort gegen die Schatten. Vor kurzem noch war das Samnath, das Versammlungshaus, voller Menschen gewesen, jetzt waren die Laternen gelöscht und die Menschen gegangen. Nur drei Männer waren zurückgeblieben. Sie saßen im Lichtkreis der schwachen Flamme und starrten schweigend auf ein weißes Tuch, das vor ihnen auf dem Boden ausgebreitet lag. Gelegentlich wehte der Wind feine Regenschleier durch die vielen schmalen Schlitze, die dem Haus als Fenster dienten. Zwölf Schilfrohrstücke lagen auf dem Tuch.
»Schlange, Boot und Mädchen, die Zeichen sind eindeutig«, sagte jetzt der jüngste der drei. Sein Gesicht war gerötet, und seine Hände schwitzten.
Die beiden Älteren schwiegen, einer von ihnen drehte geistesabwesend mit seiner rechten Hand Hanffasern zu einem Seil. Schatten tanzten an der Wand. Wie zum Beweis seiner Behauptung deutete der Jüngere nacheinander auf die Halmstücke zu seinen Füßen. Sie waren mit schwarzen Zeichen versehen. »Schlange, Boot und Mädchen«, wiederholte er. Er wirkte unruhig und seltsam aufgekratzt.
»Wir haben es gesehen«, sagte einer der beiden Älteren seufzend. Sein Haar bildete einen schütteren grauen Kranz um den Schädel. Er sah besorgt aus.
Der Jüngere war nicht zu beruhigen: »Ihr wart dabei, als ich das Schilf geschnitten habe, ihr habt zugesehen, wie ich die heiligen Zeichen auf den Halmen anbrachte. Die Klinge war in der Flamme gereinigt, das Tuch weiß und neu, wie es der Brauch verlangt.«
»Niemand unterstellt dir einen Fehler«, sagte der Grauhaarige wieder.
»Aber warum sind wir dann noch hier?«
Der Dritte, der bisher geschwiegen hatte, beugte sich vor und warf einen langen Blick auf die zwölf Halme. »Es gibt viel zu bedenken«, sagte er. Er hatte dichtes, schlohweißes Haar.
»Bin ich euer Edaling, oder nicht?«, fragte der Jüngste herausfordernd. Sein Blick wirkte unsicher.
»Du bist es«, erwiderte der Graue ruhig, »doch das ist keine kleine Sache. Es gibt viel zu bereden. Und deshalb habe ich euch gebeten zu bleiben.«
Der Weißhaarige wandte den Blick nicht von den Schilfstücken. Drei waren zur Seite gelegt worden. »Bevor wir aber über das reden, was nun zu tun ist, habe ich noch Fragen«, sagte der Weißhaarige.
»Die Zeichen waren eindeutig!«, sagte der Jüngste. In seiner Stimme schwang Trotz mit.
»So ist es, und genau das lässt mich zweifeln«, meinte der Weißhaarige. »Ich frage euch: Wie oft haben wir das Auwara schon befragt? Und wie oft waren die Zeichen so klar? Haben wir sonst nicht stundenlang beraten müssen, um zu verstehen, was das Schilf sagen will?«
»Und immer warst du es, der an meiner Deutung gezweifelt hat«, giftete der Jüngste.
»Beruhige dich, das war schon bei deinem Vater und dessen Vater nicht anders«, sagte der Graue begütigend. »›Immer der Seiler‹, haben sie gesagt, und beklagt, dass seine Gedanken verschlungener seien als die Netze, die er für uns fertigt.«
»Also stört dich, dass du deinem Edaling heute zustimmen musst?«, fragte der Jüngste noch einmal, so als hätte er den Grauen nicht gehört. Sein Gesicht war rot vor Erregung.
»Ich sage nur«, erwiderte der Weißhaarige bedächtig, »dass ich so etwas noch nie erlebt habe.«
»Keiner von uns hat das«, sagte der Graue, »aber von uns hat auch noch keiner erlebt, dass Sie erwacht.«
»So ist es«, sagte der Edaling schnell, »wir alle kennen nur die alten Geschichten. Und keiner von uns wusste, was zu tun ist. Aber das Auwara hat unsere Fragen beantwortet! Eindeutig!«
»Ich kann sehen, was es verlangt, wir alle können das«, erwiderte der Seiler. »Es ist nur so, dass dieses Opfer seit vielen Menschenaltern nicht mehr gebracht wurde.«
Der Edaling sprang erregt auf. »Willst du dich gegen das Auwara stellen?«
Der Graue legte ihm begütigend die Hand auf den Arm und sagte, an den Weißhaarigen gewandt: »Es war nicht nötig, weil Sie sich so lange nicht gezeigt hatte.«
Der Seiler schüttelte den Kopf. »Die Schläferin erwachte zu Zeiten der Väter unserer Großväter. Habt ihr die Geschichten vergessen? Und haben sie da das Blutopfer dargebracht? Nein!«
»Damals hatten sie die Maghai, große Maghai. Aber wen haben wir? Wo ist der mächtige Jalis? Wo die anderen? Sie haben uns verlassen. Wen haben wir noch – außer jenen, die uns die Liebsten sind?«, fragte der Grauhaarige bekümmert.
»Vielleicht sollten wir die Zauberer suchen«, meinte der alte Seiler.
»Maghai! Die Maghai haben behauptet, sie hätten das Unheil für alle Zeiten gebannt!«, zischte der Edaling. »Aber sie haben sich getäuscht – und uns!« Missmutig setzte er sich wieder.
»Das haben sie, und es ist seltsam, dass sie sich darin geirrt haben«, erwiderte der Seiler nachdenklich. Er hatte die Hanffäden zusammengedreht. Jetzt begann er, sie gedankenverloren wieder aufzufasern. »Ich frage mich, was Sie geweckt hat.«
Der Graue zuckte hilflos mit den Schultern. »Wer kann das wissen? Vielleicht der Krieg? Es wird viel Blut vergossen am Ufer des Dhanis. Vielleicht sind es die Toten im Wasser, die Ihren Schlaf stören.«
»Was ist mit dem Schatten, den Dwailis gesehen hat?«, fragte der Seiler.
»Dwailis ist ein verrückter, alter Narr!«, rief der Edaling.
»Das hast du auch gesagt, als er uns vor Ihr warnte, und er war der Erste, der Sie gesehen hat«, erwiderte der Weißhaarige.
»Ich war nicht der Einzige, der ihm nicht geglaubt hat«, rechtfertigte sich der Jüngere verdrossen.
Der Graue schüttelte unwillig den Kopf: »Es ist doch gleich, ob es der Krieg oder etwas anderes war. Die Zermalmerin ist erwacht. Und wir müssen das Unheil, das daraus folgt, ertragen.«
»Unheil? Es kann unser Ende bedeuten. Sie hat lange geschlafen, und sie ist hungrig! Aber wir können das Verhängnis noch abwenden. Nur ist keine Zeit mehr für Bedenken. Wir müssen schnell handeln!«, rief der Jüngste mit vor Erregung zitternder Stimme. »Die Zeichen sind eindeutig! Schlange, Boot und Mädchen.«
»Ist das alles, was dir wichtig ist, deine Zeichen?«, fragte der alte Seiler bitter.
»Ich bin der Edaling! Es ist meine Aufgabe, das Auwara zu legen, Alter, auch wenn dir das nicht gefällt.«
»Bitte, Männer, beruhigt euch«, sagte der Graue. »Ich habe euch gerufen, weil ich weiß, wie kummervoll dieser Weg noch werden wird. Wir, die Ältesten und der Edaling, wir führen dieses Dorf, und wir müssen einig sein, wenn wir zur Versammlung sprechen.«
»Ich habe diesen Streit nicht begonnen«, zischte der Edaling.
»Aber ich erkläre ihn für beendet!«, rief der Graue scharf. Er verlor offenbar die Geduld. »Hört, ihr Männer, die Weissagung der Halmzeichen ist klar. Keiner von uns kann es anders deuten: Das Opfer wird verlangt. Sind wir darin einig?«
»Ich habe kein gutes Gefühl, wenn wir das Auwara in dieser Frage entscheiden lassen«, sagte der Seiler langsam, »aber ich gebe zu, dass ich es auch nicht anders deuten kann.«
»Ah, du siehst ein, dass du dich geirrt hast? Was für ein seltenes Ereignis! Dann müssen wir jetzt bereit sein zu tun, was verlangt wird!«, forderte der Jüngste.
»Er hat Recht, alter Freund«, pflichtete ihm der Grauhaarige bei. »Seit vielen Menschenaltern befragen wir das Schilf und vertrauen den Zeichen. Und in diesem Fall nicht? Bald erscheint der Neue Mond, und dann müssen wir handeln. Worauf sollen wir warten? Schon vier unserer Fischer sind nicht wiedergekehrt. Jetzt wagt sich keiner mehr hinaus auf den Fluss. Vom Ufer werfen sie die Netze aus, und mit den Flussechsen müssen sie darum streiten. Und der Fang ist armselig genug. Es wird nicht mehr lange dauern, und der Hunger sitzt in diesem Dorf an jedem Tisch.«
Der Weißhaarige nickte langsam. »Ich weiß, aber ich fürchte, dass Unheil aus alldem erwächst. Ich werde nicht widersprechen, wenn das Auwara das Opfer einfordert, aber bedenkt, es wird eine unserer Familien treffen, ein Mädchen aus unserer Mitte. Das wird die Ihrigen hart ankommen.«
»Das lässt sich leider nicht vermeiden«, sagte der Edaling kühl.
»Du kannst das leicht sagen, denn du hast weder Kinder noch Enkel«, sagte der alte Seiler mit gezwungener Ruhe. »Ich fürchte jedoch, dass die Sippe der Erwählten sich wehren könnte. Es wird Beschuldigungen geben, Widerspruch, Streit.«
»Was schlägst du also vor, mein Freund?«
»Ich denke, wir lassen die Oberhäupter der Familien schwören, dass sie sich dem Los ohne Widerspruch fügen und auch niemandem beistehen, der dieses versucht. Vielleicht können wir so den Zwist gering halten. Aber geben wird es ihn, da könnt ihr sicher sein.«
»Immer siehst du schwarz«, rief der Jüngste verächtlich.
Der Weißhaarige blickte ihn scharf an: »Bedenke dies, würdiger Edaling dieses Dorfes; nicht ich bin es, der morgen das Los ziehen wird, sondern du! Deine Hand wird eines unserer Kinder zum Tode verurteilen. Du wirst morgen Abend wenigstens einen Feind mehr haben.«
»Ich bin nur die ausführende Hand, ein Diener der Mächte. Das Schicksal entscheidet, wen das Los treffen wird!«, erwiderte der Edaling mit seltsamem Stolz.
»Ich frage mich«, sagte der Graue langsam, »ob es nicht doch einen Weg gibt, all dies zu vermeiden.«
»Ich sehe keinen, alter Freund«, sagte der Seiler niedergeschlagen, »aber vielleicht findest du einen in dieser Finsternis.«
»Es wäre das erste Mal, dass ich dich darin überträfe«, erwiderte der andere lächelnd. Dann wurde er wieder ernst, zögerte kurz und sagte dann aber: »Wir könnten eine Fremde zum Opfer bestimmen.«
Einen Augenblick war es still im Versammlungshaus. Nur der Regen rauschte auf das Schilfdach. Die Kerze flackerte unruhig. Sie würde sich bald verzehrt haben.
Der Weißhaarige schüttelte den Kopf. »Unsere Vorfahren haben dem abgeschworen. Keine Fremde soll für unseren Fluch büßen.«
»Es ist auch gar nicht gesagt, dass das Opfer angenommen wird, wenn es nicht aus unserem Dorf stammt«, wandte der Edaling ein. Es klang übereifrig.
»Und ist denn gesagt, dass die Erwachte eines unserer Mädchen als Opfer annimmt?«, entgegnete der Grauhaarige scharf.
»Es ist doch auch gleich«, sagte der alte Seiler, und er klang sehr müde, »es gibt keine Fremden in unserem Dorf. Also wird eines unserer Kinder sterben müssen.«
Die drei Männer starrten schweigend in die zitternde Flamme. Die Entscheidung war gefallen, jetzt mussten sie nach Hause gehen und versuchen, damit zu leben. Aber keiner von ihnen wollte die Zusammenkunft beenden. Es war, als hofften sie, dass doch noch, von irgendwoher, Rettung käme. Sie lauschten dem stetigen Regen und hingen ihren düsteren Gedanken nach.
Plötzlich hob der Weißhaarige den Kopf: »Lasst uns etwas versuchen, Männer!« Er klang entschlossen und begann die Schilfhalme aufzusammeln.
»Was hast du vor?«, fragte der junge Edaling misstrauisch.
»Wir fragen das Auwara noch einmal.«
»Das ist gegen den Brauch!«, widersprach der Jüngste aufgebracht.
»Was erhoffst du dir davon?«, fragte der zweite Älteste erstaunt.
»Warte es ab«, sagte der Weißhaarige. Er drückte dem Edaling die Halme in die Hand und reichte ihm das weiße Tuch. »Hier. Das ist deine Aufgabe, Edaling.«
»Aber das ist gegen jede Sitte«, stotterte der.
»Das Urteil kann hinterfragt werden«, erklärte der Grauhaarige bedächtig.
»Tu es einfach!«, drängte der Weiße.
»Aber …«
»Tu es!«, donnerte der Seiler.
Der Edaling zuckte zusammen. »Ich tue es, aber nur... dir zuliebe«, stotterte er.
Der Grauhaarige seufzte und tauschte einen vielsagenden Blick mit dem Seiler. Es war offensichtlich, dass sie beide nicht viel vom Edaling hielten. Der faltete mit zitternden Fingern die Ecken des Tuches zusammen, ließ die Halme auf die kleine freie Fläche in der Mitte fallen und hob den Stoff vorsichtig an. Dann ließ er das Schilf im Tuch mit sanften Bewegungen tanzen und murmelte ein Gebet, in dem er die Ahnen und den Flussgott Dhanis bat, ihm die Hand beim Auwara zu führen. Er legte das Tuch ab. Die beiden Ältesten übernahmen die Enden und öffneten sie ein wenig. Der Edaling schloss die Augen. Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn. Er leckte sich nervös die Lippen, wiederholte seine Bitte an Dhanis, dann steckte er die Hand in das Tuch und zog drei Halme heraus.
Er öffnete erst die Augen und dann seine Hand. Die drei Schilfrohrstücke zeigten ihre Zeichen.
Der Edaling wurde blass.
»Das ist unmöglich«, flüsterte der Grauhaarige.
»Noch einmal«, forderte der alte Seiler.
Sie wiederholten die Zeremonie Schritt für Schritt. Am Ende öffnete der Edaling seine verschwitzte Hand und zeigte die drei Halme, die er gezogen hatte. Die drei Männer schwiegen betroffen. Die Halme zeigten Schlange, Boot und Mädchen.
»Das kann nicht sein«, sagte der Graue tonlos.
Der Edaling schluckte. »Aber, kann es nicht sein, ist es nicht möglich, dass Dhanis selbst will, dass wir... ich meine... vielleicht hat er…«, stotterte er, aber er brachte seinen Satz nicht zu Ende.
»Ich kenne viele Geschichten aus alter Zeit«, sagte der Seiler langsam, »von Auwara-Urteilen, die angefochten wurden. Doch noch nie, niemals, hat das Schilf dreimal die gleiche Antwort gegeben.«
»Dhanis hat mir die Hand geführt«, sagte der Edaling trotzig.
»Mach dich nicht lächerlich«, schnaubte der Alte, dann stockte er und blickte sich um. »Riecht ihr das?«, fragte er leise.
Die anderen beiden hoben den Kopf. Ein leichter, süßlicher Verwesungsgeruch wehte durch den Raum. Der Seiler nahm die plumpe Kerze und hob sie an. Die Flamme flackerte unruhig, und die Schatten im Versammlungshaus zogen sich ein wenig zurück. War dort jemand? Alle drei starrten in die dämmrigen Winkel des Hauses, aber dort war niemand zu entdecken.
Schirqu
Die Toten berichten, dass es in ihrer Stadt Ud-Sror eine Straße aus kochendem Pech gebe. Dort wandeln die verfluchten Seelen der Grabschänder.
Abeq Mahas, Das Totenreich Uos
Ein Reiter kam den langen Weg von Süden herauf. Schwerer Regen ging seit Stunden nieder, und der schwarze Mantel des Mannes war völlig durchnässt. Jetzt hatte er etwas entdeckt, das ihn auf einen trockenen Platz hoffen ließ. Natürlich hätte er auch im Wald rasten können, der sich schon eine ganze Weile zu seiner Linken ausbreitete, aber er war ein Kind der Steppe, und Wälder gefielen ihm nicht. Unsichtbare Feinde mochten darin lauern, Menschen, Wölfe. Ein gemauertes Bauwerk mit freiem Blickfeld nach allen Seiten war sicherer. Jetzt war er fast dort. Er zügelte sein Pferd. Vor ihm ragte die Ruine eines Tempels in den dunkelgrauen Himmel. Tief hängende Wolken tauchten das Land in fahles Zwielicht. Sein Tier schnaubte unruhig. Er streichelte es beruhigend am Hals und öffnete die Bänder des Halfters, in dem seine lange Lanze steckte. Donner grollte. Der Reiter warf seinen langen Reitmantel zurück und tastete nach dem Griff seines Sichelschwertes. Er war jung und trug sein langes Haar zu einem Zopf gebunden, wie es bei seinem Volk üblich war. Das Pferd tänzelte. Der Steppenreiter schnalzte mit der Zunge und gab seinem Tier leicht die Fersen. In weitem Bogen umrundeten sie den Tempel, ohne dass der Reiter das zerfallene Mauerwerk auch nur eine Sekunde aus den Augen ließ. Es war einst ein Schirqu, ein Stufentempel gewesen, einer der bescheidenen Art, bei dem die oberen Stockwerke nur angedeutet waren und in denen die vier Hüter in einem einzigen Raum im Erdgeschoss verehrt wurden. Die falschen Stockwerke waren wohl schon vor vielen Jahren eingestürzt und hatten große Teile des eigentlichen Daches und eine Außenwand vollständig zerstört. Regen fiel durch die löchrige Decke in den verlassenen Götterraum, und dichtes Buschwerk wuchs aus den geborstenen Mauerresten. Der Reiter nahm die Lanze aus dem Halfter und beugte sich vor, um in den Tempel hineinzuspähen. Der hintere Bereich der Ruine lag in tiefen Schatten. Der Reiter schlug seine Kapuze zurück. Sein Pferd war immer noch unruhig. Er nahm seinen Schild vom Rücken und streifte ihn über den linken Arm. Vorsichtig ritt er näher an den verdunkelten Teil des Tempels heran. Bewegte sich dort etwas? Der Reiter ließ sein Pferd rückwärtsgehen und behielt den finsteren Raum im Auge. Dann wendete er sein Tier und umrundete den Tempel ein zweites Mal. Der Schirqu lag an einer Weggabelung. Ein Weg führte von Norden nach Süden, der andere bog nach Westen ab. Der Reiter suchte auf dem durchweichten Boden nach Spuren, aber dort war nichts zu sehen, außer den Tritten seines eigenen Pferdes. Er war unschlüssig. Er griff nach seinem Helm mit der furchterregenden Kriegsmaske, der am Sattel festgebunden war, ließ ihn dann aber doch dort hängen. Im Schritt umrundete er die Ruine ein drittes Mal, spähte erfolglos nach verräterischen Zeichen. Dann hielt er sein Pferd wieder an. Vor ihm klaffte der dunkle Eingang der Ruine. Sein Tier schnaubte. Er hieß es, still zu stehen, und legte sich die Lanze auf den Arm. Er war weit genug vom Tempel entfernt, um sein Tier für einen Angriff in Galopp zu versetzen, und er hatte genug Platz für einen schnellen Rückzug. Es war die vollkommene Ausgangsstellung für einen Kampf. Er lauschte. Unbewegt wie ein Standbild verharrten er und sein Tier im strömenden Regen. Ein Geräusch erklang aus den Schatten des Tempels. Es war der Huftritt eines Pferdes.
Der Reiter nahm seine Zügel fester und schüttelte sein nasses Haar. »Ich bin Koro von den Hakul«, rief er laut. »Wer immer dort ist, er möge sich zeigen!«
Eine schlanke Gestalt tauchte aus der Finsternis auf. Es war ein Mädchen, oder eher eine junge Frau, in ein schlichtes graues Gewand gekleidet und offensichtlich unbewaffnet. Der Hakul runzelte die Stirn. Ein Mädchen, allein in dieser Gegend? Sie war hübsch, wenn auch etwas zu mager für seinen Geschmack. Ihr dunkles Haar fiel glatt bis auf die Schultern, und ihr Gesicht war ebenmäßig und strahlte Ruhe aus. Sie hatte helle Augen, auch wenn der Reiter aus der Entfernung die Farbe nicht erkennen konnte. Sie mochten blau sein, oder grün.
»Bleib stehen!«, rief der Reiter. Die Seher hatten gesagt, das Mädchen habe grüne Augen. Er beugte sich unwillkürlich weiter vor, um sie besser zu sehen, und senkte dabei seine Lanze um eine Handbreit. »Bist du allein, Mädchen?«
»Nein, ist sie nicht«, sagte eine Stimme hinter dem Hakul. Koro riss gedankenschnell am Zügel, doch es war zu spät. Im Buschwerk war ein Mann aufgesprungen, bewaffnet mit einem starken Ast, den er jetzt dem Hakul in die rechte Seite rammte. Der Reiter verlor das Gleichgewicht. Sein Pferd scheute und warf ihn ab. Und dann war der Angreifer über ihm und stieß dem Gestürzten einen Dolch in die Brust. Als er die Klinge wieder aus dem Körper zog, blickte er dem Sterbenden in die brechenden Augen und sagte: »Bestelle in Ud-Sror, dass sie noch ein wenig länger auf Tasil aus Urath warten müssen!«
Dann war der Hakul tot. Der Kampf hatte nicht einmal drei Sekunden gedauert.
»Fang das Pferd ein, Kröte«, rief Tasil. Er sprang selbst vor, um es am Zügel zu packen. Aber das war ein Fehler. Das Tier scheute zurück und galoppierte laut wiehernd davon, den Weg zurück, den es gekommen war.
»Soll ich ihm nachreiten, Onkel?«, rief Maru.
Tasil blickte dem Tier kurz hinterher, dann winkte er ab. »Das war dein Fehler, und jetzt ist es zu spät. Sei’s drum. Ist nur schade um die Beute. Verdammt seien die Hakul und ihre störrischen Pferde! Hast du den Helm gesehen?«
Er wischte seinen Dolch am Mantel des Gefallenen ab. »Ein Späher, unerfahren, zu unserem Glück, aber leider auch nicht sehr wohlhabend.« Er untersuchte den Leichnam. Seine wertlosen Ringe aus Kupfer ließ er dem Toten. Dann sah er sich das Schwert an und schüttelte den Kopf. »Damit muss schon der Vater seines Großvaters gekämpft haben. Schartig und kaum zu gebrauchen.« Er zog den Dolch aus der Scheide und prüfte die Klinge. »Nur Bronze, und schon zu oft nachgeschliffen. Ich habe wahrlich schon bessere Arbeiten gesehen, aber immerhin, es ist ein Dolch der Hakul.«
»Wie friedlich er aussieht«, sagte Maru, die das Gesicht des Toten betrachtete. Der Regen schien den Schmerz fortgewaschen zu haben.
»Du brauchst ihn nicht zu bedauern, Kröte. Er hätte dich genauso gerne getötet wie mich.«
»Glaubst du, er war allein, Onkel?«
»Wahrscheinlich, er hat ein Jagdhorn am Gürtel. Wären andere Hakul in der Nähe, hätte er sie sicher gerufen.«
»Ich dachte, wir hätten sie abgeschüttelt«, sagte Maru niedergeschlagen.
»Haben wir auch, Kröte. Ich denke, sie haben sich aufgeteilt, um nach uns zu suchen. Sonst wäre dieser junge Kerl hier nicht alleine gewesen. Ich würde sagen, das ist gut für uns, denn solange sie einzeln kommen, werden wir mit ihnen fertig. Und jetzt hilf mir, wir wollen ihn dort drüben ins Moor werfen. Seine Seele ist fort. Soll sein Körper dort Ruhe finden.«
»Aber wie sollen wir hier die Nacht über rasten, wenn nebenan...« Maru vollendete den Satz nicht.
»Gar nicht, Kröte. Wir werden bald aufbrechen. Es kann nicht mehr weit sein.«
»Nach Ulbai?«
»Ich habe nicht gesagt, dass wir in die Stadt reiten.«
»Aber du hast jeden Bauern, den wir getroffen haben, nach dem Weg dorthin gefragt.«
»Natürlich, Kröte. Es ist mir nämlich lieber, die Hakul suchen uns dort, statt an dem Ort, an dem wir wirklich sind.«
Maru half Tasil widerstrebend, den Hakul ins Moor zu tragen. Der ganze Landstrich bestand fast nur aus Moor und Marschland. Hier und dort fanden sich leichte Bodenwellen, zu niedrig, um Hügel genannt zu werden, aber immerhin fester Grund. Der Schirqu stand auf so einem lang gezogenen Buckel, der sich weit nach Norden und Süden erstreckte. Sie waren in Awi, dem Wasserland. Der Boden schmatzte unter ihren Füßen, als sie die Böschung hinter sich ließen. Tasil suchte einen sumpfigen Tümpel.
»Dort hinein«, entschied er.
Maru tat es ungern, aber sie gehorchte. Der tote Körper schlug mit dumpfem Klatschen auf und begann sofort zu versinken. Eine Schar schwarzer Schwäne wurde offenbar durch das Geräusch aufgeschreckt. Sie erschienen wie aus dem Nichts und stoben mit rauschenden Flügeln und misstönenden Schreien davon. Maru schauderte.
»Es ist nur die Hülle, Kröte, also stell dich nicht so an«, meinte Tasil, der die Schwäne keines Blickes würdigte. Er zerbrach die Lanze des Hakul und warf sie weit ins Moor hinaus.
»Und jetzt pack unsere Sachen. Wer weiß, vielleicht sind doch noch andere Hakul in der Nähe.«
Ein heftiger Blitz zerriss den Himmel. Der Regen ging in ein Gewitter über.
Sie kehrten zurück zum Tempel. Maru warf einen Blick über die Schulter. Der Körper des Kriegers war bereits verschwunden. Tasil hatte gesagt, das sei nur eine leere Hülle. Aber dennoch fand sie es Unrecht, so mit einem Toten zu verfahren. Nach allem, was sie wusste, kamen die Hakul nach ihrem Tod nicht nach Ud-Sror, sondern auf eine weite grüne Ebene, über die sie mit Geisterpferden dahinjagten. Aber würde dieser Hakul auch dorthin gelangen, wenn er ohne jeden Ritus in einem Sumpfloch versenkt worden war? Oder würden seine Ahnen ihn an der Pforte abweisen?
Maru blieb stehen. Da mischte sich ein mahlendes Geräusch unter den Regen. Sie hob den Kopf. Jetzt war sie sicher.
»Es kommt jemand.«
Tasil lauschte. Nun war es nicht mehr zu überhören. Es war das laute Knarren eines schweren Rades auf seiner Achse. Vielleicht ein Ochsenkarren?
»Versteck dich dort drüben, Kröte, ich werde sie am Schirqu erwarten«, sagte Tasil schnell.
Maru lief hinüber und verbarg sich im niedrigen Buschwerk, dort, wo Tasil dem Reiter aufgelauert hatte. Das Knarren kam näher. Tasil tat gelassen. Er wählte einen halbwegs trockenen Platz unter dem zerstörten Dach des Tempels und wartete. Jetzt konnte man den zweirädrigen Karren sehen, der den langen Pfad von Norden heruntergekommen war und sich gerade eine Bodenwelle hinaufkämpfte. Es war ein Eselskarren, doch wurde er nicht von einem Tier, sondern von einem Mann gezogen. Hinten schob eine weitere Gestalt. Sie war viel zierlicher als der Mann an der Deichsel, eine Frau. Maru entdeckte drei Kinder, die unter der Plane des Wagens kauerten. Hakul waren das jedenfalls nicht.
»Wer kommt da?«, rief Tasil in den Regen hinaus.
Die Frau erstarrte. Sie bemerkte erst jetzt die Ruine und den Fremden, der sie dort im Halbschatten erwartete. Der Mann schlug seinen Umhang zurück und stolperte zum Wagen. Er zog einen kurzen Speer von der Ladefläche und hielt ihn drohend auf Tasil gerichtet.
»Ihr habt nichts zu befürchten«, rief Tasil ihnen zu.
»Wer ist da?«, rief der Mann.
»Ich bin ein harmloser Reisender, ich raste hier nur«, antwortete Tasil.
»Aber können wir dir trauen?«
»Wären wir Räuber, hätten wir euch längst überfallen.«
»Wir? Wer ist da noch?«
»Maru!«, rief Tasil.
Maru kam aus ihrem Versteck. Sie schlug ihren Überwurf zurück, damit der Mann erkennen konnte, dass sie nur ein Mädchen war. Das schien ihn halbwegs von ihrer Harmlosigkeit zu überzeugen. Er nahm die Deichsel wieder auf und zog den Wagen zur Ruine. Der Speer behinderte ihn dabei, aber er hielt ihn weiter in der Hand. Die Frau half ihm und redete beruhigend auf die Kinder ein. Maru sah, dass der Mann weder Bauer noch Handwerker war. Der Stoff seiner Kleidung war kostbar, wenn auch völlig verschmutzt, und auch das Gewand seiner Frau ließ darauf schließen, dass die beiden wohlhabend waren.
»Einen seltsamen Rastplatz habt ihr euch ausgesucht«, sagte der Mann. »Dieser Tempel ist verflucht, sagt man. Voller böser Geister. Habt ihr die schwarzen Schwäne nicht gesehen?«
»Schwäne?«
»Sieben waren es, doch sie flogen einzeln, nicht im Schwarm. Ein böses Zeichen an diesem Ort des Unheils.«
»Dem einen mag er Unheil bringen, den anderen Heil. Bis jetzt haben uns die Geister in Ruhe gelassen. Außerdem ist es halbwegs trocken.«
Maru musste wieder an den jungen Hakul denken. Wie gelassen Tasil das gesagte hatte: »Dem einen mag er Unheil bringen...«
»Habt ihr...«, der Mann stockte, blickte sich zu seiner Frau um. Sie nickte ihm zu. Er fuhr fort: »Habt ihr etwas zu essen?«
Tasil nickte bedächtig und fragte: »Könnt ihr denn zahlen?«
Der Mann schluckte und schwieg betroffen. Hatte er kein Geld? Seine Kinder, keines war älter als sieben oder acht Jahre, sahen hungrig aus.
»Verzeih bitte meinem Onkel diesen Scherz«, sagte Maru schnell, »ihr seid unsere Gäste und müsst natürlich nichts zahlen.«
Tasil warf ihr einen eisigen Blick zu, aber dann sagte er: »Setzt euch. Meine Nichte wird gerne noch etwas Holz für dieses Feuer suchen, an dem ihr eure Kleider trocknen könnt.«
Die Frau lächelte dankbar, doch der Mann warf ihr einen strengen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Es ist nicht nötig, dass du das Mädchen unseretwegen in den Regen schickst. Nur etwas zu essen, wenn ihr habt. Wir müssen gleich weiter.«
»Zu sehr in Eile, um ins Trockene zu kommen?«
Der Mann ließ sich doch überreden, wenigstens für kurze Zeit nach drinnen zu kommen. Das kleine Feuer, das Tasil und Maru dort am Morgen unterhalten hatten, war lange verloschen.
»Es lohnt sich nicht, es wieder anzufachen, Fremder, wir können hier nicht bleiben«, wiederholte der Mann.
Er wirkte gehetzt. Sein unruhiger Blick ging immer wieder über die Schulter zurück. Die Kinder drängten sich eng an ihre Mutter und sahen sich ängstlich um. Tasil entzündete das Feuer, was den Tempel in rötliches Licht tauchte. Maru fand ihn bedrückend. Er war stark verfallen, aber auch in seinen guten Tagen konnte er kaum viel besser ausgesehen haben. Sie hatte noch nie einen Schirqu gesehen, der so arm an Schmuck war. Nur die vier rußgeschwärzten Nischen an einer Wand wiesen darauf hin, dass hier einmal Opferfeuer für die Hüter gebrannt haben mochten. Die Statuen waren verschwunden. Obwohl der Fremde es nicht wollte, legte Maru einen Scheit Holz auf das Feuer. Er war nass. Dichter Rauch quoll auf. Tasil hatte am Morgen eine Wildziege gefangen und gebraten. Das Fleisch war kalt, aber die Fremden hielten sich nicht damit auf, es noch einmal zu wärmen.
Gegen alle Sitten wartete Tasil, der nichts aß, nicht ab, bis das Mahl beendet war, sondern begann gleich, seine Gäste auszufragen: »Deine Kleidung, die Gewänder deiner Frau – du siehst nicht aus wie ein Bauer oder Handwerker.«
Der Mann nickte. »Utaschimtu ist mein Name«, sagte er zwischen zwei Bissen. »Noch vorgestern war ich ein angesehener Richter in Ulbai. Doch Recht und Gesetz haben die Stadt verlassen, also werde ich nicht mehr gebraucht.«
Tasil stocherte im Feuer, als sei er nur mäßig interessiert. Aber Maru konnte ihm ansehen, wie neugierig er war. Ulbai, die Hauptstadt des Reiches, war nicht mehr fern.
»Kein Gesetz? Wie meinst du das?«, fragte er beiläufig.
»Du weißt, dass wir Krieg haben?«, fragte Utaschimtu.
»Das hat man mir erzählt«, erwiderte Tasil, »allerdings wissen die Bauern und Hirten in dieser Gegend nichts Genaues. Sie berichten von großen Schlachten, doch können sie meist nicht sagen, wo gekämpft wurde, oder gegen wen und warum. Sie sind nur sicher, dass der Kaidhan von Ulbai immer siegreich ist.«
Utaschimtu lachte bitter auf. »Das erzählen sie? Nun, das wundert mich nicht. Das ist es, was Luban-Etellu, unser hochgeborener Kaidhan, über seine Boten verkünden lässt. Lubans Männer schreiten von Sieg zu Sieg, so rufen sie es aus. Und sie suchen nach jungen Männern, die bereit sind, die Reihen des ruhmreichen Heeres zu verstärken.«
Tasil nickte nachdenklich. »Es schien mir da auch das eine oder andere, was ich hörte... nun, seltsam zu sein.«
»Ich bin Richter und gewohnt, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Du weißt, dass die Stadt Serkesch sich vom Reich losgesagt hat? Du weißt, dass der Verräter Numur den Krieg mit Ulbai begonnen hat?«
»So etwas in der Art kam mir zu Ohren«, erwiderte Tasil, so als wüsste er es nicht viel besser als der Richter selbst.
Maru hingegen zuckte unwillkürlich zusammen. Sie hatten es nicht nur gehört, sie waren dabei gewesen, als es begann. War es wirklich schon ein halbes Jahr her, seit sie das brennende Serkesch so fluchtartig hinter sich gelassen hatten?
Utaschimtu fuhr kauend fort: »Nun, der Kaidhan schickte sein Heer flussaufwärts, nach Norden, um den Verräter Numur zu unterwerfen. Zuerst kam die Meldung von einem Sieg bei Igaru, dann hieß es, die Serkesch seien bei Aqar Bairuti geschlagen worden. Schließlich wurde gemeldet, die Truppen des Kaidhans stünden kurz davor, die Stadt Esqu zu erobern – verstehst du, was ich meine, Fremder? Jeder dieser Orte liegt viel weiter südlich als der vorherige. Und wenn wir Esqu belagern, dann müssen es die Serkesch doch erst erobert haben! Und Esqu liegt schon in Aurica!«
Utaschimtu war aufgebracht. Tasil sah ihn aufmerksam an, dann sagte er: »Ich verstehe, wenn Numur wirklich Esqu genommen hat, dann hat er schon das halbe Reich erobert.«
»Das halbe? Was ist denn noch übrig? Esqu ging vor fünf Wochen verloren. Und jetzt wird Numur mehr durch die Sümpfe von Awi als durch die Krieger des Kaidhans aufgehalten.«
»Also seid ihr auf der Flucht vor Numur?«
»Nein, wir sind auf der Flucht vor Luban, der es nicht wert ist, den Namen seines großen Vorfahren Etellu zu tragen! Der Kaidhan begnügt sich nicht mehr damit, Hirten und Fischer mit Lügen in sein Heer zu locken – jeder Mann, der eine Waffe tragen kann, wird einberufen. Es würde ja angehen, wenn er dies mit Handwerkern und Bauern machte, aber selbst verdienstvolle Verwalter und Richter sind nicht mehr sicher! Ja, selbst die althergebrachten Unterschiede zwischen Kydhiern und Akkesch lässt er nicht mehr gelten. Er lässt Kydhier sein Heer befehligen und Akkesch müssen gehorchen. Er ist auch nicht besser als der Verräter Numur.«
Maru hatte den Mann bis jetzt bedauert, doch seine Überheblichkeit stieß sie ab. Utaschimtu setzte seinen Bericht fort. »Es war nicht leicht, aus der Stadt zu entkommen, das kannst du mir glauben, Fremder. Luban hat die Brücke über den Dhanis abgebrochen und den Hafen sperren lassen. Niemand darf die Stadt verlassen. Ich konnte einen Fischer bestechen, der uns auf die andere Seite brachte. Das kostete mich ein Vermögen. Ganz zu schweigen von dem, was ich alles zurücklassen musste. Was ich noch besaß, gab ich einem Bauern, der uns dafür diesen armseligen Karren überließ. Uns ist nicht viel mehr geblieben als das, was wir auf dem Leib tragen. Selbst um Essen müssen wir nun schon betteln.« Der Richter starrte zu Boden. Offensichtlich schämte er sich für seine Not.
»Was glaubst du, wann werden die Serkesch Ulbai erreichen?«, fragte Tasil. Das Schicksal der Flüchtlinge interessierte ihn ganz offensichtlich nicht.
Utaschimtu fing sich wieder. »Bist du auf dem Weg dorthin, Fremder? Dann kann ich dich nur warnen. Die Stadt wird bald belagert werden, aber sie wird sicher nicht schnell fallen. Ulbai war schon von jeher gut befestigt, und wir Akkesch haben sie in eine uneinnehmbare Festung verwandelt. Sie liegt hoch über dem Fluss, auf allen Seiten vom Wasser des Dhanis geschützt. Dennoch...«
»Du hast Zweifel?«
»Hunger und Krankheit machen nicht vor Mauern halt. Wer weiß, wie lange Ulbai einer großen Belagerung standhalten kann? Außerdem sind hier auch noch Kräfte am Werk, die ein armer Mensch wie ich nicht begreifen kann.« Er hielt inne. Dann fuhr er flüsternd fort: »Hast du von dem Gott gehört, der Numurs Heer vorangehen soll?«
»Ah, der neue Gott! Von dem haben auch die Bauern gesprochen, aber wie immer wussten sie nichts Genaues. Weißt du, was das für ein Gott ist?«
»Nein, Luban hat verboten, darüber zu sprechen. Ich selbst musste Männer zum Tode verurteilen, die es trotzdem taten. Ich weiß nur, dass dieser Gott Numur bisher immer den Sieg geschenkt hat. Er soll ein Diener des Kriegsgottes Strydh sein, so heißt es. Vielleicht ist es auch der Flussgott Dhanis, der sich an uns Akkesch rächen will, weil wir versuchen, ihn mit Gräben, Dämmen und Kanälen zu zähmen.« Der Richter schaute nachdenklich in das qualmende Feuer, dann stand er plötzlich auf. »Ich danke dir für das Mahl und das Feuer, Fremder, aber wir müssen nun weiter.«
»Weiter? Bei diesem Wetter? Wohin?« Tasils Erstaunen war dieses Mal echt.
»Wir sind hier nicht sicher. Ich war ein Hoher Richter des Kaidhans. Es ist möglich, dass er mir meinen Abschied weder erlaubt noch vergibt. Vielleicht lässt er mich verfolgen. Es ist besser, wir bringen möglichst viele Stunden zwischen uns und die Stadt. Und das empfehle ich dir übrigens auch, Fremder. Würde es nicht Tag und Nacht regnen, könntest du sehen, dass selbst die Sterne zittern. Schlimme Zeichen sind das. Luban und die große Stadt Ulbai sind dem Untergang geweiht. Glaube mir, es ist besser, nicht dort zu sein, wenn das geschieht.« Seufzend blickte er in den wolkenverhangenen Himmel. Der Schauer hatte kaum nachgelassen. »Wir ziehen weiter nach Süden, zur Küste. Vielleicht finden wir dort einen Fischer, der uns über das Meer bringt. Hier ist es jedenfalls nicht sicher. Und weil ich dir für deine Gastfreundschaft nichts geben kann, Fremder, warne ich dich. Die Krieger Lubans ziehen durch das Land. Sie werden sicher auch hierherkommen, und sie zwingen jeden unter Waffen, den sie finden. Warum kommt ihr nicht mit zur Küste? Gemeinsam wären wir sicher vor Räubern und Wölfen.«
»Ich danke dir für dein Angebot, Utaschimtu, doch gedenke ich, einen anderen Weg einzuschlagen.«
»Nun, ich habe dich gewarnt, mehr kann ich nicht tun.«
Dann nahm Utaschimtu die Deichsel wieder auf, und mit einem lauten Knarren setzten sich die schweren Räder in Bewegung. Als sie außer Sichtweite waren, sagte Tasil: »Lösch das Feuer, Kröte, wir brechen auf.«
»Nach Ulbai, Onkel?«, fragte Maru, während sie Erde über die Flammen häufte, um sie zu ersticken.
»Lass dich überraschen«, sagte Tasil grinsend.
Das Dorf im Strom
Klopfe an einen Baum, und höre, wie es klingt.
Maru spähte unter ihrer Kapuze aufmerksam nach rechts und links. Ihr Pferd trottete durch den Regen, der seit Stunden und Tagen die Welt in Morast verwandelte. Es würde bald Abend werden. Die Tritte ihres Pferdes waren schwer, denn der Boden war durchweicht, so dass man tief einsank. Marus Wollmantel war völlig durchnässt. Sie war müde, wie ihr Reittier, aber unruhig. Sie wusste, wo sie waren. Das Fenn, nannten es die Bauern. Sie hatten noch Beinamen dafür: Das Verfluchte, das Endlose oder einfach das Schwarze Fenn. Und ausgerechnet in diesen Sumpf führte Tasil sie nun hinein. Maru fühlte sich unwohl. Sie spürte eine ungute Spannung in der Luft, die sie nicht erklären konnte. Es ging nicht in die Große Stadt Ulbai, wie sie geglaubt hatte. Sie hatten den schmalen Weg eingeschlagen, der am Schirqu in den Wald abzweigte. Er war eine Weile einem flachen, aber breiten Hügel gefolgt und hatte sie schließlich auf einen alten Dammweg geführt, der sich lange durch sumpfiges Gelände und dann hinaus in den Strom schlängelte. Der Dhanis hatte sie wieder, der mächtige Strom, dem sie vor einem halben Jahr den Rücken gekehrt hatten, der Fluss, den die Kydhier Vater des Landes nannten. Sie waren an einem seiner Seitenarme, den die Bauern den Schwarzen nannten. Als Maru das dunkle Wasser sah, das sich zwischen den Schilfinseln hindurchschlängelte, wusste sie, warum. Aber es war beileibe nicht die Farbe des Stroms, die sie beunruhigte. Nein, es ging ein Gerücht um im Wasserland: Von einer gewaltigen Seeschlange, einer Awathani, die nach jahrhundertelangem Schlaf wieder erwacht sei. Die Bauern sprachen eigentlich von nichts anderem. Viel wussten sie nicht darüber, und schon gar nichts Genaues. Sicher waren sie nur, dass der Krieg, der das Reich zerriss, die Schläferin geweckt hatte. Und sie waren sich einig, wo das Untier zu finden war: Im Schwarzen Dhanis. Und genau da waren sie nun. Auf einem alten Damm, der hineinführte in den endlosen Sumpf, den der Strom hier mit tausend Armen durchzog.
Vor ihnen tauchte jetzt ein hoher Zaun auf. Maru hatte schon Zweifel bekommen, ob der Dammweg sie wirklich an ihr Ziel führen würde, aber jetzt waren sie offensichtlich irgendwo angekommen. Tasil hielt sein Pferd an. Der Weg endete an einem hölzernen Tor. Rechts und links davon zog sich ein hohes, aber nicht sehr starkes Gatter die Böschung hinunter bis ins Schilf und weiter ins schwarze Wasser. Tasil sah sich um. Ein Stück Holz baumelte an einem Strick neben dem Tor. Tasil nahm es und schlug damit auf die große Baumscheibe, die offensichtlich zu diesem Zweck dort aufgehängt war.
Nach wenigen Augenblicken zeigte sich ein Gesicht zwischen den Stäben des Tors. »Wer seid ihr, und was wollt ihr?«, fragte eine dünne Stimme.
»Wir sind Reisende und suchen Unterkunft für die Nacht.«
»Für eine Nacht?«
»Das sagte ich, ja.«
»Wie sind eure Namen? Wo kommt ihr her? Und was ist euer Ziel, Fremder?«
»Ich bin Tasil aus Urath, und das ist meine Nichte Maru. Wir wollen zur Stadt Ulbai.«
Das Tor öffnete sich einen Spalt. Dahinter zeigte sich ein Gesicht.
»Deine Nichte?«
»Ja, meine Nichte.«
»Kann ich sie sehen?«
Tasil starrte den Mann an. Es regnete in Strömen. Tasil winkte Maru nach vorn. Vorsichtig lenkte sie ihr Pferd an seine Seite. Der Weg war schmal und rutschig und die Böschung hinunter in den Sumpf steil. Das Tor öffnete sich noch etwas weiter. Ein Mann sah hervor. Er trug einen flachen Schilfhut und einen Strohmantel. Er war barfuß und hüpfte jetzt über die Pfützen hinaus auf den Weg. Er starrte Maru mit zusammengekniffenen Augen an. Regen lief ihm ins Gesicht.
»Ein Mädchen«, stellte er schließlich fest. »Und sie ist sicher nicht deine Frau?«
»Nein, meine Nichte, und sie würde die Nacht gern im Trockenen verbringen, genau wie ihr Onkel«, sagte Tasil ungeduldig.
»Aus Urath, sagst du. Liegt das im Norden?«
»Nein, im Süden«, erwiderte Tasil.
»Und da kommt ihr jetzt her?«
»Mehr oder weniger. Mann, wie lange willst du uns hier noch im Regen warten lassen?«
»Wir haben es gleich, wir haben es gleich«, beschwichtigte ihn der Wächter. »Seid ihr unterwegs jemandem begegnet? Kriegern vielleicht? Aus Ulbai? Oder von anderswo?«
»Nur einem Bauern, der uns gesagt hat, wo wir dieses Dorf finden«, erwiderte Tasil, »und das war gut so. Der Weg hierher ist in einem so erbärmlichen Zustand, dass ich mich schon fragte, ob an seinem Ende wirklich jemand wohnen kann.«
Maru saß auf ihrem Pferd und wartete. Der Pfad war wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Sie waren ihm über eine ganze Anzahl kleinerer und größerer Inseln hinaus in den Fluss gefolgt. Zwischen den Eilanden hatte man einst Dämme angelegt, aber die waren teilweise weggespült oder abgetragen worden. Mehrfach hatten sie absteigen und ihre Tiere durch sumpfige Rinnsale führen müssen. Bis zu den Hüften waren sie durch Schlamm gewatet. Maru hatte nasse Füße und Hunger. Aber natürlich musste der Torwächter seine Fragen stellen, auch wenn es teilweise ziemlich seltsame Fragen waren. Das waren unruhige Zeiten, und die Welt außerhalb der Dörfer war gefährlich.
Dem Wächter schien zu gefallen, was Tasil sagte, denn er grinste breit. »Dann komm herein, Tasil aus Urath, wir werden schon ein trockenes Plätzchen für dich und deine Nichte finden. Nach Ulbai würdet ihr es heute ohnehin nicht mehr schaffen.«
Er hüpfte über die Pfützen zurück zum Tor und öffnete es. Maru begriff jetzt, warum Tor und Zaun so schwach befestigt waren. Sie schützten nicht mehr als einen kleinen, schilfgedeckten Unterstand. Dahinter begann eine Rampe, die nach wenigen Schritten im Nichts endete. Im strömenden Regen konnte Maru die Umrisse einer Insel ausmachen, die durch einen schmalen Flussarm vom Dammweg getrennt war. Sie war von einem weiteren Zaun geschützt. Der Wächter sprang in seine kleine Hütte und schlug einen blechernen Gong an.
»Was gibt es?«, rief eine Stimme von drüben.
»Zwei Reisende. Ein Mann und seine Nichte. Ein Mädchen.«
»Ein Mädchen?«
»Ja. Seine Nichte.«
Ein durchdringendes Knarren ertönte, und ein Teil des Zaunes senkte sich nach vorne herab. Maru erkannte erstaunt, dass es eine Zugbrücke war. Sie war nicht sehr breit. Sie mussten hintereinander darüberreiten. Auf der anderen Seite wurden sie von einem weiteren Mann erwartet. Er stand unter einem stark befestigten Holztor. Der ganze Zaun bestand aus dicken Stämmen, er wirkte fast wie eine Mauer. Von der Brücke aus sah Maru, dass unterhalb dieser Wehrmauer spitze Pfähle schräg aus dem Wasser ragten. Ihr Pferd stampfte unruhig auf der Stelle. Maru fragte sich, was das Tier so erregen mochte. Der Mann da vor ihr war es sicher nicht. Er fragte noch einmal nach ihrem Namen.
»Tasil und Maru aus Urath«, wiederholte er, wie um sie sich einzuprägen. »Willst du nach Ulbai, um deine Nichte einem Manne zu geben?«
Maru starrte den Wächter verblüfft an. Das war eine seltsame Frage, selbst für einen Awier.
Auch Tasil wirkte befremdet. »Nicht, dass dich das etwas anginge, ehrwürdiger Torwächter, aber wir reiten nicht in die Hauptstadt, um Hochzeit zu feiern. Es wäre doch auch ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt, oder?«
»Natürlich, natürlich«, sagte der Mann hastig. »Falsche Zeit, schlimme Zeit... der Krieg, ich verstehe«, sagte er und begann, die knarrende Zugbrücke wieder hochzuziehen.
»Gibt es also einen trockenen Platz für uns und unsere Pferde?«
»Den gibt es, natürlich. Wir haben zwar keine vornehme Herberge, wie du sie vielleicht aus der Stadt kennst, doch werdet ihr, so hoffe ich, zufrieden sein. Geht hier links hoch bis zur Edhil-Säule. Dort seht ihr auf der rechten Seite ein lang gestrecktes Haus. Es gehört Skef. Wenn ihr ihn fragt, wird er nichts dagegen haben, dass ihr eure Pferde dort unterstellt. Fragt ihn dann nach dem Haus von Hiri. Dort werdet ihr einen Schlafplatz finden. Dann geht weiter, zur Mitte der Insel ins Samnath und stellt euch den Ältesten vor. So ist es Brauch. Ich werde euch dort einstweilen ankündigen.« Und mit diesen Worten sprang er über die Pfützen davon. Sie stiegen von ihren Pferden und zogen sie am Zügel durch das Tor. Der Boden war zwar schlammig, aber er wirkte viel vertrauenerweckender als der Sumpf, den sie jetzt endlich hinter sich ließen. Eigentlich sollte die Aussicht auf ein trockenes Plätzchen sie doch froh stimmen, aber Maru fühlte eine ungewisse Beklemmung, als sie durch das Tor schritt. Sie konnte es sich nicht erklären und schob es schließlich auf den leichten, süßlichen Verwesungsgeruch, der aus dem Sumpf aufstieg.
Sie zogen ihre Pferde den leichten Hang hinauf Richtung Inselmitte. Das Dorf bestand aus einer Ansammlung dicht gedrängter Hütten, wie Maru sie noch nie gesehen hatte. Es waren schilfgedeckte Pfahlbauten, hoch genug gebaut, dass die Wohnräume selbst bei einem starken Hochwasser noch trocken stehen würden. Schweine und Ziegen tummelten sich in Gattern unter den Behausungen. Maru fragte sich, ob die Bewohner sie mit in die Hütten nahmen, wenn der Fluss es verlangte. Etwas anderes beschäftigte sie aber noch mehr: »Ist das nicht seltsam, Onkel? Die Wächter haben uns hineingelassen, ohne dass du sie bestechen musstest. Sie haben noch nicht einmal Wegezoll verlangt.«
Tasil nickte. »Gut beobachtet, Kröte, aber für den Augenblick soll es mir recht sein. Ich will nicht noch eine Nacht im Nassen schlafen.«
Da war Maru mit ihm einer Meinung. Sie ritten seit Tagen durch Awi, und Maru verstand jetzt, warum man es das Wasserland nannte. Wenn es nicht regnete, nieselte es, und wenn es nicht nieselte, schüttete es wie aus Eimern. Wenn es wirklich einmal weder schüttete noch regnete, noch nieselte, dann dampfte die Luft in brütender Hitze, und das Atmen fiel schwer. Es wurde dann so unerträglich schwül, dass man sich bald wünschte, es würde wieder regnen. Überhaupt schien es in Awi mehr Wasser als Land zu geben. Jedem See folgte ein Teich oder Tümpel, und wenn man einen Bachlauf überquert hatte, wartete sicher schon der nächste Fluss, den man durchschwimmen musste. Und das »Land« schien nur aus Morast, Sümpfen, Mooren und Marschen zu bestehen. Es war ein Wunder, dass hier überhaupt Menschen leben konnten – und wollten.
Die Edhil-Säule tauchte vor ihnen auf. Sie war aus Holz, schmal und mit vielen Zauberzeichen verziert. Skefs Haus war nicht zu verfehlen. Es war mit Abstand das größte am Platz, der die Säule umgab. Skef selbst entpuppte sich als einsilbiger, aber freundlicher Mann, der ihre Pferde ohne Umstände unter seiner Hütte unterbrachte. Der Stall war geräumig, und der Boden seiner Hütte lag hoch genug für ihre Reittiere. Er verlangte nur ein Segel Kupfer für jedes Pferd und jede Nacht. Tasil gab ihm für die erste Nacht drei, woraufhin Skef anbot, die Tiere auch noch selbst mit Stroh trockenzureiben. Er schickte Tasil und Maru dann weiter zu Hiri, einer Frau, die fast genauso breit wie hoch war. Auch sie erwies sich als freundlich. »Wir haben nicht oft Gäste in unserem Dorf, und eine richtige Herberge gibt es gar nicht. Aber ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was ich euch anbieten kann«, schnaufte sie kurzatmig, als sie ihnen ihr Nachtlager zeigte.
Missmutig betrachtete Tasil ihre Unterkunft. Er legte unter normalen Umständen großen Wert auf eine eigene, abgeschiedene und vor allem verschließbare Kammer. Aber hier gab es nur offene, hölzerne Verschläge. Maru war das gleich, Hauptsache, es war trocken. Hiri hatte Tasils Blick gesehen und richtig gedeutet. »Es tut mir leid, wir sind nicht für hohen Besuch eingerichtet. Wie gesagt, es kommen nicht oft Reisende hierher. Früher habe ich hier meine Ziegen gehalten, aber dann ist mein Mann, dieser Narr, ertrunken.« Hiri seufzte, fuhr aber fort: »Und was für meine Ziegen gut war, kann doch für Menschen nicht schlecht sein, oder?«
»Und wo sind die Ziegen jetzt?«, fragte Tasil, der versuchte, Hiris Gedankensprüngen zu folgen.
»Ich habe sie meiner Ältesten geschenkt. Was soll ich alte Frau mich noch mit den störrischen Viechern abplagen?«
»Wir sind wohl nicht die einzigen Gäste«, sagte Tasil, der sich die anderen Verschläge ansah.
Auch Maru hatte gesehen, dass dort Decken ausgebreitet waren. Ein großer Akkesch-Schild lehnte an einer hölzernen Wand.
»Ja, mit euch sind es jetzt acht«, sagte Hiri. »So viele Fremde waren hier seit Jahren nicht mehr.«
Hiri bot ihnen auch etwas zu essen an, riet ihnen aber, zuerst zum Samnath zu gehen: »Dort sitzt der Rat der Ältesten und des Edalings, und sie mögen es nicht, wenn sich Fremde nicht gleich bei ihnen melden.«
»Was ist ein Edaling?«, fragte Maru.
»Oh, er ist der Wächter des Schreins und der Hüter der Riten. Er wohnt im Haus der Ahnen, und er ist derjenige, der für uns mit ihnen spricht.«
»Also ein Priester?«, fragte Maru.
»Wenn du so willst. Aber eigentlich trifft es das nicht. Schon gar nicht bei Hana.« Hiri schien nicht allzu viel von ihm zu halten. »So ist das eben mit alten Bräuchen. Manchmal folgt man ihnen einfach zu lange. Sein Großvater war Edaling, und sein Vater auch. Und dann eben Hana. Na ja, du wirst ihn kennen lernen. Ihn und die anderen.«
Maru hängte ihre Sachen zum Trocknen über die niedrigen Bretter des Verschlags.
»Gibt es hier einen Tempel?«, fragte Tasil unvermittelt.
»Einen Tempel? Es gibt das Schreinhaus für Dhanis, wo wir ihn und unsere Ahnen verehren, aber einen Tempel? Nein«, sagte Hiri.
»Kein Schirqu für die Hüter?«, fragte Maru erstaunt.
»Wozu? Die Hüter schlafen – warum sollten wir sie mit unseren Gebeten belästigen? Wir verehren Edhil, den Schöpfer der Welt, und Dhanis, den Vater unseres Landes. Andere Götter brauchen wir nicht«, sagte Hiri. Dann schlug sie sich auf die Stirn: »Aber halt, wo habe ich meine Gedanken? Es gibt einen Tempel. Drüben, auf dem Festland. Den hat vor vielen Jahren ein Abeq aus Ulbai eigenhändig errichtet. Aber es wurde ihm bald zu einsam dort, und unser Wetter bekam seinem Schirqu nicht. Er ist eingestürzt. Ihr müsstet ihn gesehen haben, er liegt an der Weggabelung.«
Das war also der Tempel, an dem sie den Hakul getötet hatten. Tasil schien über die Auskunft enttäuscht zu sein.
Hiri half Maru, die Decke auszubreiten. Sie setzte ihren Gedankengang fort: »Es ist Regenzeit. Alle sitzen im Samnath und warten, dass Fahs die Schauer endlich weiterziehen lässt.«
Regenzeit – Maru fand, das war eine sehr angemessene Beschreibung. »Hört es denn irgendwann auf?«, fragte sie.
»Natürlich«, sagte Hiri lächelnd, »heute vielleicht nicht mehr, aber der Regenmond ist im letzten Viertel. In vier Tagen kommt der Neue Mond und...«, sie stockte plötzlich.
»Ja?«, fragte Maru.
»Nichts. Dann wird es trockener, und es kommt die Zeit der Aussaat. Sonst nichts«, sagte Hiri, die es plötzlich sehr eilig hatte, zurück ins Haus zu kommen. Sie ließ ihre Gäste einfach stehen, und dann hörten sie, wie sie schnaufend die schmale Treppe nach oben hinaufstieg.
»Ist das nicht eigenartig, Onkel?«, fragte Maru, als die Tür oben ins Schloss fiel.
Tasil antwortete mit einem Achselzucken: »Awier«, sagte er dann, »ein seltsames Volk. Es heißt, sie seien vom selben Blut wie die Dhanier, vielleicht stimmt das. Auf jeden Fall aber ist dies das Dorf, das ich gesucht habe.«
Maru runzelte die Stirn. Das Dorf sah armselig aus. Was wollte Tasil hier? Sie hatte ihn unterwegs danach gefragt, aber wie immer keine befriedigende Antwort bekommen.
Sie zogen trockene Kleider an. Maru musste lächeln, als sie in ihr graublaues Garwan schlüpfte. Es war eigentlich nichts Besonderes, ein schlichtes ärmelloses Gewand, das knapp über den Knien endete und als einzige Zier einen schmalen Gürtel hatte. Aber es war noch nicht lange her, da hatte sie nur ein einziges Kleid besessen, und das hatte mehr von einem Sack als von einem Gewand gehabt. Jetzt besaß sie drei. Tasil hatte Wort gehalten. Als sie vom Grab Utus flohen, war ihr erstes Ziel eine Siedlung der Salzleute gewesen, wo Tasil ein Pferd und, wie versprochen, auch bessere Kleider für sie gekauft hatte. Sie waren dann nach Süden geritten, weiter durch das Land der Romadh, immer am Rand der Balas, der Salzwüste, entlang. Am Anfang hatte Tasil zur Eile getrieben. Doch nach und nach war klar geworden, dass sie nicht verfolgt wurden. Maru wusste inzwischen, dass man in Serkesch andere Sorgen hatte. Krieg war ausgebrochen, und sie war froh um jede Stunde, die sie sich vom Reich entfernten. Über sein Ziel hatte sich Tasil lange in Schweigen gehüllt. Er schien etwas abzuwägen und führte Selbstgespräche in dieser Zeit. Schließlich waren sie in den Vorbergen der Imuledh angekommen. Hier hatte er eines Morgens die großen Leinensäcke mit der Beute aus dem Grab Utu-Hegaschs geschultert und war zwischen den Felsen verschwunden. Maru hatte einen ganzen Tag gewartet. Dann war Tasil zurückgekommen – ohne die Säcke. Wo er sie versteckt hatte, oder zu welchem Zweck, darüber schwieg er sich aus. Bis dahin hatten sie ein bequemes Leben geführt, sie hatten weder stehlen noch irgendwelche Gräber ausrauben müssen, und hatten sich vom Reich der Akkesch ferngehalten. Das änderte sich nun. Tasil nahm den Weg nach Aurica, und das gehörte dem Kaidhan. In Aurica gab es nicht viel, außer Schafherden, armseligen Dörfern, Wind – und Hügelgräbern. Die waren alt, sehr alt. Tasil hatte ihr gezeigt, wie man einen Raubschacht so anlegte, dass er nicht über einem zusammenfiel, und wie man die Steinmauern des eigentlichen Grabes öffnete, ohne das, was dahinter lag, zu beschädigen. Trotz seiner Umsicht und Erfahrung war die Ausbeute mager gewesen. Manche Gräber waren schon geplündert. In den anderen fanden sie oft nur alten Bronzeschmuck, den sie einschmelzen mussten, weil er sie sonst verraten hätte. Es gab weder Silber noch Eisen in diesen alten Gräbern. Es war mühselig und enttäuschend. Tasils Laune hatte sich von Tag zu Tag verschlechtert. Und dann hörten sie das Gerücht: Fremde Reiter seien aufgetaucht, in schwarzen Mänteln und mit schrecklichen Masken statt Gesichtern. Und sie suchten nach einem Mörder, einem Grabschänder, einem Südländer, der mit einem grünäugigen Mädchen reiste. Die Hakul hatten ihre Spur gefunden! Und so war aus ihrer Wanderung wieder eine Flucht geworden. Zuerst waren sie nach Süden geflohen, doch dann, eines Morgens, hatte Tasil eine neue Richtung eingeschlagen. Das war in einer Hafenstadt am Schlangenmeer gewesen, nach einem Abend, an dem sich Tasil lange mit einem Mann aus Ulbai, einem Schreiber, unterhalten hatte. Aber natürlich hatte er ihr nicht verraten, worüber er mit diesem Mann gesprochen hatte.
»Trödel nicht, Kröte, wir werden erwartet«, riss sie Tasil schließlich aus ihren Gedanken.
Es war inzwischen dunkel geworden, und der Regen hatte etwas nachgelassen. Das Samnath lag in der Mitte der Insel, an ihrem höchsten Punkt. Es war ein großes Gebäude mit dem üblichen, dick gedeckten Schilfdach. Seine Holzwände waren durch viele schmale Schlitze unterbrochen. Lichtschein drang nach draußen. Drinnen sprach jemand, es war der typische Tonfall eines Erzählers. Maru blieb stehen. Diese Stimme… »Hörst du das, Onkel?«
Tasil runzelte die Stirn. »Es klingt zumindest sehr ähnlich.«
Als Maru über die Schwelle trat, war sie sich schon sicher. Einige Laternen erhellten das Samnath, aber ihr Licht war schwach und der Saal voller Schatten. Viele Menschen waren dort versammelt, Männer zumeist, die alle gebannt in die Mitte des Raumes starrten. Dort stand er: Biredh! Der blinde Erzähler gab eine seiner Geschichten zum Besten. Maru war so überrascht, ihn hier zu treffen, dass sie zunächst gar nicht darauf achtete, was Biredh zu erzählen hatte. Er war in seinem Element. Seine Stimme schien wie ein lebhafter Vogel durch die Halle zu flattern. Die Zuhörer hingen an seinen Lippen. Und jetzt nahm auch Maru den Faden der Geschichte auf. »... und sie kämpften wie Löwen, Malk Numur und Immit Schaduk«, erzählte Biredh. »Unter dem Tor des Brond stießen die beiden Recken zusammen. Und um sie herum stand die Stadt in lodernden Flammen.«
Maru traute ihren Ohren nicht. Biredh berichtete aus Serkesch!
»Und Numur durchbohrte zehn Krieger aus Ulbai mit seiner Lanze, und Schaduk erschlug zehn Männer Numurs mit seinem Schwert. Endlich aber standen sie einander gegenüber.«
Maru konnte nicht glauben, was sie da hörte: Der Immit? Gekämpft wie ein Löwe? Dieser schmächtige alte Mann war doch wohl kaum in der Lage gewesen, ein Schwert zu führen, und sicher war er außer Stande, Männer damit zu erschlagen. Sie erinnerte sich an das Bild, das der Daimon ihr gezeigt hatte: Schaduk, der halb verbrannt unter dem Tor gelegen hatte, und seine Frau, die schöne Umati, die verwundet zwischen toten Kriegern stand. Biredh nahm sich für seine Erzählung offenbar einige Freiheiten heraus.
»Und der Immit holte zu einem gewaltigen Streich aus und sprang auf Numur los, und mit seinem Hieb zerschmetterte er den Schild des Malk.« Ein Aufschrei lief durch die gebannt lauschende Menge. »Aber dabei zerbrach nicht nur der Schild, auch das Schwert zersprang in des Immit Hand! Und so stand er Numur gegenüber, ohne Schwert, mit zerfetzter Rüstung. Ein wehrloser Mann. Doch Numur ist nicht von jener Art, die Mitleid kennt. Er hob den siegreichen Speer seiner Ahnen und durchbohrte den Leib seines Feindes.«
Wieder erklangen Schreie. Die Spannung im Saal war mit Händen zu greifen.
»Und Schaduk brach zu Füßen des Abtrünnigen zusammen. Sterbend aber sagte er zu Numur: ›Edler Malk, du hast meine Krieger getötet und nun auch mich überwunden, aber was ist dein Sieg wert? Sieh, deine Stadt steht in Flammen, und ihre Mauern zerbersten. Bald schon wird nichts von ihr übrig sein als Asche und Staub.‹ Und dann starb Immit Schaduk.«
Maru glaubte, vereinzelt leises Schluchzen zu hören.
»Und Malk Numur blickte sich um und sah, dass der Immit wahr gesprochen hatte. Da packte ihn große Wut. Er hob den Speer mitsamt dem gewaltigen Leib des Immit auf und rief: ›Soll es so sein, dass ich einen Sieg erringe, der mir nun unter den Händen zerrinnt? Hört keiner meiner Ahnen die Klagen meiner Stadt? Will keiner meiner Vorfahren eine Hand für Serkesch rühren, die Stadt, die wir, aus dem Hause Hegasch, mit unseren eigenen Händen gebaut haben?‹ Und mit diesen Worten rammte Numur den Speer seiner Vorfahren in die Erde, dass sie erbebte! Da erhörten seine Vorfahren sein Flehen, denn dort, wo Numur noch am selben Morgen den Körper seines geliebten Vaters zur ewigen Ruhe gelegt hatte, da erzitterte der Fels, und plötzlich brach er auf – und aus dem Grab von Raik Utu spie das Gestein eine große Woge Wassers hinaus! Und der Bach, der Jahrhunderte versiegt war, er sprudelte wie nach einem großen Regen! Das Wasser strömte durch das Tal der Gräber und hinaus zur Stadt Serkesch. Und es wird erzählt, dass Utu die Toten aus den Gräbern erweckte und sie aussandte, um die tausend Brände in der Stadt zu löschen. Denn als alle Flammen erstickt waren, da fand man viele Knochen auf den Straßen. Und die Serkesch fragten: ›Wie kann das sein? Woher kommt dieses Wasser, und wie konnten die Toten uns helfen?‹ Und Malk Numur antwortete: ›Habt ihr es nicht gesehen? Utu, mein Vater, Ahngott der Stadt, hat sich erhoben. Er hat die Toten zu Hilfe gerufen und uns Wasser gebracht in der Stunde der Not. Wahrhaftig – er ist ein Gott.‹ Da rief ein Fischer: ›Ich habe den Leib des Ahngottes gesehen. Er trieb mit dem Wasser hinaus auf den Dhanis und fort nach Süden.‹ Da traten die Priester aller Tempel zusammen. Sie deuteten die Zeichen und einig waren sie, wie nie zuvor. Der Oberste von ihnen, Mahas, der Diener Strydhs, sprach: ›So ist es der Wille von Gott Utu, dass wir seinem Leib nach Süden folgen und nehmen, was uns zusteht. Denn in Ulbai verehren sie Strydh nicht und sie lachen über ihn. Aber Utu, Strydhs Diener, wird ihnen das Lachen austreiben.‹ Und keiner war in Serkesch, der an seinen Worten zweifelte. Also nahmen sie ihre Schwerter und Schilde und zogen in den Krieg. Ihr Gott Utu aber schritt ihnen voran, und als die Akkesch aus Ulbai seiner angesichtig wurden, da warfen sie ihre Waffen fort und flohen. Und seither folgen die Serkesch ihrem neuen Gott den Fluss hinab – und schreiten von Sieg zu Sieg zu Sieg.«
Betretene Stille hatte sich im Samnath ausgebreitet.
»Er ist immer noch ein guter Erzähler«, murmelte Tasil anerkennend.
»Aber Onkel!«, flüsterte Maru, »das Wasser... aus dem Grab – das waren doch wir!«
Tasil betrachtete sie mit einem durchdringenden Blick. »So? Waren wir das? Es geschah doch erst, als ich das Grab schon verlassen hatte. Was genau ist eigentlich damals geschehen, Kröte?«
Das war nun eine Frage, die Maru auf keinen Fall beantworten wollte.
»Ich danke dir, alter Mann, du hast den Kindern Angst gemacht«, sagte eine höhnisch klingende Stimme vom Kopfende des Samnath. Dort, auf den Ehrenplätzen, saßen vier Männer. Es waren wohl die Ältesten, von denen der Wächter gesprochen hatte. Drei waren im Greisenalter, oder kurz davor, aber einer war viel jünger, sicher kaum dreißig. Er war dicklich und rotgesichtig, und er war es, der gerade gesprochen hatte.