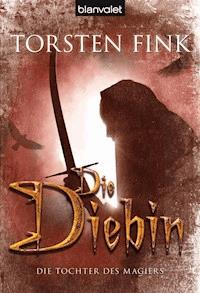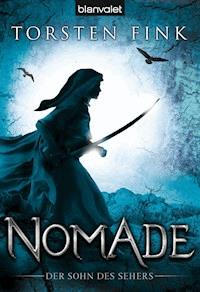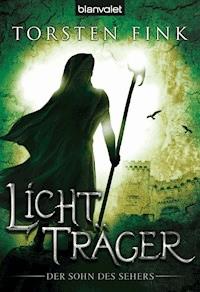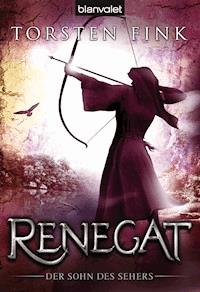Die Tochter des Magiers Band 1-3: Die Diebin / Die Gefährtin / Die Erwählte (3in1-Bundle) E-Book
Torsten Fink
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine Sklavin, doch in ihren Adern fließt das Blut mächtiger Magier!
Maru ist von Geburt an eine Sklavin. Auf sie wartet der Dienst in der Palastküche oder auf den Feldern vor der Stadt. Bis sie eines Tages an den skrupellosen Grabräuber Tasil verkauft wird – der Maru als Marionette in seinem gefährlichen Spiel um Reichtum und Macht missbraucht. Und auch der uralte Dämon Utukku entwickelt Interesse an der jungen Frau. Denn Utukku hat erkannt, dass in den Adern der Sklavin das Blut der mächtigen Magier der Sümpfe fließt …
Die große Trilogie in einem Band: 1. Die Diebin, 2. Die Gefährtin, 3. Die Erwählte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1710
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Maru ist eine Sklavin. Auf sie wartet der Dienst in der Palastküche oder auf den Feldern vor der Stadt. Bis sie eines Tages an den skrupellosen Grabräuber Tasil verkauft wird – der Maru als Marionette in seinem gefährlichen Spiel um Reichtum und Macht missbraucht. Und auch der uralte Dämon Utukku entwickelt Interesse an der jungen Frau. Denn Utukku hat erkannt, dass in den Adern der Sklavin das Blut der mächtigen Magier der Sümpfe fließt …
Autor
Torsten Fink, Jahrgang 1965, arbeitete lange als Texter, Journalist und literarischer Kabarettist. Er lebt und schreibt heute in Mainz.
Von Torsten Fink bereits erschienen:
Die Tochter des Magiers (Einzelbände)
1. Die Diebin
2. Die Gefährtin
3. Die Erwählte
Der Sohn des Sehers
1. Nomade
2. Lichtträger
3. Renegat
Schattenprinz-Trilogie
1. Der Prinz der Schatten
2. Der Prinz der Klingen
3. Der Prinz der Skorpione
Der Prinz der Rache
Tochter der schwarzen Stadt
Der Erbe des Skorpions
Unter dem Pseudonym Arthur Philipp veröffentlicht:
Die Feja-Trilogie
1. Die Dunkelmagierin
2. Die Feuerdiebin
3. in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
TORSTEN FINK
DIE
TOCHTER
DES
MAGIERS
Die komplette Trilogie in einem Band
Glossar
Begriffe
Abeq – Priester, »Vater« (Plural: Abeqai)
Abeq-ut-Abeqai– Hohepriester
Ahngötter – die zu Göttern aufgestiegenen Raik von Serkesch
Alfhold – Geist, guter Geist (Daimon)
Alfskrol – böser Geist, Unhold (Daimon)
Ansai – Einheit von sechzig Mann (fünf Eschet)
Bet Raik – »Haus des Fürsten«, Palast
Bet Tabihu – »Haus des Schlachters«, ein Beiname für den Tempel Strydhs, den man besser nicht in Gegenwart seiner Priester verwendet
Bet Ulmu – »Haus der Axt«, der Akkesch-Beiname für den Tempel Strydhs
Daimon – Dämon, jedoch nicht unbedingt böser Gesinnung. Sie werden oft als Naturgeister an Quellen, Hainen und kleineren Seen vermutet.
Eschet – Einheit von zwölf Mann
Hüter – die vier erstgeborenen Götter Alwa (Wasser), Brond (Feuer), Hirth (Erde), Fahs (Himmel)
Immit – (Titel) Rechte Hand des Kaidhans
Kaidhan – »Großer Herr«,Herrschertitel des Reiches von Neu-Akkesch. Der Begriff ist dhanischen Ursprungs, auch der Fürst der Budinier führt den Titel Kaidhan.
Kischir – Einheit aus zwölf Ansai, in der Regel also 720 Mann
Maghai – Zauberer
Malk – Sohn eines Raiks oder Kaidhan (Prinz)
Maschir – Leibwache des Raiks und Wache des Bet Raiks
Raik – Fürst (einer Stadt)
Schab – »Anführer«.Jeder Befehlshaber in der Armee von Neu-Akkesch führt diesen Titel, vom Schab einer Eschet (zwölf Mann) bis zum Schab-ut-Schabai, (»Anführer der Anführer«), dem Oberbefehlshaber eines Heeres.
Schirqu – Stufentempel der Hüter
Segel – Währungseinheit, flaches Silberstück
Sker– kurzes, rockartiges Kleidungsstück, Beinkleid, in Neu-Akkesch das typische Kleidungsstück der Arbeiter, Bauern, Fischer, Flussschiffer
Ud-Sror – Unterweltstadt
Personen und Götter
Alwa – Hüterin allen Wassers, eine der erstgeborenen Göttinnen
Atib– ein Kaufmann
Abeq Asid – Hohepriester der Ahngötter im Tempel der Raik
Abeq Mahas – Hohepriester Strydhs
Biredh– ein blinder Erzähler
Brond– Hüter der Herdglut und des Feuers, einer der erstgeborenen Götter
Dhanis – Flussgott, »Vater des Landes«
Edhil – Schöpfergott
Emadu – Schab der Zweiten Kischir von Serkesch
Enlin-Etellu – vorheriger Kaidhan von Ulbai
Etellu(-Kaidhan) – Begründer des Neuen Reiches der Akkesch
Fahs – Hüter der Himmel, Sterne und Winde, einer der erstgeborenen Götter
Fakyn– Hauptmann der Wachen des Kaufmanns Atib
Harbutu – Schab Kischir von Immit Schaduk
Hassadi – Tochter von Immit Schaduk
Hirth – Erdgöttin,eine der erstgeborenen Göttinnen
Iddin – der ältere der beiden gleichgeborenen Malk (Prinzen)
Immit Schaduk – Rechte Hand des Kaidhans
Jalis– ein Maghai aus dem Land Awi
Kerva– Schreiber
Kwem– ein Wirt
Luban-Etellu – Kaidhan in Ulbai
Maru (Nehis) – eine Sklavin unbekannter Herkunft
Muqtaq – Schab der Palastgarde (Maschir)
Narsesch – Sohn von Immit Schaduk
Numur – ein Malk (Prinz), der Jüngere
Qurdu– Schab Eschet vom Tor der Hirth
Schaduk – Immit des Kaidhans von Ulbai
Schatir– Erster Schreiber des Raiks
Skalwala – Alfholde des ausgetrockneten Baches bei Serkesch
Tasil – Reisender aus der Stadt Urath
Uo – Totengott
Utu-Hegasch – betrauerter Raik (Fürst) der Stadt Serkesch
Umati – dritte Ehefrau von Immit Schaduk
Utukku – ein Akkesch-Wort für Dämonen aller Art, eigentlich kein Eigenname
Prolog
Eine mitleidlose Sonne stand hoch über der Wüste der Erschlagenen. Die roten Felsen des Glutrückens, die dem Reisenden in den Morgenstunden für kurze Zeit Schatten spendeten, warfen nun nur noch mehr Hitze in die Dünen. Die Luft flirrte. Bussarde ließen sich weit oben von den Aufwinden durch den gleißenden Himmel tragen. Es war die tote Stunde, die Zeit, in der sich selbst die Feuerkäfer im Sand vergruben, um der Sonne zu entfliehen.
Ausgerechnet jetzt tauchten zwei Punkte aus einer Senke auf. Es waren Reiter, die nahe den nackten Felsen dem endlosen Auf und Ab der Dünen folgten. Beide waren in weite, leichte Umhänge gehüllt und hatten ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Es war still. Der schleppende Schritt ihrer Pferde im tiefen Sand war das einzige Geräusch.
Voran ritt eine hagere Gestalt, die im Sattel vornüberhing und nur dem Klang dieser Schritte zu lauschen schien. Ihr Pferd wirkte völlig erschöpft, getrockneter Schweiß stand auf seinen Flanken, und es ächzte, als es sich die Düne emporquälte. Auf der Hügelkuppe hielt der Reiter kurz an und drehte sich um. Sein misstrauischer Blick galt nicht seinem Begleiter, er suchte den Horizont ab. Aber da war nichts außer Sand und roten Felsen. Hinter ihnen und im Westen war endlose Wüste, aber vor ihnen, im Süden, zeichnete sich in der Ferne eine schwache graublaue Linie ab. Ein Lächeln schlich über die rissigen Lippen des Mannes. Mit einem Druck seiner Schenkel trieb er das Pferd wieder an. Hängenden Kopfes trottete es die Düne hinab. Bei jedem Schritt sank es tief in den fließenden Sand ein.
Der zweite Reiter war kleiner und leichter. Unter seiner Kapuze schaute ein bartloses Kinn hervor. Er kauerte müde auf einem Packsattel und ließ die Zügel schleifen. Sein Tier hatte außer dem Gewicht des Jungen auch noch einen großen ledernen Sack und viele kleinere, prall gefüllte Beutel zu tragen. Vielleicht wählte es deshalb einen anderen Weg die Düne hinauf, wo der sandige Hang sanfter anstieg.
Etwas veränderte sich. Der Hagere richtete sich auf und lauschte. Seine Nackenhaare hatten sich aufgestellt. Gefahr lag in der Luft. Er konnte es fühlen. Dann hörte er es. Ein gequältes Stöhnen entrang sich der Brust des zweiten Pferdes, dann ein ängstliches Schnauben.
»Onkel!«, schrie eine helle Stimme entsetzt auf.
Der Mann riss sein Tier herum. Der Junge war nur zwei Dutzend Schritt hinter ihm und, warum auch immer, nicht in seiner Spur geritten. Jetzt saß er mit schreckgeweiteten Augen auf dem Packpferd. Das Tier schnaubte und kämpfte, aber je mehr es sich anstrengte, desto schneller versank es. Der Sand! Der ganze Hang war in Bewegung geraten, und dort, wo der Junge schrie, wuchs rasend schnell ein Trichter, der scheinbar die ganze Düne verschlingen wollte – und Reiter und Pferd mit ihr! Der Mann erstarrte für einen Augenblick, dann sprang er aus dem Sattel und rannte zurück
»Onkel Tasil!« Die Stimme des Jungen überschlug sich in heller Panik.
Tasil fluchte. Der ganze Hang vor ihm war in Bewegung. Er blieb stehen und starrte gebannt auf den Boden.
»Onkel!«
Tasil löste seinen Blick vom Sand. Er sah das Pferd, er sah den Jungen inmitten des Trichters. Es war zu weit. »Den Sack!«, rief er. »Wirf mir den Sack zu!«
»Ich versinke!«
»Schneid ihn los und wirf ihn mir zu, dann wirst du leichter.«
Das Pferd schnaubte und stöhnte. Der Schweiß troff ihm vom Fell, und seine Flanken zitterten. Mit jedem verzweifelten Schritt grub es sich tiefer in den Sand. Der Junge zog seine Beine erschrocken an, als sie den trügerischen Boden berührten. Der Trichter wuchs immer weiter. Tasil sah die Veränderung im Boden, sie kroch auf ihn zu. Er wich langsam Schritt um Schritt zurück. »Maru! Nimm dein Messer und schneid den Gurt durch! Ihr müsst leichter werden. Wirf mir den Sack zu! Dann hört es auf.«
Jetzt erreichte der Sand den Packsattel. Der Junge keuchte entsetzt. Sein Atem ging hektisch, aber die Angst hatte ihn gelähmt.
»Maru, du Auswurf eines Schakals! Reiß dich zusammen! Versuch zu springen. Vergiss das verdammte Tier! Vom Rücken, du kannst vom Rücken aus hierherspringen. Und wirf mir den Sack zu!«
Der Junge nickte, zitternd versuchte er, auf den Packsattel zu klettern. Das Tier war schon fast bis zum Widerrist eingesunken.
»Den Sack! Zuerst den Sack!«
Aber der Junge dachte nicht an den schweren Beutel. Ungelenk versuchte er einen Sprung, der viel zu kurz geriet. Sofort bildete sich ein neuer Trichter. Es dauerte nur wenige Augenblicke, und er war bis zur Hüfte eingesunken. Dabei war er immer noch zu weit von Tasil entfernt, sodass der ihm nicht helfen konnte – nur zusehen.
Zuerst versank das bis zuletzt kämpfende Pferd und mit ihm der lederne Sack, dann der Junge, mit in Todesangst weit aufgerissenen Augen. Tasil stand mit zusammengebissenen Zähnen am Rand des Trichters und wartete, bis es vorbei war. Der Sand füllte leise raschelnd die Vertiefungen auf, die die beiden Körper hinterlassen hatten, dann rührte sich nichts mehr. Tasil blickte zum Himmel. Die Bussarde waren verschwunden. Die Sonne stand immer noch am Scheitelpunkt ihrer Bahn und versengte mitleidlos jedem Geschöpf, das sich zu dieser Tageszeit in die offene Wüste wagte, die Haut. Es war die tote Stunde. Tasil bedachte sie mit einem Fluch. Dann stieg er auf sein Pferd und trieb es weiter nach Süden.
Die Dolche der Hakul
Verlassen und leer liegt das Land zwischen den Roten Hügeln und dem Dhanis, und kein Korn Gerste fließt mehr von dort in die Kammern des Raiks.
Kerva der Schreiber, Bericht für den Hohen Verwalter
Die Nacht war angebrochen, und die Taube hatte am Ufer des Dhanis angelegt. Sie war ein gedrungenes Schilfboot, beinahe eher ein Floß, fast so breit wie lang, mit wenig Tiefgang und einem rechteckigen Segel am kurzen Mast. Im Bug waren Fässer, Ballen und Bündel gestapelt, im Heck gab es einen Verschlag für lebende Ware. Etwa zwei Dutzend Menschen drängten sich in dem engen Holzkäfig. Es waren Sklaven, Namenlose. Sie fanden kaum genug Platz, um zu sitzen, und sicher nicht genügend, dass in der Nacht alle gleichzeitig liegen und schlafen konnten. Sie saßen dicht an dicht, einige mit dem Rücken aneinandergelehnt, und unterhielten sich flüsternd.
»Ich dachte, wir würden es heute schaffen, und jetzt müssen wir noch eine Nacht in diesem Loch verbringen«, sagte ein junger Mann.
»Ja, ich verstehe es auch nicht. Meine Knochen würden sich freuen, wenn ich sie mal wieder richtig ausstrecken könnte«, bestätigte ein älterer.
Trotz der drangvollen Enge gab es eine schmächtige Gestalt, die allein in einer Ecke des Käfigs saß. Es schien, als wollten die anderen ihr nicht zu nahe kommen. Zwei Krieger bewachten den Verschlag. Sie standen am Mast, und ihre Silhouetten zeigten, dass sie mit Speer und Schild bewaffnet waren.
Die Schiffsführer hatten die Taube in einer kleinen Bucht vertäut. Hier floss das Wasser des Stromes nur träge. Am Ufer hatte einst eine Siedlung gelegen, eingezwängt zwischen dem Dhanis und dem Höhenzug des Glutrückens, doch das Dorf war wohl schon vor langer Zeit zerstört worden. Ölpalmen und Rotdornbüsche wuchsen zwischen den Ruinen, und raues Gras hatte sich auf geborstenen Lehmziegeln angesiedelt.
»Was macht Atib?«, fragte der Jüngere jetzt.
»Er steht immer noch da drüben auf der Mauer.«
»Aber wozu?«
»Frag ihn doch«, brummte der ältere.
Atib der Händler stand auf den Mauerresten eines niedergebrannten Hauses und starrte nach Osten. Die ersten Sterne zeigten sich am Himmel. In Mauerspalten hockten Zikaden und Grillen und erfüllten die warme Abendluft mit ihrem zirpenden Gesang. Der Fluss rauschte leise. An einem Lagerfeuer, dicht beim Schiff, saßen sechs Männer. Zwei von ihnen trugen den rockartigen Sker, die kurze, leichte Kleidung der Flussschiffer. Drei der anderen waren an ihren ledernen Waffengurten und den schmucklosen Bronzehelmen als Krieger zu erkennen. Ihre Speere hatten sie in Griffweite in den Boden gerammt, die mannshohen Lederschilde an eine verbrannte Mauer gelehnt. Der Jüngste von ihnen war damit beschäftigt, die Sehne seines kurzen Bogens zu fetten.
»Sieh dir nur den kleinen Dyl an«, flüsterte einer der Sklaven im Verschlag.
»Was ist mit ihm?«, fragte eine junge Frau zurück.
»Er behandelt den Bogen mit einer Liebe, wie er sie sicher noch keiner Frau geschenkt hat.«
Leises Gelächter lief durch den Verschlag. Die beiden Wachen am Mast hoben argwöhnisch die Köpfe, und das Lachen verstummte.
Der größte der Männer am Feuer, der alle anderen noch im Sitzen um Kopfeslänge überragte, trug einen langen ledernen Schuppenpanzer, der ihm im Stehen sicher bis an die Schenkel reichte. Jetzt lag der Saum in Falten im Staub. Eine schwere Bronzeaxt ruhte auf seinen Knien. Ihr Blatt war geschwärzt, aber an der einen oder anderen Stelle schimmerte matt das Metall hindurch. Ein Zeichen häufiger Benutzung. Der Sechste in dieser Runde war offensichtlich weder Soldat noch Schiffer; wer in sein greises und zerfurchtes Gesicht blickte, konnte feststellen, dass die Augenhöhlen des Mannes leer waren. Er war nicht einfach nur blind, sondern hatte keine Augen. Der Alte hielt einen langen Stab in den Händen, lächelte versonnen und schien dem prasselnden Feuer zuzuhören. Ein schwarzer Kochtopf hing über den Flammen, und der Geruch von gekochtem Lammfleisch verbreitete sich mit dem Gesang der Zikaden zwischen den Ruinen.
Atib blickte unverwandt nach Osten, wo ein matter roter Schimmer den Horizont hinter den Hügeln erhellte. Er seufzte und schüttelte den Kopf. Dann stieg er von der Mauer und trat ans Feuer.
»Fakyn, du bist ein Künstler nicht nur mit dem Speer, scheint mir«, sagte gerade der Blinde mit brüchiger Stimme, »ich rieche Lamm und Linsen und einige Kräuter, die ein Festmahl versprechen.«
»Und du glaubst, wir geben dir was ab?«, brummte der große Krieger missvergnügt und warf ein Stück Holz ins Feuer.
Der Alte lachte. »Du möchtest, dass ich für meine Mahlzeit bezahle, Fakyn?«
»Worüber reden sie?«, fragte ein älterer Sklave im Verschlag.
»Ich glaube, sie wollen, dass der alte Biredh etwas erzählt«, sagte ein anderer, »aber er ziert sich. Dyl will etwas über Boga und Arku hören, und der dicke Kadar fragt nach dem Marsch der Akkesch. Ist ihm wohl beides nicht recht. Ich glaube, er hat Hunger und will lieber essen. Aber warte …«
Unten am Feuer hatte der Erzähler einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Dyl und Kadar wirkten nicht sehr begeistert, doch Fakyn, der Anführer der Krieger, stimmte zu. Der Alte räusperte sich, dann schien er sich zu verwandeln. Seine Gesichtszüge glätteten sich, seine Stimme, die eben noch leise und brüchig klang, wurde nun sanft und zugleich fest. Sie erfüllte die verbrannten Ruinen mit Leben, hallte von den Hängen der Anhöhen wider. Die Sklaven im Verschlag konnten jedes Wort verstehen.
»Nun gut, die Geschichte der zwölf Städte. Wisset also: Vor unvorstellbar langer Zeit lebten die Menschen in immerwährendem Frieden und ewiger Eintracht in zwölf großen Städten. Sie befuhren das Meer, um zu fischen, bebauten ihre Felder, weideten ihr Vieh und brachten den Hütern – den erstgeborenen Göttern – ihre Opfer dar. Die Hüter hielten die Naturgewalten im Zaum, und die nachgeborenen Götter, die nur ihre Diener sind, folgten ihren Befehlen. Es waren Zeiten des Glücks, und die Menschen mehrten sich. Die Hüter walteten ihrer Aufgabe, wie es Edhil, der Tiefdenkende, der Schöpfer der Welt, ihnen aufgetragen hatte. Die Städte am Meer standen unter dem Schutz Alwas, und die Fischernetze waren immer gut gefüllt. Die schöne Hirth sorgte dafür, dass in den Ebenen die Herden gediehen und die Felder reiche Ernte trugen. Brond schützte die Siedlungen an den Hängen der Feuerberge, und unter seinem Segen schufen die Schmiede dort wunderbare Werkzeuge, die sie mit den anderen Städten tauschten. Die Bewohner der himmelnahen Berge jedoch huldigten Fahs, und seine Winde lehrten sie die Geheimnisse der Heilkunst und manch anderes Wissen, das nun verloren ist. Sie lebten gut, die Menschen unter dem Schutz der Hüter, und sie waren frei von Leid und Elend.«
Der Alte schwieg und schien den Nachklang seiner Worte zu prüfen. Die Männer am Feuer hingen an seinen Lippen. Beide Wachen an Bord der Taube waren aus dem Schatten des Mastes getreten und lauschten nun, auf ihre Wurfspeere gestützt, dem Erzähler. Hinter ihnen drängten sich die Namenlosen, die Sklaven, an das Gitter. Auch Atib der Händler hörte der altbekannten Geschichte aufmerksam zu.
»Dann aber«, fuhr der Erzähler fort, »kam Strydh, der letzte der erstgeborenen Götter, zu den Fürsten der zwölf Städte und sprach zu ihnen: ›Ein hartes Leben ist es, das ihr führt, nichts als Mühe und Schweiß, und es währt nur kurz. Ist es aber zu Ende, dann steigt ihr hinab in das Land ohne Wiederkehr und wartet im Staub der Totenstadt Ud-Sror auf das Vergessen. Und dieses ereilt euch schnell, denn wer entzündet Opferfeuer für euch, wenn eure Söhne erst einmal gestorben sind? Dann entschwindet euer Geist endgültig aus dem Kreis dieser Welt, und verloren seid ihr auf ewig.‹
Und die Fürsten fürchteten sich.
Strydh aber fuhr fort: ›Dies ist das Los der Menschen seit alters, ich aber kann euch ein neues Leben zeigen. Wenn ihr mir folgt, werden eure Tage ruhmvoll sein, Gold und Silber wird eure Hallen schmücken, und noch die Enkel eurer Enkel werden eurer Taten gedenken. In der Stadt der Toten aber werdet ihr an der Tafel meines Dieners Uo, des Fürsten der Toten, sitzen, und lange und ehrenvoll soll euer Sein dort währen, denn die Opferfeuer für Helden werden nie verlöschen. Diesen Weg aber kann nur ich euch zeigen, denn meine Geschwister, die Hüter, wissen nichts von ihm.‹
Da gelobten die Fürsten Strydh Treue und schworen, seinem Rat zu folgen und künftig ihm – noch vor den Hütern – zu huldigen. So lehrte Strydh sie, Helme, Speere und Schilde zu schmieden, und er zeigte ihnen, wie sie im Kampfe Ruhm gewinnen konnten. So endete die lange Zeit des Friedens, denn bald schon kämpfte Stadt gegen Stadt. Große und ruhmreiche Taten wurden vollbracht und besungen.
Und Strydh hielt Wort. Der Reichtum der Fürsten nahm zu, und bald schmückten Gold und Silber ihre Hallen. Doch aus den Straßen der Städte stiegen Klagen auf, denn manches Heer, das auszog, kehrte nie zurück, und mancher Held, der besungen wurde, hat den Lobgesang nie vernommen. So wie der Glanz der Städte zunahm, so sank die Zahl der Bewohner, und viele Menschen – Männer, Frauen und Kinder – glitten lange vor ihrer Zeit hinab in das Land ohne Wiederkehr. Auch vor den Hallen der Mächtigen machte das Leid nicht Halt, denn viele Fürstensöhne starben auf den Schlachtfeldern.
Jetzt erschraken die Mächtigen, und sie sagten: ›Wohl kann es sein, dass unsere Namen nicht vergessen werden, wenn wir sterben. Doch wie lange werden wir an der Tafel Uos sitzen, wenn unsere Söhne und deren Söhne gefallen sind und unsere Völker uns verfluchen, statt uns in ehrendem Gedenken Opfer zu bringen? Strydh hat uns betrogen, er ist ein Gott der Falschheit und des Todes, und wir wollen seinem Weg nicht mehr folgen.‹ Und sie zerbrachen ihre Speere, sagten sich von Strydh los und erklärten ihre Eide für ungültig.
Strydh aber ging zu den Hütern und klagte die Menschen an, die ihr Wort einem Gott gegeben und es gebrochen hatten. Diese waren hilflos. So ungern sie es auch taten, so mussten die Erstgeborenen Strydh doch recht geben. Fürchterlich waren die Strafen, die nach Strydhs Willen verhängt wurden: Alwa entfesselte mächtige Fluten, die die Küsten zerschmetterten, Brond ließ Feuer und Asche aus den Bergen steigen und vom Himmel regnen, und Fahs entfesselte Blitz und Sturm. Hirth aber zermalmte Berge mit gewaltigen Beben, und ihre Stiefkinder, die Wüsten, verschlangen das Land. Zwölfmal zwölf Monde wüteten die Hüter, bis alle Städte der Menschen zu Staub zermahlen waren und keiner von den wenigen, die noch lebten, das Angesicht der Welt wiedererkannte.
Endlich beendeten die Hüter ihr Zerstörungswerk und begaben sich zur Ruhe, um am folgenden Tag die Wunden der Welt zu heilen, die Meere und Wüsten zurückzudrängen und den Menschen eine neue Zeit des Friedens zu schenken.
Strydh jedoch schlich in der Nacht an ihr Lager und belegte sie mit einem Zauber, den er der Schlafblume gestohlen hatte, sodass sie am folgenden Tag nicht erwachten. Auch der nächste Sonnenaufgang konnte sie nicht wecken und der übernächste auch nicht. Und so kam es, dass die Hüter die Welt nicht geheilt haben, dass sie keine Macht mehr über die Geschicke dieser Welt besitzen und sie unser Flehen nicht hören außer in ihren Träumen. Deshalb herrscht Strydh als Einziger der fünf ersten Götter und regiert die Welt mit Krieg und Zerstörung – bis, ja, bis eines Tages das Horn Bogas erklingt und die Hüter erweckt.«
»Möge das Horn Bogas bald gefunden werden«, murmelten die Männer die Formel, die immer am Ende der Geschichte gesagt wurde.
Der Alte nickte. Seine Geschichte war zu Ende, und seine Gestalt schien wieder zu der eines Bettlers zu schrumpfen. Nachdenklich starrten die Männer ins Feuer. »Strydh ist ein mächtiger Gott«, sagte Fakyn.
Kadar legte Holz ins Feuer. Im Kochtopf blubberte es leise vor sich hin, und der Fluss rauschte. Die Zikaden und Grillen schwiegen.
Plötzlich hob der Alte den Kopf und lauschte in die Nacht. »Es kommt jemand, ein Reiter.«
Nach einer Weile hörten selbst die Sklaven an Bord der Taube den Hufschlag. Es war der langsame Tritt eines müden Pferdes. Die Krieger waren bereit, jedem, der dort aus der Nacht kam, einen würdigen Empfang zu bereiten. Der junge Dyl lauerte im Schatten einer Mauer mit einem Pfeil auf der Sehne. Fakyn, der Schab der Männer, hatte mit Kadar am Rande des Feuerscheins Stellung bezogen. Im Stehen zeigte sich erst, was für ein Hüne er war. Der stämmige Kadar wirkte an seiner Seite beinahe wie ein Kind. Ihre mächtigen Turmschilde würden sie vor unangenehmen Überraschungen schützen, und gegen Reiter waren ihre langen Speere die besten Waffen. Der Schiffsführer hatte sich mit seinem Gehilfen sofort an Bord der Taube zurückgezogen. Die beiden, die dort Wache hielten, waren mit dem Schatten des Kahns verschmolzen. Nur die Spitzen ihrer Wurfspieße schimmerten im Feuerschein. Atib hielt sich hinter dem Käfig der Sklaven versteckt. Der alte Biredh war sitzen geblieben und starrte aus leeren Augenhöhlen ins Feuer.
Fakyn lächelte grimmig. Vermutlich machte er sich selbst Vorwürfe, weil er mit den Wachen so nachlässig gewesen war. Der Hufschlag kam näher.
Kadar war unruhig. »Was, wenn es nicht nur ein Reiter ist?«
Fakyn schüttelte den Kopf. »Sie würden kaum einen Reiter vorschicken, wenn sie sich anschleichen wollten, oder?«
Jetzt erschien ein Schatten am Rand der Ruinen.
»Wer kommt da?«, rief Fakyn.
»Ein Mann, in Frieden«, antwortete eine raue Stimme.
»Zeig dich!«
Der Reiter lenkte sein Pferd näher an das Feuer heran. Dabei hielt er seine Hände ausgestreckt, sodass gut zu sehen war, dass er keine Waffe hielt.
»Du bist allein?«
»Nur ein Mann und sein Pferd. Im Namen der Hüter erbitte ich Schutz für die Nacht.«
Die Krieger entspannten sich. Es waren harte und unruhige Zeiten, aber wer sich auf die Hüter berief und um Schutz bat, wurde erhört. Das Gastrecht war heilig – für den Gastgeber ebenso wie für den Gast. Nichts Übles würde in dieser Nacht von dem Fremden ausgehen. Was aber der morgige Tag brachte, das würde man sehen.
»Sei willkommen an unserem Feuer und iss mit uns, Fremder«, sagte Fakyn.
Es galt als unhöflich, einen hungrigen Reisenden während des Essens mit Fragen zu belästigen. Nach dem Mahl, das Lob verdiente und bekam, waren Fragen natürlich erlaubt.
Atib der Händler erkundigte sich mit der gebotenen Höflichkeit nach Namen, Herkunft, Beruf und – wie es der Brauch verlangte – dem Wohlbefinden des Fremden.
»Tasil ist mein Name, und aus Urath, einer Stadt weit südlich des Schlangenmeeres, stamme ich. Händler bin ich, doch wurde ich vom Unglück verfolgt, denn nach einigen guten Geschäften mit den Hakul verlor ich in der Wüste meinen Begleiter und mein Packpferd im Sand.« Er schilderte einer begierigen Zuhörerschaft, wie sein Begleiter mitsamt Pferd von der Wüste verschlungen worden war – wobei er den schweren Ledersack nicht erwähnte.
»Du hast die Wüste der Erschlagenen durchquert? Auf einem Pferd? Wirklich ein kühnes Unternehmen. Selbst die Hakul reisen dort nur mit dem Trampeltier.«
»Es sei denn, sie haben vor, etwas zu stehlen oder zu rauben«, warf Fakyn übellaunig ein.
Tasil tat, als hätte er die Bemerkung nicht gehört, und Atib hakte nicht nach. Ihn interessierten andere Dinge. »In wessen Namen hast du gehandelt? Und welche Waren? Wenn du nur ein Packpferd hattest, können es ja kaum Häute oder Sklaven gewesen sein.«
»Ases, der Kaidhan von Albho, gab mir sein Siegel. Er vertraute mir einige Maß Salz und etwas Silber an. Ich habe dafür Bernstein und Wolfspelze und andere Dinge eingetauscht.«
»Wenn du zurück nach Albho willst, bist du recht weit von deinem Weg abgekommen«, sagte Fakyn.
»Der Weg über Serkesch erschien mir sicherer«, entgegnete Tasil schnell.
»Wie man sich täuschen kann«, antwortete der Schab trocken.
Atib achtete nicht darauf: »Ah, Bernstein! Eine gute Wahl! Die Frauen in Ulbai sind ganz verrückt danach. Ich nehme an, bei den Romadh in Albho ist es nicht anders. Mit wem hast du gehandelt?«
Tasil lächelte. »Verzeih, dass ich meine Quelle nicht offenbare, nicht bei dieser Ware. Wie du sicher weißt, kommt der Stein aus dem fernen Norden, und die Hakul geben nicht viel von dem weiter, was sie eintauschen. Ich denke außerdem daran, das Geschäft zu wiederholen.«
»Ach schade, aber ich verstehe dich nur zu gut«, sagte Atib, »und all der Bernstein wurde vom Sand verschlungen?«
»Jedes einzelne Stück.«
»Warum hast du etwas so Wertvolles nicht am Leib getragen?«
Tasil zögerte einen Moment, dann sagte er: »Ich bereue diesen Fehler, aber ich wollte mein Pferd schonen, ihm so viel Gewicht ersparen wie möglich.«
Den jungen Dyl beschäftigte etwas anderes. »Ein Loch, das sich im Boden auftut und ein Pferd mitsamt Reiter verschlingt? Wie ist das möglich? War das ein Alfskrol?«
»Ich weiß nicht, ob es ein Alfskrol oder ein anderer Daimon war, doch habe ich so etwas auch noch nie zuvor erlebt.«
»Ja, eine sehr seltsame Geschichte«, sagte Fakyn.
Biredh räusperte sich. »Die Slahan hat schon ganze Heere verschlungen. Es heißt, dass ihre Dünen über Knochenberge wandern und dass es sogar Seen aus Blut unter dem Sand gibt. Und sie verbirgt noch weit mehr Schrecken und Geheimnisse.«
Dyl starrte den Alten mit aufgerissenen Augen an, doch Atib schnitt dem alten Erzähler das Wort ab. »Nun, es ist furchtbar, Tasil, wie dir dieses Geschäft verdorben wurde, doch ich bin überzeugt, dass die Götter dir bald wieder mehr Glück gönnen werden, denn sie belohnen die Mutigen. Es gehört schon einiges dazu, mit den Hakul Geschäfte zu machen. Ihr Stolz ist fast so groß wie ihr Eigensinn, sagt man. Leicht zu beleidigen sind sie und nachtragend. Wenn sie sich einmal übervorteilt fühlen, vergessen sie das nie, habe ich gehört.«
»Die, mit denen ich zu tun hatte, werden sich nicht über mich beklagen«, sagte Tasil schlicht. Biredh lachte leise, so als habe er hinter dem Gesagten einen verborgenen Sinn gehört. Tasil wechselte das Thema. »Und du handelst mit den Budiniern?«, fragte er Atib.
»So ist es. Unter dem Siegel des Raiks Utu-Hegasch zog ich nach Akyr. Die Budinier sind auch nicht einfach, das könnt ihr mir glauben. Wenn das Geschäft halbwegs gut ist, dann muss man noch froh sein, wenn man auf dem Hin- oder Rückweg nicht Räubern zum Opfer fällt. Deshalb auch diese tapferen Krieger zu meinem Schutz.« Atib lachte halblaut. »Wir haben Häute, Kupfer und Namenlose erworben. Was die Budinier eben so anbieten …« Er wurde ernst. »Seit Wochen sind wir nun schon unterwegs, immer im Kampf mit dem Staub, den störrischen Lasteseln und den faulen Treibern. Auf dem Rückweg kamen noch die Sklaven dazu, auf die man ein Auge haben muss, denn es sind meist dumme Menschen, die selbst in der Wildnis davonlaufen würden, eine Idee, auf die doch kein vernünftiger Mensch kommen würde. Dazu die wandernden Sippen der Budinier, die das Siegel eines Raiks oder Dhans nur achten, wenn es von bewaffneten Männern getragen wird. Dennoch war es eine gute Reise, wir haben nur wenige Esel und Treiber verloren und nur einen einzigen Sklaven. Den hat am Fuße der Hochebene von Edhawa ein Löwe geholt. Ein großer und starker Mann und somit ein echter Verlust, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ein Löwe?«, fragte Tasil verwundert.
»Ja, das ist seltsam, nicht wahr. Ich weiß nicht, warum er einen Menschen angegriffen hat, wo er doch leicht einen unserer Esel hätte reißen können. Und ich weiß auch nicht, warum er sich dann diesen prachtvollen Mann geholt hat und nicht das Mädchen, das mit ihm zusammen Feuerholz gesucht hat. Das wäre noch zu verschmerzen gewesen. Nun, die Hüter werden es wissen.« Er seufzte.
Tasil warf einen Blick auf den Holzverschlag der Sklaven. Es war nicht viel mehr zu erkennen als Hände, die sich an den hölzernen Stäben festklammerten.
»Als wir endlich in Scha-Adu das Schiff bestiegen, dachte ich, wir hätten das Schlimmste hinter uns«, fuhr Atib fort. »Wenigstens waren wir die störrischen Esel und ihre Treiber los, die mindestens genauso verstockt waren wie ihre Tiere. Nun, die Taube ist klein und bietet nicht viel Bequemlichkeit, aber wir kamen der Heimat schnell näher. Doch wie es scheint, hat mich das Unglück jetzt doch noch getroffen, ebenso wie dich, Fremder.«
Tasil blickte den Händler überrascht an. »Ist euer Schiff beschädigt? Ich habe mich schon gefragt, warum ihr angelegt habt. Es kann nicht mehr weit sein bis nach Serkesch.«
»Wenn es nur das Boot wäre, ein zerrissenes Segel, ein verlorenes Ruder, das alles ist nichts gegen das Verhängnis, das über uns alle hereingebrochen ist.« Atib nahm Tasil am Arm und zog ihn einige Schritte vom Feuer weg. Fakyn folgte ihnen. Der Händler deutete stromabwärts. »Sieh nach Osten, Fremder.«
Tasil blickte in die angegebene Richtung. Tausende Sterne standen jetzt am Himmel. Im Osten war der Himmel jedoch rot verfärbt. »Dort brennt es«, stellte er fest, »ist das Serkesch?«
»Nein, es ist nicht die Stadt, doch kann dies durchaus noch geschehen, wenn das Unglück es will.«
»Es ist das Letzte Haus unseres Raiks, das dort in Flammen steht«, erklärte Fakyn düster.
»Und das bedeutet?«, fragte Tasil schlicht.
Atib seufzte. »Nun, als wir aufbrachen, hieß es, Utu-Hegasch, der geliebte Raik von Serkesch, Freund und Gesalbter der Götter, sei ernsthaft erkrankt, was eigentlich erstaunlich ist, denn Utu ist … war … in seinen besten Jahren. Die Priester haben zu Fahs, dem Hüter der Heilkunst, gebetet und gehofft, ihre Gebete würden seine Träume erreichen und ein Wunder bewirken. Sie haben sogar Maghai aus den fernen Sümpfen zurate gezogen. Und du kannst dir vorstellen, wie schlimm es steht, wenn die Priester diese Zauberer um Rat fragen. Ich selbst habe eine nicht unbedeutende Summe für Opfergaben gespendet, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, versteht sich. Das war vor beinahe zwei Monden. Als wir von Akyr nach Scha-Adu zurückkamen, hörten wir bereits, dass das Letzte Haus errichtet worden sei. Heute, kurz vor der Abendstunde, hat dann der junge Dyl den schwarzen Rauch entdeckt. Es ist fürchterlich.«
»Also ist der Raik verstorben?«
»So ist es. Du musst wissen, bei den Kydhiern war es Brauch, den Palast des Herrschers bei seinem Ableben niederzubrennen, mit allem, was darin war. Es ist dies das erste Opfer, das ihm in der Stadt der Toten den Weg an Uos Tafel ebnen soll.«
»Mit allem? Den Schätzen? Den Sklaven?«
»Natürlich, was für einen Sinn soll es für einen Sklaven haben weiterzuleben, wenn der Raik verstorben ist?«
»Was für eine Verschwendung«, sagte Tasil.
Atib lachte. »Ah, ein Händler, der den Wert der Dinge zu schätzen weiß! Du gefällst mir, Urather. Ich glaube, die Akkesch haben ebenso gedacht, denn als sie das Land eroberten, haben sie den Brauch zwar übernommen, aber doch geändert. Wenn ein Raik in die Jahre kommt oder Zeichen seines baldigen Todes auftreten, errichten sie einen neuen Palast aus Holz, eben sein Letztes Haus. Es ist bedeutend ärmlicher eingerichtet als der eigentliche Palast, wie du dir vielleicht denken kannst. Nach seinem Tod tränken sie alles mit Erdpech und verbrennen es, natürlich auch die Sklaven. Das Opfer darf nicht zu gering sein, denn der Raik soll mit Würde und Stolz an Uos Tafel treten können. Vor drei, nein vor vier Jahren haben sie es so gemacht in Igaru, als Raik Biltu-Nin starb, und davor habe ich Gleiches aus der Stadt Esqu gehört. Aber ich teile deine Meinung, es ist eine Verschwendung. Allein das Erdpech muss ein Vermögen wert sein.«
»Ich verstehe, doch bin ich erstaunt, dass die Akkesch ihre Toten neuerdings verbrennen.«
»Nein, nein, sie verbrennen den Raik doch nicht! Sie haben in einem Tal hinter der Stadt Tempel für Uo und die verstorbenen Raik. Dort im Felsen ruhen sie, begraben mit ihren Schätzen.«
Tasils Miene blieb beinahe auffällig ausdruckslos. »Mit ihren Schätzen?«
»Ja, so will es der Brauch«, bestätigte Atib.
Fakyn sah Tasil misstrauisch an. »Warum fragst du danach?« Seine Hand ruhte auf dem Blatt seiner Axt.
Tasil ging nicht darauf ein. »Also, Raik Utu ist tot. Ich verstehe, dass dies ein Unglück ist, doch begreife ich nicht, warum du um die Stadt fürchtest, oder hat er keine Erben hinterlassen?«
Atib breitete die Arme in einer Geste der Verzweiflung aus: »Schlimmer, er hat zwei! Zwillingsbrüder!«
»Zwillinge? Und er hat keinen der beiden töten lassen? Das ist wirklich ein Unglück!«
»Ja, die Akkesch haben viele gute Sitten in dieses Land gebracht, und sie waren klug genug, viele Gebräuche von uns Kydhiern anzunehmen, wenn sie auf Weisheit gründeten. Doch in dieser Frage …«
»Er war doch lange krank, sagst du. Hat er da seine Nachfolge nicht geregelt?«
»Nun, die Krankheit, die ihn befiel, war von sehr eigenartiger Natur, musst du wissen. Es war ein tiefer, fiebriger Schlaf, der ihn überfallen hatte. Er konnte weder reden noch schreiben. Leider hat er seine beiden Söhne zu sehr geliebt, sonst hätte er die Entscheidung sicher schon früher gefällt. Jetzt ist es zu spät. Für uns alle, fürchte ich. Ich habe Kupfer, Häute und Sklaven geladen, beste Ware, Ware für den Palast, alles unter dem Siegel Utu-Hegaschs. Doch was ist sein Siegel jetzt noch wert? Wer wird den Leuchtenden Thron besteigen, wer die neuen Siegel ausgeben? Wem soll ich meine Waren anvertrauen? Und wer wird mich für meine Mühen entschädigen? Und wann? Sind die Tage der Trauer und heiligen Riten erst einmal vorbei, wird es sicher einen Bruderkrieg geben. Da ist der Ausgang immer ungewiss, und was, wenn ich mich für die falsche Seite entscheide? Und als Händler des Raiks muss ich mich entscheiden. Ich glaube, Strydh wird noch viel Freude an Serkesch haben.« Atib blickte zum roten Horizont, schüttelte den Kopf und war offensichtlich bereit, in seinem Jammer zu versinken.
Fakyn schüttelte unmerklich seinen Kopf und sagte mit einer Spur Verachtung in der Stimme: »Wenn es der Wille Strydhs ist, wird es zum Kampf kommen. Ich bin bereit, mich jedem Schicksal zu stellen.«
Tasil schwieg und betrachtete die hängenden Schultern des Händlers. Plötzlich lächelte er. »Die Sklaven, die du geladen hast …« Er machte eine Pause.
Atibs Aufmerksamkeit war geweckt. »Ja, zwei Dutzend, beste Ware, das heißt, jetzt sind es noch dreiundzwanzig, denn einen hat ja der Löwe geholt.«
»Wie ich vorhin erwähnte, habe ich meinen Begleiter in der Wüste verloren. Ich könnte Ersatz gebrauchen.«
Atib schien aus seinen trüben Gedankengängen herauszutreten. »Du brauchst einen Sklaven? Ich hatte angenommen, dein Begleiter … Wie war sein Name?«
»Maru.«
»Richtig. Ich hatte angenommen, Maru sei ein Verwandter gewesen? Dein Neffe, nicht wahr?«
»Ja, doch ist es unwahrscheinlich, dass ich in dieser Gegend jemanden von meiner Familie treffe, oder? Deshalb werde ich mich mit einem Sklaven als Ersatz zufriedengeben müssen.«
Atib lachte leise. »Natürlich, einen Verwandten kann ich dir nicht anbieten, wie dumm von mir.« Er stutzte und schüttelte den Kopf. »Allerdings gehören die Sklaven nicht mir, sondern sind Eigentum des Raiks, wer immer das auch werden mag. Ich kann dir nicht helfen, fürchte ich.«
»Ich denke, ich werde dir ein ansprechendes Angebot unterbreiten können.«
»Sagtest du nicht, du habest dein ganzes Vermögen in diesem scheußlichen Sandloch verloren?«
»Nun … Nicht mein ganzes Vermögen«, entgegnete Tasil lächelnd.
»So?« Atib rieb nervös die Fingerspitzen aneinander. »Ich habe nur die beste Ware. Bestimmt für die Tempel und den Palast. Und dann die Gefahr für mich, wenn die Verwalter das herausfinden!«
»Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist im Moment die größte Gefahr, dass du für deine Mühen gar nichts erhältst.«
Atib wand sich und schüttelte besorgt den Kopf, aber schließlich schien er seine Zweifel zu überwinden und lachte wieder einnehmend. »›Ansprechend‹, sagst du? Was benötigst du?«
»Am besten zeigst du mir einfach, was du hast.«
»Jetzt? Im Licht der Fackeln? Du willst nicht bis morgen warten?«
Tasil schüttelte den Kopf. »Machen wir es jetzt«, drängte er.
»Meinetwegen, aber nicht, dass du hinterher Beschwerde führst.«
Atib führte Tasil auf das Deck der Taube, wo Fakyn zwei Fackeln entzündete. In dem engen Gitterverschlag warteten die Sklaven, allesamt mit kurz geschorenen Haaren und in einfaches Leinen gekleidet.
»Habe ich dir zu viel versprochen? Allerbeste Ware, alle wohlgenährt. Der hier«, Atib zeigte auf einen untersetzten Mann, »kann sogar schreiben.«
»Was soll ich damit?« Tasil umrundete den Verschlag zweimal. »Die meisten sind zu groß oder zu fett. Und warum haben sie keine Haare?«
»Die Läuse, du verstehst? Die Budinier sind da nicht so empfindlich wie die Verwalter des Raiks«, erklärte Atib, der mit einer Fackel hinter Tasil herlief, »aber sie wachsen ja wieder nach. Und was hast du gegen kräftige Sklaven? Ein Händler kann doch immer einen starken Handlanger gebrauchen.«
»Mein Begleiter muss jung und lernwillig sein, für einen alten Ochsen habe ich keine Verwendung. Was ist mit dem da? Und dem in der Ecke?«
»Die beiden? Unsere Jüngsten. Die sind für den Tempeldienst vorgesehen … oder für die Palastküche. Je nachdem.«
»Können sie lesen und kochen?«
»Weder noch«, Atib lachte, »aber sie sind jung und können lernen.«
Der Händler winkte die beiden schmächtigen Gestalten an das Gitter heran. Tasil leuchtete mit der Fackel und prüfte mit harter Hand die Stärke ihrer Arme, schüttelte missmutig den Kopf und griff erst dem einen, dann dem anderen ins Gesicht, öffnete ihren Mund und warf einen Blick auf ihre Zähne. Abschließend schaute er ihnen in die Augen. Der eine der beiden senkte sofort den Kopf, aber das Augenpaar des anderen hielt seinem Blick stand.
»Ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet, aber wie heißt der hier?«
»Wer?«
»Na, dieses Milchgesicht.«
Atib wirkte einen Moment verunsichert, bevor er langsam sagte: »Es sind Sklaven, Namenlose, sie haben keine Namen, bis der Käufer ihnen einen gibt.«
Unter den Sklaven entstand Unruhe. Sie sahen einander an, doch keiner sagte etwas.
Tasil achtete nicht darauf. »Keine Namen?«, vergewisserte er sich. »Ein Budinier scheint er nicht zu sein. Wo kommt er her? Ist er mit einem der anderen verwandt?«
»Über die Herkunft kann ich dir nichts sagen. Es sind Sklaven, wer fragt danach, wo sie herkommen? Keine Familie, keine Namen, aber einen gewissen Wert, vor allem unter den gegenwärtigen Umständen, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Über den Wert kann man geteilter Meinung sein, aber ich sehe nichts Besseres. Ich will dir zeigen, was ich dir zum Tausch anbieten kann.« Tasil verschwand in der Dunkelheit.
Als er außer Sicht war, drehte sich Atib zu den Sklaven um: »Ich will kein Wort hören. Oder soll ich euch alle im Dhanis ersäufen?«
Tasil kam kurz darauf mit einem Bündel zurück, das er im Schein der Fackeln entrollte. Zum Vorschein kamen fünf gekrümmte Messer in kunstvoll gearbeiteten Scheiden.
»Bei den Hütern!«, rief Atib. »Sind das Dolche der Hakul?«
»Du sagst es«, erwiderte Tasil lächelnd.
Atib versuchte vergeblich, seine Begeisterung zu zügeln. Er nahm einen der Dolche in die Hand und zog ihn aus der Scheide. »Herrliche Arbeit!«
Fakyn war näher getreten. Die Augen des Kriegers funkelten, als er die Klingen musterte. »Es heißt, sein Dolch sei dem Hakul mehr wert als sein Weib, seine Kinder und selbst sein Pferd. Es heißt auch, dass er sich nie davon trennt.« Er wog ein Messer in der Hand und betrachtete das eingravierte Muster. Der Feuerschein spiegelte sich in der polierten Bronzeklinge.
»Oh, sie machen Ausnahmen«, erwiderte Tasil ausdruckslos.
»Und in diesem Fall gleich fünfmal«, sagte Fakyn langsam, aber er konnte seine Augen nicht von der Waffe in seiner Hand lassen.
Tasil nickte, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Eine Eisenklinge!«, rief Atib entzückt, der einen anderen Dolch aus der Scheide gezogen hatte.
»Ich möchte einen Sklaven, nicht die ganze Ladung kaufen«, sagte Tasil.
Atib seufzte. »Ich habe Kupferbarren, ich würde dir ein Dutzend davon zusätzlich anbieten.«
»Was soll ich damit? Ich bin mit nur einem Pferd unterwegs. Den Sklaven, mehr Gepäck will ich nicht. Ich biete dir dafür diesen Dolch, und du kannst nicht sagen, dass das ein schlechtes Angebot ist.« Tasil reichte Atib eine Klinge, deren Horngriff mit eingelegten Silberfäden verziert war. Es war eine meisterhafte und sehr markante Arbeit.
Atib runzelte die Stirn. Das Messer war mehr wert als ein Sklave, viel mehr. Eigentlich war das Angebot viel zu gut. Es musste einen Haken geben. Atib sah Tasil ins Gesicht. Der erwiderte den Blick gelassen. Der Händler wog den Dolch in der Hand und betrachtete ihn. Die Silberfäden schimmerten im Schein der Fackeln. »Gut, abgemacht«, sagte er, »dieser Dolch gegen – wie sagtest du? – das Milchgesicht.« Und er schlug in Tasils angebotene Hand ein.
Sie kamen überein, die »Ware« über Nacht noch im Verschlag zu lassen und den Austausch erst am Morgen vorzunehmen. Als Tasil sich im Schatten des Schiffs zur Ruhe betten wollte, stand auf einmal der blinde Biredh vor ihm. »Erlaubst du, dass ich mein Nachtlager hier neben dir bereite?«
»Du bist ein Erzähler, hat man mir gesagt.«
»So ist es.«
»Nun, solange du nicht vorhast, mir eine deiner langweiligen Geschichten zu erzählen, soll es mir recht sein.«
Der Alte lachte leise. »Keine Sorge, ich habe nicht vor, Silber von dir zu erbetteln, aber ich wollte dir etwas sagen.«
»Und das wäre?«
»Das war ein guter Kauf.«
Das Feuer warf flackerndes Licht auf das zerfurchte Gesicht des Erzählers. Tasil starrte in die Schatten seiner leeren Augenhöhlen. »Nun, ich weiß das. Aber woher weißt du es, blinder Mann?«
»Der Fluss hat es mir gesagt.«
Tasil schnaubte verächtlich. »Was hat der Dhanis dir denn noch erzählt?«
»Nun, du hast deine Geheimnisse, ich habe meine«, antwortete der Alte kichernd
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
Biredh senkte die Stimme ein wenig. »Ich meine nur, dass es seltsam ist, dass ein Mann fünf Dolche bei sich trägt, seinem Pferd aber das Gewicht von etwas Bernstein ersparen will. Dabei ist der so leicht, dass er sogar auf den Fluten des Dhanis schwimmen würde.«
Tasil schaute ihn nachdenklich an. »Und ich denke, dass du diese Gedanken besser für dich behalten solltest, alter Mann, sie könnten sonst deiner Gesundheit schaden.« Sein Tonfall war ausnehmend freundlich.
Am nächsten Morgen war der Alte verschwunden. Keine der Wachen hatte sein Verschwinden bemerkt, weshalb Fakyn einige sehr ernste Worte mit ihnen wechselte. Atib nahm die Sache leichter: »Vielleicht hat er sich auf den Weg nach Serkesch gemacht, vielleicht geht er auch nach Westen. Wer kann das bei einem Geschichtenerzähler schon wissen?«
»Er ist also nicht mit euch gereist?«, fragte Tasil.
»Nein, wir haben ihn erst gestern in diesen Ruinen getroffen. Es ist schade, dass er fort ist, denn er konnte gut erzählen.«
Tasil ließ sich von Atib zu einem kurzen Frühstück nötigen. Die schwarze Rauchsäule stand noch immer im Osten.
»Wie weit ist es bis Serkesch?« erkundigte sich Tasil.
»Auf dem Landweg weniger als zwei Doppelstunden«, sagte der Schiffsführer.
Nach dem Frühstück sollte der Warenaustausch stattfinden. Tasil wirkte beunruhigt, was vielleicht daran lag, dass sich alle Männer zu diesem doch eher belanglosen Vorgang am Verschlag der Sklaven versammelten. Fakyn sah ihn ausdruckslos und von oben herab an, was ihm aufgrund seiner Körpergröße nicht schwerfiel.
Ein Verdacht beschlich Tasil, als der Sklave aus dem Verschlag geholt wurde. Er schaute in ein schmales Gesicht mit grünen Augen, die ohne Angst seinem Blick standhielten. Die Farbe der Augen war aber nicht das Schlimmste. »Das ist ein Mädchen!«
»Wie?« Atib tat überrascht. »Was sollte es denn sonst sein?«
Die umstehenden Männer grinsten, Fakyn von allen am breitesten.
»Du willst mir ein Mädchen verkaufen?«
»Das ist nicht ganz richtig, Tasil aus Urath, denn ich habe dir diese Namenlose bereits verkauft, erinnerst du dich?« Atib sah ihn mit gut gespielter Besorgnis an. »Ist denn etwas nicht in Ordnung, Tasil? Es ist die, die du gestern unter all den anderen selbst ausgewählt hast.«
»Ein Mädchen? Ich? Lieber würde ich einen Eimer Pferdemist kaufen!«
»Damit kann ich leider nicht dienen«, spottete der Händler. »Nun, ich gebe zu, ich habe mich auch gewundert, und hättest du gesagt, dass du ausschließlich einen Jungen willst, so hätte sich das sicher einrichten lassen.«
Jetzt lachten die umstehenden Männer schallend.
»Die will ich nicht. Was soll ich mit einem Weib? Der Kauf ist ungültig, du hast mich betrogen.«
»Ah, jetzt kränkst du mich, Urather! Es war nicht meine Idee, sich die Ware in der Nacht anzusehen, erinnerst du dich?« Atib war ernst geworden. »Der Kauf ist von uns beiden per Handschlag besiegelt worden, nicht wahr, Fakyn?«
»Ich habe es gesehen«, sagte der Hüne und legte die Hand auf die Axt an seinem Waffengurt. Die Männer um ihn herum spannten sich an.
Tasils Hand zuckte zum Dolch in seinem Gürtel. In seinem Gesicht kämpfte Zorn gegen Vernunft. Doch mit einem Mal schien er sich zu beruhigen. »Gut, ich nehme sie, doch nicht, weil ich es will, sondern weil ihr viele seid, und ich allein bin. Die Hüter werden dich für deinen Betrug bestrafen.«
»Dann fehlt nur noch eine Kleinigkeit«, stellte Atib der Händler ungerührt fest.
Tasil nickte grimmig und gab den Dolch heraus. Der war mindestens zwei oder drei gute Sklaven wert. Es war eine auffällige Waffe, sie würde die Aufmerksamkeit jedes Hakuls wecken, der sie zu Gesicht bekam.
»Ich danke dir, Tasil, es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen.«
»Das Gleiche kann ich von dir nicht behaupten.«
»Oh, dein Urteil ist hart. Und wenn dir die Ware nicht gefällt, kaufe ich sie gerne für ein paar Kupferstücke zurück.«
Tasil sattelte sein Pferd unter dem Gelächter der anderen, aber er tat, als achtete er nicht mehr darauf. Er bestieg sein Pferd, bedeutete dem Mädchen mit einem Kopfnicken, ihm zu folgen, und ritt nach Osten davon. Die Rauchsäule stand immer noch am Horizont.
Erst als sie die Ruinen weit hinter sich gelassen hatten, hielt Tasil sein Pferd an. Das Mädchen war ihm ohne Widerspruch gefolgt und hatte noch kein Wort gesprochen.
»Kannst du eigentlich sprechen?«, fragte er.
»Ja«, sagte das Mädchen einfach.
»Wie alt bist du?«
»Das weiß ich nicht.«
Tasil lenkte sein Pferd im Kreis um sie herum, um sie von allen Seiten zu betrachten. Ihr fehlten sicher noch ein, vielleicht zwei Jahre, um als Frau zu gelten, ihr Körper zeigte noch keine Anzeichen weiblicher Entwicklung. Wäre sie die Tochter eines Bauern gewesen, hätte man sie natürlich trotzdem schon verheiratet. »Hast du einen Namen?«
»Ich bin eine Namenlose, Herr, bis du mir einen Namen gibst.«
»Man wird dich doch irgendwie gerufen haben.«
»Die anderen nannten mich Nehis«, erklärte das Mädchen.
»Ein seltsamer Name.«
»Es heißt die Ruhige in der Sprache der Dhanier, Herr.«
»Du bist eine Dhanierin?«
»Das weiß ich nicht, Herr, doch die Kräuterfrau, die mich als Erste so nannte, war von diesem Volk.«
»Eine Budinierin bist du nicht, das sehe ich, aber vielleicht stammst du von den Bauern im Norden ab oder von den Waldleuten, den Farwiern«, überlegte Tasil. »Woher stammen dein Vater und deine Mutter?«
»Ich habe sie nie kennengelernt, Herr, doch es heißt, auch sie seien schon Namenlose gewesen.«
Noch immer umkreiste Tasil das Mädchen auf seinem Pferd. »So? Heißt es das? Ich glaube, das erzählen die Budinier allen Sklavenkindern. Und hör auf, mich Herr zu nennen.«
»Wie soll ich dich nennen?«
»Nenn mich Onkel.«
»Onkel?«
»Ja, alle meine Sklaven haben mich so genannt. Kannst du dir das merken, oder bist du dazu zu dumm?«
»Ich werde es mir merken … Onkel.«
»Gut, und ich werde dich Maru nennen, verstanden?«
»Maru?«
»Ja, in der alten Sprache meiner Heimat bedeutet das Junge, aber hier wird das keiner wissen. Ich habe bisher alle meine Sklaven so genannt, und ich sehe nicht ein, diesen Brauch zu ändern, nur weil du ein wertloses Mädchen bist.«
Maru, die einmal Nehis gerufen worden war, sah Tasil schweigend an.
»Du hast grüne Augen, Maru.«
Das Mädchen schwieg. Was sollte sie darauf auch sagen?
»So wie die Göttin Hirth, weißt du das?« Er umkreiste sie immer noch. Eine Hand hatte er auf seinen Dolch gelegt. Seine Miene war finster. »Weißt du, was man von den Grünäugigen sagt?«
»Nein … Onkel.«
Tasil hielt sein Pferd an. Er sah in das blasse, schmale Gesicht. Seine Hand ruhte immer noch auf dem Griff der Waffe. Dann entspannte sich seine düstere Miene. »Du weißt es wirklich nicht?« Er zog seinen Dolch aus der Scheide. »Nun gut, komm her, Maru.«
Sie trat zögernd einen Schritt näher. Er beugte sich herab, griff nach dem schmalen Lederband, an dem das bleierne Sklavenzeichen um ihren Hals hing, schnitt es durch und steckte es ein. »Das heißt nicht, dass du frei bist, verstanden? Du bist mein, und es ist besser, du vergisst das nie. Solltest du versuchen zu fliehen, werde ich dich finden. Und du weißt, was man mit entflohenen Sklaven macht.«
Das Mädchen, das jetzt Maru hieß, nickte. Tasil steckte das Messer wieder ein. Er schüttelte den Kopf, so als würde er sich über sich selbst wundern. Dann streckte er seinen Arm aus: »Spring auf, Maru, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Erster Tag
Die Mauern von Serkesch
Seit jeher haben die Wächter eines Tores Anrecht auf einen Krug Brotbier am Tag, der Schab der Eschet auf deren zwei. Jeden Tag liefern unsere Brauer also vierzehn Krug zu jedem Wachwechsel an jedes der vier Tore, doch welche Eschet, o Herr, zählte noch zwölf Mann?
Kerva der Schreiber, Bericht für den Hohen Verwalter
Der Weg von Tasil und Maru führte am Ufer des Dhanis entlang nach Osten. Der Fluss war eingezwängt zwischen den südlichen Ausläufern des Glutrückens und einer gegenüberliegenden Hügelkette, deren Namen Maru nicht kannte. Sie traute sich nicht, ihren Herrn danach zu fragen. Nach drei Stunden erreichten sie ihr Ziel. Der Weg überquerte eine kleine Anhöhe, dann lag Serkesch vor ihnen. Maru hatte noch nie eine so große Stadt gesehen, und der erste Eindruck war überwältigend. Die Stadt lag ein Stück oberhalb des Flusses in einer sanft ansteigenden Ebene, auf zwei Seiten geschützt durch die roten Felsen der Hügelkette. Eine hohe Mauer mit zahllosen Türmen ragte in den Himmel. Gerade als das Pferd auf der Hügelkuppe stehen blieb, wehte der Wind den Klang von Hörnern herüber. Er trieb auch feine Staubwolken über die Ebene, und Marus Herr zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht, eine Möglichkeit, die Maru nicht hatte. Ihre Augen tränten.
»Das erinnert mich daran, dass ich Fahs, dem Hüter der Himmel und der Winde, ein Opfer bringen muss«, sagte Tasil. Es war das Erste, was er sagte, seit sie gemeinsam ritten.
»Warum?«, fragte Maru.
Tasil drehte sich um und lächelte auf eine Art, die das Mädchen an einen Wolf erinnerte. »Sagen wir, er hat mir zur rechten Zeit einen sehr hilfreichen Sandsturm geschickt.«
»Als du bei den Hakul warst … Onkel?« Es fiel ihr schwer, Tasil so zu nennen, und sie hatte auch keine Ahnung, warum er das von ihr verlangte.
»Du solltest nicht zu viele Fragen stellen, Maru. Und ich sollte dir vielleicht nicht zu viel erzählen. Weiter jetzt.«
Entlang des Flusses waren Felder angelegt. Auch Akyr, die Stadt, in der Maru die letzten Jahre gelebt hatte, lag am Strom, und auch die Budinier hatten Felder am Fluss angelegt, aber die Akkesch hatten ein feines Netz von Kanälen durch die Ebene gegraben, und so war ein breiter Streifen des einst trockenen Tals von Palmenhainen und Feldern bedeckt. Der Dhanis schwenkte kurz hinter der Stadt in einer weiten Schleife nach Süden ab. Und soweit Maru sehen konnte, waren beide Ufer von üppigem Grün gesäumt.
Inmitten der Felder lag der Hafen der Stadt. Er war von einer roten Mauer umgeben, und die Masten einiger Schiffe ragten hinter dieser hervor. Maru hatte in Akyr von Serkesch gehört. Die Budinier sprachen in einer Mischung aus Verachtung und Bewunderung von dieser Stadt, ihrer Größe – die sicher ungesund war –, ihren uneinnehmbaren Mauern – die die Akkesch und Kydhier wie Vieh zusammenpferchten –, ihrem Reichtum – der doch nur geraubt sein konnte –, den Kanälen, in denen das Wasser bergauf floss – was sicher das Werk böser Zauberer war. Maru hatte sich die Stadt trotz aller blumigen Beschreibungen nie recht vorstellen können. Die nördliche Festung der verhassten Akkesch war in aller Munde, auch wenn niemand, den Maru danach fragte, jemals dort gewesen zu sein schien. Jetzt lag die Stadt vor ihr, und sie übertraf alles, was sie darüber gehört hatte. Dennoch war etwas seltsam. Sie brauchte einige Zeit, bis sie sich darüber klar wurde, was es war: Es war heller Tag, aber niemand arbeitete auf den Feldern, kein Fischerboot schwamm auf dem Strom.
Sie zupfte Tasil am Ärmel. »Onkel, wo sind die ganzen Menschen?«
»Irgendwo werden sie schon sein«, brummte er.
Das Westtor, dem sie sich im gemächlichen Schritt ihres Pferdes näherten, war von dunkler Farbe. Zwei staubige Wege führten hinaus. Der eine war jener, auf dem sie ritten, der andere führte nach Norden. Dort durchschnitt ein schmales Tal die Hügel des Glutrückens. Die schwarze Rauchwolke, die sie den ganzen Tag schon hatten sehen können, stieg von irgendwo dort auf.
Tasil hielt das Pferd an. Er schien zu überlegen, ob er zunächst in dieses Tal oder geradewegs in die Stadt reiten sollte. Wieder wehte der Klang vieler Hörner aus der Stadt über die Mauer. Maru empfand ihn als misstönend. Vielleicht verstand Tasil dies als Zeichen, jedenfalls entschied er sich für den Weg zum Tor. Die Wälle waren aus Tausenden von gebrannten Ziegeln gemauert. Rund um das mächtige Tor waren sie dunkelrot lasiert, in den vielen goldgelben Flammenzeichen darauf erkannte Maru das Symbol des Feuergottes Brond. Die riesigen, mit Kupfer beschlagenen Holztore, drei an der Zahl, waren verschlossen. Sie wurden von einer Handvoll Speerträger bewacht. Diese wirkten unruhig, aber offensichtlich hatte das nichts mit ihnen zu tun, denn sie schenkten den beiden Ankömmlingen bislang keinerlei Beachtung.
Wieder klang das vielstimmige, misstönende Hörnersignal über die Mauern, und es war so laut, dass Tasils Pferd scheute. Er und das Mädchen hatten alle Hände voll zu tun, nicht abgeworfen zu werden. Die Wächter wichen an die Mauern zurück, so als drohe Gefahr aus dem Inneren der Stadt. Die Tore öffneten sich, aber zunächst ließ sich nur ein einzelner junger Mann mit rasiertem Schädel sehen. Er rannte aus dem Tor, drehte sich kurz um und rannte dann weiter.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Hunderte Menschen drängten aus den Seitentoren. Im Mitteltor erschien eine Schar kahlköpfiger Jungen, die mit kurzen Besen eilig den Weg kehrte, Kinder liefen hinter ihnen und streuten Blumen, die Menge machte aber noch keine Anstalten, ihnen zu folgen.
»Was ist das, Onkel?«, fragte Maru.
»Wart es ab!«, erwiderte der barsch. Er war immer noch damit beschäftigt, das Pferd im Zaum zu halten.
Eine Gruppe stattlicher Krieger marschierte jetzt durch das mittlere Tor. Selbst Maru konnte erkennen, dass dies keine gewöhnlichen Speerträger waren. Sie waren allesamt groß, fast so groß wie der Hüne Fakyn, die Spitzen ihrer Speere waren aus kostbarem Eisen, und ihre großen, runden Schilde waren üppig mit Bronze beschlagen. Sie trugen knielange, mit zahllosen Bronzenieten verstärkte Lederpanzer und federgeschmückte Helme. Achtlos trampelten sie über die gestreuten Blumen hinweg und stellten sich beiderseits des Weges auf. Immer mehr Menschen drängten aus den Seitentoren, aber die Krieger verhinderten, dass sie den Weg blockierten. Aus der Stadt erklangen Schreie durch die Pforten.
Eine große Gruppe langsam schreitender Hornbläser erschien, die noch im Torbogen anhielt und mit einer Vielzahl unterschiedlicher Hörner den furchtbarsten Lärm veranstaltete, den Maru sich vorstellen konnte. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Knochen im Leib von dem durchdringenden Klang erzitterten. Das Pferd scheute, und dieses Mal konnte sie sich nicht oben halten. Sie wurde abgeworfen, und Tasil versuchte fluchend, das aufgeregte Tier zu beruhigen. Aus den Seitentoren strömten weiter zahllose Menschen. Es schien, als sei die ganze Stadt auf den Beinen. Sie riefen durcheinander, jubelten und klagten und ließen, während sie vorwärtsdrängten oder gedrängt wurden, die Augen nicht vom mittleren Tor.
Dort erschienen jetzt, in würdevoller Langsamkeit, zwölf weiß gekleidete Männer, an ihren rasierten Schädeln leicht als Priester zu erkennen, die auf einer mit purpurnen Tüchern geschmückten Bahre eine mächtige Tonfigur trugen. Sie musste schwer sein, denn die Mienen der Priester waren vor Anstrengung verzerrt. Die Augen der Menge waren allein auf die Figur gerichtet. Die überlebensgroße Statue hatte die Gestalt eines bärtigen Kriegers in voller Rüstung. In der Rechten hielt er ein Sichelschwert aus Eisen, in der Linken einen kurzen Hirtenstab. Die Gestaltung der Gesichtszüge war starr und wie alles an der Figur übertrieben streng und würdevoll. Der Helm war mit einem silbernen Reif geschmückt, und Bernsteine funkelten anstelle der Augen.
Maru saß immer noch im Staub. Ihr war nichts passiert. Tasil hatte sein Tier jetzt im Griff und stieg ab, ohne seinen Blick von der seltsamen Szene zu wenden.
»Was ist das?«, rief Maru wieder, und sie musste sich anstrengen, um den lärmenden Misston der Hörner zu übertönen.
Ihr Herr antwortete nicht, sondern redete weiter beruhigend auf das Pferd ein. Es schien ihn nicht zu interessieren, wie seine Sklavin den Sturz überstanden hatte.
Die Menge nahm kein Ende, drängte an die Statue heran und schien doch davor zurückzuscheuen. Noch mehr Krieger erschienen und eilten nach vorn, um die Seiten der Trage zu schützen und die Menge zurückzudrängen. Maru stellte sich auf die Zehenspitzen. Sie sah weitere Priester. Vier waren weiß gekleidet, also Priester der Hüter, wie sie wusste. Dann wurde der Strom der Menschen dünner.
Maru konnte allerdings einen kurzen Blick auf einen weiteren Priester erhaschen. Er war hager, groß und kahlköpfig, und eines seiner Augen war mit einer Augenklappe verschlossen. Sein langes Priestergewand war grau und mit einer blutroten Schärpe geschmückt. Maru wusste, dass es sich bei ihm um einen Hohepriester Strydhs handelte. Dem Priester folgten, geschützt von einer Schar Krieger, zwei junge Männer mit ernsten Gesichtern. Sie blickten starr geradeaus und schienen darauf zu achten, einander nicht zu nahe zu kommen. Hinter ihnen strömten noch mehr Menschen, viel mehr Menschen, aus den Toren. Sie weinten, beteten, und über dem Jammern und Rufen ertönte immer wieder das Schmettern der Hörner. Der Zug folgte langsam dem Pfad. Maru sah den Läufer, der den Zug eröffnet hatte, in einiger Entfernung am Wegesrand stehen. Er gab den kehrenden Jungen und den Blumen streuenden Kindern Zeichen. Sie verließen den Weg, und der lärmende Zug folgte ihnen langsam hinunter zum Fluss. Die Tore wurden wieder geschlossen.
»Was war das, Herr?«, erneuerte Maru ihre Frage.
»Du sollst mich Onkel nennen.«
»Was war das, Onkel?«
»Das war die Statue von Raik Utu-Hegasch.«
»Und was bedeutet das … Onkel?«
»Stell nicht so viele Fragen. Komm jetzt, wir wollen in die Stadt. Und kein Wort, bis wir an den Wachen vorbei sind.« Er packte das Pferd am Zügel und ging voraus.
Ein Soldat versperrte ihnen den Weg mit seinem Speer. »Halt, Fremde. Wie sind eure Namen? Und was führt euch in unsere Stadt?«
»Tasil ist mein Name, das ist die Tochter meiner Schwester, Maru genannt. Ich bin Händler.«
Der Soldat musterte ihn und schlenderte einmal um ihn, Maru und das Pferd herum, dann sagte er: »Viele Waren hast du ja nicht feilzubieten …«
»Der Schein trügt.«