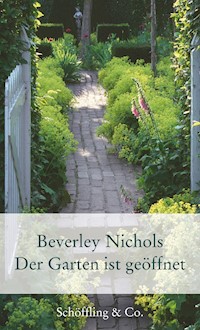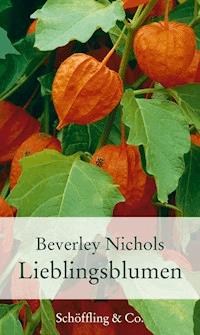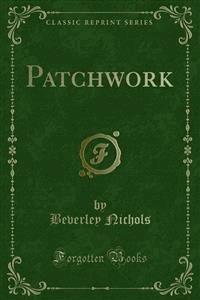3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Es soll Mr. Green, dem feinfühligen und warmherzigen Privatdetektiv, nicht vergönnt sein, sich unbeschwert an der herbstlichen Glut der Ahornbäume im Park von Broome Place zu weiden. Denn über diesem prächtigen Herrensitz, der von seinem Besitzer, dem Finanzbaron Lloyd, mit den erlesensten Kunstwerken angefüllt und mit unvergleichlichem Luxus ausgestattet wurde, lastet eine drückende Atmosphäre voller Spannung, die sich in einem häßlichen Verbrechen entlädt. Nicht nur Menschen, sondern auch eins der kostbaren Bilder, auf dem ein Engel dargestellt ist, fallen dem unbekannten Mörder zum Opfer … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Ähnliche
Beverley Nichols
Der rätselhafte Engel
Aus dem Englischen von Maria Meinert
FISCHER Digital
Inhalt
I Der Schuss
1
Wie heißumstritten die anderen Tatsachen auch sein mochten in den spannenden, aufreibenden Wochen, die auf die Nacht des dreizehnten Oktober folgten, über einen Punkt wenigstens waren sich alle einig: Miß Larue hatte einen über den Durst getrunken.
Wie tief sie aber ins Glas geschaut hatte, darüber gingen die einzelnen Meinungen auseinander. John, der junge Diener, der den Gästen Champagner serviert hatte, stand offenbar unter dem Eindruck, daß sie lediglich etwas «angeheitert» gewesen war. Soweit er sich entsinnen konnte, hatte er ihr Glas nur dreimal gefüllt. Dieses Zeugnis wurde entkräftet durch die Aussage von Miß Sally Kane, die – da ein Herr fehlte – beim Essen zu ihrer Rechten gesessen hatte. Sie habe kaum den Kopf zur Seite gedreht, beteuerte Miß Kane, da habe Miß Larue auch schon in unverschämtester Weise ihr Glas weggenommen und geleert, bevor man sie daran hindern konnte. Lady Coniston hatte dieses ganz und gar nicht damenhafte Benehmen auch beobachtet, und sie war eigentlich – wie sie nachdrücklich hinzufügte – gar nicht davon überrascht. Sie hatte ebenfalls bemerkt, daß Miß Larue vor dem Essen drei trockene Martinis getrunken hatte, daß sie mit ihrem Kleid an einer Chippendale-Kommode hängengeblieben war, als man die lange Galerie zum getäfelten Musikzimmer hinunterging, und daß sie sich nach dem Essen gelben Chartreuse in rauhen Mengen zu Gemüte geführt hatte. Woraus hervorgeht, daß Lady Coniston eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe besaß.
Die Aussagen der anderen Mitglieder der Hausgesellschaft waren je nach Temperament verschieden. Mr. Cecil Gower-Jones, der glänzende junge Musikkritiker der Neuen Ära, sprach äußerst ungern über die Angelegenheit. Trunkenheit fand er langweilig und widerwärtig. Als Miß Larues Zustand ihm aufgefallen war, hatte er einfach ganz woandershin geblickt. («Der gute Cecil», so äußerte sich Lady Coniston später, «scheint in kritischen Momenten immer woandershin zu blicken.») Ein paarmal war er jedoch gezwungen gewesen, Miß Larue anzusehen, und dabei hatte er festgestellt, daß sie außerordentlich rot im Gesicht war und schwer atmete. Auch war es ihm nicht entgangen, daß das Oberteil ihres Kleides in Unordnung geraten war. Diese Symptome waren auch Palmer, dem hochintelligenten jungen Butler, aufgefallen, aber anscheinend ohne dasselbe Mißfallen zu erregen. «Einfach großartig sah sie aus», schilderte er im Dienstbotenzimmer, «wie sie mit wirrem Haar im Sessel zurücklehnte, ohne sich den Teufel um die anderen zu scheren. Wie der Engel auf dem Rubensgemälde über der Treppe.» Eine intelligente Bemerkung. Wenn Miß Larue auch gerade kein Engel war, so besaß sie doch die Linien, die Farben und die Textur eines Rubens der allerbesten Periode.
Die Aussagen der anderen entsprachen ganz den Erwartungen. Sir Luke Coniston bemerkte zunächst kurz und bündig, er habe sich in Gedanken zu sehr mit der Börseneruption beschäftigt, um auf die Possen einer beschwipsten Frau zu achten. – So, sie war also beschwipst gewesen? – Ja, das nahm er an. Jetzt, wo es zur Sprache kam, fiel ihm auch ein, daß sie etwas Brandy über seinen Smoking gegossen hatte. Nicht, daß ihm das etwas ausmachte. Er besaß ja noch viele andere Smokings.
Andrew Lloyd, der Gastgeber, erzählte ungefähr dieselbe Geschichte. Auch er hatte sich Gedanken über den Börsenmarkt gemacht … weit mehr noch als Sir Luke, der sich im entgegengesetzten Lager befand. Ja, er hatte Miß Larues Zustand bemerkt, sich aber weiter nicht den Kopf darüber zerbrochen; denn er hatte gesehen, daß sie bei seiner Frau Nancy gut aufgehoben war, die sie dann auch eine Stunde vor der Tragödie taktvoll auf ihr Zimmer begleitet hatte.
Letzten Endes war Nancy Lloyds Aussage die einzige, die ein etwas freundlicheres Licht auf das Benehmen der unglückseligen Frau warf – wenn auch ihre sanften Andeutungen vielleicht kaum als «Zeugenaussage» gelten konnten. Sie gab zu, daß Miß Larue etwas viel getrunken hatte, aber sie war eben ein heiteres, sorgloses Geschöpf und wußte vielleicht nicht einmal, was sie tat. Vielleicht fühlte sie sich auch nicht gut … hatten die anderen denn nicht gemerkt, wie blaß sie vor dem Essen war? War es ferner nicht möglich, daß sie ihren üblichen Schlaftrunk schon vor dem Essen genommen hatte anstatt hinterher? Miß Larue war durchaus nicht sinnlos betrunken, als sie ihr Zimmer erreichte. Sie hatte sich aufs Bett gelegt, zur Decke gestarrt und – ganz vernünftig – erklärt, sie wolle mit dem Ausziehen noch etwas warten, dann ein Bad nehmen und vielleicht vorm Schlafengehen noch ein wenig lesen. Sie hatte so schön ausgesehen, wie sie dort lag, auf so tragische Weise anders als … hinterher.
2
Jede Geschichte – sei sie tragischer oder komischer Natur – wurzelt tief in der Vergangenheit. Aber zunächst brauchen wir uns nur mit der letzten Stunde zu befassen. Und wenn wir später auch näher an die Charaktere herantreten – so nahe, daß wir jeden Schatten sehen können, der über ihre Gesichter huscht – können wir uns im Augenblick damit begnügen, die ganze Angelegenheit wie ein Drama auf der Bühne zu betrachten – gleichsam, als hätten wir einen Parkettsitz im Theater.
Die Stunde ist ein Viertel vor zehn, Samstagabend, den 13. Oktober, und die Zeit ungefähr die Gegenwart. Der Schauplatz ist Broome Place, ein Herrschaftssitz aus der Zeit der Königin Anne, der hoch auf einem Hügel in der Grafschaft Sussex steht und Eigentum des Finanzbarons Andrew Lloyd ist. Die handelnden Personen wurden uns bereits kurz vorgestellt.
Der Vorhang hebt sich, während ein Grammophon spielt. Wie jeder andere Gegenstand in Broome Place ist dieses Grammophon luxuriös und ungewöhnlich. Luxuriös, weil es von Meistern des Fachs mit der Hand gearbeitet ist. Ungewöhnlich, weil es trotz der kostbaren Verkleidung mit Stulppaneelen aus der Tudorzeit und der darüber gebreiteten Decke aus verblichenem karmesinroten Samt, die wahrscheinlich aus einem Altartuch geschnitten war, nicht annähernd so protzenhaft aussieht, wie es sich anhört. «Obschon natürlich», hatte Nancy Lloyd einmal geäußert, «jeder doch sagen wird, es ist protzenhaft, schon allein, weil Andrew ein Börsenmakler ist. Für einen Börsenmakler ist es sogar protzenhaft, wenn er einen Rembrandt kauft.»
Die Herren hatten sich nach dem Essen gerade wieder zu den Damen gesellt. Cecil Gower-Jones war der erste, der den Raum betrat. Sobald er die Musik hörte, rief er begeistert: «Liebste Nancy! Wie haben Sie es nur erraten, daß der Blaue Joseph gerade der Mann in der Welt ist, den ich heute abend brauche?»
Sie lächelte ihn sonderbar an. «Vielleicht lese ich Ihre Artikel, Cecil.»
«Sie finden immer das richtige Wort.» Er warf dem Grammophon einen Handkuß zu. «Blauer Joseph – du Teufelskerl!»
«Blauer wer?» Die knappe, abrupte Frage kam von einem jungen Mädchen, das am Kamin stand und sich die Hände an der Glut des Holzfeuers wärmte. Sie war ungefähr einundzwanzig, blond, ein hübscher Stupsnasentyp mit schlechtem Teint. Aber sie blickte mürrisch drein.
«Blauer – wie sagten Sie doch?» wiederholte sie schnippisch, bevor er antworten konnte.
Er starrte sie ganz überrascht an. «Für eine Amerikanerin, die noch dazu aus einem der Südstaaten stammt, ist das eine höchst merkwürdige Frage.»
Sally Kane zuckte die Achseln. Aber der primitive Rhythmus begann seine Wirkung auf sie auszuüben. Cecil sah, daß sie leise mit den Fingern knipste. «Sehen Sie», fuhr er fort, «Sie können nicht widerstehen. Lassen Sie uns tanzen.» Er merkte, wie sie einen Blick auf die Uhr warf. «Ihr lästiger Richard wird doch nicht vor einer Stunde hier sein.»
Sie wandte sich an Palmer, der gerade mit einem schwersilbernen, gläserbeladenen Tablett vorbeikam. «Sind Sie ganz sicher, daß Seine Lordschaft gesagt hat, er sei nicht vor elf Uhr hier?»
«Ganz sicher, Miß.»
Sie nickte nachdenklich vor sich hin. Nach ihrem Gesichtsausdruck zu schließen, konnte Lord Richard mit keinem allzu warmen Empfang rechnen. Dann gab sie Cecil ihre Hand, und sie fingen an zu tanzen.
Sir Luke ging zu Nancy Lloyd und beugte sich über sie. Er glänzte vom Scheitel bis zur Sohle, und als er den Kopf neigte, funkelte das Licht des Kronleuchters auf seinem dichten schwarzen Haar.
«Ich dachte immer, du könntest solche Musik nicht ausstehen», sagte er.
Wie seltsam, dachte sie bei sich, daß seine Stimme – obwohl er in Harrow und Cambridge studiert hat – immer noch diesen schwachen östlichen Einschlag aufweist.
Laut sagte sie: «Kann ich auch nicht. Ich bekomme stets eine Gänsehaut.»
«Warum spielst du sie dann?»
«Weil sie nun mal dazugehört.» Sie lächelte zu ihm auf. «Man gilt heutzutage nicht als intelligent, wenn man nicht über ein Geräusch in Ekstase geraten kann, das in meinen Ohren klingt wie eine Versammlung neurotischer Neger in den letzten Stadien der Epilepsie.»
«Warum spielst du sie dann?» wiederholte er.
Wie beharrlich er ist, dachte sie mit einer Spur von Gereiztheit. Wieder einmal der östliche Einschlag!
«Cecil ist davon so begeistert. Und man muß auf seine Gäste Rücksicht nehmen.» Sie blickte zu Lady Coniston hinüber, die in einem teuren Magazin blätterte. «Ich glaube, Sybil würde gern tanzen.»
«Warum nicht mit Andrew?»
«Weil Andrew niemals tanzt. Und weil Sybil deine Frau ist. Und weil du den ganzen Abend kaum ein Wort mit ihr gesprochen hast. Und weil – o du meine Güte – weil wir uns wenigstens etwas Bewegung verschaffen könnten, wenn wir schon dieses Gejaule über uns ergehen lassen müssen.»
Mit einem Seufzer schlug er die Hacken zusammen und verbeugte sich. Dann ging er zu seiner Frau hinüber, die sein Kommen freudig begrüßte, und forderte sie zum Tanz auf.
3
«Stellen Sie das Ding ab … stellen Sie’s ab!»
Es war fünf Minuten später, und der Schrei kam von der unglücklichen Miß Larue. Sie lag zurückgelehnt in einem karmesinroten Samtsessel in der äußersten Ecke des Zimmers. Ihre Augen waren halb geschlossen, und – wie Palmer, der Butler, bemerkt hatte – ihr Dekolleté war verrutscht. Bei der geräuschvollen Musik hörten die tanzenden Paare sie nicht. Mrs. Lloyd anscheinend auch nicht. Aber Andrew Lloyd hörte sie. Er wandte sich an seine Frau und sprach leise mit ihr.
Ehe sie antworten konnte, ließ sich Miß Larue schon wieder vernehmen, und zwar bedeutend lauter als vorher. Sie zeigte mit dem Finger auf Cecil Gower-Jones, den sie offenbar als den Urheber der Musik ansah, und kreischte: «Stellen Sie das verdammte Ding ab, sag’ ich Ihnen!»
Die Paare blieben wie angewurzelt stehen und starrten sie an. In den nächsten paar Minuten passierte dann alles sehr schnell. Nach einem ängstlichen Blick auf Miß Larue, die Anstalten machte, sich aus ihrem Sessel zu erheben, ging Cecil zum Grammophon, um es abzustellen. Seine Partnerin Sally machte eine Gebärde des Abscheus und kehrte zu ihrem Platz am Kamin zurück. Die Conistons standen einfach da und starrten. Andrew Lloyd ging einen Schritt auf Miß Larue zu, blieb aber zögernd stehen …
Nancy Lloyd rettete jedoch die Situation. Sie ging schnell zu den Conistons hinüber, nahm Sir Lukes Arm, legte ihn um seine Frau und brachte sie mit einer geschickten Handbewegung wieder zum Tanzen. Sie holte Cecil vom Grammophon und führte ihn zurück zu Sally. Dann ging sie zu Miß Larue und flüsterte ihr etwas zu, das sie – o Wunder! – zum Lachen brachte. Miß Larue lachte so laut, daß ihre Lachsalven das Geschmetter des Grammophons übertönten. Mit diesem homerischen Gelächter verließ sie an Nancys Arm den Raum.
Als Nancy einige Minuten später zurückkam, stellte Cecil das Grammophon ab, und alle umdrängten sie.
«Liebes Kind», rief Lady Coniston, «du hast einen Orden verdient. Wie kann man sich bloß so aufführen!»
«Fühlt sie sich besser?» Diese Frage wurde von Andrew gestellt. Aus seiner Stimme klang Besorgnis, was Lady Coniston veranlaßte, ihn scharf aufs Korn zu nehmen.
Nancy nickte ruhig. «Ja, entschieden besser. Sie hat sich aufs Bett gelegt und schläft wahrscheinlich schon.»
Cecil schauderte etwas theatralisch. «Hoffentlich verharrt sie in diesem Zustande. Wenn sie wieder nach unten kommt, kriege ich Schreikrämpfe. Sie sah ganz danach aus, als ob sie mich anfallen wollte!»
«Was hat denn eigentlich diesen Heiterkeitsausbruch verursacht?» fragte Sally.
«Etwas ganz Blödes. Ich weiß nicht mehr was.» Nancy wandte sich an Sir Luke. «Reden wir von etwas anderem. Oder will jemand noch tanzen?» Aber niemand verspürte große Lust dazu.
«Dann», schlug Andrew vor, «wollen wir uns mal meinen neuen Van Goyen ansehen.»
Sir Luke warf ihm einen finsteren Blick zu. «Hast du noch einenVan Goyen gekauft?»
«Sicher. Hast du etwas dagegen?»
Sir Luke grunzte nur und folgte ihm aus dem Zimmer.
4
Die nächste halbe Stunde war ein verhältnismäßig friedliches Intermezzo. Wenn dies wirklich ein Theaterstück wäre und wir im Parkett säßen, könnten wir uns tatsächlich veranlaßt fühlen, uns über Mangel an Handlung zu beklagen; denn die Bewegungen einer Reihe von Leuten, die aufs Geratewohl durch die Galerien und Räume eines herrschaftlichen Hauses schlendern, vor Bildern stehenbleiben und sich diese anschauen, haben gerade nichts Aufregendes an sich.
Erst kurz nach halb elf kam Leben in die Sache. Nancy Lloyd war in der Bibliothek, wo sie Lady Coniston eine kleine, ausgezeichnete Skizze eines Kinderkopfes von Romney zeigte. Plötzlich drangen einige im Eifer des Gefechts lautgewordene Stimmen an ihr Ohr.
Seufzend legte sie die Skizze hin. «Liebste Sybil, sie liegen sich mal wieder in den Haaren.»
«Wer?»
«Andrew und Luke. Hörst du sie denn nicht?»
«Natürlich höre ich sie.» Sie klopfte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. «Das kommt von dem elenden Van Goyen. Andrew hätte nichts davon erwähnen sollen. Ist er gut?»
«Ja. Er ist ausgezeichnet.»
«Um so schlimmer. Luke tobt geradezu, wenn Andrew etwas Besonderes kauft.» Die Stimmen wurden lauter. «Man sollte sie zum Schweigen bringen.»
«Ich habe mich bereits als Friedensstifter betätigt. Es langt mir für einen Abend.»
«Aber, liebste Nancy, du verstehst dich doch so gut darauf.»
Nancy zauderte. In diesem Augenblick trat Cecil ins Zimmer. Er fuhr zusammen, als er die beiden Frauen sah. «Ich dachte, Sie seien nach oben gegangen», murmelte er. Er warf einen Blick über seine Schulter. «Da ist ja ein Höllenspektakel im Gang.»
«Dann ist es gerade gut, daß Sie gekommen sind», erwiderte Lady Coniston schnippisch. «Sie sind der einzige andere Mann im Haus.» Sie verlieh dem Wort einen boshaften Klang. «Sie könnten hingehen und sie auseinanderbringen.»
Cecil klimperte nur mit seinen langen Augenwimpern. Ohne sie einer Antwort zu würdigen, stürzte er durch die andere Tür aus dem Zimmer.
Lady Coniston gab einen verächtlichen Laut von sich. «Widerliches Subjekt. Ich kann nicht verstehen, warum du ihn einlädst. Liebste, nun geh doch schon hin und schütte Öl auf die stürmischen Wogen.»
Nancy kämpfte noch mit sich. Dann zuckte sie die Achseln. «Na, schön», sagte sie.
Sie gingen hinaus. Die beiden Männer standen in der langen Galerie vor einem Bild, das sie auf ein Sheraton-Sofa gestellt hatten. Sie stritten sich so heftig, daß sie sie gar nicht kommen hörten.
«Wenn du den leisesten Schimmer von Van Goyen hättest …» sagte Andrew gerade.
«Und wenn du den leisesten Schimmer von Van Goyen hättest, würdest du ihn nicht ohne Namenszug gekauft haben.»
«Ich habe dir hundertmal gesagt, es gibt drei Perioden bei Van Goyen … die grüne, die graue und die braune … und in der grünen Periode hat er seine Bilder nicht gezeichnet und …»
«Und du kannst es mir noch hundertmal sagen, du verdammter Narr … grün, grau, braun – was hat das schon damit zu tun?» Sir Lukes Gesicht zuckte, und eine häßliche Ader zeichnete sich auf seiner Stirn ab.
In diesem Augenblick legte sich Nancy ins Mittel. «Hört mal, meine Lieben!» rief sie mit einer so schallenden Stimme, daß sie gezwungen waren aufzuhorchen. «Ich möchte mein Haus nicht in einen Bärenkäfig verwandelt sehen.»
Keiner der Männer antwortete. Man hörte sie nur keuchen.
«Andrew, du bist wirklich nicht nett. Du hast Luke geärgert. Nimm ihn mit und gib ihm etwas zu trinken.»
«Wenn Luke was trinken will, dann weiß er, wo’s steht.»
«Danke bestens», lautete Sir Lukes barsche Antwort. Ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, drehte er sich um und ging fort.
Nancy starrte ihm nach. «Wohin ist er denn nur gegangen?»
«Zum Teufel, hoffe ich.»
«Andrew, du bist ekelhaft. Warum eigentlich?»
«Ich weiß es nicht. Bin verärgert.» Er setzte sich auf das Sofa und legte den Arm über den Rahmen des Bildes.
«Wegen des Van Goyen?»
«Natürlich. Luke hat viel Unsinn darüber geredet, und ich kann Dummköpfe nun einmal nicht ausstehen.»
Sie lächelte ihn wohlwollend an. «Das ist mir nicht ganz neu. Aber es war doch nicht nur der Van Goyen, nicht wahr?»
In diesem Augenblick hörte sie eine Stimme vom anderen Ende der Galerie. Es war Lady Coniston. Sie stand mit einem Armvoll von Magazinen am Fuß der Treppe.
«Gute Nacht, Kinder!» drang ihr Bühnengeflüster zu ihnen. «Ich gehe zu Bett!» Sie legte einen Finger an die Lippen und wies in die Richtung, in der ihr Mann verschwunden war. Dann warf sie ihnen eine Kußhand zu und stieg die Treppe hinauf.
«Dämliche alte Trine!» murmelte Andrew vor sich hin.
«Es war nicht nur der Van Goyen, nicht wahr?»
«Na, Margot hat auch nicht gerade zur Heiterkeit des Abends beigetragen.» Er seufzte. Dann streckte er seine Hand nach ihr aus. «Ich finde, daß du mit dieser ziemlich peinlichen Episode ganz hervorragend fertig geworden bist.»
«Danke für das Kompliment. Ich hoffe, es wird mir auch in Zukunft gelingen.»Ihre Stimme war kalt und formell. Aber sie drückte ihm fest die Hand.
Es herrschte Schweigen in der langen Galerie. Schweigen ist ein elastisches Wort; es kann eine Ewigkeit in den Bruchteil einer Sekunde packen und einen Moment der Langeweile wie einen Monat erscheinen lassen. Dies war ein seltsames Schweigen, das sich endlos auszudehnen schien. Doch war es kein absolutes Schweigen; denn draußen hatte sich ein Wind erhoben, der rasch anschwoll, und das alte Haus gab eine Menge kleiner Geräusche von sich: es stöhnte und knarrte und seufzte und ächzte.
Es war zwanzig Minuten vor elf.
Nancy zog ihre Hand zurück. Sie war nicht sentimental veranlagt, und außerdem mußte sie an ihre Gäste denken.
«Wo stecken sie denn bloß alle?»
«Ist das wichtig?»
«Natürlich. Wir können doch nicht alle so verschnupft zu Bett gehen. Es ist ja geradezu lächerlich. Wir müssen uns wirklich darum kümmern. Wo ist Cecil zum Beispiel?» In diesem Augenblick kam der Butler durch die Tür des Arbeitszimmers und drehte hinter sich das Licht aus. «Wissen Sie, wo Mr. Gower-Jones ist, Palmer?»
«Er ist vor einigen Minuten nach oben gegangen, gnädige Frau.»
Sie zog die Augenbrauen hoch. «Zu Bett?»
«Das kann ich nicht sagen, gnädige Frau.»
Sie wandte sich an ihren Mann. «Cecil würde doch sicher nicht zu Bett gehen, ohne gute Nacht zu sagen?»
«Wahrscheinlich ist er nur dahin gegangen, wo der Kaiser zu Fuß hingeht.»
«Sie können gehen, Palmer.» Sie zog die Stirn in ärgerliche Falten, als der Butler fortging. «Und Sally? Wo ist die geblieben?»
«Sie war vor einer Minute noch hier.»
«Das ist wohl nicht gut möglich. Ich bin selbst schon mindestens drei Minuten hier.»
«Sei doch nicht so pedantisch. Ich weiß natürlich nicht, wieviele Minuten es genau waren. Aber sie war hier, als Luke seine Mucken bekam. Da habe ich sie fortgeschickt.»
«Wohin?»
«Ich habe ihr geraten, sich deinen neuen Hondecoeter anzusehen.»
«Aber der steht doch immer noch im Blumenzimmer gegen die Wand gelehnt, und sie wird ihn niemals richtig beleuchten können. Er sieht schrecklich aus, wenn er nicht das richtige Licht hat.»
Lloyd blickte seine Frau fragend an. «Du scheinst ja merkwürdig darauf bedacht zu sein, daß Sally einen guten Eindruck von deinem Hondecoeter bekommt.»
«Das bin ich auch». Sie lächelte ihn sanft an. «Sieh mal, Liebling, ich bin nämlich nicht so ganz sicher, ob es überhaupt ein Hondecoeter ist. Und wenn nicht … na, ich könnte vielleicht Sally davon überzeugen, daß es gerade das Richtige ist für die Sammlung ihres lieben Vaters.»
Er ergriff ihre Hand und küßte sie. «Ich finde dich einfach bezaubernd, wenn du dich wie ein Gauner benimmst.»
«Benehme ich mich wie ein Gauner? Ob es ein Hondecoeter ist oder nicht, es ist jedenfalls ein sehr hübsches Bild. Und Mr. Kane ist ein sehr törichter Mann, wenn er auch hundertmal Millionär ist.» Plötzlich blickte sie zum Fenster hinüber. «Was war das?»
«Was war was?»
«Ich dachte, ich hätte etwas gehört.» Sie ging rasch zum Fenster, schob die Vorhänge beiseite und blickte suchend hinaus. «Nein. Nichts.»
«Liebling, bist du nervös?»
«Nein. Nur gelangweilt.» Sie ließ die Vorhänge wieder zurückfallen. «Wirklich, Gäste haben doch heutzutage die merkwürdigsten Manieren. Einfach so zu verschwinden. Luke und ich wollten doch ein Puffspiel machen. Wo ist er denn nur?»
Sie ging ein paar Schritte vor, machte aus ihren Händen einen Trichter und rief: «Luke! Luke!»
Ihre Stimme – die ein wenig zitterte, zweifellos vor Ärger – lief mit Hall und Widerhall die lange, trübe erleuchtete Galerie entlang. Schweigen war die Antwort.
Aber das Schweigen war von kurzer Dauer. Im nächsten Moment ertönte ein Schuß … der Schuß, mit dem unsere Geschichte eigentlich erst anfängt.
II Der Brief und der Hüter des Gesetzes
1
Der junge Ronald Bates hätte niemals Polizist werden sollen. Er war viel zu sanft, zu liebenswürdig und zu schüchtern, wenn es galt, sich in die Angelegenheiten anderer Leute zu mischen. Außer in Fällen von tatsächlicher Grausamkeit – wo er leicht den Kopf verlor und dazu neigte, etwas zu heftig und eigenmächtig einzugreifen – hätte er viel lieber die Leute ungestört ihren eigenen Weg gehen lassen.
Aber was konnte man schon machen, wenn man einen begabten großen Bruder beim Yard hatte. Sobald Arthur zum Assistenten des großen Kommissars Waller befördert worden war, hatte der junge Ron gewußt, daß sein Schicksal besiegelt war. «Du magst es eines Tages ebenso weit bringen», hatte man ihm versichert. «Du kannst in seine Fußstapfen treten.» Es war zwecklos zu beteuern, daß das der letzte Platz war, wo er hinzutreten wünschte. «Hinein in die Polizei!» hieß die Parole. So kam es denn, daß er in dieser stürmischen Nacht des 13. Oktober ganz allein im Dienstzimmer der kleinen Polizeiwache in West Greenstead saß und inbrünstig betete, daß nichts passieren möge.
Er hatte einen besonderen Grund, ängstlich zu sein. Erst vor ein paar Stunden war sein Vorgesetzter, der normalerweise für etwaige Notfälle zur Stelle gewesen sein würde, unter heftigen Schmerzen an seinem Tisch zusammengebrochen und mußte sich in diesem Augenblick im hiesigen Hospital einer Blinddarmoperation unterziehen. Und da ein Unglück selten allein kommt, hatte zehn Minuten später der wachhabende Beamte der Süd-Sussex-Polizei angerufen und ihn davon in Kenntnis gesetzt, daß vier Polizisten seines Reviers einen Autounfall gehabt hätten; er hatte ihn aufgefordert, sich «in Bereitschaft» zu halten, falls in der Nachbarschaft etwas passieren sollte. In Bereitschaft! Das hörte sich schon ganz unheimlich an.
Er blickte auf die Uhr. Es war elf Uhr fünfzehn. Noch fünfundvierzig Minuten. Um Mitternacht würde er, Gott sei Dank, vom jungen Simpson abgelöst.
Da klingelte das Telefon.
Der Anruf kam von Broome Place; Andrew Lloyd war am Apparat. Während der junge Bates den Worten lauschte, nahm sein Gesicht einen unglücklichen Ausdruck an. Das Schlimmste war eingetroffen. Eine junge Dame, Miß Larue, hatte sich das Leben genommen. Es schien, als ob die Umstände eine Untersuchung verlangten. Seine Anwesenheit war dringend erwünscht.
Als Ron den Hörer auflegte, war er den Tränen nahe. Nur zwei Dinge trösteten ihn. Das eine war ein schwacher, das andere ein nicht so schwacher Trost. Zunächst konnte er sich eine gewisse Befriedigung nicht versagen bei dem Gedanken, wie ärgerlich der junge Simpson sein würde, wenn er hörte, daß er diese Chance, sein Genie unter Beweis zu stellen, verpaßt hatte. Zweitens hegte er den starken Verdacht – der sich halb auf Furcht, halb auf Hoffnung gründete – daß seine eigene Unfähigkeit als Polizist so zutage treten würde, daß er – großer Bruder hin, großer Bruder her – in Kürze gezwungen sein würde, sich nach einer anderen Beschäftigung umzusehen.
2
Das prächtige Haus erstrahlte im Lichterglanz, als Bates junior genau um halb zwölf vor der Säulenhalle hielt und sein Motorrad parkte. Im selben Augenblick öffnete sich die Haustür, und er sah in das ihm bekannte Gesicht von Palmer. Das flößte ihm einen gewissen Mut ein. Er hattePalmer oft in der Wirtschaft angetroffen und sich sogar manchmal beim Pfeilspiel mit ihm gemessen. Palmer würde ihm vielleicht ein paar Winke geben können.
Aber ehe er noch guten Abend sagen konnte, erschienen bereits andere Gestalten, und das Herz sank ihm wieder in die Kniekehlen. Da standen Andrew Lloyd im Smoking und eine Dame in schwarzem Samt mit Diamanten um den Hals und eine andere Dame in einem höchst merkwürdigen Aufzug – eine Art Morgenrock – und ein hübsches Mädchen in Grün und noch ein paar Herren. Und alle starrten ihn an.
«Guten Abend, Herr Wachtmeister», begrüßte ihn Lloyd. «Wollen Sie bitte hereinkommen?»
«Ja, danke, Sir.» Selbst das Wort «Wachtmeister» versetzte ihn schon in helle Aufregung. Als er eintrat und zum erstenmal die lange Galerie sah, traute er seinen Augen nicht. Es war wie im Film. Nein – besser noch. So ein Glühen und Funkeln und solch eine Üppigkeit gab es im Film nicht. Besonders nicht solche Üppigkeit. Der junge Ron war vielleicht kein guter Polizist, aber er war ein beeindruckbares menschliches Wesen, und im Augenblick fühlte er sich vom Reichtum überwältigt. Der Reichtum lag ihm zu Füßen in Gestalt von weichen Buchara-Teppichen, die die Galerie in ihrer ganzen Länge schmückten. Der Reichtum blendete ihn, als er die lange Reihe geschickt beleuchteter Meisterwerke sah, die kein Ende zu nehmen schien – Madonnen und Heilige und Heilige Familien, steif gemalt, aber glitzernd vor Gold und leuchtend in ihrem primitiven Blau und Scharlachrot. Der Reichtum erstickte ihn; denn selbst die Luft schien damit geladen zu sein.
Am Fuße der Treppe blieb Lloyd stehen. «Nancy, du könntest eigentlich alle ins Musikzimmer bringen. Vielleicht ist unsere Anwesenheit nachher erwünscht. Ich führe den Wachtmeister direkt nach oben.»
Bates folgte ihm die lange Treppe hinauf, und dann ging’s noch eine Galerie entlang. Als sie am Ende ankamen, öffnete sich eine Tür, und ein älterer Mann trat heraus. Er hatte einen schwarzen Mantel an und trug eine kleine Ledertasche. Bates erkannte ihn als einen der Ärzte vom Krankenhaus.
«Ich wollte Sie gerade aufsuchen», sagte er zu Lloyd. Er sprach mit matter, jammernder Stimme, denn um diese Zeit lag Dr. Cartwright gewöhnlich schon längst im Bett.
«Vielleicht bleiben Sie noch einen Augenblick und reden mit Mr ….» Andrew Lloyd lächelte Bates plötzlich an. «Ich kann Sie nicht dauernd Wachtmeister nennen.»
«Bates, Sir.»
«Mit Mr. Bates.»
Der Doktor zuckte die Achseln. «Wenn Sie es wünschen. Ich kann ihm zwar nicht viel sagen.» Er wandte sich an Bates. «Es ist gerade kein schöner Anblick», bemerkte er barsch.
Bates nickte nur. Sie traten ins Schlafzimmer.
3
Nein. Die tote Margot Larue bot keinen schönen Anblick. Aber der junge Bates hatte in seiner kurzen Laufbahn schon Schlimmeres gesehen. Sein Magen drehte sich einmal um. Dann schluckte der junge Mann, holte tief Atem und machte weiter.
Zu seiner größten Überraschung entdeckte er, daß die Eintragungen, die er in sein Notizbuch machte, mit fester Hand geschrieben und durchaus verständlich waren. Da diese Aufzeichnungen in den folgenden Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen, ist nachstehend ein Auszug daraus gegeben.
Todesursache. Kernschuß durchs rechte Ohr. Beträchtliche Entstellung. Arzt bestätigt sofortigen Tod.
Lage der Leiche. Liegt auf dem Bett. Rechter Arm hängt über den Rand. Revolver am Boden, ungefähr fünfzehn Zentimeter von der Hand.
Revolver. Armee-Colt, Nummer II. Nur eine Kugel abgefeuert.
Spuren von Gewalttätigkeit. Im Schlafzimmer keine. Bettdecke glatt. Glas Wasser auf dem Nachttisch. Auch ein Teller mit Trauben. Auf dem Fußboden des Badezimmers jedoch eine zerbrochene Flasche, wahrscheinlich ein Toilettenpräparat. Inhalt für Analyse zurückbehalten.
Zugänge zum Schlafzimmer. Vier Türen.
Haupttür zum Korridor. Diese war von innen verschlossen. Schlüssel im Schloß.
Badezimmertür zum Korridor. Diese war auch von innen verschlossen. Der Schlüssel dieser Tür lag jedoch auf dem Fußboden des Badezimmers.
Diese Tatsachen sind von mehreren Zeugen bestätigt.
Eine Tür, die vom Badezimmer in das nächste Schlafzimmer führt. Dieser Raum wird von Miß Kane bewohnt, die behauptet, sie habe nicht gewußt, wohin diese Tür führe. Tür verschlossen. Kein Schlüssel im Schloß.
Feuertreppe. Über diese ist Mr. Lloyd in den Raum gedrungen, nachdem er entdeckt hatte, daß alle Türen verschlossen waren. Hier war die Tür wiederum von innen zugeschlossen. Fenster jedoch teilweise geöffnet. Schlüssel im Schloß.
Besondere Notizen. Es scheint nach dem jetzigen Stand der Untersuchung, daß mehrere Personen den Raum sofort betreten haben, als Mr. Lloyd die Türen aufschloß. Nach Mr. Lloyds Aussage kam seine Frau zuerst herein. Er behauptet, sie sei nur einen Augenblick darin geblieben. Er erinnert sich auch daran, daß Mr. Gower-Jones und Sir Luke Coniston eingetreten sind. Offenbar haben weder Miß Kane noch Lord Richard das Zimmer betreten.
Hier hört das Résumé auf. Denn an dieser Stelle reichte Andrew Lloyd dem jungen Bates einen Brief.
Und an dieser Stelle verlor Bates junior den Kopf.
4
«Ich möchte, daß Sie dieses lesen», sagte Lloyd.
Bates, der am Fenster stand und suchend die Feuertreppe hinunterblickte, drehte sich um.
«Worum handelt es sich, Sir?»
«Um einen Brief, den ich auf Miß Larues Schreibtisch fand. Er lag mit der beschriebenen Seite nach unten. Ich weiß nicht, warum ich ihn aufgenommen und gelesen habe. Aber ich habe es nun einmal getan und bin ganz froh darüber, weil … hm … er ziemlich häßlich klingt.»
Bates trat vor. Lloyd hob den Brief und hielt ihn zwischen den äußersten Fingerspitzen. Aber er gab ihn Bates zunächst noch nicht, sondern sagte: «Sie wundern sich vielleicht, daß ich Ihnen den Brief noch nicht vorher gezeigt habe. Das geschah aus einem sehr einfachen Grunde. Ich wollte Ihre Untersuchungen nicht durch eine vorgefaßte Meinung beeinflussen. Sie sollten an den Fall herantreten, als handele es sich um einen gewöhnlichen Selbstmord. Und das mag es ja auch sein … ich hoffe sogar sehr, daß es nichts anderes ist.»
«Sie hatten ja schon erwähnt, daß besondere Umstände, wie Sie sich ausdrückten, vorhanden seien, Sir.»
Lloyd nickte. «Das stimmt.» Dieser junge Mann, dachte er, ist doch nicht so dumm, wie er aussieht.
«Na, hier sind die – besonderen Umstände.»
Damit reichte er ihm den Brief. Dieser war in großen Blockbuchstaben geschrieben, und der einfache cremefarbene Briefbogen war von einem billigen Block abgerissen.
«Liebe Margot,
Du bist also entschlossen, die Sphinx zu spielen. Na schön. Wenn es nicht bis Samstagabend in meinen Händen ist, werde ich mal auspacken. Und ich denke dabei nicht nur an solche Lappalien wie gesellschaftliche Unannehmlichkeiten.
xxx»
Bates junior starrte auf den Brief, und die Worte schienen plötzlich vor seinen Augen zu verschwimmen. Bis zu diesem Augenblick hatte er selbst über seine Kaltblütigkeit gestaunt. Wie eine gut gelenkte Marionette hatte er alle die richtigen Bewegungen ausgeführt; er hatte die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Notizen gemacht. Er hatte sich nicht durch das luxuriöse Milieu einschüchtern lassen. Nicht einmal das schauerliche Aussehen der verstorbenen Miß Larue hatte ihn übermannt. Doch jetzt …
Andrew Lloyd fixierte ihn mit seinem Blick. «Was verstehen Sie darunter?» fragte er.
Bates blickte auf, und Lloyd mochte das stumme Flehen in seinen Augen richtig gedeutet haben. Kein Dummkopf, mag er sich gesagt haben, aber vielleicht kein sehr guter Polizist.
Laut sagte er: «Vielleicht geben Sie zu, daß wir wohl gerechtfertigt sind, Scotland Yard hinzuzuziehen?»
«Ich fürchte, das geht nicht, Sir. Noch nicht, Sir.»
«Warum nicht?»
«Das wäre nicht der richtige Instanzenweg, Sir.» Auf jeden Fall, dachte Bates, mußte er sich an den «richtigen Instanzenweg» halten. Nichts hätte er lieber getan, als sich mit Scotland Yard verbinden und von seinem großen Bruder aus der Patsche ziehen zu lassen. Aber so ein Benehmen wäre gehradezu unerört gewesen.
«Darf ich telefonieren, Sir?»
«Gewiß. Der Apparat steht drüben auf dem Tisch. Wen wollen Sie anrufen?»
«Den Nachtdienst-Beamten der Süd-Sussex-Polizei.»
«Das ist der richtige Instanzenweg, ja?» In Lloyds Stimme klang ein leiser Spott.
«Ja, Sir.»
«Und dann?»
«Er wird sich wahrscheinlich mit dem Bezirkskommissar oder dessen Stellvertreter in Verbindung setzen.»
«Und dann?»
«Nun, Sir, der Bezirkskommissar wird sich eventuell an den Yard wenden. Die Bezirkspolizei ist nämlich selbständig und hat an sich mit dem Yard nichts zu tun, und …»
Lloyd fiel ihm ins Wort. «Das klingt ja nach einer langwierigen Angelegenheit. Ich werde solange draußen warten.»
Unter normalen Umständen wäre es tatsächlich eine langwierige Angelegenheit gewesen. Aber die Götter standen in dieser Nacht auf seiten von Bates junior. Durch seinen Anruf bei dem Nachtdienstbeamten der Süd-Sussex-Polizei erfuhr er von der äußerst kritischen Lage in dem sonst so ruhigen Etablissement. Die vier in den Autounfall verwickelten Polizisten lagen im Krankenhaus. Und um das Maß vollzumachen, hatten innerhalb der letzten Stunde nicht weniger als drei bewaffnete Überfälle in diesem Bezirk stattgefunden. Der Bezirkskommissar – so gab ihm der Beamte vom Nachtdienst grimmig zu verstehen – sei nicht gerade in der rosigsten Laune, nachdem ihm das Wochenende auf diese Weise verdorben worden war, und er werde dem jungen Mr. Bates bestimmt nicht um den Hals fallen, wenn dieser ihm noch mehr aufbrumme. Es müßte schon eine ganz große Sache sein, sonst möchte er nicht in Mr. Bates’ Schuhen stecken.
«Es ist auch eine ganz große Sache», erwiderte der junge Bates.
Er holte tief Atem und wartete darauf, daß die Verbindung mit dem Stellvertreter des Bezirkskommissars hergestellt wurde. Eine halbe Minute später sprach er mit ihm, und er sprach mit so beredter Zunge, daß der Bezirkskommissar sich selbst einschaltete, noch ehe er mit seiner Geschichte zu Ende war. Er hatte eine gute Geschichte daraus gemacht. Schließlich hatte er ja auch die Zutaten: Tod und Erpressung und im Hintergrund Millionen.
Und so geschah es, daß genau um zwölf Uhr neunundzwanzig das Telefon im Zimmer 333 in Scotland Yard läutete.
5
Zehn Minuten später kam Polizeikommissar Waller aus seinem Büro. Auf seinem Gesicht lag ein grimmes Lächeln. Es ist doch erstaunlich, dachte er, was man mit Geld alles erreichen kann. Wenn diese Miß Larue, so vermutete er scharfsinnig, ihren Geist in einem weniger luxuriösen Milieu ausgehaucht hätte, wäre sie von dem Bezirkskommissar der Süd-Sussex-Polizei wohl nicht so wichtig genommen worden.
Waller blickte auf seine Uhr. Zwanzig vor eins. Bates müßte inzwischen die Verbindung mit Broome Place hergestellt haben. Wachtmeister Bates war sein Lieblingsassistent – ein heiterer junger Hüne mit blondem Haar und blauen Augen. Bates hatte nur eine Schattenseite: er brannte offenbar zu sehr darauf, jeden Fall selbst in die Hand zu nehmen, eine Hand, die zwar groß, aber noch nicht sehr erfahren war. Nun, Bates würde früher oder später auch mal an den Drücker kommen. Inzwischen war Waller froh, ihn um sich zu haben.
Er stieß die Tür zum Zimmer 334 auf. Bates telefonierte gerade.
«Na, hat’s geklappt?»
Der Wachtmeister blickte auf. «Bleib am Apparat», bellte er in den Hörer. Dann legte er ihn auf den Tisch und hielt die Hand darüber.
«Es ist Ron, Sir – mein junger Bruder.»
«Ja, und was ist mit ihm?»
«Er spricht von Broome Place. Sie entsinnen sich vielleicht, daß er in West Greenstead stationiert ist.»
«Mein Gott, stimmt ja auch!» Waller grinste. «Eine regelrechte Familienangelegenheit. Kann man aus ihm klug werden?»
«Ziemlich gut, Sir, wenn man bedenkt, daß es Ron ist.»
«Wer ist sonst noch anwesend?»
«Meinen Sie die Gäste, Sir?» Waller nickte. Bates rief die Frage ins Telefon und machte sich einige Notizen auf seinem Block. Dann wandte er sich an Waller. «Miß Sally Kane, Mr. Cecil Gower-Jones, Lady Coniston, Sir Luke Coniston …»
«Das genügt.» Waller ging mit raschen Schritten zum Tisch. «Lassen Sie mich an den Apparat!» Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, da tat es ihm schon leid. Bates zog ein Gesicht wie ein Kind, dem man ein Spielzeug wegzureißen droht. ,Dies ist mein Fall‘, schien er protestierend zu sagen. ,Es ist mein Bruder. Er hat die Leiche gefunden.‘
Über Wallers Gesicht breitete sich langsam ein Grinsen. Na schön. Es war Zeit, daß Bates auch mal eine Chance bekam. Er würde ihm die Vorarbeiten überlassen.
«Ich habe es mir anders überlegt», sagte er. «Sie bearbeiten den Fall am besten weiter. Wieviel Zeit brauchen Sie für die Fahrt nach Broome Place?»
Bates hielt den Atem an. «Sie meinen … Sie glauben …» begann er.
Waller schnitt ihm das Wort ab. «Ich meine, daß ich mich brennend für alles interessiere, was Sir Luke Coniston angeht. Natürlich mag er mit der Sache gar nichts zu tun haben. Aber es läßt sich nichts an der Tatsache ändern, daß er sich in einem Hause aufhält, in dem eine junge Dame nach erpresserischen Drohungen Selbstmord begangen hat, falls es Selbstmord war. Es sei denn», fügte er kurz und bündig hinzu, «Ihr gescheiter junger Bruder hat sich das alles selbst ausgedacht.»
«Nein, Sir. Er scheint ziemlich gut informiert zu sein.»
«Also gut. Wie schnell können Sie hinkommen?»
«Um diese Nachtzeit müßte ich es eigentlich in einer Stunde schaffen können.»
«Dann sagen Sie Ihrem Bruder, Sie werden gegen …»Waller blickte auf seine Uhr «… gegen zwei Uhr dort sein. Fahren Sie aber nicht zum Haus. Sagen Sie ihm, er soll Sie in seiner Bude treffen. Dort lassen Sie sich die Situation erklären und gehen dann morgen in aller Herrgottsfrühe zum Haus.»
«Warum nicht heute nacht, Sir?»
«Wir kennen noch nicht das ganze Drum und Dran. Es mag an der Sache überhaupt nichts dran sein. Abgesehen davon, möchte ich nicht, daß Sir Luke den Eindruck gewinnt, wir seien zu sehr interessiert … jetzt jedenfalls noch nicht. Ich werde gegen elf Uhr dort sein. Bis dahin werden Sie sich ein ziemlich klares Bild verschafft haben können. Ich überlasse das allgemeine Interview Ihnen.»
Bates strahlte über das ganze Gesicht. «Vielen Dank, Sir.» Das allgemeine Interview bildete einen wesentlichen Bestandteil der Wallerschen Untersuchungstechnik. Die Anregung dazu hatte er aus einem Paragraphen des Buches «Erste Grundsätze der Verbrechensaufklärung», dem klassischen Werk seines alten Freundes, Horatio Green, geschöpft. Es handelte sich da um den Grundsatz, daß das, was die Leute in einem Interview nicht sagen, oft wichtiger ist als das, was sie sagen. Davon hatte Waller das allgemeine Interview abgeleitet, eine anscheinend zwanglose Angelegenheit, die fast wie eine Familienplauderei war, wo alle wirklich und scheinbar Beteiligten ihren kleinen Vers aufsagten. Es war erstaunlich, wieviel sie vor versammeltem Publikum vergaßen, woran sie sich nachher unter vier Augen wieder erinnerten – erstaunlich und äußerst aufschlußreich.
Aus dem Telefon drangen gedämpfte Laute, als ob jemand heftig protestiere.
«Ihr junger Bruder da scheint aufsässig zu werden», sagte Waller. «Sehen Sie zu, wie Sie mit ihm fertig werden.» Er zögerte einen kurzen Augenblick. Gern hätte er Bates noch ein Dutzend Winke gegeben. «Oder möchten Sie, daß ich kurz mit ihm rede?»
«Nein, danke, Sir», erwiderte Bates energisch. «Ich glaube, das mache ich am besten selbst.»
Waller verstand den Wink mit dem Zaunpfahl. «O.K.», brummte er. «Bis morgen also. Gute Nacht.» Er ging hinaus und machte die Tür leise hinter sich zu.
6
Oben auf der kleinen Treppe, die in den inneren Hof hinabführt, blieb Waller stehen. Ein plötzliches Schuldgefühl bemächtigte sich seiner. Anstatt nach Hause und ins Bett zu gehen, hätte er eigentlich in sein Büro zurückkehren und sich die Akten über Sir Luke Coniston geben lassen müssen … für den Fall, daß Sir Luke wirklich etwas mit dieser Sache zu tun hatte. Aber warum sollte er etwas damit zu tun haben? Nur weil er sich in einem Hause aufhielt, in dem eine Frau Selbstmord beging, bedeutete das noch lange nicht, daß er etwas damit zu tun hatte. Wenn es Selbstmord war. Aber wiederum – was für einen Grund hatte er, anzunehmen, daß es etwas anderes sei? Da war natürlich die Geschichte mit der Erpressung … dabei fiel ihm ein, daß er Bates nicht einmal gefragt hatte, welcher Art die Erpressung gewesen sei!
Himmel nochmal … er war müde. Man konnte auch nicht vierundzwanzig Stunden am Tage arbeiten.