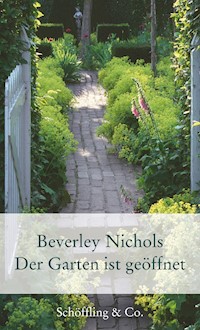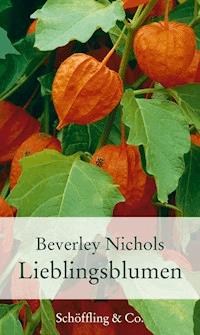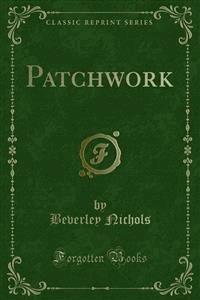3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Als Detektiv Green die kauzige Orchideenzüchterin tot in ihrem Gewächshaus findet, ahnt er nicht, daß ausgerechnet die seltene Mondblume den Schlüssel zu diesem Mord liefern soll. Und dann entdeckt er einen Abgrund von Haß, Intrige und Rache … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Ähnliche
Beverley Nichols
Die Mordblume
Aus dem Englischen von Karin Holm
FISCHER Digital
Inhalt
1
Es war eine unfreundliche Nacht. Südwest-England wurde von heftigem Wind und Regen gepeitscht; die See schlug brüllend an seine Küsten. Die Wetterkarte auf dem Fernsehschirm wirkte so bedrohlich, daß vernünftige Bürger ihre Apparate abdrehten und seufzend zu Bett gingen.
Nirgends aber war die Nacht dunkler und schrecklicher als über Dartmoor, und in keinem Teil Dartmoors war das Wüten so gewaltig wie vor den Mauern des Princetown-Gefängnisses. Sein kalter grauer Stein beantwortete Gewalt mit Gewalt. Es warf dem Sturm, der durch seine Türme pfiff, ein frohlockendes Echo entgegen, als fordere es ihn heraus, die elenden, in seinem Inneren schmachtenden Männer zu retten. »Befreie sie, wenn du kannst!« So schrien die Türme in den Aufruhr der Elemente hinaus, und sie schrien es so deutlich, daß es manchen der Männer, die dort drinnen auf grauen Wolldecken saßen und auf eine Reihe schwarzer Eisenstäbe starrten, bis ins Mark hinein fror. Aber für einen dieser Männer bedeutete der Wind nicht schaurige Kälte, sondern Herausforderung. Denn er war der Welt der grauen Wolldecken, weißen Mauern und schwarzen Eisenstäbe entronnen – auf Kosten allerdings eines scharlachroten Flecks, der sich vom Schädel des von ihm ermordeten Wärters ausbreitete. Der Mann stand auf der Brustwehr und trank den Wind in großen Schlucken wie starken, eiskalten Wein, was er für ihn ja auch wirklich war: der Wein der Freiheit. Ein Mann vermochte alles zu tun mit dem Wind als Freund, mit dem Wind und der Dunkelheit. Er konnte die Welt bekämpfen, er konnte dem Himmel Trotz bieten, er konnte sogar fliegen.
Der Mann atmete noch einmal tief und schloß die Augen. Für eine Sekunde entschlüpfte ein bleicher, seltsamer Mond den Wolken, um einen Blick auf die Erde zu werfen. Sein weißes Licht beschien ein breites, brutales Gesicht unter flammend rotem Haar; denn nicht einmal die Gefängnisschere hatte Kupfer-Jack seine Haarfarbe rauben können.
Ein gewaltiger Windstoß fuhr über das Tal hin. Er befahl dem Manne: Jetzt oder nie! Mit dem Wind zum Freund …
»Du meine Güte«, murmelte Mr. Green vor sich hin. »Man hat aber auch nie einen Augenblick Ruhe.«
Er saß im Schankraum des Gasthofes zum »Greyhound«, im Dorfe Moreton Fallow. Es war fast elf Uhr; die letzten Gäste waren schon lange gegangen. Er hatte sich gefreut auf eine friedliche halbe Stunde am Feuer, um sein Bier schlürfen zu können und im Blatt der Königlichen Gartenbau-Gesellschaft einen Artikel über neue Forschungsergebnisse hinsichtlich der tropischen convolvulus zu lesen. Dann hatte das Telefon geklingelt, und nach einem kurzen, atemlosen Gespräch war Ivy, die Kellnerin, mit den Neuigkeiten hereingestürzt.
»Das nenne ich unerhört!« rief sie aus. »Schon der dritte in sechs Monaten, der ausgebrochen ist! Ein Mädchen kann ja nachts nicht mehr schlafen, wenn solche Dinge passieren.« Sie schenkte sich ein Gläschen Whisky ein. »Ich erlaube mir das sonst nicht, so spät noch, aber wirklich …« Sie leerte das Glas in einem Zug, und wartete, an ihrem hellblond gefärbten Haar zupfend, daß Mr. Green spräche. Er war gewiß nicht ein anregender Gesellschafter zu nennen, der komische, kleine, rundliche Mann mit dem fast kahlen Kopf und der Hornbrille. Dennoch, er war besser als niemand.
Mr. Green seufzte und legte das Buch weg. »Wurde der Name des entflohenen Sträflings genannt?«
»Jawohl. Jack Borley soll er heißen. Und sie sagten, er werde Kupfer-Jack genannt, weil er ein Rotkopf sei.« Sie schauderte.
»Haben Sie schon von ihm gehört?«
Mr. Green lächelte leicht. »Ja«, antwortete er, »ich habe schon von ihm gehört.«
Kupfer-Jack! Der Bandenführer im Falle der Bessingham-Diamanten vor sieben Jahren. Ja, Mr. Green hatte allerdings von ihm gehört, hatte man doch damals den Mann hauptsächlich durch seine, Mr. Greens, glänzende Schlußfolgerung zu fassen gekriegt, obschon die Polizei nicht imstande gewesen war, ihm den Mord nachzuweisen, den er zweifellos begangen hatte. Kein Geselle, dem man in einer solchen Nacht gerne begegnete, besonders da Kupfer-Jack ein gutes Gedächtnis besaß und geschworen hatte, Mr. Green zu erledigen, sobald er wieder »draußen« sei.
»Glauben Sie, er kommt hierher?« fragte Ivy.
»Ich denke nicht.«
»Er könnte aber. Es ist ja nur zwanzig Kilometer bis hierher. Vielleicht ist er schon in dieser Minute auf dem Weg. O Gott, es ist einfach nicht gerecht, so leben zu müssen!«
Mr. Green entgingen die Anzeichen von Hysterie nicht.
»Ich habe nicht das Gefühl, daß wir uns allzu große Sorgen zu machen brauchen«, entgegnete er sanft. »Ein Mann auf der Flucht wird sich kaum in dieses Dorf wagen. Er wird sich viel eher an unbewohntes Gelände halten, bis er das Moor hinter sich hat.«
»Das stimmt«, gab sie zu. »Man kann aber trotzdem nie wissen. Sie müssen nicht denken, daß ich um mich selbst besorgt bin. Ich sorge mich um Mrs. Keswick da oben.« Sie zeigte zur Decke hinauf.
»Ist das die Frau des Wirtes?«
»Jawohl. Sie erwartet ein Kind. Ihr erstes!«
»Du meine Güte!« (Nie einen Augenblick Ruhe!)
»Es kann jetzt jede Minute soweit sein.«
Wie um ihre Worte zu bestätigen, stieß ein Mann die Tür auf und kam herein. Er war groß und gut gewachsen, hatte die in Devonshire übliche rötliche Gesichtsfarbe, die auf strahlende Gesundheit deutet. Er befand sich in einem Zustand hochgradiger Erregung.
»Gott sei Dank sind Sie noch hier, Ivy«, begann er.
»Ist sie … hat sie …?«
»Nein. Immer noch gleich. Aber ich kam herunter, um Sie zu bitten, sie ja nichts merken zu lassen von den Geschehnissen draußen.«
»Wo denken Sie hin!«
»Tut mir leid, Ivy. Ich bin aufgeregt, das ist’s.« Dann bemerkte er Mr. Green in seiner Ecke.
»Oh, Verzeihung! Ich dachte, Sie wären zu Bett gegangen.«
Der junge Mann trat nun zu Mr. Green ans Feuer. »Kein großartiges Willkommen in Dartmoor, fürchte ich, Sir. Werden Sie lange hierbleiben?« Er sah, wie sich Mr. Greens Augenbrauen ganz leicht hoben. »Entschuldigen Sie, Sir. Geht mich nichts an. Ich bin heute recht verwirrt.«
Mr. Greens Augenbrauen senkten sich wieder. Er war ein freundlicher kleiner Mann, und es wurde ihm plötzlich bewußt, daß er nicht sehr entgegenkommend war.
»Aber natürlich geht es Sie etwas an«, antwortete er. »Nein, ich denke nicht, daß ich lange bleiben werde. Es hängt von dem Betragen einer gewissen Blume ab.«
Zu Mr. Greens Überraschung gab der junge Mann kein Zeichen des Erstaunens. Er nickte nur. »Das wird die Mondblume sein, nehme ich an. Oben in Candle Court.«
»Ja. Um sie zu sehen, bin ich hierhergekommen. Also haben auch Sie schon von ihr gehört?«
»Oh, jedermann hier in der Gegend hat von ihr gehört. Es stand eine ganze Menge darüber in den hiesigen Zeitungen.« Er beugte sich über den Schanktisch und reichte Mr. Green eine Zeitung. »Das steht in der Devon Gazette von heute morgen.«
Mr. Green las:
GEHEIMNISVOLLE BLUME IN CANDLE COURT
1000 £ pro Same
Wird die Mondblume blühen?
Das große Gewächshaus in Candle Court, dem Wohnsitz der begüterten Mrs. Faversham, bildet den Hintergrund zu einem spannenden Schauspiel. In den nächsten Tagen wird sie erfahren, ob ihr größtes Wagnis von Erfolg oder von Mißerfolg gekrönt sein wird.
Wie die Leser der Devon Gazette wissen werden, war es Mrs. Faversham, die vor bald einem Jahr die Expedition ins Gebiet des Uruguay-Flusses zur Auffindung der »zauberhaften Mondblume«, einer Abart der riesigen tropischen convolvulus, finanzierte. Die Expedition, die über 12000 £ gekostet haben soll, stand unter der Leitung des berühmten Botanikers Hilary Scole. Vor sechs Wochen, am Abend vor Weihnachten, kehrte Mr. Scole nach England zurück und brachte dreizehn Samen der exotischen Pflanze mit – zu 1000 £ der Same. Der Transport der Samen erfolgte in einem eigens dafür konstruierten Schränkchen, in dem die Temperatur durch einen Thermostat kontolliert wurde. An Weihnachten wurden sie im Gewächshaus, das schon so manche aufsehenerregende Versuche in der Pflanzenzucht gesehen hat, ausgesät.
Die Devon Gazette ist im Besitz der Exklusivinformation, daß wenigstens einige der Samen gekeimt und lange, kriechende Stengel getrieben haben, deren Blätter von einem so dunklen Grün sind, daß sie beinahe schwarz wirken. Noch hat jedoch keine der Pflanzen geblüht. Bilden sie innerhalb der nächsten Wochen keine Blüten, so besteht keine Hoffnung mehr auf das Gelingen des Versuches.
Die Tatsache, daß der Ehrenwerte Hilary Scole für morgen in Candle Court erwartet wird, gibt Anlaß zu der Vermutung, daß die Mondblume mit ziemlicher Sicherheit blühen wird.
»Du meine Güte!« murmelte Mr. Green. »Hoffentlich hat die Devon Gazette recht.«
Der junge Mann nickte. »Tausend Pfund für einen einzigen Samen! Ich hätte nichts dagegen, ein Paket voll davon zu haben. Kennen Sie die alte Dame, Sir?«
»Nur flüchtig.«
Er setzte sich näher ans Feuer. Er fragte sich, ob überhaupt jemand Mrs. Faversham besser kannte als »nur flüchtig«. Vor zwanzig – oder fünfundzwanzig? – Jahren, als sie in London glänzende Gesellschaften zu geben pflegte, hatte er ihr einmal einen Dienst erwiesen. Es ging um einen Juwelendiebstahl, der alles andere als erfreulich war: Es hatte nämlich der starke Verdacht bestanden, daß ihr eigener Sohn darin verwickelt war, ein hübscher mürrischer Schuljunge, der später, wie er sich erinnerte, von Eton relegiert wurde. Kurz danach starb ihr Gatte, sie verließ London und kaufte Candle Court, dessen wundervollen Garten sie vor dem Verfall rettete und dessen berühmte Gewächshäuser sie wieder instand setzte. Es war eine merkwürdige Richtung, die diese selbstsüchtige, weltliche Frau so spät in ihrem Leben noch einschlug. Sie sammelte nun seltene Pflanzen so gierig, wie sie früher Diamanten gesammelt hatte – und Männer.
Die Mondblume bedeutete für sie die Krönung – oder, besser gesagt, würde sie bedeuten, wenn sie blühte.
»Eigentlich recht aufregend, nicht wahr?«
Der Wirt hatte Mr. Greens Träumereien unterbrochen mit Worten, die wie ein Widerhall seiner eigenen Gedanken klangen.
Mr. Green nickte. Er fühlte sich warm und schläfrig auf seinem Platz am Feuer.
»Eine Blume wie diese … aus dem Urwald … die dort oben in einer solchen Nacht blühen wird … Beinahe romantisch.«
Es waren einfache Worte, gesprochen in banaler Umgebung, und doch beschworen sie für einen Augenblick eine geradezu dichterische Atmosphäre herauf. Ja, dachte Mr. Green, es war romantisch. Dort oben auf dem Hügel schliefen jetzt wohl die silberen Blütenblätter einer Blume in ihrem duftenden kristallenen Käfig und warteten darauf, sich einer fremden Welt zu öffnen.
Dann klingelte das Telefon.
»Zum Teufel!« sagte der junge Mann. Er ging hinüber in den Nebenraum, nahm den Hörer ab und rief: »Hallo! Hallo!« Dann lächelte er, und seine Stimme klang sanfter. »Ach, Sie sind’s, Miss Wells! Nein, immer noch gleich. Der Doktor meint, noch einmal vierundzwanzig Stunden. Ja, ich werde Sie anrufen sobald der Arzt es für nötig hält. Morgen, denke ich. Gute Nacht, Miss Wells.«
Er kam zurück ans Feuer.
»Das ist mal eine junge Dame, wie es sie so bald nicht wieder gibt«, meinte er. »Miss Sandra Wells von Candle Court.«
Mr. Green versuchte, Interesse vorzutäuschen, aber er war wirklich schon sehr schläfrig. Nur durch einen Schleier der Müdigkeit hindurch hörte er den Wirt die Tugenden der unbekannten Miss Wells preisen.
Mr. Green unterdrückte ein Gähnen und erhob sich. »Es wird mich freuen, die junge Dame kennenzulernen«, murmelte er unaufrichtig. »Und nun will ich Sie nicht mehr länger aufhalten. Gute Nacht.«
»Nie einen Augenblick Ruhe!«
Kommissar Waller erwachte in seinem kleinen Haus in Putney Hill, setzte sich im Bett auf und lauschte dem eindringlichen Geklingel des Telefons unten in der Halle. Ein Blick auf das Leuchtzifferblatt seiner Armbanduhr zeigte ihm, daß es nach Mitternacht war. Endlich hatte er einmal früh schlafen gehen können, und nun …
Er hatte gute Lust, das verdammte Ding klingeln zu lassen. Wenn er aufstand, so weckte er seine Frau, und sie hatte es ebenso satt, spät zu Bett zu gehen, wie er selbst.
»Geh lieber dran«, tönte eine Stimme vom andern Kissen her.
»Ich dachte, du schliefest!« brummte er.
»Das tat ich auch, aber das Telefon hat mich geweckt. Es muß schon eine ganze Weile geklingelt haben. Geh lieber hin. Vielleicht ist es etwas Wichtiges!«
»Hoffentlich, so spät in der Nacht!«
Er drehte das Licht an und wälzte sich ächzend aus dem Bett. Mit seinen fünfzig Jahren – und auch in dem wollenen rosa Pyjama – war der Kommissar eine respektgebietende Figur: ein Meter fünfundachtzig groß, kein Gramm überflüssiges Fett am Körper, und gerade nur einen Schimmer grauer Haare an den Schläfen. Als er auf das lächelnde Gesicht seiner Frau herabblickte, fand er, auch sie hätte sich eigentlich sehr gut gehalten.
»Wer möchte schon ein Polizeibeamter sein in einer solchen Nacht!« schimpfte er. »Da, nun hat’s einen Ziegel herabgeweht. Wenn das so weitergeht, haben wir morgen kein Dach mehr.«
Er schlüpfte in einen alten Kaschmir-Schlafrock und ging hinunter.
»Ja, ja, hier spricht Waller. Wer ist dort?«
»Sanders.«
Waller straffte sich. Sanders war sein Vorgesetzter, der Chief Commissioner in Scotland Yard, und eine Person, vor der man automatisch Haltung annahm, sogar am andern Ende des Drahtes.
»Haben Sie von der Sache in Princetown gehört?«
»Nicht daß ich wüßte, Sir.«
»Kupfer-Jack hat einen Wärter getötet und ist geflohen.«
»Uff! Das sind allerdings Neuigkeiten! Aber ich bin heute abend früh zu Bett gegangen.«
»Ja, natürlich, ich erinnere mich. Der Schmuggel-Fall hat Ihnen während der letzten achtundvierzig Stunden arg zu schaffen gemacht. Sie hätten Ausspannung verdient. Aber leider habe ich eine neue Arbeit für Sie.«
Waller stieß einen tiefen Seufzer aus, der nicht ungehört blieb.
»Es tut mir wirklich leid, aber Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. Sie sollten nicht so tüchtig sein.«
Waller schloß die Augen und seufzte wieder. Sanders ließ »seinen Charme spielen«, der schlechte Kerl.
»Wenn Sie hin und wieder etwas verpatzten, würden wir Sie nicht immer so dringend brauchen.«
Er brächte mit seinen Reden sogar einen störrischen Esel zum Traben, dachte Waller. Trotzdem fühlte er sich innerlich erwärmt.
»Was kann ich für Sie tun, Sir?«
»Ich möchte, daß Sie gleich morgen nach Princetown fahren. Sie werden den Zug um sieben Uhr dreißig ab Paddington nehmen müssen.«
»Aber, Sir …«
»Einen Augenblick. Ich möchte, daß Sie wissen, wie wichtig die Sache ist. Dies ist der dritte Ausbruch innerhalb von sechs Monaten. Außerdem hat es vor drei Wochen einen häßlichen Aufruhr gegeben. Die Öffentlichkeit wird langsam unruhig, aber noch lange nicht so unruhig wie der Innenminister. Er muß dieses neue Gefängnisreform-Gesetz im Parlament durchbringen, was auch unter günstigsten Umständen nicht leicht sein wird; es ist eine ziemlich revolutionäre Sache.«
»Ich sehe noch immer nicht ganz, was ich da tun kann.«
»Ich offen gestanden auch nicht. Und, unter uns gesagt, auch der Innenminister nicht. Trotz allem möchte er, daß Sie hingehen und wäre es auch nur um des Anscheins willen, daß etwas unternommen wird. Er hat es mir selbst vor einer Stunde gesagt.«
Die Wärme in Wallers mächtiger Brust verstärkte sich. »Hat er mich persönlich erwähnt?«
»Jawohl.« Ein belustigtes Lachen ertönte am andern Ende der Leitung. »Er muß in irgendeinem Kriminalroman über Sie gelesen haben.«
Waller überhörte dies.
Der respektgebietende Ton kehrte in Sanders’ Stimme zurück. »Das wäre also Ihre Aufgabe. Sie ist schwierig, aber ich habe Vertrauen zu Ihnen. Falls es Ihnen gelingen sollte, zu der Festnahme unseres Kupfer-Freundes beizutragen, gäbe das natürlich eine nicht zu unterschätzende Feder auf Ihren Hut. Dies ist jedoch nicht Ihre Hauptaufgabe, sondern wichtig ist, daß Sie als Vertreter von Scotland Yard handeln und daß Sie die Leute wissen lassen, es werde von uns alles menschenmögliche unternommen.«
Waller hatte noch einen Einwand. »Ich bin es nicht gewohnt, nichts anderes zu sein als ein Vertreter.«
»Das weiß ich wohl, alter Freund. Ich erwarte dies auch gar nicht von Ihnen. Bitten Sie Mrs. Waller um Entschuldigung für die Störung. Gute Nacht. Und viel Glück.«
Waller hängte ein. So war das nun. Morgen würde er wieder früh aus den Federn müssen, er würde den Wecker auf sechs Uhr stellen.
Er drehte das Gasfeuer im Kamin an – für sie – und trat in den Flur hinaus. Gott, was für eine Nacht! Der Sturm schien sich mit der Wut eines Lebewesens auf sein kleines Haus zu stürzen; er zerrte am Dach, rüttelte an der Tür und pfiff mit Geheul, Gefluche und Drohen durch die Fensterritzen.
Waller überlief ein Schauer, und einen Augenblick lang schweiften seine Gedanken zu den nackten Hügeln von Dartmoor, wo ein verzweifelter Mann sich durch das Wüten des Sturmes kämpfte.
Wer möchte schon ein Polizeibeamter sein in einer solchen Nacht? Geschweige denn ein Sträfling?
»Nie einen Augenblick Ruhe!«
»Ist das meine Schuld?«
Der Mann, der beim Kaminsims stand, gab keine Antwort. Er starrte weiter ins Feuer.
»Ist das meine Schuld?« fragte sie in noch schrillerem Ton.
Er drehte mürrisch den Kopf nach ihr um. »Hör doch um Gottes willen auf zu schreien! Du weckst das ganze Haus.«
»In einer solchen Nacht?« Sie trat ans Fenster. »Man könnte einen Mord begehen, ohne von jemand gehört zu werden.« Sie schob die schweren Vorhänge beiseite und starrte hinaus in die Finsternis.
»Das ist eine Idee«, murmelte der Mann.
Sie wandte sich rasch um. »Ja«, sagte sie, »das ist eine Idee.«
Sie standen im Gelben Zimmer von Candle Court, einem langen, schmalen Raum mit großen Fenstern, die auf das Tal hinunterblickten. Von der Mitte der Decke herab hingen drei blumenartige Leuchter aus venezianischem Glas, verziert mit mattem Gold. Auf dem Boden lagen drei große, primelfarbige Aubusson-Teppiche, auf denen einst Kaiserin Josephine geschritten war; napoleonische Bienen waren auf einen Hintergrund von Wiesen gewoben, deren Rand von zart gestickten Narzissen eingefaßt war. Die elfenbein- und goldfarbenen Vorhänge stammten aus einem Schloß in der Nähe von Chartres, dessen Besitzer sie einst aus der Kathedrale geholt hatte.
Candle Court stand auf einer Anhöhe oberhalb des Fallow-River-Tales, in das sich das kleine Dorf Moreton Fallow einschmiegte. Blickte man jetzt zum Fenster hinaus, so sah man weit unten einen kleinen Lichtfleck durch Regen und Sturm heraufschimmern: den Gasthof zum »Greyhound«, wo Mr. Green wohnte. Wäre die Nacht klar gewesen, so hätte man die anmutige Fassade von Candle Court aus der Zeit Königin Annes mit ihrer luftigen palladianischen Säulenhalle bewundern können.
»Ja«, flüsterte sie wieder. »Das ist eine Idee.«
Sie wandte sich um und setzte sich ans Feuer.
Beryl Faversham war dreißig Jahre alt. Sie war eher vornehm als schön zu nennen. Sie war von schlankem, hohem Wuchs und hatte schöne graue Augen und eine hohe Stirn. Ihr dunkles Haar trug sie im Stil einer florentinischen Madonna. Sie bewegte sich mit Würde, die jedoch über ihren Mangel an Selbstsicherheit nicht hinwegzutäuschen vermochte. Ihre Stimme war ein angenehmer Alt, aber es schwangen seltsame Untertöne mit, als spreche sie in einem leeren Zimmer.
Diese Untertöne waren heute abend besonders gut hörbar.
»Es ist einfach unmenschlich!« Sie ballte die Fäuste. »Uns so kurzerhand aus dem Zimmer zu vertreiben! Und ausgerechnet wegen Pusey!«
»Vielleicht meinte Mutter gar nicht, was sie sagte.«
»Wirklich, Liebling …« – mit Spott beladen kam das Kosewort aus ihrem Munde –, »während der achtzehn Monate unseres Ehelebens habe ich deine hochverehrte Mutter sehr gut kennengelernt, und ich weiß jetzt, daß sie immer alles meint, was sie sagt, und zwar bis zur letzten Silbe.«
»Sie sagte es nach dem Abendessen ganz nebenbei, wir saßen am Kamin, und Ackworth brachte gerade die Getränke …«
»War Sandra auch dabei?«
»Natürlich! Kannst du mir aus den letzten Monaten einen Augenblick nennen, in dem Sandra nicht dabei war? Unterbrich mich doch nicht immer! Deine Mutter stellte also den Fernsehapparatab; sie hatte wohl eben bemerkt, daß mir das Stück, das sie brachten, gefiel. Dann wandte sie sich zu mir und sagte: ›Übrigens, meine Liebe, wie du weißt, wird Mr. Pusey uns morgen besuchen kommen. Ich möchte ihm so gerne das Gelbe Zimmer geben, wenn es dir recht ist.‹ Ich war so verblüfft, daß ich nichts erwidernkonnte. Überhaupt hätte ich kaum Zeit dazu gehabt, denn sie stand auf – mit einem so netten – Lächeln – und meinte: ›Das wäre also in Ordnung‹, und damit ging sie zu Bett.«
Kenneth Faversham ließ sich schwer in einen Sessel sinken. Alles an ihm war schwer, seine Glieder, seine Hände, sein Unterkiefer, seine Augenlider. Trotzdem erweckte er nicht den Eindruck von Kraft, sondern von Schwäche.
»Das Chinesische Zimmer ist doch recht angenehm«, begann er. »Liebling!« Diesmal fuhr das Wort wie ein Schlag hernieder. »Falls du den ergebenen Sohn zu spielen gedenkst …«
»Es geht nicht darum!«
»Nein, wirklich nicht.« Sie beherrschte sich mühsam. »Aber es geht darum, daß dies hier mein Zimmer ist und es immer gewesen ist. Ich bin hier geboren und erzogen worden, habe hier meine ersten Schulstunden gehabt. Lange bevor deine Familie auch nur etwas von diesem Haus gehört hat, wohnte meine Familie schon hier – seit über zweihundert Jahren!«
»Müssen wir das alles wieder durchnehmen?«
»Als ich dich heiratete, da war der Gedanke heimzukehren … Ich kann dir nicht sagen, was es mir bedeutete.«
»Mehr als ich dir bedeute offenbar.«
Sie drehte sich zu ihm um. »Und wenn?«
Er zuckte die Achseln. »Du erzählst mir da nichts, was ich nicht schon früher vermutet hätte.«
»Das ist wenigstens ein Trost.«
Einen Augenblick herrschte Stille. »Was werden wir tun?«
»Was sie will, nehme ich an. Was denn sonst?«
»Es wird nicht für lange sein.«
»Was bringt dich auf diesen Gedanken? Es sollte auch nicht für lange sein, als sie uns den Rolls-Royce wegnahm und uns fragte, ob wir etwas dagegen hätten, den Morris zu benützen. Es sollte nicht für lange sein, als sie die Wohnung in London aufgab und uns fragte, ob wir etwas dagegen hätten, im Hotel zu wohnen. Es sollte nicht für lange sein, als sie dein monatliches Taschengeld so weit herabsetzte, daß es niedriger war als Ackworth’ Lohn …«
»Hör auf, um Gottes willen!«
Er erhob sich jäh und wandte sich zum Ankleideraum, aus dem ein trübes Licht herüberschien. »All dieser Haß bringt uns nirgends hin. Mit Haß bringt man’s nie weit.«
»Nie?« wiederholte sie.
»Was meinst du?«
Ihre Augen begegneten sich, stellten Fragen, tauschten Geheimnisse und teilten Befürchtungen.
Dann ging er hinaus, und sie blieb, ins Feuer starrend, sitzen.
Es war, als hülle der Sturm das Haus in seinen eigenen Haß ein. Und in der Tat schwebte in jener Nacht ein Übermaß von Haß über Candle Court; er schlich durch jeden Flur und lauerte in jedem Schatten.
Die einzige Person, die sich weder einer innerlichen noch einer äußeren Ruhestörung bewußt zu sein schien, war die alte Dame, der Mittelpunkt all jener erregten Gefühle. Mrs. Faversham schlief am andern Ende des Hauses friedlich in ihrem großen Bett. Seine scharlachroten Vorhänge raschelten und flüsterten unter den hereindringenden Windstößen, da das Fenster sogar in Nächten wie dieser einige Fingerbreit offenzustehen pflegte. Sie schlief einen tiefen, langen Schlaf, der wohl von angenehmen Träumen erhellt wurde, denn ein leichtes Lächeln lag auf ihren Lippen – wie immer, wenn sie jemandem etwas besonders Unangenehmes hatte antun können.
2
Am nächsten Vormittag machte sich Mr. Green auf den Weg nach Candle Court. Der Wind blies immer noch stark, aber der dunkle Wolkenvorhang war auseinandergerissen und zog nun zerfetzt und zerknüllt nach Norden weiter.
Der Spaziergang den Hügel hinauf war nur kurz, das Getose des Wasserfalls wurde immer deutlicher. Das Haus selber war hübsch genug mit seiner zierlichen, hellen Backsteinfassade, sein größter Reiz aber lag in seiner Aussicht. Es stand auf einer schmalen Erhöhung, von wo aus man einen weiten Blick ins Tal hatte, und an seiner hinteren Seite erhob sich steil ein mit Silberbirken und Rhododendren bewachsener Hügel, der nach und nach kahler wurde und schließlich im Sumpfgebiet endete.
Über diesen Hügel hinunter hüpfte der Fallow-Fluß. Dort, wo er den Boden erreichte, auf dem Candle Court stand, floß er für kurze Zeit ruhig neben der niederen Mauer dahin, die einen Kirschbaumgarten umgab, um sich nachher tosend und im rauschenden Sprühregen fünfzig Fuß tief in das dunkle Geheimnis des Waldes hinunterzustürzen.
Diese Musik des Wassers begleitete ständig das Leben der Bewohner von Candle Court, die gelernt hatten, sie als etwas so Alltägliches hinzunehmen wie die Luft, die sie atmeten. Im Hochsommer, wenn das Moor braun und ausgetrocknet und der Fluß nur noch ein Bächlein war, konnte man die Musik kaum hören. Aber im Herbst, wenn die Blätter gelb wurden und zu Boden fielen und mächtige Sturmwolken über den Himmel fegten, fand der Fluß seine Stimme wieder, und in den Wintermonaten war es eine äußerst kräftige Stimme.
Als Mr. Green die kurze Auffahrt hinaufging, schlug eine Uhr von den Stallungen her zwölf Uhr. Ackworth, der Butler, stand in der Türe, um ihn zu begrüßen. Er war ein kleiner, runzeliger Mann mit einem Gesicht wie eine Birne, die man lange aufbewahrt und dann vergessen hat.
»Immer pünktlich, Sir«, krächzte er und half Mr. Green aus seinem Mantel. »Ganz wie in den alten Tagen.«
»Und wie geht’s Mrs. Ackworth?«
»Nicht allzu gut, Sir, nicht allzu gut. Das war ja auch zu erwarten. Keiner von uns ist mehr so jung wie früher.«
»Danke.« Mr. Green kannte Ackworth’ düstere Art. Er war nicht halb so alt, wie er aussah – kaum sechzig. Aber seine hypochondrische Frau hatte vor beinahe zwanzig Jahren beschlossen, er solle mit einem Fuß im Grabe stehen, und er hatte bis heute den Mut nicht gefunden, ihn wieder herauszunehmen.
»Mrs. Faversham erwartet Sie, Sir.«
Er ging Mr. Green voran durch die große Halle, in der der berühmte Beauvais-Wandteppich der vier Jahreszeiten hing, und öffnete die Tür zum Wohnzimmer. Mr. Green hatte vergessen, wie schön der Raum war: eine Symphonie von matten Halb- und Vierteltönen, in der jede starke Farbe einen Mißton erzeugt hätte. Die getäfelten Wände waren zu einem silbernen Grau verblaßt; die Vorhänge waren aus mattem, elfenbeinfarbenem Brokat. Sogar die Lackschränkchen, die zur Zeit Königin Annes narzissengelb gewesen waren, hatten eine schwache Patina angenommen. Es war jenem stillen und gehaltvollen Hintergrund zuzuschreiben, daß die kleine Gestalt Mrs. Favershams so überaus lebendig wirkte. Sie war einen Meter sechzig groß und rundlich und trug ein schwarzes Kleid.
»Horatio!« rief sie und ging ihm mit ausgestreckten Armen entgegen.
Mr. Green zuckte zusammen. Er war schon immer empfindlich gewesen, was seinen stilvollen Vornamen betraf, und er vermutete, daß Mrs. Faversham dies wußte, da sie ihn so oft aussprach.
»Wie viele Jahre ist es her? Fünfzehn?«
»Vierzehn und ein halbes«, murmelte Mr. Green.
»So peinlich genau wie früher, und immer noch ebenso rund und süß! Und noch viel, viel berühmter! Horatio, mein Lieber, ich habe Sie vermißt!« Sie hängte sich bei ihm ein. »Aber ich muß Sie vorstellen.« Sie wandte sich zu einem hübschen Mädchen, das vor dem Kamin stand. »Sandra, meine Liebe, dies ist Mr. Horatio Green. Ich sollte Sie Mr. Green als Miss Wells vorstellen, aber ich bin sicher, er wird sie bald wie jedermann Sandra nennen.«
Das Mädchen trat mit einem schüchternen Lächeln auf ihn zu und schüttelte seine Hand. »Ich habe Ihren Namen schon oft erwähnen hören, Mr. Green.«
Er lächelte. »Und ich habe schon viel von Ihnen gehört.«
»Von mir? Wo denn?«
»Ich wohne im ›Greyhound‹. Die Ohren müssen Ihnen gestern nacht geklungen haben.«
»Ach so, ich verstehe – die Keswicks!« Sie lachte errötend.
»Sie verspricht jedem Lebewesen ihre Hilfe«, warf Mrs. Faversham ein. »Babys, Kätzchen, kranken Hunden … Es wundert mich, daß sie für mich überhaupt noch Zeit findet. Das erinnert mich daran, meine Liebe, daß mein Stärkungsmittel nicht gekommen ist. Würden Sie bitte den gräßlichen Apotheker anrufen?«
»Gewiß.«
Sie eilte hinaus.
»Was ich ohne das Mädchen tun würde, weiß ich wirklich nicht.«
»Ist sie schon lange bei Ihnen?«
»Erst seit sechs Monaten. Sie fiel mir zu wie ein Geschenk der Götter. Es geschah letzten Juni beim Gartenfest. Es war schrecklich heiß, und ich hatte mir zuviel zugemutet mit dem Herumlaufen und Begrüßen all der Leute; und plötzlich brach ich zusammen, buchstäblich in ihren Armen.«
»Wie kam sie dorthin?«
»Sie war hier in der Nähe in den Ferien und sah die Plakate im Dorf, so kam sie her und zahlte ihren Shilling wie alle andern.«
»Sie ist wohl gelernte Pflegerin, nehme ich an?«
»Ja, eine wundervolle Pflegerin. Sie war während des Krieges in Indien. Der alte Doktor Reesdale sagte, daß ich ohne sie nicht mehr hier wäre. Sie ist wirklich ein Engel – ein Engel!« Sie wandte sich jäh um: »Was man von Ihnen nicht behaupten könnte, Hilary.«
Der Mann, an den sie jene Bemerkung gerichtet hatte, blieb in der Türe stehen. Mr. Green erschrak tief, als er ihn erblickte. Der berühmte Hilary Scole sah um Jahre älter aus als auf seinen Fotografien, er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Tropen hatten offensichtlich ihren Tribut gefordert von dem stattlichen Abenteurer, der über die ganze Welt hin Blumen – und Frauen – mit demselben unermüdlichen Eifer gejagt hatte. Doch dies war der Mann, der erst vor ein paar Monaten eine der seltensten Blumen aufgespürt hatte.
»Kommen Sie doch herein!« fuhr Mrs. Faversham ihn an. »Und schließen Sie die Tür, es zieht.« Mr. Green hob die Augenbrauen; sie sprach mit ihm wie mit einem Dienstboten. »Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer er ist, Horatio. Er ist in der Öffentlichkeit bekannt genug.«
Mr. Green drückte ihm die Hand. »Es ist mir eine Ehre«, sagte er. »Ich danke Ihnen.« Scoles Stimme war sehr sanft und freundlich. »Ich wünschte, ich fände andere Worte für ›Die Ehre ist ganz meinerseits‹, aber diese müssen genügen.«
»Und nun Schluß mit den Komplimenten für heute«, mischte sich Mrs. Faversham ein. »Und außerdem, Hilary, ist Mr. Green nicht hergekommen, um sich an Ihnen satt zu sehen. Er ist wegen etwas viel Hübscheren gekommen. Gehen wir es uns anschauen.«
Sie schritt ihnen voran zu der Tür am anderen Ende des Zimmers und stieß sie mit ihrem Stock auf. Sie standen in einem langen, gewölbten Flur. Am Ende des Flurs befand sich eine Tür aus Milchglas, die in das Hauptgewächshaus führte. Ein großer, dunkler Mann in einer Gärtnerschürze kam ihnen entgegen.
»Sie erinnern sich an Wilburfoss?«
Mr. Green reichte ihm die Hand. »O ja, gewiß.«
»Guten Morgen, Sir. Es freut mich, Sie wiederzusehen«, sagte der Mann. Seine Stimme klang tief und dunkel. Es war eine Stimme, wie sie in jener Gegend oft zu finden ist, aber es schwang ein Unterton von Lebensart mit ihr mit, wie sie auch in seinem ganzen Gebaren zu spüren war.
»Wilburfoss ist mir nun schon seit beinahe dreißig Jahren treu«, sagte Mrs. Faversham. »Nicht wahr, Wilburfoss?«
Er schien sie nicht zu hören. Er drehte sich um und führte sie in das Gewächshaus hinein, das neben dem Allerheiligsten, dem kleineren Warmhaus, lag, in dem die Mondblume ihrer harrte.
Wie Mr. Green so in dieser kleinen Prozession mitmarschierte, wurde ihm plötzlich bewußt, daß er soeben das zehnte Gebot brach. Wie sollte ein Mann seiner Art sich nicht gelüsten lassen nach einem Ort wie diesem? Es war ein Ort, wo die Natur überwunden war und die Zeit stillstand. Der Duft der Gardenien umfing ihn wie einst der Märchenzauber der »Arabischen Nächte«, aufdringlich und süß. Und immerwährend drang von draußen das Geräusch des Wasserfalls herein, der in der kalten Luft sang und jauchzte und kämpfte, eine vielstimmige Wassermusik, die – merkwürdiger Widerspruch der Natur – die Stille im Treibhaus noch zu vergrößern schien.
Nun öffnete Wilburfoss die Tür zum Allerheiligsten.
Mrs. Faversham bat Mr. Green mit einer Handbewegung, einzutreten.
Sechs Blumentöpfe standen auf dem Boden. Aus ihnen erhob sich ein Blättergewinde, das sich an einem feinen Drahtgeflecht emporrankte. Die Blätter waren glatt und dunkel, beinahe schwarz, und schienen eine wilde Kraft in sich zu bergen, als müßten sie mit der Zeit um die Wette laufen. Aber es lag Dunst über ihnen, ein heißer Dunst, in dem sie leise schwankten und zitterten …
»Da wären wir.« Mrs. Favershams Stimme kam von den fernsten Sternen her.
»Ich glaube«, sagte Mr. Green, »ich falle in Ohnmacht.«
Und das tat er auch.
Es dauerte kaum einige Sekunden … ein plötzliches Stolpern in Wilburfoss’ Arme, eine rasche Dunkelheit, wie wenn sich ein Vorhang über sein Hirn gesenkt hätte. Und dann hob sich der Vorhang wieder, und er entdeckte, daß er auf einem Schubkarren im Kalthaus nebenan saß und zwinkernd in ein Paar schöne dunkle Augen blickte.
»So ist’s besser«, sagte Miss Wells mit sanfter Stimme. »Lehnen Sie sich zurück, damit ich Ihren Kragen lockern kann.«
»Ich bitte um Verzeihung«, begann er.
»Hören Sie schon auf damit, Horatio«, unterbrach ihn Mrs. Faversham. »Und sprechen Sie ja nicht. Sandra, Liebe, geben Sie ihm mein Riechsalz.«
Der stechende Ammoniakgeruch brachte die Farbe in seine Wangen zurück.
»Ich kann mir nicht vorstellen …«, begann er von neuem.
»Versuchen Sie’s auch nicht. Wilburfoss, laufen Sie zu Ackworth und bitten Sie ihn um ein Glas Kognak.« Er hörte das Geräusch eilender Schritte und schloß wiederholt die Augen. Dann kamen die Schritte zurück, er nippte an dem Kognak und fühlte sich sogleich besser.
Er reichte Miss Wells das leere Glas. »Sehen Sie«, sagte er, »meine Hand zittert kein bißchen.«
»Bleiben Sie lieber noch einen Augenblick sitzen«, entgegnete sie und blickte ihn forschend an. »Hatten Sie je einen Sonnenstich?«
»Ja. In Indien.«
»Ich dachte es mir. Sie sollten sich in acht nehmen vor plötzlichen Temperaturunterschieden.«
»Hab ich’s Ihnen nicht gesagt?« warf Mrs. Faversham ein. »Sandra weiß alles.«
»Allerdings. Wie hoch ist die Temperatur nebenan?«
Hilary Scole trat zu ihnen. »Einundzwanzig Grad, und das ist fünf Grad zuwenig.«
»Zuwenig?« Mrs. Favershams Stimme klang sehr scharf. »Wie kommt das, Wilburfoss?«
»Nun, das Haus ist groß, und da ist es nicht immer möglich …«
»Ach! Nach der Ölrechnung zu schließen, sollte es überall so heiß sein wie in einem Ofen!«
»Das wäre noch schlimmer«, entgegnete Scole trocken. »Es ist eine sehr heikle Angelegenheit.«
»Daran brauchen Sie mich nicht zu erinnern. Nur sechs Samen von den dreizehn haben gekeimt! Und nun läßt man die Temperatur so fallen, daß weiß der Himmel was mit diesen restlichen geschehen kann. Das wäre sogar für die Geduld eines Heiligen zuviel! – Wilburfoss!« Sie schrie mit schriller Stimme. »Wilburfoss! Wohin gehen Sie?«
Die einzige Antwort war das Zuschlagen der Tür, als der Gärtner hinausging.
Sie starrte ihm nach, mit dem Stock heftig auf den Boden klopfend.
»Eines Tages werde ich diesen Mann entlassen!«
»Das wäre sehr unklug.«
»Niemand ist unentbehrlich, Hilary. Sie sollten sich dessen besonders bewußt sein. Sie scheinen nicht zu merken …« Sie hielt, augenscheinlich nur mit großer Anstrengung, inne. »Aber wir vergessen unsern Kranken.«
»Sie brauchen mich nicht länger so zu nennen.« Mr. Green stellte sich ein wenig unsicher auf die Füße.
»Ich helfe Ihnen«, sagte Miss Wells.
»Sie sind sehr liebenswürdig.« Er nahm ihren Arm. Dann wandte er sich zur Tür des Warmhauses. Es sah sehr verlockend aus in seiner tropischen Fülle, mit den dunklen Blättern der Mondblume, die im Schatten glänzten. »Können wir nicht noch einmal hineinsehen? Nur für einen Augenblick?«
»Was für ein Unsinn, Horatio! Sie haben uns heute morgen schon genug Sorgen gemacht.«
Er seufzte schwer. »Ich fürchte, das stimmt.«
Aber es schien sich alles gegen ihn verschworen zu haben, um ihn von der Mondblume fernzuhalten.
Das Mittagessen zog sich hin bis fast um drei Uhr, weil unendlich lange darüber gestritten wurde, wer heute abend in welchem Wagen zum Ball fahren sollte.
»Pusey kann euch doch alle in seinem Wagen mitnehmen«, meinte Mrs. Faversham und erklärte Mr. Green: »Pusey ist mein Rechtsanwalt. Er ißt zuviel und schwimmt in Lavendelparfüm, aber er versteht seine Sache.«
»Vielleicht hat er gar keine Lust hinzugehen«, meinte Beryl gelangweilt.
»Pusey? Der wird sich den Ball einer Gräfin bestimmt nicht entgehen lassen.«
Kenneth beugte sich verdrießlich vor. »Wenn wir alle mit Pusey fahren, so müssen wir auch alle mit Pusey heimkommen, und er wird bestimmt bis zum Morgengrauen bleiben wollen.«