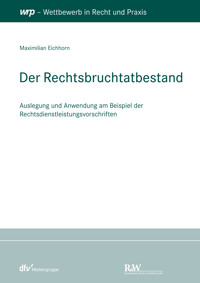
87,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe Wettbewerb in Recht und Praxis
- Sprache: Deutsch
Die unbefugte Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Nichtanwälte, zumeist durch Verstoß gegen § 3 RDG, ist für Mitbewerber wie auch für Rechtsanwaltskammern ein großes Problem. Denn der Konkurrenzdruck insbesondere durch neuartige Dienstleister und Legal-Tech Akteure wächst als Folge der Verrechtlichung aller Lebensbereiche. Nicht ohne Grund sind es daher Rechtsanwälte und Rechtsanwaltskammern, die immer häufiger auch gegen kleinere Verstöße vorgehen. Das Mittel der Wahl ist die Geltendmachung eines Rechtsbruchs nach § 3a UWG vor den Wettbewerbsgerichten wegen eines Verstoßes gegen eine Norm des RDG, RDGEG oder der RDV. Der Rechtsbruchtatbestand ist aber eine denkbar anspruchsvolle Materie, über dessen Auslegung noch immer keine Einigkeit herrscht. Auch die Rechtsprechung justiert in der Auslegung der Merkmale des Rechtsbruchtatbestandes immer wieder nach oder greift auf vorhandene Kasuistik zurück. Um zu vermeiden, dass die Einordnung von Normen durch die bisherige Auslegung der Merkmale des Rechtsbruchtatbestandes ein bloßer Schuss ins Blaue ist, werden in dieser Arbeit anhand einer streng systematischen und dogmatischen Herangehensweise Auslegungsvorschläge erarbeitet, die eine praktisch leichtgängige, effiziente und rechtssichere Handhabung des Rechtsbruchtatbestandes ermöglichen. Dem Praktiker wird aufgezeigt, welche Rechtsdienstleistungsvorschriften im Falle eines Verstoßes nach diesen Auslegungsvorschlägen einen Rechtsbruch nach § 3a UWG bedeuten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Rechtsbruchtatbestand
Auslegung und Anwendung am Beispiel der Rechtsdienstleistungsvorschriften
Maximilian Eichhorn
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Der Rechtsbruchtatbestand
Auslegung und Anwendung am Beispiel der Rechtsdienstleistungsvorschriften
Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München
vorgelegt von Maximilian Eichhorn 2023
Referent: Professor Dr. Helmut Köhler Koreferent: Professor Dr. Matthias Leistner Tag der mündlichen Prüfung: 27. April 2023
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1880-7
© 2023 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main www.ruw.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München im Wintersemester 2022/23 als Dissertation angenommen.
Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Helmut Köhler, für seine hervorragende Betreuung und die große Freiheit, die er mir während der Anfertigung der Arbeit gelassen hat, aber auch für seine wertvollen Ratschläge und den jederzeitigen fachlichen Austausch. Herrn Professor Dr. Matthias Leistner danke ich sehr für die Erstellung des Zweitgutachtens.
Bei Herrn Rechtsanwalt Thies Ruven Appelkamp bedanke ich mich herzlich für seine hilfreichen Anregungen zur Themenauswahl und den intensiven Austausch über diese Arbeit. Dank gebührt auch dem Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, Herrn Rechtsanwalt Dr. Rüdiger Suppé, für die Herstellung wichtiger Kontakte zu Praktikern sowie der Kanzlei NORDEMANN Rechtsanwälte für die Unterstützung mit empirisch-statistischen Daten zu geführten RDG-Verfahren im lauterkeitsrechtlichen Kontext. Zu Dank verpflichtet bin ich schließlich Herrn Rechtsanwalt Dr. Nico Frehse für seine vielen Hinweise für die Erstellung dieser Arbeit und seinen kollegialen Rückhalt.
Ich danke der Studienstiftung iusvivum und insbesondere ihrem Stiftungsvorstand, Herrn Professor Dr. Haimo Schack sowie der Ludwig Sievers Stiftung für die finanzielle Förderung dieser Arbeit und die großzügige Gewährung eines Druckkostenzuschusses.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Heinz Heinrich Hottendorf und Herrn Dipl.-Ing. Jürgen zum Felde für ihren durchgängigen Rückhalt und die finanzielle Förderung meiner Ausbildung. Ebenso danken möchte ich Herrn Dipl.-Betriebsw. Knut Henning, der mir stets kreative Auszeiten ermöglicht hat und Unterstützung zuteil werden ließ.
Meinen ganz besonderen Dank verdient meine Mutter, Frau Marion Eichhorn, für die immerwährende Motivation und den stetigen guten Zuspruch. Ohne sie wäre diese lange Ausbildung nicht möglich gewesen.
Die Arbeit wurde Mitte Dezember 2022 abgeschlossen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis einschließlich dieses Datums berücksichtigt werden.
Stade, im Juli 2023
Maximilian Eichhorn
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel: Einleitung
A. Problemdarstellung und Zielsetzung
B. Gang der Untersuchung
2. Kapitel: Entwicklung und aktueller Stand des Rechtsbruchtatbestandes
A. Überblick über die historische Entwicklung bis zum UWG 2004
I. Fehlende Generalklausel im UWG 1896
II. Entwicklungen im Geltungszeitraum des UWG 1909
1. Vorsprunggedanke
2. Ablösung durch den Wertbezug von Vorschriften
a) Wertbezogene Normen
b) Wertneutrale Normen
3. Veränderter personal-subjektiver Schutzbereich
a) Schutz der Allgemeinheit
b) Verbraucherschutz und Marktgegenseitenschutz
4. Einordnung der Rechtsberatungsvorschriften bis zum UWG 2004
5. Einflussgebende Kritik des Schrifttums an der Rechtsprechung zu § 1 UWG 1909
6. Akzeptanz der Normzwecktheorie durch den BGH
B. Kodifikation der Fallgruppe Rechtsbruch durch die UWG Novelle 2004
C. Anpassungen an die UGP-RL durch die UWG Novelle 2008
D. Aktueller Stand: Neuformung des Rechtsbruchtatbestandes durch § 3a UWG im Zuge der Novelle 2015
E. Zwischenergebnis
3. Kapitel: Aufbau und Voraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes
A. Natur und Aufbau des Rechtsbruchtatbestandes
B. Voraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes
I. Konstitutive Voraussetzung: Vorliegen einer geschäftlichen Handlung
1. Definition der geschäftlichen Handlung
2. Geschäftspraktik als Modellbegriff
a) Definition und Begriffsinhalt
aa) Persönliche Reichweite
bb) Gegenständliche Reichweite
cc) Sachliche Reichweite: objektiver Unmittelbarkeitszusammenhang
dd) Zeitliche Reichweite
(1) Vorvertraglicher Bereich der Absatzförderung
(2) Vertragliche Phase des Geschäftsabschlusses
(3) Nachvertragliche Phase der Vertragsdurchführung
b) Harmonisierungsumfang der Geschäftspraktik
c) Harmonisierungsfreie Bereiche
3. Geschäftliche Handlung in den harmonisierungsfreien Bereichen: Auslegung im Sinne der Geschäftspraktik?
a) Ausgangslage: objektiv zu verstehender Einheitsbegriff
b) Auslegung im harmonisierungsfreien B2C-Bereich
c) Auslegung im harmonisierungsfreien B2B-Bereich
aa) Vertikal B2B
bb) Horizontal B2B
d) Auslegung in Fällen der Bereichsausnahmen
e) Zwischenergebnis
4. Zusammenfassende Auslegung der geschäftlichen Handlung
II. Tatbestandsaufbau der normenspezifischen Tatbestandskomponente
1. Zuwiderhandeln gegen eine gesetzliche Vorschrift
a) Gesetzliche Vorschrift
b) Zuwiderhandeln
aa) Eigenes, täterschaftliches Zuwiderhandeln
bb) Zuwiderhandeln durch die Zurechnung wettbewerbswidriger Handlungen Dritter
2. Kernmerkmal: Regelung des Marktverhaltens auch im Interesse der Marktteilnehmer
a) Systematische Einordnung
b) Überblick über die Auslegung der Merkmale der normenspezifischen Tatbestandskomponente
aa) Marktverhaltensregelung und Abgrenzung zur Marktzutrittsregelung
bb) Regelung von Marktverhalten
cc) Interesse der Marktteilnehmer
dd) „Bestimmung“ einer Norm
ee) Zwischenergebnis
III. Bagatellkomponente
1. Funktion
2. Dogmatische Einordnung
3. Auslegung der Bagatellkomponente
a) Eignung zur spürbaren Interessenbeeinträchtigung
b) Rückkopplung an die geschützten Interessen der Marktteilnehmer
c) Beurteilungsmaßstab und Kriterien
d) Indizierung der Spürbarkeit bei Betroffenheit gewichtiger Interessen?
e) Spürbarkeit im Falle der Betroffenheit wirtschaftlicher Abnehmerinteressen nur bei Entscheidungsrelevanz?
aa) Bedeutung der Entscheidungsrelevanz für § 3a UWG nach Knuspermüsli II?
bb) Nach Knuspermüsli II: Keine Parallelprüfung des § 3a UWG und keine Prüfung der Entscheidungsrelevanz bei § 3a UWG im Anwendungsbereich der UGP-RL
cc) Berücksichtigung der Entscheidungsrelevanz außerhalb der UGP-RL?
(1) Keine zwingende Angleichung in harmonisierungsfreien Bereichen
(2) Überschießende Auslegung: Spürbarkeit nur bei Entscheidungsrelevanz?
4. Zusammenfassung
4. Kapitel: Anwendung des Rechtsbruchtatbestandes neben anderen Ansprüchen und Sanktionen
A. Anwendung anderer lauterkeitsrechtlicher Tatbestände neben § 3a UWG?
B. Anwendung sonstiger zivilrechtlicher und öffentlichrechtlicher Sanktionen neben § 3a UWG?
I. Parallelität lauterkeitsrechtlicher und anderer, zivilrechtlicher Ansprüche und Rechtsfolgen
II. Parallelität von ordnungsrechtlichen- und Strafsanktionen
III. Ausnahme: Abschließendes Rechtsfolgenregime
C. Bindungswirkung behördlicher und fachgerichtlicher Entscheidungen
I. Originär lauterkeitsrechtliche Normauslegung
II. Prozessuale Durchsetzungskonkurrenz
1. Grundsätzliche Bindung behördlicher Entscheidungen bei Tatbestandswirkung
2. Reichweite der Tatbestandswirkung
3. Folgen eines Widerspruchs
4. Fälle fehlender Tatbestandswirkung
5. Bindung in Fällen nicht vorhandener Tatbestandswirkung
a) Duldung durch die Behörden
b) Verwaltungsvertrag und zugesichertes Untätigbleiben
c) Delegierte Rechtsnormen
III. Vertrauensschutz im Hinblick auf die behördliche oder fachgerichtliche Entscheidung?
D. Folgerungen für Verstöße gegen Rechtsdienstleistungsvorschriften
I. Kein abschließendes Sanktionenregime im RDG
II. Vorhergehende Gerichtsentscheidungen
III. Verwaltungsrechtliche Rechtsakte
1. Registrierungsverwaltungsakt nach alter Rechtslage
2. Registrierungsverwaltungsakt nach neuer Rechtslage
3. Sonstige verwaltungsrechtliche Maßnahmen
E. Zusammenfassung
5. Kapitel: Untersuchung der analyserelevanten Kernmerkmale des § 3a UWG
A. Gesetzliche Vorschrift mit Regelungscharakter
I. Gesetzliche Vorschrift
II. Regelung
1. Auslegung einer Regelung
a) Verhaltenssteuerung durch Gebote und Verbote
b) Irrelevanz einer Regelung
c) Stellungnahme
2. Feststellung einer Regelungswirkung
3. Zwischenergebnis
B. Marktverhaltensregelung im Interesse der Marktteilnehmer
I. Einheitsmerkmal oder Aufspaltung?
1. Uneinheitliche Behandlung durch die Rechtsprechung
a) Alleinige Maßgeblichkeit des geschützten Marktteilnehmerinteresses (interessengerichteter Wettbewerbsbezug)
b) Keine Prüfung eines Merkmals
c) Separate Prüfung beider Merkmale
d) Zwischenergebnis
2. Beurteilung durch das Schrifttum
a) Ablehnung einer kumulativen Analyse
b) Befürwortung einer kumulativen Analyse als Doppelfilter
3. Zusammenfassung und Stellungnahme
II. Auslegung der Marktverhaltensregelung
1. Begriff „Marktverhalten“
2. Bestimmung einer Marktverhaltensregelung
a) Ausgangspunkt: Normzweck einer Vorschrift
b) Ermittlung des Normzwecks
aa) Subjektiv-normativer Ermittlungsansatz
bb) Objektiv-formaler Ermittlungsansatz
cc) Stellungnahme und eigener Auslegungsvorschlag
(1) Bewertung der Ansätze
(2) Argumente für die formal-objektive Normzweckermittlung
(a) Wortlaut
(b) Systematik
(c) Rechtsökonomische Erwägungen
(d) Rechtspraktische Erwägungen
(e) Zwischenergebnis
(3) Eigener Auslegungsvorschlag
(a) Grundsätzliche Maßgeblichkeit des tatbestandlich geregelten Verhaltens
(b) Ausnahme: Ermittlung anhand der objektiven Stoßrichtung einer Norm
(c) Marktverhalten muss lediglich eigenständige Kategorie bzw. Anwendungsfall sein
III. Auslegung des Merkmals „im Interesse der Marktteilnehmer“
1. Die Interessensubjekte
a) Mitbewerber
b) Verbraucher
c) Sonstige Marktteilnehmer
2. Die Interessen
a) Kein unmittelbarer Schutz von Allgemeininteressen
b) Das geschützte Marktteilnehmerinteresse
aa) Irrelevanz privater und personenbezogener Partikularinteressen
bb) Maßgeblichkeit der abstrakten Interessen der Marktteilnehmergruppen
cc) Geschützte Interessengattungen der Marktteilnehmer
(1) Funktionsorientierte Auffassung
(2) Extensive Auffassung
(3) Gegenüberstellung der Auffassungen und Bewertung
(4) Eigene Analyse
(a) Analysemaßstab
(b) Grammatische Auslegung
(c) Historisch-genetische Auslegung
(d) Systematische Auslegung und Schutzzweckerwägungen
(aa) Schutzzweck nicht allein auf wirtschaftliche Interessen beschränkt
(bb) Systematik überwiegend, aber nicht allein auf wirtschaftliche Interessen bezogen
(cc) Kein Systemwiderspruch durch mittelbare Einbeziehung von Allgemeininteressen
(dd) Schutz gewisser Allgemeininteressen durch den Gesetzgeber akzeptiert
(e) Teleologische Auslegung
(f) Unionsrechtskonforme Auslegung
(g) Weitere Erwägungen
(h) Zwischenergebnis
(5) Funktion eines extensiv verstandenen Marktteilnehmerinteresses?
(a) Funktionslosigkeit?
(b) Ausgrenzungsfunktion des Marktteilnehmerinteresses
3. Ergebnis und Auslegungsvorschlag zum Marktteilnehmerinteresse
C. Zusammenfassende Übersicht der Auslegungsvorschläge
6. Kapitel: Analyse und Beurteilung der Rechtsdienstleistungsvorschriften
A. Einführung und Grundlagen des Rechtsdienstleitungsrechts
I. Definitorischer Umfang
II. Entstehungsgeschichte und Systematik
1. Entwicklung vom Rechtsberatungsrecht zum liberalen Rechtsdienstleistungsrecht
2. Systematik und Regelungsstrategie
a) Struktureller Aufbau
b) Schutzzwecke
c) Regelungstypus, Funktion und Regelungsstrategie
aa) RDG als präventives Verbotsgesetz
bb) Ordnungsrechtliche Natur der Rechtsdienstleistungsvorschriften
cc) Nicht abschließende, aber umfassende Regelungsstrategie
III. Verfassungs- und Unionsrechtskonformität
IV. Anwendbarkeit des UWG auf die Rechtsdienstleistungsvorschriften
B. Lauterkeitsrechtliche Behandlung von Rechtsdienstleistungsvorschriften und Leitlinien der Rechtsprechung
I. Einordnung von Rechtsdienstleistungsvorschriften durch die Rechtsprechung
1. Begründung der Primärnormqualität durch die Schutzzweckklausel
2. Pauschalisierende Erstreckung auf alle Vorschriften des RDG
3. Ableitbare Grundsätze zur Beurteilung von Rechtsdienstleistungsvorschriften
4. Bewertung
II. Verwertbarkeit der Leitlinien für die hier unterbreiteten Auslegungsvorschläge
C. Analyse der Rechtsdienstleistungsvorschriften durch Anwendung der Auslegungsvorschläge
I. Vorschriften des Rechtsdienstleistungsgesetzes
1. § 1 RDG – Anwendungsbereich
2. § 2 RDG – Begriff der Rechtsdienstleistung
3. § 3 RDG – Befugnis zur Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen
a) Regelungscharakter
b) Marktverhaltensregelung
aa) Tatbestandlich geregeltes Verhalten unbestimmt
bb) Objektive Stoßrichtung zielt auch auf Marktverhalten
c) Marktteilnehmerinteresse
4. § 4 RDG – Unvereinbarkeit mit einer anderen Leistungspflicht
5. § 5 RDG – Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit
6. Weitere Vorschriften, die Erlaubnissätze beinhalten (§§ 6 bis 8, 10 RDG)
a) Erlaubnissätze
b) Anleitungs- und Ausstattungspflicht nach §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 2 und 8 Abs. 2 RDG
aa) Regelung
bb) Marktverhaltensregelung
c) Verfahrensvorschriften bei registrierten Personen, § 10 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3 RDG
d) Angabepflicht bei Teilbereichsregistrierung, § 10 Abs. 3 S. 3 RDG
7. § 9 RDG – Untersagung von Rechtsdienstleistungen
8. § 11 RDG – Besondere Sachkunde, Berufsbezeichnungen
a) Erfordernis besonderer Sachkunde gem. § 11 Abs. 1 bis 3 RDG
b) Berufsbezeichnungsvorschriften nach § 11 Abs. 4 und 5 RDG
9. § 12 RDG – Registrierungsvoraussetzungen
10. § 13 RDG – Registrierungsverfahren
11. § 13a RDG – Darlegungs- und Informationspflichten gegenüber Privatpersonen
12. § 13b RDG – Darlegungs- und Informationspflichten für Verbraucher
13. § 13c RDG – Vergütungsvereinbarungen für Inkassodienstleistungen und Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht
14. § 13d RDG – Vergütung der Rentenberater
15. § 13e RDG – Erstattungsfähigkeit der Kosten für Inkassodienstleister
16. § 13f RDG – Beauftragung von Rechtsanwälten und Inkassodienstleistern
17. § 13g RDG – Umgang mit Fremdgeldern
18. § 13h RDG – Aufsichtsmaßnahmen
19. § 14 RDG – Widerruf der Registrierung
20. § 14a RDG – Bestellung eines Abwicklers für Rentenberater
21. § 15 RDG – Vorübergehende Rechtsdienstleistungen
a) Erlaubnissatz
b) Erstmeldeobliegenheit
c) Änderungsmeldung
d) Wiederholungsmeldung
e) Herkunftssprachliche Berufsbezeichnungspflicht
f) Berufshaftpflichtversicherung und Hinweispflicht
g) Übrige Vorschriften
22. §§ 15a bis 20 RDG – Weitere Vorschriften des RDG
II. Vorschriften der Rechtsdienstleistungsverordnung
1. §§ 2 und 3 RDV – Nachweis der theoretischen und praktischen Sachkunde
2. § 4 RDV – Sachkundelehrgang
3. § 5 RDV – Berufshaftpflichtversicherung
4. §§ 6 bis 10 RDV – Weitere Vorschriften der RDV
III. Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz
1. § 1 RDGEG – Erlaubnisinhaber nach dem Rechtsberatungsgesetz
2. § 2 RDGEG – Versicherungsberater
3. § 3 RDGEG – Gerichtliche Vertretung
4. § 4 RDGEG – Vergütung
5. § 5 RDGEG – Diplom-Juristen aus dem Beitrittsgebiet
6. § 6 RDGEG – Schutz der Berufsbezeichnung
7. § 7 RDGEG – Übergangsvorschrift zu § 13 Absatz 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes
IV. Zwischenergebnis zur Analyse der Rechtsdienstleistungsvorschriften
D. Ergebnis und Mehrwert der Auslegungsvorschläge
7. Kapitel: Zusammenfassung der Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Es gibt kein richtiges Leben im falschen.
– Theodor W. Adorno –
1. Kapitel: Einleitung
A. Problemdarstellung und Zielsetzung
Die Nachfrage nach Rechtsberatung und Rechtsdienstleistungen war noch nie so groß wie heute. Sie bezieht sich auf die unterschiedlichsten Lebens- und Wirtschaftsbereiche und wird von allen Gruppen von Marktakteuren gestellt. Ursächlich ist die schon seit langem zu beobachtende rechtliche Durchdringung, kurz: Verrechtlichung, aller Lebensbereiche. Ein weiterer, aber erst seit den letzten Jahren aufkommender Trend ist die Technologisierung des Rechts. Beides hat dazu geführt, dass sich der Rechtsberatungsmarkt für verschiedene neue Berufs- und Tätigkeitsfelder jeglicher Couleur weit geöffnet hat. Der Gesetzgeber hat dies zum Anlass genommen, das Rechtsdienstleistungsrecht zu reformieren und zu deregulieren und hat hierzu das Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen vom 1.1.2008 (RDG)1 geschaffen, mit dem eine unmittelbare und für die Rechtsanwaltschaft spürbare Öffnung des Rechtsberatungsmonopols einhergegangen ist.2 Diese Liberalisierung der Rechtsdienstleistungsbefugnis hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Heutzutage greifen so viele nichtanwaltliche Anbieter von Rechtsdienstleistungen, sowohl konventionelle als auch technologiezentrierte, wie nie nach Stücken des Rechtsdienstleistungsmarkt-Kuchens. Vor allem das Marktsegment von technologiezentrierten Rechtsdienstleistungen, das sog. „Legal-Tech“, hat rasant an Fahrt aufgenommen. Anbieter für neuartige Angebote wie automatisierte Rechtsdokumentengeneratoren oder das Masseninkasso im Wege des echten Factorings, die auch die Geltendmachung von Ansprüchen aus Situationen des täglichen Lebens möglich machen, sind aus dem Boden geschossen.3 Viele von ihnen haben sich auf dem Markt längst etabliert.4 Oftmals treten sie bewusst als Konkurrenten zur Anwaltschaft auf. Allerdings begeben sich viele Unternehmer nicht selten auch unbewusst auf das dünne Eis unerlaubter Rechtsdienstleistungen, wenn sie in einzelnen Aspekten ihrer Berufstätigkeit Rechtsdienstleistungen erbringen, ohne zu wissen, dass diese Tätigkeiten unter die Definition erlaubnispflichtiger Rechtsdienstleistungen fallen.5 Durch diese zunehmende Anzahl nichtanwaltlicher Rechtsdienstleister wird ein immenser Wettbewerbsdruck auf Anwälte erzeugt. Dem steht nicht entgegen, dass der Markt für Rechtsdienstleistungen insgesamt größer geworden ist. Denn parallel dazu hat sich der Wettbewerb intensiviert.6
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Rechtsanwaltskammern und anwaltliche Mitbewerber sich gegen dieses für sie nachteilige Marktumfeld zu wehren versuchen. Das Mittel der Wahl, um gegen die unliebsamen nichtanwaltlichen Konkurrenten vorzugehen, ist ganz überwiegend das Lauterkeitsrecht. Der mit Blick auf die gegen Rechtsdienstleistungsvorschriften verstoßenden Rechtsdienstleister wichtigste und gleichzeitig mit den weitreichendsten Konsequenzen verbundene Unlauterkeitstatbestand ist der Rechtsbruchtatbestand des § 3a UWG7.8 Auf dieser Grundlage verlangen die Konkurrenten bzw. Verbände dann die Unterlassung der behaupteten unzulässigen Rechtsdienstleistung überwiegend im einstweiligen Verfügungsverfahren, was in letzter Konsequenz im Erfolgsfalle nicht selten die Untersagung des gesamten Geschäftsmodells des Beklagten bedeutet. Mit entsprechendem Eifer und Hartnäckigkeit werden die jeweiligen Verfahren häufig bis vor die Oberlandesgerichte getragen oder sogar vor dem BGH9 ausgefochten.
Der Rechtsbruchtatbestand ist für die Durchsetzung von Ansprüchen wegen Verstößen gegen Rechtsdienstleistungsvorschriften daher von ganz herausgehobener Bedeutung. Er stellt jedoch eine denkbar anspruchsvolle Materie dar und die Frage, ob ein Rechtsbruch vorliegt, zählt nach mancher Ansicht zu den schwierigsten und umstrittensten Fragen des Lauterkeitsrechts.10 So herrscht seit jeher Uneinigkeit über die genaue Auslegung einzelner Tatbestandsmerkmale. Insbesondere kann häufig keine klare Antwort darauf gegeben werden, welche Vorschriften dazu bestimmt sind, das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln, wie es der Rechtsbruchtatbestand in § 3a UWG für solche Rechtsnormen bestimmt, die als „außerwettbewerbsrechtliche“ Vorschriften Einzug in das UWG finden sollen. Dies ist aber notwendig, denn die Konsequenzen sind ernst. Durch das Eingreifen des lauterkeitsrechtlichen Rechtsfolgenregimes der §§ 8ff. UWG, das primär auf Unterlassung gerichtet ist, können ganze Geschäftsmodelle vernichtet werden, die ansonsten den wertvollen Schutz der Berufsfreiheit nach Art. 12 GG11 genießen. Die Auslegung des Rechtsbruchtatbestandes darf deshalb weder leichtfertig noch lapidar erfolgen. Diese Unsicherheiten werden durch eine sehr wechselhafte Rechtsprechung des BGH in den vergangenen Jahren zu dieser Thematik noch verschärft.
Im Hinblick auf den dargestellten Bedeutungsgewinn des Rechtsbruchtatbestandes für außergerichtliche Rechtsdienstleistungen und der damit einhergehenden stetig steigenden Anzahl an lauterkeitsrechtlichen Verfahren sind klare Auslegungsleitlinien für den Rechtsbruchtatbestand zugunsten einer rechtssicheren privatrechtlichen Sanktionierung von Verstößen gegen das RDG unbedingt erforderlich. Bislang haben sich die Wettbewerbsgerichte indes nur oberflächlich und unzureichend mit der Qualifikation der Normen des RDG als im Interesse der Marktteilnehmer liegenden Marktverhaltensregelungen befasst. Zumeist wird lapidar und gebetsmühlenartig darauf hingewiesen, dass sie zu den Vorschriften zählen, die dazu bestimmt sind, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, da das RDG gemäß seiner Schutzzweckklausel dazu diene, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen.12 In der jüngeren lauterkeitsrechtlichen Judikatur ist nun vermehrt zu beobachten, dass überhaupt keine eigenständige Begründung mehr vorgenommen wird.13 Diese „Argumentationsmethodik“, die eigentlich keine ist, lässt jedoch außer Acht, dass der Gesetzgeber klar umrissene Tatbestandsmerkmale für die Analyse von Vorschriften i.S.d. § 3a UWG vorgesehen hat. Und dennoch werden die Vorschriften, wenn überhaupt, überwiegend anhand ihrer Schutzrichtung und des gesetzgeberischen Willens, wie er sich in den Materialien darstellt, als rechtsbruchrelevant beurteilt. Vor dem Hintergrund der elementaren Bedeutung des Rechtsbruchtatbestandes für die lauterkeitsrechtliche Sanktionierung von Gesetzesverstößen, vor allem solchen gegen das RDG, ist aber eine einfache, treffsichere und vor allem tatbestandsorientierte Auslegung des § 3a UWG unbedingt erforderlich.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, im Interesse der Rechtsklarheit und der einfachen und effizienten Handhabbarkeit des Rechtsbruchtatbestandes Auslegungsvorschläge anhand der im Normtext des § 3a UWG klar festgelegten Merkmale zu entwickeln und damit einen Alternativvorschlag zu der bisherigen und weit überwiegend verwendeten Auslegungsmethodik zu präsentieren. Die Auslegungsvorschläge sollen sich dazu eignen, vor allem in dem lauterkeitsrechtlich so relevanten Verfügungsverfahren eine effiziente und schnelle sowie einfach handhabbare und stringente Analyse von außerhalb des UWG gelegenen Vorschriften zu ermöglichen. Die Auslegungsvorschläge sollen dabei universell anwendbar sein und zu präzisen Ergebnissen führen, mit der Folge, dass die praktische Anwendung des Rechtsbruchtatbestandes für den Rechtsanwender erleichtert wird. Prüfstein hierfür werden die Rechtsdienstleistungsvorschriften sein. An diesen Auslegungsvorschlägen sollen also die Vorschriften des Rechtsdienstleistungsrechts gemessen werden. Für den Rechtsanwender soll so schließlich ein Überblick gegeben werden, welche Vorschriften des Rechtsdienstleistungsrechts über den Rechtsbruchtatbestand sanktioniert werden können.
1
Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen vom 12. Dezember 2007, BGBl. I, 2840.
2
Römermann/Römermann
, ZAP Fach 23 (2008), 779 (783).
3
So z.B. für den Bereich des Mietrechts die Conny GmbH; für Fluggastrechte die Flightright GmbH oder für Erbschaftsstreitigkeiten die Jurfin GmbH.
4
Remmertz
, BRAK-Mitteilung 5/2018, S. 231.
5
Vielfach werden daher auch Versicherungen, Banken und sonstige Finanzberatungen verstärkt als Wettbewerber um Beratungsmandate wahrgenommen, vgl. DAV, Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030: Eine Zukunftsstudie für die deutsche Anwaltschaft, S. 12. Unbewusst in Konkurrenz zur Anwaltschaft treten dagegen oft Autohändler, Werkstattbetreiber, Sachverständige und Mietwagenunternehmen bei Unfallschadenregulierungen.
6
DAV, Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030: Eine Zukunftsstudie für die deutsche Anwaltschaft, S. 4.
7
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004, BGBl. 2004 I, 1414. Vorschriften ohne Gesetzesangabe oder Jahreszusatz beziehen sich auf solche des UWG in aktueller Fassung.
8
Skupin
, S. 542.
9
Bundesgerichtshof.
10
Köhler/Bornkamm/Feddersen/
Köhler
, 40. Aufl. 2022, UWG, § 3a Rn. 1.1.
11
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949.
12
So etwa das KG, GRUR-RR 2021, 494 (498); s.a. BGH, GRUR 2016, 1189 (1190) –
Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur
; OLG Brandenburg, GRUR-RR 2019, 159 (160); LG Köln, BeckRS 2015, 20742.
13
BGH, GRUR 2021, 1425 (1426) –
Vertragsdokumentengenerator
; BGH, GRUR 2021, 758 (761) –
Rechtsberatung durch Architektin
; OLG Köln, GRUR-RS 2020, 17239; OLG Köln, GRUR-RS 2018, 49064; OLG Hamm, GRUR-RS 2015, 10960.
B. Gang der Untersuchung
Für das Verständnis der in dieser Arbeit kritisierten, bisher überwiegend vorgenommenen Auslegungsmethodik sowie für die spätere Auslegung der geschützten Marktteilnehmerinteressen ist es zunächst wichtig, die Entwicklung des Rechtsbruchtatbestandes zu verstehen. Besonders die vorrechtlichen BGH-Entscheidungen Abgasemissionen und Elektroarbeiten waren ursächlich für die in ihren Kernmerkmalen noch heute fortbestehende, nunmehr kodifizierte Fassung des Rechtsbruchtatbestandes seit dem UWG 2004.
Daher wird im folgenden 2. Kapitel zunächst der Ursprung und der Bedeutungswandel des zunächst lediglich als Fallgruppe ausgestalteten Rechtsbruchtatbestandes aufgezeigt und überblicksartig dargestellt, welche verschiedenen Entwicklungsschritte die Fallgruppe Rechtsbruch durchlaufen hat, wie sie nach früherer Ansicht ausgelegt wurde und wie sie zu der heutigen Gesetzesfassung gelangt ist. Insbesondere wird darauf eingegangen, welche Schwierigkeiten die vorrechtliche Auslegung mit sich brachte und wie unterschiedlich die Rechtspraxis in diesem Zusammenhang die Normen des RBerG14 als Vorgängervorschrift zum Rechtsdienstleistungsgesetz eingeordnet hat.
Unmittelbar aus der geschichtlichen Entwicklung des Rechtsbruchs ist dann der kodifizierte Rechtsbruchtatbestand hervorgegangen. Dessen Voraussetzungen und Inhalte sollen im 3. Kapitel beleuchtet werden. Besonders relevant hierfür ist das Verständnis der geschäftlichen Handlung. Sie hat die frühere nationalrechtliche Wettbewerbshandlung abgelöst und entspricht heute in jedem Fall der Geschäftspraktik in den durch die Richtlinie 2005/29/EG15 harmonisierten Bereichen, hat aber zugleich einen engen Bezug zur Regelung des Marktverhaltens. Gewisse Rechtsmaterien, wie etwa, was zu zeigen sein wird, die Rechtsdienstleistungsvorschriften, sind jedoch vom Harmonisierungszwang der Richtlinie ausgenommen. Der Fokus wird somit auf der Auslegung der geschäftlichen Handlung vor allem in diesem Bereich liegen, da sie nicht nur konstitutive Voraussetzung für die Anwendung des UWG und des Rechtsbruchtatbestandes, sondern auch von erheblicher Bedeutung für die Auslegung der Marktverhaltensregelung ist. Auf die Auslegung einer Marktverhaltensregelung im Interesse der Marktteilnehmer im Detail wird jedoch im 5. Kapitel näher eingegangen werden, in welchem eine vollumfängliche Untersuchung dieser Kernvoraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes erfolgt. Die verschiedenen Voraussetzungen werden daher im 3. Kapitel nur überblicksartig dargestellt. Vertieft wird im 3. Kapitel zudem die Auslegung der Bagatellkomponente, die als Feinfilter für den Ausschluss von sehr geringfügigen Interessenbeeinträchtigungen im Rahmen des Rechtsbruchtatbestandes gilt. Das Kapitel schließt mit der Diskussion der Frage, ob die unionsrechtlich determinierte Entscheidungsrelevanz i.S.d. § 3 Abs. 2 UWG, Art. 2 e) der Richtlinie auch auf Konstellationen anwendbar ist, in denen es zwar um die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher und Abnehmer geht, die allerdings nicht in den durch die Richtlinie harmonisierten Bereich fallen, z.B. weil die jeweilige Vorschrift nicht auf unionsrechtlicher Grundlage beruht oder eine harmonisierungsfreie Regelungsmaterie betroffen ist.
Erfüllt ein Gesetzesverstoß materiell-rechtlich den Rechtsbruchtatbestand, liegt nicht immer auf der Hand, ob der Rechtsbruchtatbestand dann auch anwendbar ist. Anwendungsprobleme können sich nicht nur aus der Konkurrenz mit anderen Unlauterkeitstatbeständen im UWG ergeben, sondern auch in Zusammenhang mit anderen privatrechtlichen und ordnungs- bzw. verwaltungsrechtlichen Ansprüchen und Sanktionen. Eine genaue Kenntnis ist für die Anwendung des Rechtsbruchtatbestandes indes unabdingbar. Denn wenn möglicherweise andere Tatbestände oder Sanktionen vorrangig sind, etwa, weil ein Gesetz ein spezielleres Sanktionenregime beinhaltet, welches die Anwendung des Lauterkeitsrechts im Allgemeinen und des Rechtsbruchtatbestandes im Speziellen ausschließt, ist der Rechtsbruchtatbestand von vornherein nicht anwendbar. Von praktischer Bedeutung für den Rechtsanwender ist hierbei primär das Spannungsverhältnis zwischen einer abweichenden Beurteilung einer Gesetzesverletzung von Behörden und Verwaltungsgerichten einerseits und der Wettbewerbsgerichte andererseits, also die Thematik der Bindung behördlicher und fachgerichtlicher Entscheidungen insbesondere in den Fällen, in denen eine sog. Tatbestands- oder Feststellungswirkung vorliegt. Deshalb soll die Anwendbarkeit des Rechtsbruchtatbestandes vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Eigenheiten der Rechtsdienstleistungsvorschriften im 4. Kapitel dieser Arbeit thematisiert werden.
Unmittelbar maßgeblich für die Transmission der hier analysegegenständlichen Rechtsdienstleistungsvorschriften ist jedoch nicht der gesamte Rechtsbruchtatbestand. Es geht vielmehr um den Teil, in dem die Merkmale enthalten sind, die Anknüpfungspunkt für die in das UWG einzubeziehenden außerwettbewerbsrechtlichen Normen sind. Dies ist die zumindest sekundäre Bestimmung einer Vorschrift zur Regelung von Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer. Die Merkmale dieser Tatbestandskomponente des § 3a UWG sind daher zentral für die hier vorliegende Fragestellung und werden detailliert im 5. Kapitel dieser Arbeit besprochen. Die Auslagerung in ein gesondertes Kapitel erscheint sinnvoll, da es um eine umfassende Analyse der wichtigsten Merkmale des Rechtsbruchtatbestandes geht. Im Laufe der Untersuchung und Auslegung dieser Komponente und ihrer Merkmale werden praxisorientierte Auslegungsvorschläge erarbeitet, die es erlauben, in allen Verfahrensarten, vor allem aber in dem in der Rechtspraxis so häufig durchgeführten Verfügungsverfahren eine zuverlässige, rechtssichere und zügige Einordnung von außerhalb des UWG liegenden Vorschriften vorzunehmen. Im Fokus stehen der Regelungsgehalt einer Vorschrift, die Auslegung einer Marktverhaltensregelung, die dieser zugrundeliegenden Normzweckermittlung sowie die Bestimmung und Funktion des Interesses der Marktteilnehmer. Die Auslegungsvorschläge sollen einerseits den Eigenheiten des zivilrechtlichen Wettbewerbsverfahrens Rechnung tragen, zugleich aber auch auf einem dogmatisch tragfähigen Gerüst stehen und sich nahtlos in das System des UWG integrieren.
Im Anschluss daran werden im 6. Kapitel unter Zugrundelegung der entwickelten Auslegungsvorschläge die Rechtsdienstleistungsvorschriften analysiert und untersucht, welche von ihnen Marktverhaltensregelungen im Interesse der Marktteilnehmer darstellen. Zuletzt werden im 7. Kapitel die gefundenen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.
14
Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935, RGBl. 1935 I, 1478.
15
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EG 2005 L 149, 22 (im Folgenden: UGP-RL oder Richtlinie).
2. Kapitel: Entwicklung und aktueller Stand des Rechtsbruchtatbestandes
Der Rechtsbruchtatbestand kann auf eine mehr als hundertjährige Entwicklung zurückblicken. Durch immer neue Veränderungen und Novellierungen unterlag die Transmission von außerwettbewerbsrechtlichen Normen einem ständigen Wandel. Vor allem die Einordnung der Rechtsberatungsvorschriften des RBerG war mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und ist durch Rechtsprechung und Schrifttum dementsprechend uneinheitlich beurteilt worden.
A. Überblick über die historische Entwicklung bis zum UWG 2004
I. Fehlende Generalklausel im UWG 1896
In der Frühphase des Lauterkeitsrechts existierte noch kein Tatbestand zur Sanktionierung von wettbewerbswidrigen Gesetzesverstößen. Das erste „Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896“16 kannte allein fragmentarische Einzeltatbestände für das Verbot eines spezifischen, dem Gesetzgeber als sanktionswürdig erscheinenden wettbewerbswidrigen Verhaltens. Dadurch waren lediglich sehr wenige, konkrete Handlungen im Wettbewerb erfasst, sodass es nicht möglich war, weitere Verhaltensweisen zu sanktionieren. Stattdessen ist dafür hilfsweise auf das Deliktsrecht zurückgegriffen worden.17
16
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27.05.1896, RGBl. 1896 Nr. 2306, S. 145.
17
Fezer/Büscher/Obergfell/
Fezer
, 3. Aufl. 2016, UWG, § 1 Rn. 60;
v. Walter
, S. 10.
II. Entwicklungen im Geltungszeitraum des UWG 1909
Mit dem „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909“18 (UWG 1909) wollte der Gesetzgeber dieser Problematik Abhilfe schaffen. Hierfür schuf er in § 1 UWG 1909 eine umfassende Generalklausel. Sie lautete: „Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden“. Erforderlich für einen Wettbewerbsverstoß war im Kern also das Vorliegen einer sittenwidrigen Handlung. Damit sollte die Möglichkeit geschaffen werden, außerwettbewerbsrechtliche Zuwiderhandlungen zu sanktionieren, wenn sie jeweils eine Handlung im geschäftlichen Verkehr darstellen, die gegen die guten Sitten verstößt. Aus dieser Generalklausel heraus bildete die Rechtsprechung dann eine Fallgruppenkasuistik, mit der die Annahme einer Sittenwidrigkeit greifbarer gemacht werden sollte. Eine hiervon war die Fallgruppe Rechtsbruch.
1.Vorsprunggedanke
Sittenwidrig konnte danach insbesondere ein Gesetzesverstoß (also ein Rechtsbruch) sein. Das war der Fall, wenn sich ein Wettbewerber durch eine gesetzesverletzende Handlung im Wettbewerb einen Vorteil gegenüber seinen redlichen Mitbewerbern verschaffte und sich dadurch im Wettbewerb besser stellte.19 Nach diesem Vorsprunggedanken entschied sich die Sittenwidrigkeit danach, welche Folgen eine rechtswidrige Handlung für die übrigen Mitbewerber und die Lauterkeit des Wettbewerbs hatte. Maßgeblich war, dass das Vorgehen seinem Gesamtcharakter nach, insbesondere bei Betrachtung der verwendeten Kampfmittel, gegen die guten Sitten verstieß, selbst wenn der Normverstoß als solcher nicht als sittenwidrig anzusehen war.20 Demnach war die Sittenwidrigkeit aus drei Aspekten zu ermitteln: dem Vorliegen eines Normverstoßes, einem darauf beruhenden ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprung und einer Gesamtbetrachtung, die das Vorgehen als sittenwidrig erscheinen ließ.
2.Ablösung durch den Wertbezug von Vorschriften
Später reifte in der Rechtsprechung die Erkenntnis, dass durch den Vorsprunggedanken Verstöße gegen alle Arten von Normen ausreichten. Damit konnte sie aber nicht erklären, weshalb Verstöße gegen rein ordnende, aus Gründen staatlicher Zweckmäßigkeit erlassene Normen das Sittenwidrigkeitsverdikt tragen sollten. Denn solche Normen hatten mit den sittlichen Anschauungen der Bevölkerung überhaupt nichts zu tun. Daher forderte die Rechtsprechung fortan, dass den verletzten Normen auch eine gewisse innere Qualität oder ein innerer Gehalt zukommen und Ausdruck sittlicher Anschauungen sein müsse.21 Somit konnte das Problem, ob die Norm für das Wettbewerbsrecht i.S.d. § 1 UWG 1909 relevant war, nur aus den inneren Wertungen der Norm selbst heraus gelöst werden. Hierdurch war der Grundstein für eine Kategorisierung von außerwettbewerbsrechtlichen Normen in wertbezogene und wertneutrale Normen gelegt.22
a)Wertbezogene Normen
Normen, die für das Lauterkeitsrecht relevante innere Wertungen besaßen, wurden deshalb als wertbezogen beschrieben. Wertbezogene Normen waren solche, in denen eine sittliche Grundanschauung zum Ausdruck kam oder die spezifische wettbewerbliche Pflichten für die Marktakteure vorsahen und dadurch den Wettbewerb regulieren sollten. Später wurden auch Vorschriften den wertbezogenen Normen zugeordnet, denen zwar selbst keine sittliche Anschauung immanent war, die aber dem Schutz wichtiger Allgemeingüter dienten.23 Die Verletzung wertbezogener Normen sollte aufgrund der in diesen verkörperten und durch den Gesetzgeber getroffenen Wertentscheidung automatisch zur Sittenwidrigkeit führen.24 Kein automatisches Sittenwidrigkeitsurteil lösten hingegen Verletzungen wertneutraler Normen aus.25 Zu diesen Normen zählten vor allem staatliche Ordnungsvorschriften, die allein aus Gründen staatlicher Zweckmäßigkeit erlassen worden waren.26 Zur Bejahung einer Sittenwidrigkeit war das Hinzutreten zusätzlicher Umstände erforderlich, die z.B. in einem planmäßigen und bewussten Vorgehen bei dem Verstoß oder in einem ungerechtfertigten Vorsprung gegenüber den sich rechtstreu verhaltenden Mitbewerbern zu sehen sein konnten.27 Der Vorsprunggedanke wurde also nur noch für die Begründung weiterer Unlauterkeitsmomente fruchtbar gemacht. Die Kategorie der wertbezogenen Normen unterteilte sich also in sittlich fundierte Normen, Normen zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter und solche mit wettbewerbsregelnder Funktion.28
Die Bezeichnung „sittlich fundiert“ diente als Umschreibung für Vorschriften, die als eine Verkörperung einer bestimmten sittlichen Auffassung oder Ausdruck eines „sittlichen Gebots“29 des Gesetzgebers anzusehen waren; die also nicht mit dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit in Einklang zu bringen waren.30
Um zu ermitteln, ob eine Norm sittlich fundiert war, musste die materielle Unrechtsdimension der verletzten Norm analysiert werden. Darüber hinaus waren nach der Rechtsprechung auch Vorschriften, die dem Schutz besonders wichtiger Rechts- und Gemeinschaftsgüter dienten, wertbezogen.31 Während die Rechtsprechung des Reichsgerichts anfangs noch den lauterkeitsrechtlichen Schutz von wichtigen Gemeinschaftsgütern ablehnte32, hatte der BGH ab 1956 in Auseinandersetzung mit der Auffassung des Reichsgerichts angenommen, dass der Verstoß gegen Vorschriften, die dem Schutz der Volksgesundheit dienten, den Anschauungen des verständigen Gewerbetreibenden33 und denen der Allgemeinheit34 widerspreche und daraus eine Sittenwidrigkeit i.S.d. § 1 UWG 1909 abgeleitet. Neben dem Gesundheitsschutz35 wurden von der weiteren Rechtsprechung alle Normen, deren Schutz von besonders wichtiger Bedeutung für die Allgemeinheit waren oder die ranghohe Rechtsgüter schützen sollten, stets als die Sittenwidrigkeit begründend angesehen, so etwa Vorschriften des Umweltschutzes36 und der Steuer- und Rechtspflege.37
Die Rechtsprechung hat indes nie genau geklärt, wie sie Normen, die dem Schutz gewichtiger Gemeinschaftsgüter dienen, definiert. Praktisch haben die Gerichte dafür auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zurückgegriffen.38 Demnach schienen die verfassungsrechtlichen Wertungen, die einer Norm zugrunde lagen, maßgeblich dafür zu sein, ob eine Norm einem wichtigen Rechts- oder Gemeinschaftsgut dient oder nicht. Regelungen mit Rechtsgutbezug beinhalteten den Schutz eines überragend wichtigen Gemeinschaftsguts, wenn sie zum Schutz absoluter, also allgemein anerkannter und von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhängiger Gemeinschaftswerte getroffen wurden oder durch den Gesetzgeber zum Schutz solcher Gemeinschaftsinteressen in den Rang eines wichtigen Gemeinschaftsguts erhoben worden waren, die sich erst aus den besonderen wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Zielen des Gesetzgebers ergaben.39 Daher konnten nur solche Normverstöße als sittlich missbilligenswert angesehen werden, in deren Postulat übergeordnete und allgemeingeltende schutzwürdige Gemeinschaftswerte zum Ausdruck kamen oder denen eine verfassungsrechtliche Grundwertung des Gesetzgebers zugrunde lag. Sie zogen dann eine „per-se-Sittenwidrigkeit“ nach sich.
Schließlich wurden auch Normen mit wettbewerbsregelnder Funktion als wertbezogen begriffen.40 Verstöße gegen sie führten aufgrund deren Schutzzwecks nach zuletzt gefestigter Rechtsprechung stets zur Sittenwidrigkeit. So einzuordnende Normen waren darauf gerichtet, den geschäftlichen Wettbewerb in dem Sinne zu regeln, dass sie festlegen, unter welchen Voraussetzungen der geschäftliche Wettbewerb im Einzelnen gestattet ist.41
b)Wertneutrale Normen
Keine automatische Sittenwidrigkeit zogen Verstöße gegen wertneutrale Normen nach sich, welche also lediglich aus Gründen ordnender Zweckmäßigkeit erlassen worden waren.42 Denn § 1 UWG 1909 sollte nicht schlechthin jeden Gesetzesverstoß sanktionieren, sondern nur einen solchen, bei dem weitere Umstände und das daraus folgende Gesamtbild aus wettbewerbsrechtlicher Sicht das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zu verletzen vermochte.43 Als wertneutral galten dementsprechend etwa behördliche Zulassungsgenehmigungen von Geschäftsbetrieben, die die Voraussetzungen für die Art und Weise einer bestimmten Geschäftstätigkeit oder bestimmte Formerfordernisse für sie festlegten.44 Solche Normen waren wertneutral, weil sie zwar das Wirtschaftsleben regulierten und ordneten, aber keiner spezifisch sittlichen Wertung des Gesetzgebers Ausdruck verliehen.45 Der Verstoß war dann rechtswidrig, aber nicht wettbewerbswidrig. Das Sittenwidrigkeitsverdikt konnte nur unter Hinzutreten besonderer wettbewerbsrelevanter Umstände angenommen werden, z.B. durch ein subjektiv bewusstes und planvolles Handeln in dem Sinne, dass der Verletzer hätte erkennen können, dass er dadurch einen sachlich nicht gerechtfertigten Vorsprung erlangen würde.46
3.Veränderter personal-subjektiver Schutzbereich
a)Schutz der Allgemeinheit
Weitere wesentliche Entwicklungen waren in Bezug auf den subjektiv-personalen Schutzumfang des UWG zu beobachten. In seiner ersten Entscheidung zum § 1 UWG 1909 hatte das Reichsgericht im Hinblick auf den subjektiven Schutzbereich der Generalklausel darauf abgestellt, dass es auf die Sittenwidrigkeit nach Maßgabe des Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden ankomme, nicht aber darauf, ob der Anspruch des klagenden Mitbewerbers in seiner gesundheitspolizeilichen Dimension zu bejahen wäre.47 Allgemeinheitsinteressen spielten für die Generalklausel damit zunächst noch keine Rolle. Schutzgüter, die auf den Schutz von Allgemeinwohlbelangen gerichtet waren, sollten für eine lauterkeitsrechtliche Beurteilung außer Betracht bleiben. Einige Jahre später ließ das Reichsgericht von seiner Ablehnung des Schutzes von Allgemeinheitsrechtsgütern ab und ließ eine vorsichtige Tendenz zugunsten des Schutzes der Allgemeinheit und des Verbraucherschutzes erkennen.48 Danach konnten auch solche Wettbewerbshandlungen einen wettbewerbswidrigen Sittenverstoß darstellen, mit denen der Wettbewerber gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen hatte, die zum Zwecke des Schutzes vor Gesundheitsschädigungen erlassen worden waren und sich der Wettbewerber im geschäftlichen Verkehr gegenüber seinen Mitbewerbern Absatzvorteile zu verschaffen versuchte.49 In ausdrücklicher Abkehr von der früheren Ansicht des Reichsgerichts schloss sich der BGH dieser neueren reichsgerichtlichen Auffassung an.50 Die bloße Einbeziehung des Schutzes der Allgemeinheit und von wichtigen Gemeinschaftsgütern (z.B. von Gesundheitsvorschriften) war so auch höchstrichterlich entschieden und als sittenwidrigkeitsbegründend akzeptiert.51
b)Verbraucherschutz und Marktgegenseitenschutz
Der unmittelbare lauterkeitsrechtliche Schutz von Verbraucherinteressen war nach der Konzeption des UWG 1909 zunächst nicht anerkannt, da das UWG als Ausformung des deliktsrechtlichen Konkurrentenschutzes und als wettbewerbsrechtliches Gegenstück zu § 826 BGB52 verstanden worden war.53 Daher war ein „allgemeiner Publikumsschutz“54 ausgeschlossen. Obwohl der Verbraucherschutz im Laufe der Entwicklung der Fallgruppe Rechtsbruch nicht vollständig ausgeklammert worden war, wurde er lediglich beiläufig beachtet und nur hilfsargumentativ zur Begründung eines Sittenverstoßes herangezogen.55 Viele Möglichkeiten seit der Fassung des UWG 1909, den Schutz des Verbrauchers als eigenständigen Schutzzweck zu etablieren, wurden weder von dem Gesetzgeber noch von der Rechtsprechung genutzt.56 Spätestens seit dem UWG 2004 und der Implementierung der Schutzzweckklausel in § 1 Abs. 1 S. 1 UWG ist der Verbraucher- und Marktgegenseitenschutz nun aber eindeutig Schutzzweck des UWG.
4.Einordnung der Rechtsberatungsvorschriften bis zum UWG 2004
Bereits in dieser vorrechtlichen Zeit des Rechtsbruchs bereitete die Einordnung der Rechtsberatungsvorschriften des RBerG vor dem Hintergrund einer unklaren Abgrenzung der verschiedenen Kategorien von wertbezogenen und wertneutralen Normen Probleme. Die Schwierigkeiten der Zuordnung der Vorschriften des RBerG zu einer der Wertkategorien der Generalklausel des § 1 UWG 1909 waren symptomatisch für die fehlende Trennschärfe dieser Kategorisierung.
In Beratung in LA-Sachen befasste sich der BGH erstmals mit der wettbewerbsrechtlichen Einordnung von Normen des RBerG.57 Die von der Beklagten angebotenen Entschädigungsprüfungen und Antragstellungen nach dem Lastenausgleichsgesetz erforderten die Beantwortung von teilweise schwierigen Rechtsfragen sowie eine erhebliche rechtliche Prüfungstiefe und bedürften daher einer Erlaubnis nach Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG, über die die Beklagte nicht verfügte. Dieses Verhalten sei gemäß § 1 UWG 1909 unlauter.58 Denn ein Verstoß gegen ein solches Gesetz (das RBerG), „das durch den Erlaubniszwang gerade die Grenzen der Zulässigkeit des Wettbewerbs überhaupt auf einem bestimmten einschlägigen Gebiet festlegt, stellt aber stets ein wettbewerbswidriges Verhalten dar und erfüllt damit die Voraussetzungen des § 1 UWG“59. Der BGH ordnete Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG also als Vorschrift mit wettbewerbsregelnder Funktion ein. Auch Teile der Instanzrechtsprechung schlossen sich dieser Einordnung an.60
Andere beurteilten die Vorschriften des RBerG hingegen als sittlich fundiert. So sah das LG Marburg in Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG „eine sittlich fundierte, mithin wertbezogene Norm, sodass bereits der Verstoß gegen diese Vorschrift ohne weiteres wettbewerbswidrig ist“61.
Überwiegend wurden die Rechtsberatungsvorschriften indes als Vorschriften zum Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsgutes angesehen, da sie im allgemeinen Interesse am Schutz einer zuverlässigen Rechtspflege lägen.62 Die Verstöße gegen Vorschriften des RBerG führten folglich dazu, dass sie ohne das Hinzutreten weiterer Umstände wettbewerbswidrig waren.63
Die inkonsequente Einordnung der Vorschriften des RBerG beruhte auf zwei Faktoren: Erstens setzte sich die Rechtsprechung nur unzureichend mit der Natur des RBerG auseinander. Denn die Einordnung in die eine oder andere Normkategorie beruhte auf recht lapidaren Feststellungen, nicht aber auf einer sauberen und dogmatisch tragfähigen Herausarbeitung der Frage, warum die jeweilige Vorschrift unter die ein oder andere Normkategorie zu fassen sei. Zweitens hat die Rechtsprechung nie klare und abgrenzbare Kriterien aufgezeigt, nach welchen sie die verschiedenen Vorschriften in die jeweilige Normkategorie einordnet. Da die Natur einer Norm vor diesem Hintergrund auch mehrgestaltig sein konnte, verwundern diese Zuordnungsprobleme nicht. Im Ergebnis führte dies freilich zu keinem Unterschied, denn die Vorschriften des RBerG wurden in jedem Fall als wertbezogen aufgefasst.64 Denn das RBerG hatte nicht nur den Zweck, die Rechtsanwaltschaft und die zugelassenen Rechtsberater vor dem Wettbewerb nicht zugelassener Personen zu schützen.65 Der Erlaubniszwang im RBerG wurde auch als im allgemeinen Interesse an einer zuverlässigen Rechtspflege liegend angesehen.66Damit entsprach die Einordnung der Rechtsberatungsvorschriften auch dem Schutzzweck des UWG 1909, der, anders als heute, allein auf den Konkurrentenschutz ausgerichtet war und auch die Interessen der Allgemeinheit als schützenswert ansah. Dementsprechend lag in einem Verstoß gegen eine Vorschrift des RBerG stets ein sittenwidriges Wettbewerbsverhalten durch Rechtsbruch.
5.Einflussgebende Kritik des Schrifttums an der Rechtsprechung zu § 1 UWG 1909
Führender Kritiker der wertorientierten Rechtsprechung war Schricker, der sich schon 1970 umfassend für eine Abkehr der bis dahin vorgenommenen Zweiteilung in wertbezogene und wertneutrale Normen hin zu einem stärkeren Rückbezug auf den Schutzzweck des UWG aussprach.67 Nach ihm sollte der Wettbewerbsbezug einer außerwettbewerbsrechtlichen Norm im Fokus stehen. Normen, die mit dem wettbewerbsgerichteten Schutzzweck des UWG nichts zu tun hätten, müssten unberücksichtigt bleiben, denn der Schutzzweck des UWG sei nicht auf allgemeine Belange und alle Abnehmerinteressen gerichtet.68 Derartige, in einer Norm verkörperten Belange seien nur geschützt, wenn und soweit sie in die Wettbewerbssphäre hineinragen. Die Schutzzwecke der verletzten Norm müssten daher mit den wettbewerbsrechtlichen Schutzzwecken in Beziehung gesetzt werden.69 Ähnlich wie bei dem deliktischen Schadensersatzanspruch müsse also die Frage, ob ein Sittenverstoß vorliegt oder nicht, danach aufgelöst werden, ob und inwieweit der Normzweck der jeweils verletzten Norm mit dem Schutzzweck des UWG übereinstimmt.70 Entscheidend sei, dass die außerwettbewerbsrechtliche Norm nach ihrer persönlichen und gegenständlichen Ausrichtung sowie nach der Verletzungsform mit der des UWG korrespondiert.71 Aufgrund des in dieser Zeit herrschenden Leitbildes des UWG als wettbewerbsrechtlich ausgeformter, deliktischer Konkurrentenschutz war mit der subjektiv-persönlichen Ausrichtung freilich der Schutz bestimmter Wettbewerber (voreinander) gemeint. Dieses dogmatische Konstrukt wird gemeinhin mit Normzwecktheorie oder Schutznormlehre beschrieben. Auch dem RBerG wurde eine insoweit zum UWG kongruente Schutzfunktion zugesprochen.72
6.Akzeptanz der Normzwecktheorie durch den BGH
Der BGH hat sich in Abgasemissionen der Normzwecktheorie angeschlossen und den Schutzzweck des Wettbewerbsrechts und den Wettbewerbsbezug der jeweiligen außerwettbewerbsrechtlichen Norm in den Vordergrund gerückt.73 Er führte aus, dass § 1 UWG 1909 nicht, „als Grundlage für Individualansprüche gegen Rechtsverletzungen jeder Art, die in irgendeiner Form Auswirkungen auf das Wettbewerbsgeschehen haben können“74, missverstanden werden dürfe. Vielmehr sei ein Wettbewerbsbezug notwendig, der dann anzunehmen ist, wenn die verletzte Norm zumindest sekundär die Funktion hat, die Gegebenheiten eines bestimmten Marktes zu regeln und damit auch gleiche Voraussetzungen für die darauf tätigen Wettbewerber zu schaffen.75 Damit prägte der BGH die sekundäre wettbewerbsbezogene Schutzfunktion und schloss sich der Ansicht von Schricker an. Die weitere Rechtsprechung des BGH führte diese Linie fort.76
18
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 07.06.1909, RGBl. 1909 Nr. 3619, S. 499.
19
RG, RGZ 117, 16 (21) –
Bewachungsgewerbe
.
20
RG, RGZ 117, 16 (22) –
Bewachungsgewerbe
.
21
RG, RGZ 166, 315 (319) –
Makler-Fachgruppe
.
22
Freilich ist dies keine einfache Kategorisierung und sind die verwendeten Termini im Schrifttum uneinheitlich. Zugunsten der Übersichtlichkeit erscheint eine „Zweiteilung“ in wertbezogene und wertneutrale Normen vorzugswürdig. Anders aber
Dettmar
, S. 21ff.;
Doepner
, WRP 1980, 473f.
23
Zu allem: GK-UWG/
Pahlow
, 3. Aufl. 2020, UWG, § 3a Rn. 2.
24
Böhler
, S. 68.
25
Böhler
, S. 81f.
26
RG, GRUR 1941, 280 (282) –
Makler-Fachgruppe
.
27
BGH, GRUR 1957, 558 (559) –
Bayern-Expreß
; BGH, GRUR 1965, 373 (375) –
Blockeis II
.
28
Vgl.
Böhler
, S. 68ff.
29
BGH, GRUR 1960, 193 (195) –
Frachtrückvergütung
.
30
MüKoUWG/
Schaffert
, 3. Aufl. 2020, UWG, § 3a Rn. 8; BGH, WRP 1999, 643 (647) –
Hormonpräparate
.
31
BGH, GRUR 1986, 823 (824) –
Fernsehzuschauerforschung
.
32
RG, RGZ 77, 217 (220f.) –
Drogenhandlung.
33
BGH, GRUR 1957, 131 (136) –
Apothekenpflichte Arzneimittel
.
34
BGH, GRUR 1986, 823 (824) –
Fernsehzuschauerforschung.
35
BGH, GRUR 1970, 558 (559f.) –
Sanatorium
; BGH, GRUR 1971, 585 (586) –
Spezialklinik
; BGH, GRUR 2001, 450 (453) –
Franzbranntwein-Gel
.
36
BVerfG, NJW 1990, 1229f.; BGH, GRUR 1991, 548 (549) –
Umweltengel
.
37
BGH, GRUR 1957, 558 (560) –
Bayern-Expreß
; BGH, GRUR 1987, 172 (176) –
Unternehmensberatungsgesellschaft I
; BGH, GRUR 1989, 437 (439) –
Erbensucher
.
38
Beispielhaft BGH, WRP 1990, 282 (285) mit Hinweis auf BVerfG, NJW 1981, 33 (34f.) für die Rechts- und Steuerrechtspflege.
39
Hömig/Wolff/
Wolff
, GG, 13. Aufl. 2022, Art. 12 Rn. 18.
40
Dettmar
, S. 30ff. und
Elskamp
, S. 35f. hingegen erachteten diese Gruppe als eigenständig. Nimmt man als Ausgangspunkt für die Bewertung als wertbezogene Normen die Rechtsfolge, nämlich das automatische Sittenwidrigkeitsurteil, überzeugt die Einordnung als Untergruppe wertbezogener Normen.
41
LG Köln, NJW 1953, 258f.; BGH, NJW 1956, 749 (750) –
LA-Sachen
.
42
RGZ, 166, 315 (319) –
Makler-Fachgruppe
; BGH, GRUR 1957, 558 (559) –
Bayern-Expreß
; BGH, GRUR 1960, 193 (195) –
Frachtrückvergütung
; BGH, GRUR 1973, 146 (147) –
Flughafen-Zubringerdienst
; BGH, GRUR 1986, 621f. –
Taxen-Farbanstrich
.
43
RGZ 166, 315 (319) –
Makler-Fachgruppe
.
44
Dettmar
, S. 34.
45
MAH GewRS/
Dittert
, 5. Aufl. 2017, § 14 Rn. 12.
46
BGH, GRUR 1957, 558 (559) –
Bayern-Expreß
; BGH, GRUR 1965, 373 (375) –
Blockeis II
; BGH, GRUR 1974, 281 (282) –
Clipper
; BGH, GRUR 1979, 553 (554) –
Luxusferienhäuser
; BGH, GRUR 1994, 222 (224) –
Flaschenpfand
.
47
RG, RGZ 77, 213 (220) –
Drogenhandlung
.
48
Näher:
Plager
, S. 211f. mit Verweis auf RG, MuW 1931, 83 –
Salicylzusatz
.
49
RG, MuW 1932, 83 (84) –
Salicylzusatz
.
50
BGH, GRUR 1957, 131 –
Arzneifertigwaren
.
51
BGH, GRUR 1957, 131 (136) –
Arzneifertigwaren
und kurz darauf auch in BGH, GRUR 1957, 355 –
Spalttabletten
. Vgl. auch
v. Walter
, S. 17. Näher zu den Gemeinschaftsgütern:
Böhler
, S. 73ff.
52
Bürgerliches Gesetzbuch vom 02.01.2002, BGBl. 2002 I, 42.
53
Fezer/Büscher/Obergfell/
Fezer
, 3. Aufl. 2016, UWG, § 1 Rn. 61.
54
Baumbach
, WettbewerbsR, 1. Aufl. 1929, S. 128.
55
Siehe hierzu vertiefend
Hagenmaier
, S. 50f.; 53ff.
56
Vgl.
Hagenmaier
, S. 52ff.
57
BGH, NJW 1956, 749 –
Beratung in LA-Sachen
.
58
BGH, NJW 1956, 749 (750) –
Beratung in LA-Sachen
.
59
BGH, NJW 1956, 749 (750) –
Beratung in LA-Sachen
.
60
LG Köln, GRUR 1953, 259 (259); ähnlich LG Hamburg, NJW 1953, 1590 (1591), nach dem eine Handlung, die gegen das RBerG verstößt, „
schon wegen der besonderen Stellung dieses Gesetzes im Wettbewerbsrecht den Stempel der Unsittlichkeit notwendig auf der Stirn trägt
“.
61
LG Marburg, NJW 2001, 2028 (2030).
62
BGH, NJW 1967, 1558 (1560); BGH, GRUR 1974, 396 (398) –
Unfallhelfer-Ring II
; BGH, GRUR 1987, 710 (711) –
Schutzrechtsüberwachung
; BGH, NJW 2004, 847 (848) –
Rechtsberatung durch Automobilclub
.
63
BGH, NJW 2004, 847 (848) –
Rechtsberatung durch Automobilclub
.
64
Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl. 2001, Art. 1 § 1 Rn. 205.
65
Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl. 2001, Art. 1 § 1 Rn. 11, 205.
66
BGH, NJW 1967, 1558 (1560); BGH, GRUR 1974, 396 (398) –
Unfallhelfer-Ring II
.
67
Schricker
, S. 239ff., 275.
68
Vgl.
Schricker
, S. 245.
69
Vgl.
Schricker
, S. 247.
70
Vgl.
Schricker
, S. 253ff.
71
Vgl.
Schricker
, S. 252ff., 255-257.
72
Vgl.
Schricker
, S. 276.
73
BGH, GRUR 2000, 1076 (1078) –
Abgasemissionen
.
74
BGH, GRUR 2000, 1076 (1079) –
Abgasemissionen
.
75
BGH, GRUR 2000, 1076 (1079) –
Abgasemissionen.
76
BGH, GRUR 2001, 354 (356) –
Verbandsklage gegen Vielfachabmahner
; BGH, GRUR 2002, 825 (826) –
Elektroarbeiten
; BGH, GRUR 2003, 164ff. –
Altautoverwertung
.
B. Kodifikation der Fallgruppe Rechtsbruch durch die UWG Novelle 2004
Im Anschluss an diese Entwicklung griff auch der Gesetzgeber die Normzwecktheorie mit der UWG Novelle von 2004 auf.77 Er implementierte in das UWG ein Regelungskonstrukt, das sich aus einer generalklauselartigen Verbotsnorm und einem Katalog aus Regelbeispielen in Form von Beispielen des unlauteren Wettbewerbs zusammensetzte.78
Der § 3 UWG 2004 normierte, dass unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil eines Marktteilnehmers zu beeinträchtigen, unzulässig waren. In § 4 Nr. 11 UWG 2004 legte der Gesetzgeber sodann die in Gesetzesform gegossene Fallgruppe Rechtsbruch fest, nach deren Voraussetzungen unlauter handelt, „wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln“. Der dem neuen § 4 Nr. 11 UWG 2004 zugrundeliegende Schutzzweck war aus der gesetzessystematischen Zweckvoranstellung des § 1 UWG 2004 abzuleiten. Der Zweck des UWG liege darin, das Marktverhalten der Unternehmen im Interesse der Wettbewerber, der Verbraucher und sowie der sonstigen Marktteilnehmer sowie das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb zu regeln.79 Aus der auf die übrigen Normen des UWG ausstrahlenden Zweckbestimmung des § 1 UWG 2004 musste demnach auch der Zweck des Rechtsbruchtatbestandes gelesen werden. Dementsprechend waren für die Transformation einer Norm in das UWG durch den Rechtsbruchtatbestand der Schutzzweck des UWG und der Normzweck der gesetzlichen Vorschrift zueinander in Beziehung zu setzen.80 Die Frage, ob eine Unlauterkeit i.S.d. §§ 3, 4 Nr. 11 UWG 2004 vorlag, war also daran zu messen, ob die Schutzzwecke des UWG und die der verletzten Norm zumindest teilweise übereinstimmten. Im Gesetzestext wurde vor diesem Hintergrund die sekundäre wettbewerbsbezogene Schutzfunktion in der zumindest sekundären Bestimmung („auch“) einer Vorschrift zur Regelung von Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer übersetzt.81 Fortan sollte nicht jeder Verstoß gegen eine Norm sogleich zur Unlauterkeit führen. Entscheidend war, dass der Rechtsbruchtatbestand nur solche Normen in das UWG inkorporiert, die ein Mindestmaß an Wettbewerbsbezug aufweisen.82
Dass Normen allein reine Allgemeininteressen, also nach der bisherigen Konzeption der Wertbezogenheit von Normen wichtige Gemeinschaftsgüter schützten, genügte nicht mehr.83 Diese Kodifikation wurde vom Schrifttum mitunter als vorschnell kritisiert, da der Gesetzgeber dadurch in einen möglicherweise noch andauernden Rechtsprechungswandel eingreife, dessen weiterer Verlauf ungewiss sei.84 Dennoch ist diese Entscheidung schließlich akzeptiert worden.
Entgegen der vereinzelten Ansicht, der Vorsprunggedanke gelte als wichtigstes Kriterium des Konkurrentenschutzes in dem Rechtsbruchtatbestand als ungeschriebenes Merkmal weiter, hat der Vorsprunggedanke heute tatsächlich und rechtlich keinerlei Bedeutung mehr.85 Der Konkurrentenschutz ist de lege lata nicht mehr alleiniger Zweck des UWG und damit auch nicht des Rechtsbruchtatbestandes. Der Gesetzgeber hat sich für eine gleichberechtigte Schutzzwecktrias hinsichtlich der Mitbewerber, Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer entschieden.86 Er hat zudem die Entscheidung getroffen, die bis zu diesem Zeitpunkt ergangene Rechtsprechung zur Fallgruppe Rechtsbruch, die den Vorsprunggedanken zuletzt nicht mehr weiterverfolgt hatte, in Tatbestandsform zu gießen. Ein Festhalten am bloßen Konkurrentenschutz und die Aufnahme des Vorsprunggedankens würde eine unzulässige Umgehung der gesetzgeberisch eindeutig definierten Voraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes bedeuten, einen zweiten gesetzlichen Tatbestand schaffen und wäre deshalb eindeutig verfehlt.87
77
BT-Drs. 14/1587, S. 19; s.a.
Frey-Gruber
, S. 57.
78
Niebel
/
Jauch
, BB 2016, 259;
Elskamp
, S. 57.
79
BT-Drs. 15/1487, S. 15f. Der Gesetzgeber erwähnt zwar nicht explizit sonstige Marktteilnehmer, aus dem Wort „insbesondere“ in der Gesetzesbegründung zu § 1 UWG 2004 lässt sich dies aber schlussfolgern.
80
BT-Drs. 15/1487, S. 19. Die Gesetzesbegründung geht auf den Privatentwurf von
Köhler
,
Bornkamm
und
Henning-Bodewig
zurück, vgl.
Köhler
/
Bornkamm
/
Henning-Bodewig
, WRP 2002, 1317 (1326); zuvor schon
Köhler
, NJW 2002, 2761 (2763).
81
Vgl. BT-Drs. 15/1487, S. 19.
82
Götting/Nordemann/
Ebert-Weidenfeller
, UWG, 3. Aufl. 2016, § 3a Rn. 45.
83
BT-Drs. 15/1487, S. 16.
84
Köhler
, NJW 2002, 2761;
Dettmar
, S. 59;
Doepner
, WRP 2003, 1292 (1294, 1301).
85
So aber Fezer/Büscher/Obergfell/
Götting
/
Hetmank
, 3. Aufl. 2016, UWG, § 3a Rn. 46g;
Glöckner
, GRUR 2008, 960 (967);
Hetmank
, GRUR 2014, 437 (441);
Festl-Wietek
, S. 25f.;
Sack
, WRP 2005, 531 (540).
86
Vgl. auch BT-Drs. 15/1487, S. 13.
87
Frey-Gruber
, S. 60. Denn nach der vertretenen Gegenauffassung würde § 3 UWG einen Auffangtatbestand darstellen für solche Vorschriften, die zwar kein Marktverhalten regeln, durch deren Verletzung sich der Wettbewerber aber dennoch einen Wettbewerbsvorsprung verschafft; s.a.
Sack
, WRP 2005, 531 (540 a.E.).
C. Anpassungen an die UGP-RL durch die UWG Novelle 2008
Im Zuge der Angleichung der verschiedenen mitgliedstaatlichen Regelungen über unlautere Geschäftspraktiken durch die UGP-RL hat das UWG im Jahr 2008 eine Überarbeitung erfahren. Der Richtlinienauftrag war dabei eine vollständige Rechtsangleichung der Vorschriften, sodass die Mitgliedstaaten weder überschießende Regelungen treffen noch hinter den Vorgaben der Richtlinie zurückbleiben durften.88
Der Rechtsbruchtatbestand ist dabei allerdings nicht angetastet worden. Indes war sowohl für seinen Anwendungsbereich als auch für den Anwendungsbereich des UWG insgesamt die Angleichung der Tathandlung des UWG relevant, nämlich die Angleichung der Wettbewerbshandlung an die unionsrechtliche Geschäftspraktik. Die Wettbewerbshandlung wurde infolgedessen durch die geschäftliche Handlung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2008 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG nF) ersetzt. Anders als das UWG sah und sieht die Richtlinie indes keine Regelung zum Rechtsbruch vor. Durch das deshalb weiterreichende UWG ist der Rechtsbruchtatbestand aber nicht plötzlich richtlinienwidrig geworden, auch wenn man das zunächst aufgrund des Vollharmonisierungsansatzes der Richtlinie, nach dem die Richtlinie keine strengeren Maßnahmen erlaubt, auch wenn damit ein höheres Verbraucherschutzniveau erreicht werden soll, hätte annehmen können.89 Indes führt das nicht zu Problemen. Sind Marktverhaltensregelungen unionsrechtlich determiniert, muss die UGP-RL als alleiniger Auslegungsmaßstab gelten. Allerdings sind in Art. 3 UGP-RL Bereichsausnahmen zugelassen worden, zu denen etwa in Absatz 8 Regelungen zu reglementierten Berufen zählen. Für diese Regelungsmaterien ist der Rechtsbruchtatbestand uneingeschränkt anwendbar.90
88
BR-Drs. 345/08, S. 13.
89
EuGH, GRUR 2009, 599 (603) –
VTB/ Total Belgium u. Galatea/Sanoma
.
90
Götting/Nordemann/
Ebert-Weidenfeller
, 3. Aufl. 2016, UWG, § 3a Rn. 10.
D. Aktueller Stand: Neuformung des Rechtsbruchtatbestandes durch § 3a UWG im Zuge der Novelle 2015
Im Jahr 2015 wurde durch eine erneute UWG-Reform der Tatbestand des § 4 Nr. 11 UWG aF aus dem Regelbeispielsystem des §§ 3, 4 UWG aF herausgelöst, in eine eigene Norm überführt und durch die ursprünglich in dem § 3 UWG aF enthaltene Spürbarkeitsklausel ergänzt.91 Der § 3a UWG lautet in seiner aktuell gültigen Fassung: „Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.“ Er vereint die zuvor in §§ 3 und 4 Nr. 11 UWG aF normierten Voraussetzungen. In den ersten Halbsatz wurden wortlautidentisch die Tatbestandsvoraussetzungen aus dem § 4 Nr. 11 UWG aF überführt. In den zweiten Halbsatz wurde das ursprünglich in § 3 UWG aF enthaltene Spürbarkeitserfordernis aufgenommen. Die Änderungen waren überwiegend systematischer Natur, da die inhaltliche Anwendung der Vorschriften des UWG unter Einbeziehung der UGP-RL als richtlinienkonform angesehen worden war.92 Ziel war es u.a., die praktische Anwendung des Rechtsbruchtatbestandes zu erleichtern und dessen Eigenständigkeit zu verdeutlichen.93 Materielle Änderungen waren hingegen nicht beabsichtigt.94
91
Dazu: GK-UWG/
Pahlow
, 3. Aufl. 2020, § 3a Rn. 6.
92
BT-Drs. 18/4535, S. 1. u. 2, S. 8; BR-Drs. 26/15, S. 8.
93
BGH, GRUR 2016, 954 (955) –
Energieeffizienzklasse
.
94
BGH, GRUR 2016, 954 (955) –
Energieeffizienzklasse
; BGH, GRUR 2016, 516 (517) –
Wir helfen im Trauerfall; Niebel
/
Jauch
, BB 2016, 259 (260).
E. Zwischenergebnis
Der Rechtsbruchtatbestand wurde in seinem materiellen Kern seit 2004 nicht verändert. Vorschriften, die in das UWG transformiert werden können, müssen nach der aktuellen Gesetzesfassung auch dazu bestimmt sein, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Dieser Formel liegt die Normzwecktheorie Schrickers zu Grunde, die zunächst durch die Rechtsprechung und später durch die Konzeption des Rechtsbruchtatbestandes von dem Gesetzgeber aufgenommen worden ist. Entscheidend ist also, dass die untersuchten Normen einen Normzweck bzw. eine Funktion haben, die zumindest teilweise mit denen des UWG übereinstimmen. So wird in subjektiver Hinsicht auf das Interesse der Marktteilnehmer abgestellt, zu welchen heute neben den Mitbewerbern anerkanntermaßen auch die Verbraucher bzw. die Marktgegenseite und die sonstigen Marktteilnehmer zählen. Die frühere Kategorisierung von Vorschriften in wertbezogene und wertneutrale Vorschriften ist vollständig aufgegeben worden. Sie war ohnehin nicht geeignet, eine greifbare und rechtssichere Einordnung von Vorschriften unter die Fallgruppe Rechtsbruch zu ermöglichen, vor allem, weil die Abgrenzung der einzelnen Wertekategorien unklar war, wie sich an der uneinheitlichen Behandlung der Vorschriften des RBerG gezeigt hat. Deshalb sind auch reine Allgemeininteressen in Vorschriften, die früher als wertbezogene Normen durch die Fallgruppe Rechtsbruch erfasst worden waren, heute für sich genommen kein eigenständiges und unmittelbares Schutzgut des UWG mehr und auch der Konkurrentenschutz ist nicht mehr alleiniger Schutzzweck des UWG und dementsprechend des Rechtsbruchtatbestandes. Ferner kann der anfänglich ausschlaggebende Vorsprunggedanke nicht mehr zur Begründung eines Rechtsbruchs aktiviert werden. Stattdessen findet sich heute neben dem persönlich-subjektiven Schutzzweck (Schutz der Marktteilnehmerinteressen nach dem § 1 Abs. 1 S. 1 UWG) ein sachlicher Schutzzweck, der in der Regelung von Marktverhalten liegt und in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG sowie in den Gesetzgebungsmaterialien zum UWG 2008 verankert ist. Im Kern entspricht dies dem Schutz vor unlauteren geschäftlichen Handlungen.95 Dadurch wird sichergestellt, dass nur solche Rechtsmaterien in das UWG Einzug finden, die auch (außerhalb des UWG gelegenes) Wettbewerbsrecht darstellen. Der Rechtsbruchtatbestand hat sich somit von einer an sich nicht wirklich zum Wettbewerbsrecht passenden Fallgruppe in einen Tatbestand gewandelt, der sich harmonisch in das System des UWG einfügt und an dessen Schutzzwecke anbindet. Seit 2015 enthält er die aus § 3 UWG aF stammende Spürbarkeitsklausel, was die Eigenständigkeit des Rechtsbruchtatbestandes hervorhebt.
95
BT-Drs. 16/10145, S. 11.
3. Kapitel: Aufbau und Voraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes
Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass der Rechtsbruch über einen sehr langen Zeitraum eine enorme Entwicklung vollzogen hat. Zum Ende dieser Entwicklung hat der Gesetzgeber versucht, die Aussagen der Rechtsprechung zur Auslegung der Fallgruppe Rechtsbruch in greifbare Tatbestandsmerkmale zu gießen und die Eigenständigkeit des Rechtsbruchs hervorzuheben. Es wurde dargestellt, dass der § 3a UWG Wechselwirkungen zu den Funktionen und Schutzzwecken des UWG aufweist, die im Zuge dieser Entwicklung hervorgetreten sind und nur in Zusammenhang mit dem persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des UWG, wie er aus § 1 Abs. 1 S. 1 UWG, § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG folgt, gelesen und ausgelegt werden muss. Dass insoweit eine funktionale Beziehung zwischen dem Rechtsbruchtatbestand und dem Anwendungsbereich des UWG besteht, kann als gesichert angesehen werden. Von herausragender Bedeutung ist nun die Frage, wie genau diese funktionale Beziehung ausgestaltet ist und wie sich dies auf die Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 3a UWG auswirkt, mit denen die Einbeziehung von außerwettbewerbsrechtlichen Primärnormen in das UWG steht und fällt. Vorgeschaltet ist es aber erforderlich, sich den Aufbau und die Voraussetzungen des gesamten Rechtsbruchtatbestandes zu vergegenwärtigen, um sich später mit der detaillierten Auslegung der einzelnen Merkmale auseinandersetzen zu können.
A. Natur und Aufbau des Rechtsbruchtatbestandes
Der Rechtsbruchtatbestand stellt eine sog. „Transformationsnorm“96 dar, die es außerhalb des UWG liegenden Vorschriften ermöglicht, die Grenze des spezifisch Lauterkeitsrechtlichen zu überwinden und Einzug in das UWG zu finden. Er stellt damit eine Konkretisierung der Transmissionsfunktion des Unlauterkeitsbegriffs in Normengestalt dar, d.h. er ist Einfallstor für die Berücksichtigung von Normen außerhalb des UWG im Lauterkeitsrecht. Für diese Funktion bietet der Tatbestand des § 3a UWG einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt.97 Die Einbeziehung solcher Normen in das UWG steht gem. § 3a 1. HS UWG für gesetzliche Vorschriften offen, die auch dazu bestimmt sind, das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln. Normen, die diese Voraussetzungen erfüllen, werden als Primärnormen bezeichnet.98 Dieser Teil des § 3a UWG kann als normenspezifische Tatbestandskomponente beschrieben werden. Davon zu trennen ist die Bagatellkomponente gem. § 3a 2. HS. UWG, nach welcher der Primärnormverstoß im konkreten Fall dazu geeignet sein muss, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Hierbei wird nicht auf die abstrakte Normenqualität abgestellt, sondern auf die spezifische geschäftliche Handlung, durch die der Primärnormverstoß erfolgt ist.99 Die Frage, welche Normen Einzug ins UWG über den Rechtsbruchtatbestand finden können, ist gleichwohl allein anhand der normenspezifischen Tatbestandskomponente zu beurteilen. Diese kann wiederum untergliedert werden in eine gesetzliche Vorschrift, die auch dazu bestimmt ist, das Marktverhalten zu regeln (also Regelung und Marktverhaltensvorschrift; zusammen: Marktverhaltensregelung oder Marktverhaltensklausel) und dies gerade auch im Interesse der Marktteilnehmer (Interessenklausel).
Aufgrund seiner Öffnung für eine Vielzahl von außerhalb des UWG gelegenen Normen stellt der Rechtsbruchtatbestand gewissermaßen die kleine Generalklausel des Lauterkeitsrechts dar. Kern der Analyse von Normen ist also die Frage, ob die jeweils untersuchte Norm die Voraussetzungen der normenspezifischen Tatbestandskomponente erfüllt. Sie lautet: Sind die jeweiligen Vorschriften, insbesondere die für diese Arbeit maßgeblichen Rechtsdienstleistungsvorschriften, gesetzliche Vorschriften, deren zumindest sekundäre Bestimmung es ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln?
96
Götting/Nordemann/
Ebert-Weidenfeller
, 3. Aufl. 2016, UWG, § 3a Rn. 45.
97
Gloy/Loschelder/Danckwerts/
Lubberger
, 5. Aufl. 2019, HdB WbR, § 44 Rn. 13.
98
Ohly/Sosnitza/
Ohly
, 7. Aufl. 2016, UWG, § 3a Rn. 2;
Stolterfoht
, FS-Rittner 1991, 695 (696).
99
Vgl.
Lettl
, WRP 2019, 1265 (1271).
B. Voraussetzungen des Rechtsbruchtatbestandes
Bevor auf die Auslegung der Merkmale der normenspezifischen Tatbestandskomponente eingegangen wird, soll im Folgenden die Auslegung der geschäftlichen Handlung untersucht, in Beziehung zur unionsrechtlichen Geschäftspraktik gesetzt und schließlich das durch sie erfasste Handlungsspektrum herausgearbeitet werden. Im Anschluss sollen die die Tatbestandsmerkmale und die dogmatischen Grundlagen des Rechtsbruchtatbestandes überblicksartig dargestellt werden. Dies ist relevant, um die spätere Analyse von Primärnormen in den korrekten systematischen Kontext innerhalb der Struktur des Rechtsbruchtatbestandes einzuordnen. Erst später werden dann die Anforderungen dargestellt, denen die Auslegung des Rechtsbruchtatbestandes in der Praxis genügen sollte und deren Beachtung im Rahmen der Auslegung der einzelnen Merkmale der Primärnormenanalyse für eine praxisgerechte Handhabung wesentlich sind. Schließlich erfolgt die Auslegung dieser Merkmale für die Analyse außerwettbewerbsrechtlicher Vorschriften.
I. Konstitutive Voraussetzung: Vorliegen einer geschäftlichen Handlung
Das Vorliegen einer geschäftlichen Handlung, deren Definition sich in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG findet, ist konstitutiv für den Anwendungsbereich des UWG und folglich des Rechtsbruchtatbestandes und ist dementsprechend der Prüfung vorgelagert. Zu Recht wird die geschäftliche Handlung aus diesem Grund als der Schlüsselbegriff des Lauterkeitsrechts angesehen.100 Ihre Auslegung ist von essenzieller Bedeutung für die Befassung mit dem Rechtsbruchtatbestand. Hierfür hat es keine Bedeutung, dass der Gesetzgeber diesen „zentralen Begriff“101





























