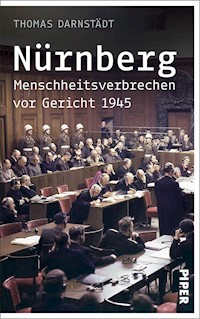10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Frau wird halbtot gewürgt in ihrer Wohnung gefunden.Die Indizien weisen auf den Ehemann Harry Wörz. Er wird noch in der selben Nacht verhaftet. Dass der seine Unschuld beteuert, hilft ihm nichts: Über 13 Jahre ist er gefangen im Netz der Justiz, viereinhalb Jahre sitzt er in Haft für eine Tat, die er nie begangen hat. Oder die 14jährige Jennifer, die behauptet, von ihrem Vater und dessen Freund missbraucht worden zu sein. Bald sitzen die Männer in Haft. Es dauert Jahre bis herauskommt, dass das Mädchen die Geschichte erfunden hat. Dies sind nur zwei von zahllosen Justizirrtümern, die sich Jahr für Jahr vor deutschen Strafgerichten ereignen. Schuld sind einseitige Ermittlungen, überschätzte Gutachter und selbstgewisse Richter. Doch selten bekennt sich die Justiz zu ihren Fehlern. Jeder kann ihr Opfer werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Helene,meine liebste Leserin
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96184-4
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: Rama/plainpicture
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
ERSTES KAPITEL
Kein Vorwort
»Ich war’s nicht!«
Nichts spricht dafür, dass Manfred Genditzki ein Mörder ist. In der Wohnanlage in Rottach-Egern am Tegernsee, wo er als Hausmeister arbeitete, galt der stille schmächtige Mann als »Kümmerer«. Das ist einer, dem es Spaß macht, unentbehrlich zu sein und mit seinem Talent für Praktisches jedermann im Haus zur Hand zu gehen. Zu der alten Frau K. im ersten Stock war er sogar richtig fürsorglich.
Die ehemalige Geschäftsfrau Lieselotte K., 87, war gehbehindert, schwer krank und einsam. Hausmeister Genditzki kümmerte sich um die alte Dame wie ein Sohn. Er fuhr sie zum Friseur und zum Arzt. Er wusch ihre Wäsche. Er kaufte für sie ein. Er frühstückte mit ihr und hörte es sich geduldig an, wenn die verbitterte Alte über ihre Verwandtschaft schimpfte. Und nachmittags kam er noch mal zum Kaffeetrinken, brachte sogar seine Frau und seine Kinder mit.
100 Euro extra gab Frau K. dem Hausmeister im Monat dafür, dass er Tag und Nacht für sie in Rufbereitschaft war, dazu ein Trinkgeld, wenn er wieder einmal die Tüten für sie geschleppt hatte. Der geduldige Manfred hatte Zugang zu ihren Konten und ihrem Bankschließfach – er musste ihr ja das Bargeld von der Bank holen. Aber regelmäßig ließ sie ihn antreten zum Abrechnen. Jeden Cent. Frau K. vertraute niemandem. Ihr Menschenhass und ihre diktatorische Art hatten sie immer einsamer werden lassen. Der Hausmeister, ihr »Manfred«, war der Letzte, den sie hatte. Er war es, der ihr Zwieback und Tee ans Bett brachte, wenn es ihr mit ihrem chronischen Durchfall schlecht ging. Genditzki, Jahrgang 1960, war der Letzte, den die Geduld mit der alten, streitsüchtigen Dame nie verlassen hatte.
Am 28. Oktober 2008 gegen 18 Uhr 30 finden Mitarbeiter des Pflegedienstes Frau K. ertrunken in ihrer Badewanne. Das Wasser läuft noch aus dem Hahn. Die Tote ist bekleidet. Der Unterschenkel ihres linken Beins hängt aus der Wanne.
Monatelang versuchen Ermittler vergeblich herauszubekommen, was an diesem 28. Oktober in der Wohnung mit Frau K. passiert ist. Es bleibt rätselhaft. Es gibt keine klaren Beweise für eine Gewalttat, aber auch keine Anhaltspunkte für einen Unfall. Gerichtsmediziner finden Hämatome unter der Kopfhaut, die könnten von einem Schlag herrühren – oder von einem Sturz. Es gibt keinen Hinweis, warum jemand die alte Dame geschlagen oder gar getötet haben sollte, nichts fehlt in der Wohnung. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand Fremdes bei Frau K. gewesen ist. Außer ihrem Manfred natürlich, wie immer. Der hatte nachmittags mit ihr Kaffee getrunken. Als er ging, hatte er den Reserve-Wohnungsschlüssel in der Tür von außen stecken lassen, damit, so sagt er, der Pflegedienst hineinkonnte, auch wenn Frau K. eingeschlafen sein sollte.
Nach monatelanger, vergeblicher Spurensuche lässt die Staatsanwaltschaft Manfred Genditzki wegen Verdachts des Mordes an Lieselotte K. verhaften. Alles, was die Ermittler gegen ihn in der Hand haben: dass niemand bekannt ist, der nach ihm die Tote lebend gesehen haben könnte. Und dass es keine andere Erklärung für ihren Tod gibt als einen Mord durch seine Hand.
»Ich war’s nicht«, sagt Genditzki. Doch sie stellen ihn vor Gericht, und das Landgericht München II verurteilt ihn wegen Mordes zu lebenslanger Haft.
»Ich war’s nicht«, insistiert Genditzki, und bald wird sein Fall immer prominenter. Die Gerichtsreporter großer Zeitungen und Magazine machen den stillen Hausmeister im ganzen Land bekannt. Ein klarer Fall von Fehlurteil? Kann es sein, dass ein Mensch als Mörder verurteilt wird, für dessen Tat es keinen einzigen Beweis gibt, ja nicht einmal einen Beweis dafür, dass überhaupt eine Straftat geschehen ist? Kann man jemanden als Täter verurteilen, einfach weil man keinen anderen hat?
Der Fall Genditzki ist offen. Wenn dieses Buch seine Leser erreicht, kämpft der Mann aus seiner Gefängniszelle heraus noch immer – mit schwindender Erfolgsaussicht – gegen den Schuldspruch. Und natürlich kann niemand außer ihm selbst sagen, ob der Hausmeister nicht vielleicht doch ein Mörder ist. Aber nicht nur für viele Zeitungsleser, sondern ebenso für eine steigende Zahl von Juristen ist der Fall zum Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der deutschen Strafjustiz geworden. Die Verunsicherung ist groß. Haben sich Polizisten, Ermittler, Staatsanwälte, Richter vergaloppiert?
Was sind die Standards der Wahrheitsfindung vor Gericht? Verfügt die Justiz über hinreichende Kontrollmechanismen, um grobe Fehler zu erkennen und zu reparieren? Wie können wir sicher sein, dass nicht Unschuldige zwischen die Mahlsteine der Justizmühlen geraten und darin zerrieben werden? Was passiert, wenn es morgen den Nachbarn trifft, dem wir immer vertraut haben wie die Leute am Tegernsee dem Manfred Genditzki?
Was passiert – wenn es uns selbst trifft?
Dass einer schreit: »Ich war’s nicht!« – und keiner glaubt ihm, das kommt häufig vor. Gut 3000 Strafurteile werden jeden Werktag vor deutschen Gerichten verkündet, und viele Täter beteuern auch danach noch ihre Unschuld. Doch wie häufig kommt es vor, dass einer schreit »Ich war’s nicht!« – und er hat recht?
Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, versichern Strafrichter, Staatsanwälte, sogar die meisten Strafverteidiger. Die Justiz irre sich nie, jedenfalls fast nie. Und wenn doch, dann merke es die nächste Instanz. Die Zahl der bekannt gewordenen Justizirrtümer wird in keiner amtlichen Statistik ausgewiesen. Wie verschwindend gering sie sei, wird häufig damit belegt, dass es nur wenige Wiederaufnahmeverfahren gibt. So verzeichnet die Statistik für das Jahr 2010 nur 1176 Fälle, in denen Strafgerichte sich nach der rechtskräftigen Verurteilung eines Täters mit neu aufgetauchten Zweifeln an der Wahrheit des Schuldspruchs auseinandersetzen mussten. 1176 von mehr als 800 000 im Jahr: Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Ist sie zu vernachlässigen?
Die Arbeit eines Richters ist ähnlich verantwortungsvoll und gefährlich wie die eines Arztes. Nun stelle man sich ein Krankenhaus vor, in dem von 1000 Patienten im Jahr nur einem einzigen der falsche Lungenflügel amputiert oder das falsche Organ transplantiert wird. Wer würde sich freiwillig in so ein Krankenhaus begeben? Doch die Zahl der Menschen, deren Leben irrtümlich oder leichtfertig durch die Justiz ruiniert wurde, ist sehr viel größer.
Wie groß sie ist, hat erst kürzlich ein Richter enthüllt. Ralf Eschelbach, als Richter am Bundesgerichtshof einer der mächtigsten und erfahrensten Juristen Deutschlands, fällt über die Justiz ein vernichtendes Urteil. Es sei die »Lebenslüge« der Justiz, schreibt der Mann, der seit 1988 als Richter arbeitet, dass es »kaum falsche Strafurteile gebe«. Nach Eschelbachs Schätzung ist jedes vierte Strafurteil ein Fehlurteil.
Seinen Alarmruf verbreitete der hohe Richter 2011 in einem Kommentar zur Strafprozessordnung: Das Justizsystem »deckt Entscheidungen, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit falsch sind«. Kontrollen und Rechtsmittel würden in einem Maße versagen, das »in einem Rechtsstaat inakzeptabel« sei. In Wiederaufnahmeverfahren würden alle Zweifel »systematisch abgeblockt«, die Kollegen erzeugten zu Unrecht den Eindruck der Unfehlbarkeit: »Die tatrichterliche Überzeugung von der Richtigkeit eigener Urteile ist eine gefährliche Selbsttäuschung.«
Doch niemand, empört sich Eschelbach, gebe diesen Justizskandal zu: »Die Furcht des Gesetzgebers und der Rechtsprechung vor den Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten, verhindert die Verbesserung der Lage.«
Es spricht für die Justiz, dass sie einen Kritiker dieses Kalibers in eines der höchsten Richterämter befördert. Es spricht gegen sie, dass sie seinen Alarmruf sorgfältig überhört. So offene Kritik an prominenter Stelle ist unter Juristen ungewöhnlich. Doch niemand in der Branche hat den Vorstoß offen zur Kenntnis genommen. Eschelbachs Texte werden wie Kassiber zu den Akten genommen – dann mahlt das große Mühlwerk der Justizmaschine ungerührt weiter, als wäre nichts passiert. Jedes vierte Urteil ein Irrtum – ach, der Eschelbach!
Wenn der Mann recht hat, werden jeden Werktag in Deutschland 650 Menschen zu Unrecht wegen einer Straftat verurteilt. Wenn er recht hat, müssen 10 000 Menschen pro Jahr unschuldig hinter deutsche Gitter. Aber hat er recht?
Es kann jeden treffen
Tatsächlich ist die Öffentlichkeit gerade in den letzten Jahren verunsichert durch eine ganze Reihe spektakulärer Justizirrtümer in Deutschland. Dieses Buch berichtet nicht nur über die Opfer und ihre Richter – es analysiert auch, wie es zu den groben Fehlleistungen gekommen ist, die oft genug harmlose Menschen für den Rest ihres Lebens ruiniert haben. Viele der Opfer erzählen die gleiche Geschichte: Wie sie völlig überraschend und völlig wehrlos mit ungeheuerlichen Vorwürfen konfrontiert den einzigen tröstenden Gedanken hatten: »Das ist ein Irrtum, das klärt sich alles auf.«
Nichts klärt sich von selbst auf. Es waren meist Zufälle, die in den hier berichteten Fällen oft erst nach Jahren Irrtum und Wahrheit ans Licht brachten. Doch selbst dann mussten viele erleben, wie die Justiz all ihre Macht einsetzte, um die eigenen Fehler zu vertuschen und den Opfern ihre Rehabilitation vorzuenthalten. In einigen Fällen drängt sich der Verdacht auf, der Irrtum sei gar kein Irrtum gewesen, sondern Ergebnis einer vorsätzlichen Intrige. »Es wird die Gefahr übersehen, wie einfach und gebräuchlich es ist, unerwünschte Personen im Wege des Strafverfahrens aus dem Verkehr zu ziehen«, warnt BGH-Richter Eschelbach.
Viel spricht dafür, so zeigt die Analyse, dass Eschelbachs Befürchtungen stimmen. Muss man Angst haben vor der Justiz? Es ist das bange Gefühl, das jeden Leser des meisterhaften Albtraumschilderers Franz Kafka überkommt, wenn er den ersten Satz seines weltberühmten Romans Der Prozess gelesen hat: »Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.«
Josef K. wird im Roman nie wieder glücklich nach diesem ersten Satz. Und mit Kafka verbindet sich die Urangst, die viele Menschen verfolgt: dass es ihnen genau so gehen könnte, dass sie Opfer eines Irrtums, einer Intrige gar werden könnten, und niemand, niemand sie schreien hört: »Ich war’s nicht!« Es ist der mit Justizopfern erfahrene Kölner Anwalt Ralf Höcker, der bestätigt: »Letztendlich kann es jeden treffen.«
Dieses Buch berichtet über die Mechanismen, nach denen Justizirrtümer entstehen: vom ersten Verdacht über die Verhaftung, den Prozess, die erfolglose Revision, die Rechtskraft des Schuldurteils, die Versuche, im Verfahren der Wiederaufnahme doch noch die Unschuld beweisen zu können. Es lohnt sich, genau hinzusehen, wie die Polizei- und Justizmaschine ihre Schlinge um die Opfer immer weiter zuzieht, wie Polizisten, Staatsanwälte und Richter mit oft leichtfertigen Beschuldigungen und halsbrecherischer Beweisführung Menschen erwürgen – und niemand ihnen in den Arm fällt. Es ist dem dringenden Verdacht nachzugehen, dass Justizirrtümer keine Fehler im Einzelfall sind, sondern dass in der Maschinerie der Gerechtigkeitsbranche etwas nicht stimmt. Ist die Strafjustiz eine Fehlkonstruktion? Einige Indizien, so wird sich zeigen, sprechen dafür.
Das Mahlwerk der Justizmaschine steht nie still. Gründliche Inspektionen sind nur bei laufendem Betrieb möglich. Täglich liefert der Apparat neue Resultate seiner Arbeit, wir kommen mit der Analyse kaum hinterher. Während dieses Buch entstand, ging auch der Fall des Hausmeisters Genditzki seinen Weg durch die Justiz, mit immer neuen Wendungen und immer neuen Enttäuschungen. Wir werden ihn im Auge und den Leser zum Aktenzeichen 1Ks 31 Js 40341/08 auf dem Laufenden halten.
Das wird Ärger geben. Richterschelte gilt als gemein. Ist es nicht ungerecht, den Arbeitern im Weinberg der Gerechtigkeit, die Tag für Tag unter Zeitdruck und Ungewissheit weitreichende Entscheidungen treffen müssen, so hartnäckig hinterherzurecherchieren? Sind Ermittlungen gegen die Wahrer der Gerechtigkeit nicht sogar ein Eingriff in deren verfassungsrechtlich verbürgte Unabhängigkeit? Ist es nicht eine Anmaßung, sich ein Urteil über ein Urteil zu erlauben, das die Richter nach oft monatelanger Auseinandersetzung mit komplizierten Lebenssachverhalten und den psychologischen Hintergründen der Beteiligten nach gründlicher Beratung mit den Kollegen der Kammer gefällt haben?
Ihre Unabhängigkeit enthebt die Richter nicht der Verpflichtung zu ordentlicher Arbeit. Und der einzig legitime Beleg für die Qualität der Arbeit eines Richters ist sein Urteil. Es ist in der Hand des Richters, überzeugende Begründungen für seine Urteile abzugeben. Nur begründete Urteile sind rechtsstaatliche Urteile. Und nur Begründungen, die ein Urteil wirklich tragen, sind rechtsstaatliche Begründungen.
Dass jeder diese Begründungen lesen kann, ist Voraussetzung dafür, dass Urteile »im Namen des Volkes« ergehen. Das Volk – nicht nur das im Gerichtssaal – darf die Richter an ihren Begründungen messen. Und nur Begründungen, die jeder – und nicht nur ein Eingeweihter – verstehen kann, wenn er sich ein bisschen bemüht, können wir gelten lassen.
Der erste Griff im Zweifel über die Justiz muss also der Griff nach den Urteilen sein. Die Analyse der Texte, die Rekonstruktion ihrer Entstehung ist die Grundlage jeder kritischen Untersuchung. Oft genug reicht das schon, um zu entdecken, dass es mit der Gerechtigkeit ist wie mit des Kaisers neuen Kleidern: Der Kaiser ist nackt, es darf nur keiner sagen.
Doch Akten sind nicht alles: Viele Richter und Betroffene haben in großer Offenheit über ihre Erfahrungen und Bedenken Auskunft gegeben. Nur in einem Fall hat die Justiz geblockt und dem Autor den Zugang zu einem inhaftierten Verurteilten gegen dessen Wunsch verboten. Das war, man muss es sagen, die Justiz mit den meisten spektakulären Fehlleistungen: die bayerische.
Die großen Mengen an Akten, Material und Informationen und die vielen Einsichten, die in diesem Buch verarbeitet sind, wären nie zusammengekommen, hätte der Autor nicht kollegiale und oft genug freundschaftliche Unterstützung für das Projekt von vielen gehabt, die manches besser wussten als er. Dazu gehören neben namenlosen Richtern und Staatsanwälten die Kollegen von Spiegel, Spiegel Online und Spiegel TV, insbesondere Gisela Friedrichsen, Thomas Heise, Dietmar Hipp, Bertolt Hunger, Beate Lakotta und Utta Seidenspinner. Zu chemischen Spezialitäten hat mich Dr. Hans-Willhelm Meyer, Hamburg, beraten, zu wissenschaftstheoretischen Feinheiten Professor Dr. Helmut Rüßmann, Saarbrücken. Die Interviewtexte hat Margareta Hüttenberger betreut. Nur was die Fehler betrifft, die sich vielleicht auch in diesem Buch finden, gilt ganz klar: Ich war’s.
ZWEITES KAPITEL
Anatomie eines Irrtums
»Ich will mein Leben zurück«
Nicht die Wahrheit ist gefährlich, sondern die Suche danach. Inquisition – mit diesem Wort verbinden sich dunkle Berichte über die Endzeit des Mittelalters, in der die wütende Suche nach der göttlichen Wahrheit Menschen mit Feuer und Folter vernichtete. Inquisition, die Jagd nach der Wahrheit mit aller Macht, kann auch heute, im Zenit der Neuzeit, Leben vernichten. Ein Mensch, der heimgesucht wird von bewaffneten, zu allem entschlossenen Wahrheitssuchern, muss ihre Fragen beantworten können, glaubwürdig, überzeugend. Wehe ihm, wenn nicht.
Harry Wörz, damals 30, konnte es nicht. Dabei war die Frage ganz einfach: »Wo waren Sie heute Nacht?«
Na, in meinem Bett.
»Haben Sie dafür Zeugen?«
Der Bauzeichner Harry Wörz lebte und schlief damals allein. In Gräfenhausen, gleich bei Pforzheim in Baden-Württemberg, wohnte er nach der Trennung von seiner Frau Andrea unterm Dach im Haus seines Vaters. Morgens musste er früh raus, mit dem Auto erst einen Arbeitskollegen abholen, dann gemeinsam zur Frühschicht in das Metallschienenwerk in Höfen, da hatte er einen Job. An jenem Apriltag 1997 hatte er mit seinem Passat noch den Oldtimer seines Freundes Guido nach Pforzheim in die Garage geschleppt und war dann nach Hause gefahren. Sein Auto – das war einer der Fehler, die er später bereuen musste – hatte er nicht vor seiner Haustür abgestellt, sondern 200 Meter entfernt in der Kettelsbachstraße, auf einer Kuppe, wo die Straße in ein Gefälle überging. So konnte er in der Kälte am nächsten Morgen einfach losrollen, falls der Passat – wie gelegentlich – Startprobleme haben sollte.
Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Die Probleme, die Harry Wörz in dieser Nacht bekam, waren sehr viel schwerer. Sie sollten ihn für Jahre hindern, wieder am Steuer seines Autos zu sitzen.
Der Anruf kam im Morgengrauen. Um 5 Uhr 12 zeichnet die Mailbox von Wörz’ Telefon die Stimme des Kriminalhauptkommissars Maischein auf: Er möge »in einer seine Ehefrau betreffenden Angelegenheit« zurückrufen. Ein Anruf von der Polizei – für Wörz nichts Alarmierendes, Kontakt zur Polizei hatte er sehr lange sehr direkt. Andrea, seine Ex, war ja selber Polizistin, deren Vater, sein ehemaliger Schwiegervater Wolfgang, gehörte auch zur Firma, und um die Sache komplett zu machen: Thomas H., der Neue von Andrea, war ebenfalls dabei, war sogar der Ausbilder der Streifenpolizistin gewesen, die einmal Harrys Frau gewesen war, der Mutter seines Sohnes Kai. Eine große Familie ist die Polizei in Pforzheim – nur Harry, der Bauzeichner, gehörte nicht dazu, und sollte es auch nicht. War nicht Wolfgang Z., der Polizistenvater der Polizistentochter, schon immer gegen eine Ehe mit diesem Verlierer-Typen gewesen? Der ist nix für eine toughe Polizistin, die von ihrem Vater trainiert bei Polizeisportwettbewerben einen Pokal nach dem anderen holt. An diesem Morgen auf dem Anrufbeantworter ist Andrea eben immer noch seine »Ehefrau«. Doch: Warum rufen sie um diese Zeit an? »Soll das ein Witz sein?«, fragt Wörz, als er zurückruft. Kein Witz, ein Blick aus dem Fenster hätte ihn leicht überzeugen können. Das Haus war umstellt von bewaffneten Uniformierten. Alles Andreas Kollegen.
Wörz hat noch Nerven genug, seinen Kollegen Jochen anzurufen, dass aus der gemeinsamen Fahrt zur Arbeit heute nichts wird. Dann zieht er sich an und begibt sich vors Haus in die Hände der Staatsgewalt. Der Mann, so verzeichnet später der Polizeibericht, »ließ sich um 5 Uhr 25 durch die vor dem Anwesen wartenden Polizeibeamten widerstandslos festnehmen«. Der Vorwurf lässt den Festgenommenen zusammenklappen: versuchter Mord an der Polizeibeamtin Andrea Z.
»Wo waren Sie heute Nacht?«
Na, in meinem Bett.
»Haben Sie dafür Zeugen?«
Die Suche nach Wahrheit endet im Rechtsstaat mit einem Strafurteil. Und wenn das Urteil rechtskräftig ist, alle Möglichkeiten legalen Widerspruchs verbraucht sind oder sich als unzulässig erwiesen haben, dann ist das Ziel erreicht – die Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die wie einst die göttliche allen irdischen Wahrheiten weit überlegen ist. Denn was Menschen, die keine Strafrichter sind, für wahr halten, ist zu widerlegen. Selbst was Naturwissenschaftler für wahr erkannt haben, gilt nur, bis jemand es widerlegt. Wenn einer nicht beweisen kann, dass er in der Nacht zum 29. April 1997 in seinem Bett geschlafen hat, dann wird die Wahrheit »im Namen des Volkes« rechtskräftig für ihn festgesetzt. Diese Wahrheit ist wie ein Würgeeisen. Sie erstickt jeden Widerspruch: »Unzulässig!«
Was geht in einem Menschen vor, der als Einziger sicher weiß, dass er die Nacht zum 29. April 1997 schlafend in seinem Bett im Dachgeschoss in Gräfenhausen verbracht hat, wenn er die Wahrheit erfährt, die nach langem Prozess »im Namen des Volkes« das Landgericht Karlsruhe rechtskräftig über ihn verhängt hat?
»Etwa um 2.00 Uhr am 29. 04. 1997 verließ der Angeklagte seine Wohnung, begab sich zu Fuß zu seinem... Pkw und fuhr zu dem etwa 3,5 km entfernten Wohnviertel in Birkenfeld, in dem das von Andrea Z. bewohnte Anwesen liegt... Er führte eine weiße Plastiktüte im Format ca. 20 mal 30 cm bei sich. In dieser Plastiktüte befanden sich neben einem olivfarbenen Dreieckshalstuch und einem weiteren baumwollenen, olivfarbenen rechteckigen 520 mm mal 480 mm großen Taschentuch ein Latexeinweghandschuh und zwei Vinyleinweghandschuhe sowie eine Zigarettenschachtel der Marke ›Marlboro‹ (rot) und eine Zigarettenschachtel der Marke ›Marlboro-Lights‹ (weiß). Die ›weiße‹ Marlboro-Lights-Schachtel enthielt sieben durchsichtige, verschweißte Plastiktütchen mit jeweils 1 g Amphetamin. In der ›roten‹ Marlboro-Schachtel befanden sich 3 aufgeschnittene, mit braunem Klebeband an der Schnittstelle wieder zugeklebte Folienbeutelchen ohne Inhalt.«
Nein! Ich habe geschlafen, ich weiß nichts von Marlboro-Schachteln, ich habe nichts mit Rauschgift am Hut: Immer wieder beteuert Wörz das. Es hilft nichts. Man unterbricht das Gericht nicht.
Weiter: »... begab er sich zu der zur im Souterrain des Einfamilienhauses gelegenen Einliegerwohnung führenden Eingangstür. Mit einem in seinem Besitz befindlichen Schlüssel schloss er die Eingangstür zur Einliegerwohnung auf, betrat das Haus, zog die Eingangstür ins Schloss und verschloss sie wieder mit dem Schlüssel. Ohne Licht zu machen, stieg er sodann die vom Souterrain/Kellerbereich in das Erdgeschoss des Hauses führende Treppe hinauf, stellte die von ihm mitgeführte Plastiktüte ... ab, öffnete die unverschlossene, zur Erdgeschosswohnung führende Tür und gelangte so in den Wohnungsflur der Erdgeschosswohnung. Nachdem er die Tür zur Kellertreppe wieder geschlossen hatte, wandte er sich nach links und betrat durch die vom Wohnungsflur abgehende Tür das zum Garten hin gelegene Schlafzimmer, in dem Andrea Z. auf der der Schlafzimmertür zugewandten Hälfte des dort befindlichen Doppelbetts lag und schlief. Welches Geschehen sich nun genau im Schlafzimmer abspielte, konnte nicht festgestellt werden. Fest steht aber, dass Andrea Z. aus dem Schlaf erwachte, die Nachttischlampe einschaltete und den in ihrem Schlafzimmer befindlichen Angeklagten erkannte. Zwischen ihr und dem Angeklagten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.«
Wie kann, mag sich Harry Wörz gefragt haben, Andrea mich erkannt haben, wenn ich gar nicht da war? »Es steht fest«, sagt das Gericht. Und damit steht es fest. Schließlich ist ein Nachbar, der bei offenem Fenster schlief, sogar aufgewacht von dem Streit im Haus von Andrea Z. Seine Digitaluhr hatte 2 Uhr 16 gezeigt, und die ging genau. Und mit Hörversuchen haben Polizeisachverständige später überprüft, ob die Stimmen durch die gekippte Terrassentür von Andreas Schlafzimmer wirklich bis zum Bett des Nachbarn dringen konnten. Eine Stimme: »Ich bring’ dich um, ich schlag’ dich tot. Mit mir kannst du das nicht machen!« Harrys Stimme? Eine Männerstimme. Jedenfalls war es eindeutig Andrea, die mit »weinerlicher Stimme« (so der Nachbar) antwortete: »Was willst du denn von mir? Ich hab’ dir doch nichts getan! Mach’ mir doch nichts!«
Das Gericht: »Der Angeklagte, der jedenfalls jetzt an seinen Händen Einweghandschuhe aus Vinylmaterial trug oder diese anzog, entschloss sich zwischen 2.16 Uhr und 2.31 Uhr, seine Ehefrau Andrea Z. zu töten. Er ergriff einen in der Wohnung von Andrea Z. ... aufbewahrten Wollschal, trat auf Andrea Z. zu ... und schlang den Wollschal einmal fest um ihren Hals. Sodann überkreuzte er die beiden Enden des Wollschals, die er jeweils mit einer Hand festhielt, im Bereich unterhalb des rechten Ohres von Andrea Z., und zog die so überkreuzten, möglicherweise auch verdrillten Enden des Schals mit aller Gewalt zusammen. Andrea Z., der die Luftzufuhr abgeschnitten wurde, versuchte, sich gegen den Drosselungsangriff zu wehren. Dies gelang ihr nicht. Der Angeklagte setzte die Drosselung mit aller Kraft fort ... Schließlich verlor Andrea aufgrund des Sauerstoffmangels das Bewusstsein. Der Angeklagte verbrachte seine Ehefrau während des ca. 3 bis 5 Minuten andauernden Drosselungsangriffs aus dem Schlafzimmer in den Wohnungsflur der Erdgeschosswohnung, wo Andrea Z. schließlich unmittelbar vor der Tür zum Abgang in das Untergeschoss zu liegen kam. Der Eintritt des Erstickungstodes, von dem der Angeklagte ausging, wurde allein durch das Eingreifen des Vaters von Andrea Z., Wolfgang Z., verhindert. Wolfgang Z. war nämlich in seinem Bett im Schlafzimmer der Souterrain-Wohnung aufgrund der durch das Tatgeschehen in der Erdgeschosswohnung verursachten ›Rumpel-Geräusche‹ aus dem Schlaf erwacht und hatte sich durch einen Blick auf die Armbanduhr davon überzeugt, dass es exakt 2.34 Uhr war ... Der Angeklagte ... verließ das Haus durch die nicht abgeschlossene Haupteingangstür der Erdgeschosswohnung, lief unbemerkt zu seinem in der Nähe des Anwesens abgestellten Pkw und fuhr mit diesem nach Birkenfeld-Gräfenhausen zurück. Dort stellte er seinen Pkw wieder auf der Kuppe in der Kettelsbachstraße ab, lief zu dem etwa 200 m entfernten Anwesen seines Vaters und begab sich in seine Dachgeschosswohnung, die er vor 2.55 Uhr erreichte und bis zu seiner Festnahme um 5.25 Uhr nicht mehr verließ.«
Das Opfer rang im Krankenhaus noch immer mit dem Tod: »Aufgrund der mit dem Drosselungsvorgang verbundenen Unterbrechung sowohl der Blutzufuhr als auch der Sauerstoffversorgung zum Gehirn erlitt Andrea Z. eine ausgeprägte diffuse ... Hirnschädigung. Im Wesentlichen blieben lediglich ihre vegetativen Hirnfunktionen, namentlich der Atemantrieb sowie die Körpertemperatur- und Kreislaufregulation erhalten. Schwerste Ausfallerscheinungen betreffen vor allem die Wahrnehmung, den sprachlichen Ausdruck sowie Planung und Ausführung von Handlungsabläufen.« So stellt es das Urteil fest.
Eine schlimme Geschichte. Kaum einem »Tatort«-Krimi würde es gelingen, den Mordversuch an der Polizistin Andrea so hautnah zu schildern, wie es die Strafkammer des Karlsruher Landgerichts fertiggebracht hat. Doch beim Fernsehen kämen die Richter mit ihrer Geschichte mit Sicherheit nicht an. Das Drehbuch würde als völlig unglaubwürdig zurückgewiesen. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum hätte Wörz seiner Ex das antun sollen? Mit Andrea Z. verband den Bauzeichner nur noch ein gepflegtes Nichtverhältnis, beide hatten neue Liebschaften, nur gelegentlich gab es Rangeleien um die Frage, ob Sohn Kai auch einmal über Nacht bei seinem Vater bleiben darf. Und dann diese Plastiktüte samt genau geschildertem Inhalt: Die hat doch mit der Tat gar nichts zu tun. Warum trug Wörz sie mit sich herum? Und warum brachte er diese Tüte zu Andrea mit? Und dann diese Mordhandschuhe: Wer zieht sich denn, wenn er aus Wut und ungeplant seinen Expartner würgen will, erst mühsam Handschuhe an?
Die Richter, die über Harry Wörz zu befinden hatten, konnten sich auch keinen Reim darauf machen. Besonders die Frage nach dem Motiv für die Untat, räumten sie ein, fände keine Antwort. Weil es einerseits »fest«-stand, dass Wörz es war, andererseits die Geschichte nicht so recht logisch war, schlossen die Juristen mit der Wahrheit einen kleinen Kompromiss: Sie verurteilten den Angeklagten nicht wegen Mordversuchs, sondern nur wegen versuchten Totschlags. Mord ist rechtlich gesehen ein »qualifizierter« Totschlag und wird darum in der Regel auch mit lebenslanger Haft bestraft. Doch in welcher einschlägigen Weise das Verbrechen zu qualifizieren war – niedere Beweggründe, Befriedigung der Sexualgier, Versuch, ein anderes Verbrechen zu vertuschen –, konnten die Richter nicht sagen. Die halbe Wahrheit reichte für die Verurteilung zu elf Jahren Gefängnis.
Es dauerte nicht elf, es dauerte 13 1/2 Jahre, bis die Justiz endlich akzeptierte, was Wörz »bei Gott« geschworen, geschrien, gefleht hatte: Er war’s nicht. Erst 2010 wurde durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs im Wiederaufnahmeverfahren eine neue Wahrheit rechtskräftig: Freispruch.
13 1/2 Jahre unter dem Bann einer Wahrheit, aus der es offenbar kein Entrinnen gab, vier Jahre davon hinter Gittern: Für Harry Wörz, mittlerweile 44, war das zu viel. Ein kleiner, scheuer Typ mit tief liegenden Augen, der langsam spricht und langsam denkt – er hat sich zurückgezogen, man soll ihn in Ruhe lassen. »Man hat mir alles gestohlen, alles, nicht nur meinen Sohn, Eltern, Verwandte, Bekannte«, sagt er verbittert in einem SWR-Film. Kai, nun bald volljährig, hat er seit Jahren nicht mehr gesehen. Rund 42 000 Euro Haftentschädigung für 1500 Tage im Gefängnis erhielt er, doch was bringt das schon? Allein seine Schulden bei Rechtsanwälten betragen mehr als 200 000 Euro. Um jeden Euro Schadensersatz für Verdienstausfall, Arztrechnungen, für ein zerstörtes Leben müssen seine Anwälte mit der Justiz ringen. Und Geld verdienen kann Wörz nach dieser Tortur vorerst nicht mehr. Er ist krankgeschrieben. Er hat psychisch die Wahrheitssuche nicht durchgestanden, ist zwischendurch zusammengebrochen, braucht seitdem psychologische Hilfe: Depression. »Ich will mein Leben zurück«, sagt Wörz, »kein Mensch kann sich vorstellen, wie’s mir geht.«
»Wie eine Herde Elefanten«
Was lief falsch im Fall Harry Wörz?
Alles.
Der Fall Harry Wörz ist ein Super-GAU in der bundesdeutschen Justizgeschichte. Das Rechtssystem Deutschlands, einer der größten und reichsten Industrienationen der Welt, des Landes mit der weltweit größten Richterdichte, hat nicht nur irrtümlich das Leben eines Menschen ruiniert, es ist einfach durchgebrannt. Es sind nur wenige Fälle bekannt geworden, in denen der große Apparat, die Menschenmühle der Strafjustiz, so fehlerhaft gearbeitet hat, ohne dass auch nur eine einzige Sicherung herausgeflogen wäre. Der Fall Wörz war für die Justiz ein Stresstest: Wie viel Unfug kann die große Wahrheitsmaschine schlucken, ohne dass sie »Error« meldet? Das Testergebnis ist eindeutig: durchgefallen.
Ohne den Mut Einzelner, die sich gegen das Mahlwerk der Maschine gestemmt haben, würde Wörz noch heute um die Wahrheit betteln. Am Beispiel des Justizopfers Wörz lässt sich der fatale Mechanismus genau studieren. Vom ersten Polizeinotruf bis zum letztinstanzlichen Urteil offenbart der Fall, wie die Justiz ihre Wahrheiten findet – und was dabei alles schieflaufen kann.
Erstens: Die Ermittlungen
Der erste Ermittler am Tatort war für die Suche nach der Wahrheit genau der falsche Mann. Wolfgang Z., angesehener und erfahrener Beamter bei der Polizeidirektion Pforzheim, war nicht nur der Kollege, sondern auch der Vater der jungen Frau im rosa T-Shirt, die nun, den Unterleib entblößt, halb tot auf dem Boden ihrer Erdgeschosswohnung lag. Vater Z. war schon seit dem Vortag im Haus der Tochter, der 28. April war sein 49. Geburtstag. Er war zum Gratulieren nachmittags zu Andrea nach Birkenfeld gekommen. Sie hatte ihn mit einem selbst gebackenen Kuchen überrascht, er sich gerührt mit einem 100-Mark-Schein bedankt. Es wurde ein netter Abend mit der Tochter und dem Enkel Kai, damals zwei Jahre alt. Wie häufig verzog sich Kais Großvater dann nach unten, um in der Einliegerwohnung zu übernachten – das ganze Haus war ja irgendwie seins, er hatte es der Tochter gekauft, als Belohnung sozusagen dafür, dass sie sich endlich von »diesem Wörz« getrennt hatte, von dem der Schwiegervater nur zu sagen wusste: »Keine Arbeit, kein Geld, nur der Rocker-Club.« Ja, Harry war ein begeisterter Motorradfahrer, Mitglied im »Whitebirds«-Club. Seine Begeisterung für die schnellen Maschinen hatte ihn zwei Fingerglieder gekostet, die ihm nach einem Unfall amputiert werden mussten. Weil er häufig Schmerzen an den Stümpfen spürte, zog er regelmäßig Plastikhandschuhe zum Arbeiten an.
Plastikhandschuhe. Man kann sich kaum dagegen wehren, schnelle Schlüsse zu ziehen und Harry Wörz unter Verdacht für die Mordgeschichte zu stellen. Wir werden sehen.
Kurz nach halb drei eilt der Vater, vom Gerumpel über ihm geweckt, die Kellertreppe hinauf, kann die Tür zur Erdgeschosswohnung nur mühsam gegen den Körper seiner dahinter am Boden liegenden Tochter aufdrücken, findet sein Kind leblos, knüpft den Schal auf, versucht mit Wiederbelebungsversuchen vergeblich, ihren Atem zurückzuholen. Dann erwacht der Polizist in ihm. Z. ruft die Notrufzentrale der Polizeidirektion Pforzheim an, seine Jungs, ordert erst einen Notarzt, dann verkündet er den Kollegen gleich sein erstes Ermittlungsergebnis: Keine Einbruchspuren, offenbar Beziehungstat, als Täter kommen nur zwei Männer in Betracht: der Kollege Thomas H., Ausbilder und Geliebter von Andrea, und natürlich Harry Wörz. Die Kollegen spuren schnell. Schon kurz vor drei sind die Häuser von Thomas H. und Wörz umstellt.
Der Rest ist eigentlich Routine. Thomas H., von den Ermittlern kollegialiter im Morgengrauen aus dem Bett geholt, reagiert auf die schlimme Nachricht vom Überfall auf seine Geliebte hochprofessionell. Fragt nicht entsetzt: Oh Gott! Wie geht’s ihr? Sondern erklärt: »Ich war die ganze Nacht zu Hause.« Zeugen? Ja klar! Thomas H. schläft nicht allein. Außer seiner Geliebten hat er seine Frau Daniela, die steht neben ihm, hinter ihm. Vor einer guten Stunde, bestätigt sie, habe man noch Sex miteinander gehabt.
Was Wunder, dass sich nun alle Ermittlungen auf Harry Wörz konzentrieren. Der wird in die Mangel genommen von Beamten, die zugleich Kollegen, Freunde von Andrea und Thomas H. sind. »Wenn du nicht gestehst, dann sind 600 Polizisten hinter dir her«, sollen sie ihm gedroht haben. Natürlich bestreiten sie das, natürlich gibt es keine Zeugen. »Wörz, das wollen wir nicht hören!«, sollen sie ihn angebrüllt haben, als er seine Wahrheit erzählte, langsam, in breitem Schwäbisch, immer dasselbe: »Ich hab’ geschlafen.«
Was auch immer sie mit ihm gemacht haben, schließlich hat er gestanden. Auf einen Zettel schrieb Harry Wörz: »Hiermit gebe ich alles ohne Wenn und Aber zu. Ich will nur noch meine Ruhe.« Aber dann geht es erst los.
»Wie bist du nach Birkenfeld gekommen?«
»Mit meinem Auto.«
»Wo hast du geparkt?«
»Zwei oder drei Häuser weiter vorne.«
»Welche Autos waren in der Straße?«
»Andreas und noch eins, Marke weiß ich nicht mehr.«
»Welche Lampen waren an?«
»Die vor dem Haus war an.«
»Wie bist du in das Haus gekommen?«
»Die Tür war auf.«
»Wo war Andrea?«
»Im Bett.«
»Und dann?«
»Wir haben Streit bekommen, ich zog meinen BW-Schal vom Hals und habe sie damit gewürgt, bis sie regungslos zusammenbrach.«
Spätestens an dieser Stelle müsste der vernehmende Beamte gemerkt haben, dass mit diesem Geständnis etwas nicht stimmen kann: Tatsächlich wurde Andrea Z. ja nicht mit einem mitgebrachten Bundeswehr-Schal, sondern mit einem Schal aus ihrem Haushalt gewürgt. Den hatte die Großmutter einst für den kleinen Kai gestrickt, Vater Harry musste ihn kennen. Die Polizei brach dann auch die Vernehmung als ergebnislos ab, der Dialog ist später von Wörz selbst rekonstruiert und in dieser Fassung in die Gerichtsakten aufgenommen worden. So wie es da steht, ist das Geständnis eher entlastend: Warum sollte jemand, der eine eigene Tat gesteht, wider besseres Wissen einen falschen Tathergang berichten?
Doch dem einzigen Beschuldigten nutzte das wenig. Die Spurensicherung am Tatort brachte ihn weiter in die Klemme. Verdächtig war den Ermittlern vor allem die Plastiktüte mit den Rauschgift-Tütchen, den beiden Zigarettenschachteln und den Handschuhen. Brauchbare Fingerabdrücke fanden sich nur auf einer der Schachteln – es waren die von Andreas Polizistenvater Wolfgang Z. Wie kam das? Kollegen konnten schnell klären: Oberpolizist Z. hatte am Tatort ein bisschen mitgeholfen, den Inhalt der Tüte – »wahrscheinlich Müll« – auf den Boden gekippt und mit nackten Fingern die rote Marlboro-Schachtel aufgehoben.
»Wie eine Herde Elefanten«, so urteilte Jahre später ein kritischer Richter, hätten die Ermittler im Eifer, den Mörder ihrer Kollegin zu finden, am Tatort gewütet. Die Räume wurden nicht, wie vorgesehen, versiegelt, ein Mülleimer wurde ungeprüft ausgeleert, auf Tatortfotos sind wichtige Gegenstände mal zu sehen, mal haben sie ihren Platz verlassen. Auch ein roter Pullover gehört dazu, der angeblich dem Kollegen Thomas H. gehörte.
Mehr Sorgfalt wandten die Ermittler bei dem Taschentuch auf, das ebenfalls in der Tüte steckte. Es wurde untersucht, gewaschen, vermessen. Denn ein ähnliches, wenn auch geringfügig größeres fand sich bei einer Hausdurchsuchung in Wörz’ Wohnung. Und dann natürlich die Plastikhandschuhe: Ganz ähnliche fanden sich bei Wörz zu Hause, bei Wörz im Auto, kein Wunder, er brauchte wegen seiner kaputten Finger ja häufig welche. Ein Schönheitsfehler der Ermittlungen allerdings: Auch in Thomas H.s Auto fanden sich, warum auch immer, solche Handschuhe.
Der entscheidende Fund am Tatort hatte ebenfalls mit Plastikhandschuhen zu tun: Zwei abgerissene Fingerlinge entdeckten die Fahnder, einen in der Nähe des Fundorts von Andrea im Flur, den anderen im Bett unter der Bettdecke. Diese Fundstücke kosteten den Beschuldigten Wörz letztlich seine Freiheit: Zwei Handschuhfinger von dem fingeramputierten Wörz, abgerissen offenbar bei der Gewalttat, am Tatort zurückgeblieben bei der eiligen Flucht, ebenso wie die weiße Plastiktüte mit Handschuh-Nachschub. Als das Labor den DNA-Befund schickte, schien die Sache klar. Fingerlinge außen: genetische Spuren von Andrea, Fingerlinge innen: genetische Spuren von Wörz.
Eine Art Siegestaumel muss Andreas Kollegen überfallen haben. Da passte nicht ins Bild, was bei einer erneuten Durchsuchung ein Kollege auf einer Ablage im Badezimmer fand: eine ganze Tüte voller einzelner Fingerlinge, neben einer Packung Kinder-Fieberzäpfchen. Andrea wäre nicht die einzige Mutter, die ihrem Kleinen mit solchen Fingerlingen die Zäpfchen in den Po schiebt. Und dass sie so etwas gelegentlich auch in ihrem Bett machte, wo man eines der Beweisstücke fand, erscheint angesichts der kaum beachteten Tatsache wahrscheinlich, dass Kai häufig – wie auch in der Tatnacht – an der Seite seiner Mutter schlief.
Die Fingerlings-Tüte verschwand spurlos. Das Gericht, das Wörz verurteilte, hat von der Entdeckung nie erfahren. Wie sollte es auch: Wie durch Zauberhand waren auch die Aktenseiten verschwunden, die den Fund festhielten.
Ein Versäumnis auch, kann ja mal vorkommen: Die erste Standardmaßnahme wäre es gleich nach dem Alarmruf zum Tatort und den Informationen von Andreas Vater gewesen, die Restwärme an den Motoren der beiden Verdächtigen-Autos zu überprüfen. Ein Handgriff am Pkw des Kollegen Thomas H. vorm Haus hätte genügt, um festzustellen, ob das Auto drei Stunden zuvor bewegt wurde oder nicht. Hat niemand von den Beamten, die da stundenlang vor dem Haus wachten, die Berührung gewagt? Oder hat nur keiner gewagt, das Ergebnis zu den Akten zu nehmen? Der Bewegungsmelder am Haus von H., so die späte, wenn auch kaum nachvollziehbare Rechtfertigung, hätte bei Prüfaktionen am Auto angeschlagen.
Na und?
Und warum haben die Polizisten darauf verzichtet, eine Hand an den Motor von Harry Wörz’ Passat zu legen? Diese winzige Routinemaßnahme hätte dem Mann 13 Jahre Quälerei ersparen können. Warum, hat Wörz immer wieder gefragt, habt ihr das nicht gemacht? Warum? Warum?
Sie hätten, gaben die Beamten zu Protokoll, sein Auto nicht finden können. Es stand ja 200 Meter von seinem Haus entfernt.
So nahm die Erforschung der Wahrheit ihren Lauf. Die einzigen Zeugen, die Harry hätten retten können, konnten nichts sagen: Andrea Z., die den Mordangriff knapp überlebte, wird wahrscheinlich nie wieder sprechen können. Geistig und körperlich schwerstbehindert lebt sie als Pflegefall bei ihren Eltern. Mediziner sehen kaum Chancen, dass sich ihr Zustand jemals bessern wird. Und Kai, der in der Mordnacht wie so oft im Bett neben seiner Mutter schlief – er muss alles mitbekommen haben. Doch die vorsichtigen Annäherungsversuche von Polizeipsychologen an das verstörte Kind blieben ergebnislos. »Mama aua« – mehr war dem Knirps über die furchtbarste Nacht seines jungen Lebens nicht zu entlocken.
So wurde Harry Wörz vor dem Landgericht Karlsruhe angeklagt. Und spätestens hier hätten die ersten Sicherungen herausfliegen müssen, die in der Strafprozessordnung gegen übereifrige Ermittler einbaut sind. Die Staatsanwaltschaft, so sieht es das Gesetz vor, ist die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Die gelernten Juristen sind dafür verantwortlich, dass die Wahrheit ordentlich erforscht wird. Ein Gewaltdelikt in Polizeikreisen – ermittelt von den persönlich bekannten Kollegen des Opfers? Warum wurde die Sache nicht an eine andere Polizeidienststelle abgegeben? Warum ließ man Andreas Kollegen die Sache im Familienkreis klären? »Sicher gab es Versäumnisse«, sagt später der Pforzheimer Kripo-Chef Hans Jäger, aber: »Schließlich war der Staatsanwalt Herr das Verfahrens.« Der Staatsanwalt gab zu Protokoll: »Ich muss mich ja auch auf die Beamten verlassen können.«
Damit solch organisierte Verantwortungslosigkeit nicht durchschlagen kann, auf die Rechte des Angeschuldigten und auf das Leben Unschuldiger, hat die Strafprozessordnung eine zweite Sicherung eingebaut: Im sogenannten Zwischenverfahren müssen die Richter, die in der Hauptverhandlung über den Fall entscheiden sollen, sich die Akten, die ihnen der Staatsanwalt schickt, genau ansehen: Lassen die Ermittlungen eine Verurteilung des Anzuklagenden hinreichend wahrscheinlich erscheinen? Eine Strafkammer, die deutliche Ermittlungsfehler sieht, Lücken in der Beweisführung, muss die Zulassung der Anklage ablehnen und unter Umständen den Beschuldigten sofort aus der U-Haft entlassen.
Doch die Strafkammer hatte keine Einwände. Die Wahrheitsfindung im Fall Harry Wörz ging unaufhaltsam weiter.
Zweitens: Der Prozess
Der Prozess vor deutschen Strafgerichten ist – anders als etwa in den USA – geprägt von der Inquisitionsmaxime. Die Richter haben gelernt, Recht anzuwenden – doch vorrangig ist es ihre Aufgabe herauszufinden, was wirklich passiert ist. Dabei dürfen die Juristen sich nicht auf die Kriminalisten und ihre Ermittlungsakten verlassen. Den Weg zur Wahrheit dürfen sie nur mit den Eindrücken finden, die sie in der Hauptverhandlung gewinnen. Das sind Eindrücke von Zeugen, die vor den Schranken des Gerichts aussagen, Dokumente, die laut vorgelesen werden, Sachverständige, die ihnen helfen, die Spuren zu verstehen, die am Tatort gefunden wurden. Entscheidend aber sind die Einlassungen des Angeklagten. Ist er geständig, kooperativ? Das macht einen guten Eindruck. Schweigt er hartnäckig? Das ist sein gutes Recht.
Der Angeklagte Wörz schwieg nicht. Er schwor, »bei Gott«, er war es nicht. Er beteuerte immer wieder, in der Nacht des Mordangriffs geschlafen zu haben, in seinem Bett, allein. Eine der wichtigsten Sicherungen des Strafprozessrechts, den Angeklagten vor Inquisition zu schützen, ist der Grundsatz, dass die Richter ihm glauben müssen – bis zum Beweis das Gegenteils. Harry Wörz ist unschuldig – so lange, bis die Unschuldsvermutung von den Richtern widerlegt ist. »In dubio pro reo«: Dieser Grundsatz ist eine der größten Kulturleistungen der Rechtsgeschichte, und wenn er strikt beachtet wird, ist die Wahrheitssuche in den Mühlen der Strafjustiz tatsächlich nur noch halb so gefährlich.
Harry Wörz hat in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1997 allein in seinem Bett geschlafen. Von Rechts wegen kann ihm nichts passieren, bis dieser Satz widerlegt ist. Es kommt also gar nicht darauf an, das wird ihm auch sein Anwalt gesagt haben, ob er Zeugen aufbieten kann, die den Schlaf des Gerechten bestätigen. Zeugen brauchen die anderen, die, die ihn widerlegen wollen. Es kommt also gar nicht darauf an, auch das könnte ihm sein Anwalt gesagt haben, ob die Pforzheimer Polizei parteiisch, unvollständig, schlampig ermittelt hat – die Richter werden es schon richten. Nur wenn die Inquisition vor den Schranken des Gerichts den Beweis erbringt, dass Wörz der Täter ist, nur dann muss er etwas von dem machtvollen Apparat befürchten. Wenn einer nichts Unrechtes getan hat, dann muss er keine Angst haben vor der Justiz: eine tolle Sache, so ein Rechtsstaat.
Wie konnte es dann kommen, dass das Landgericht Karlsruhe den Angeklagten Harry Wörz am 16. Januar 1998 wegen versuchten Totschlags an seiner Ex Andrea zu elf Jahren Gefängnis verurteilte?
Es ist auch eine Errungenschaft des Rechtsstaates, dass Richter ihre Urteile begründen müssen. Dabei geht es nicht nur um die Buchstaben der Gesetze, sondern vor allem um Logik. Nur wenn im Urteilstext eine vollständige und verständliche Beweiskette den Weg zur Wahrheit markiert, hat ein Urteil Bestand. Nur wenn jeder verständige Leser nach der Lektüre des Urteils der Karlsruher Strafkammer zu dem Ergebnis kommt, dass Harry Wörz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Täter war – nur dann ist das Urteil ein rechtsstaatliches Urteil, nur dann muss Wörz büßen. Ein Urteil »im Namen des Volkes« ist von jedermann zu überprüfen.
Machen wir uns an die Arbeit. Das Urteil des Landgerichts Karlsruhe stützt die von ihm gefundene Wahrheit auf drei Beweisketten:
a) Die Spuren an den beiden am Tatort gefundenen Fingerlingen;
b) die Plastiktüte mit ihrem rätselhaften Inhalt;
c) die Tatsache, dass es sich bei dem Angriff auf Andrea Z. um eine Beziehungstat handelte und alle in Betracht kommenden Beziehungspersonen als Täter auszuschließen sind – außer Wörz.
Halten die Ketten?
a) Die Fingerlinge
Die Methoden der modernen Spurensicherung mithilfe genetischer Fingerabdrücke haben die moderne Kriminalistik revolutioniert. Kleinste Spuren menschlicher Desoxyribonukleinsäure – amerikanisch abgekürzt DNA –, seien sie in einem Haar, einer Hautschuppe, in Speichelresten an einer Zigarettenkippe, finden sich an jedem Tatort. Mit den Hightechmethoden der Landeskriminalämter lassen sich selbst Mikro-Spuren den Vergleichsproben Verdächtiger zuordnen – oder eben nicht. An den abgerissenen Plastikfingern, die Ermittler im Bett Andreas und im Flur nahe dem leblosen Opfer fanden, isolierten Experten außen DNA des Opfers, innen DNA-Bestandteile verschiedener Personen, darunter auch solche, die Wörz zugeordnet wurden.
Drei Schlussfolgerungen zieht das Gericht aus den Gutachten, die dazu in der Hauptverhandlung abgelegt wurden:
S1: Der Täter trug bei der Tat Plastikhandschuhe mit den beiden Fingerlingen.
S2: Wörz hatte höchstwahrscheinlich die Handschuhe an.
S3: Also war Wörz höchstwahrscheinlich der Täter.
Es soll uns hier vorerst nicht die Frage beschäftigen, ob das Gutachten des Landeskriminalamts tatsächlich die Zuordnung der Spuren im Inneren der Fingerlinge erlaubte, auch daran tauchten alsbald Zweifel auf. Hier geht es nicht um Naturwissenschaft, sondern um Logik. Doch auch damit ist es nicht weit her.
S1 begründet das Gericht damit, dass deutliche DNA-Spuren von Andrea Z. an der Außenseite der Fingerlinge waren. Doch warum die DNA dorthin gelangte, ist ebenso unklar wie die Herkunft der Fingerlinge. Einer fand sich, so steht es im Urteil, erst, als die Decke auf Andreas Bett »aufgeschlagen« wurde, er lag also vermutlich unter der Decke. Wie mag er da hingekommen sein, wenn der Kampf zwischen Täter und Opfer nach den Feststellungen der Kammer irgendwo in der Wohnung, jedenfalls nicht im Bett stattfand? Die Möglichkeit, dass die Fingerlinge mit den oder ohne die dazugehörigen Handschuhe zum Haushalt des Opfers gehörten – und darum Spuren des Gebrauchs durch Andrea Z. trugen –, wurde vom Gericht nicht einmal erwähnt. Vielleicht wären die Juristen ja über die voreilige Annahme gestolpert, wenn sie bei einer Durchsicht der Ermittlungsakten auf den Bericht über jene Tüte mit vielen Fingerlingen im Bad gestoßen wären. Doch der Bericht – wir wissen es – war auf rätselhafte Weise aus den Akten verschwunden.
Schon bei S1 reißt die Beweiskette, doch es gibt ja noch S2. Danach soll Wörz die Handschuhe getragen haben, weil sich im Inneren der Handschuhe Anteile der DNA fanden, die höchstwahrscheinlich von ihm stammte. Doch jeder Laie weiß spätestens seit der spektakulären Analyse der Gletscherleiche »Ötzi« aus dem Dolomiten, dass sich genetische Spuren sogar über Jahrtausende erhalten können. Warum also sollten die Spuren von Wörz gerade in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1997 in die Handschuhe gelangt sein? Weil er in dieser Nacht die Handschuhe getragen hat? Das setzt die Gültigkeit von S1 voraus – die aber ist nicht gegeben. Vielmehr kann Wörz die Handschuhe zu einem beliebigen Zeitpunkt vorher getragen haben. Das ist nicht einmal unwahrscheinlich: Der Mann hat häufig solche Handschuhe zu allen möglichen Verrichtungen angezogen. Und es gab eine Zeit, da hatten Andrea und Harry einen gemeinsamen Haushalt als Ehepaar. Sollten sie bei der Trennung auch noch die gebrauchten Kunststoffhandschuhe auseinandersortiert haben?
Auch S2 ist nicht zu halten. Dabei hätte es so schön ins Bild gepasst: Der fingeramputierte Gewalttäter, dem im Kampf mit dem Opfer die zwei hohlen Fingerlinge vom Handschuh gerissen werden. Alles sprach perfekt gegen Wörz. Alles? Erst Jahre später wurde festgestellt, dass eines der beiden Fundstücke kein abgerissener Finger, sondern ein abgerissener Daumen war. Der Verurteilte hätte es auf Befragen im Gerichtssaal jedem vorführen können: Ihm fehlt nicht der Daumen, ihm fehlen Teile von Ring- und kleinem Finger. Aber die Richter haben ja nicht gefragt. Stattdessen fahren sie fort mit S3: »Der Angeklagte hat diese Tat begangen.«
In die »Gesamtwürdigung« ihrer Beweisaufnahme beziehen sie freilich auch die Plastiktüte ein.
b) Die Plastiktüte
Die weiße Tüte mit dem rätselhaften Sortiment an Rauschgift, leeren Zigarettenschachteln, Tüchern und – tatsächlich – Plastikhandschuhen ergibt keinen Sinn. Niemand konnte sagen, wie sie in Andreas Wohnung gekommen war, ja nicht einmal ihr genauer Fundort ist gesichert. Keiner kann sich erklären, wozu der Inhalt dienen sollte – vielleicht »Müll«, mutmaßte Andreas Vater Wolfgang Z., der, obgleich Polizist, das zentrale Beweisstück am Tatort aufgriff und ausschüttete, um den Inhalt so heftig zu inspizieren, dass sein Fingerabdruck darauf zurückblieb.
Ein Fingerabdruck von Wörz dagegen fand sich weder an der Tüte noch an deren Inhalt. Wäre ihm das Ding zuzuordnen, wäre nach Auffassung der Richter bewiesen, dass er in der Tatnacht bei seiner Ex war. Denn am Vortag war die rätselhafte Tüte noch nicht im Haus des Opfers. Das jedenfalls sagte der Vater als Zeuge vor Gericht. Er habe sie da, wo sie aufgefunden wurde, am Abgang zum Keller, nicht gesehen, als er in den Keller hinunterstieg. Das Gericht hinterfragte die »glaubhaften Bekundungen« des problematischen Zeugen nicht. Alle im Gerichtssaal außer den Profis hinter dem Richtertisch fühlten förmlich, wie schwer es der vom Schicksal geprüfte Mann hatte, kühl und sachlich seine Aussage zu machen. Wie zuverlässig ist die Erinnerung eines Vaters, der Zeuge eines Mordangriffs auf seine Tochter wird? Ist es verantwortungsbewusst, eine zentrale Prämisse der Beweisführung auf die Aussage eines Mannes zu stützen, von dem jeder annehmen muss, dass für ihn das Urteil gegen den gehassten Schwiegersohn schon feststeht?
Das Gericht lässt solche Bedenken nicht erkennen, sondern geht mit großem kriminaltechnischem Aufwand dazu über, den Inhalt der Tüte dem Angeklagten zuzuordnen. Das karierte Taschentuch: Ein ganz ähnliches fand sich bei der Durchsuchung von Wörz’ Wohnung. Die Plastikhandschuhe: Gab es überall, wo auch Wörz war. Die rote Marlboro-Schachtel, Inhalt drei leere Folienbeutelchen, war außen mit einem großen Kreuz versehen. Wörz hatte in seiner Wohnung auch eine leere Zigarettenschachtel, in der er Kleingeld aufbewahrte. Die weiße Marlboro-Schachtel: Wörz’ neue Freundin rauchte dieselbe Marke.
Mehr nicht? Kann man darauf wirklich die Verurteilung eines Mannes wegen versuchten Totschlags stützen? Alle Dinge in der Tüte können ebenso gut aus dem Haushalt des Opfers Z. stammen – oder aus der Zeit, da beide zusammen einen Haushalt hatten. Dass es nicht nur so sein könnte, sondern wahrscheinlich so war, wurde freilich erst später bekannt: Da fand sich ein Zeuge, der früher Andrea im Umgang mit Haschisch beobachtet hatte. Das Rauschgift bewahrte sie in einer leeren Zigarettenschachtel auf.
Doch das Gericht stützt seine Verurteilung ja noch auf eine weitere Annahme: die Beziehungstat.
c) Die Beziehungstat
»Für die Begehung dieser ›Beziehungstat‹ kommt aus dem näheren Umkreis von Andrea Z. allein der Angeklagte als Täter in Betracht. Weitere, ursprünglich als tatverdächtig erscheinende Personen aus dem privaten Umfeld des Opfers sind nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme mit Sicherheit als Täter auszuschließen.« So folgerte das Gericht. Doch eine solche Beweisführung ist gefährlich, weil sie davon abhängt, dass die verschiedensten Glieder der Kette ihrerseits von zuverlässigen Beweisketten abgesichert sind: Weil Zweifel zugunsten des Angeklagten gehen, reicht es im Ausschlussverfahren ja nicht, dass den anderen Tatverdächtigen nichts zu beweisen ist. Es muss vielmehr positiv bewiesen sein, dass sie es nicht waren.
War es überhaupt eine Beziehungstat, der Andrea Z. zum Opfer gefallen ist? Die Richter schließen das daraus, dass sich in der Wohnung keine Einbruchsspuren fanden, der Täter also von seinem Opfer eingelassen worden sein muss oder sogar einen Schlüssel zum Haus hatte. Großen Aufwand, das muss man anerkennen, haben die Ermittler betrieben, um diese Prämisse abzusichern. Mit allen möglichen Einbrechertricks haben sie versucht, die Wohnungstür spurlos zu öffnen – vergeblich. Auch die Probe, ob ein gewaltfreies Eindringen durch das gekippte Schlafzimmerfenster vom Garten aus möglich gewesen wäre, verlief negativ.
Als Beziehungstäter kommen neben Wörz noch Andreas Vater Wolfgang, ihr Liebhaber und Kollege Thomas H. und dessen Ehefrau Daniela in Betracht. Zu quälend ist es, nach Beweisen zu suchen, dass Vater Z. seine Tochter nicht gewürgt hat, Daniela als Täterin scheidet schon deshalb aus, weil der Nachbar am Tatort eine Männerstimme gehört hat. Es reicht, den Blick auf Thomas H. zu lenken.
Der Mann hatte ein Motiv: Seine Ehefrau hatte ihm zuvor ein Ultimatum gestellt, sich von seiner Geliebten Andrea zu trennen – sonst sei es zu Ende mit der Ehe. War er darüber mit Andrea in Streit geraten? Hatte sie ihn mit der Drohung erpresst, der Ehefrau die ganze Wahrheit über ihr Verhältnis zu sagen? Oder bei den Kollegen die Sexualpraktiken ihres Ausbilders auszuplaudern? Hatte Thomas H. die Nerven verloren? Möglich: Thomas H. hatte einen Hausschlüssel von Andrea, und Spuren zu ihm passender DNA wurden rätselhafterweise von Gutachtern in den Fingerlingen am Tatort gefunden.
Das Gericht schloss H.s Täterschaft dennoch sicher aus mit dem Argument: H. hat ein Alibi.
Dass Thomas H. die Nacht im Bett verbracht hat, und nicht bei Andrea, das hat vor Gericht seine Frau Daniela bestätigt – »voll glaubhaft«, wie die Richter fanden. Über die Glaubwürdigkeit einer Frau, die gegen ihren Mann aussagen muss, während sie um den Fortbestand ihrer Ehe fürchtet, kann sich jeder Leser selbst ein Urteil bilden. Und über den Scharfsinn von Juristen, die ihrer Beweisführung hinzufügen: »Wenig naheliegend wäre auch, dass Thomas H., unterstellt, er hätte in dieser Nacht die Tat zum Nachteil seiner Geliebten Andrea Z. begangen, nur ca. drei Stunden nach dem Tatgeschehen mit seiner Ehefrau einvernehmlich Intimverkehr hat.« Immerhin, pflichtgemäß fügte das Gericht hinzu, auch der Sex im Morgengrauen sei objektiv nachgewiesen: mit DNA-Spuren aus der Unterhose.
Das Gericht hat die Wahrheit gefunden: »Eine zusammenfassende Würdigung dieser Beweisumstände rechtfertigt nach Überzeugung des Schwurgerichts den zweifelsfreien Schluss, dass der Angeklagte die Tat begangen hat.« So macht man das. So dreht man einem Angeklagten einen Strick. Vielleicht haben die Richter im Eifer, endlich die grässliche Tat an einer Polizistin zu sühnen, gar nicht bemerkt, wie dramatisch sie gegen alle Regeln der Beweisführung verstoßen haben. Wie kleine eifrige Rädchen der großen Mühle haben sie den Ermittlungsschrott der Polizei geschluckt, verdaut – und einen Justizirrtum produziert.
Der Pfarrer läutet die tiefe Glocke
Es beunruhigt sehr, dass niemand den Richtern in den Arm fiel. Die Kollegen vom Bundesgerichtshof, der Kontrollinstanz, verwarfen die Revision der Anwälte von Wörz im August 1998 als unbegründet. Rechtsfehler, entschieden die Oberjuristen, seien in dem Urteil nicht erkennbar. Auch diese Sicherung der gefährlichen Justizmaschine funktionierte nicht. Hinter Gittern richtete sich Wörz auf ein Leben im Gefängnis ein.
Doch so einfach sperrt man ein Mitglied des Gräfenhausener Motorrad-Clubs »Whitebirds« nicht ein. Harrys Motorradkumpel organisierten die öffentliche Empörung über das Unrecht, das dem Motorradfahrer Wörz geschehen war. Sie richteten im Internet eine Homepage für Harry ein, es gab Demonstrationen, Benefizkonzerte. Die Gräfenhausener kämpften für die Wahrheit, für die wahre Wahrheit. Die Rockband »Zero« erfand das Solidaritätslied »Harry«. Ein Polizist war es, der das Lied auf CD brannte. In der Haftanstalt Heimsheim, wo Harry derweilen saß, standen die Besucher mit den guten Wünschen Schlange – Harrys Mutter führte daheim eine Warteliste, weil die Besuchszeiten begrenzt waren.
Gerechtigkeit von unten? So viel idyllische Solidarität kann nicht über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. Im selben Land, in dem Bürger mit Fackeln Mahnwachen vor den Häusern möglicherweise gefährlicher ehemaliger Sexualverbrecher veranstalten, um die Justiz zu größerer Härte, zu unbegrenzter Sicherungsverwahrung der gefürchteten Nachbarn anzustacheln, gehen Hunderte auf die Straße, um der Justiz einen Mann zu entreißen, den sie als Gewalttäter mit allen Mitteln des Rechts festhält. Kann es ein Rechtsstaat hinnehmen, dass die Bürger ihm nicht mehr glauben? Strafe findet ihre Rechtfertigung in der »Bewährung der Rechtsordnung«, so sagen die Juristen. Strafe muss sein, damit die Bürger merken, dass das Recht ernst gemeint ist.
Die Bürger von Gräfenhausen jedenfalls waren nicht zu überzeugen.
Ende der Leseprobe