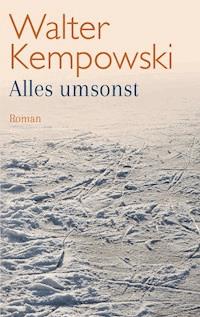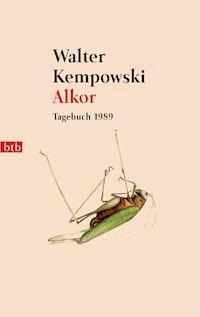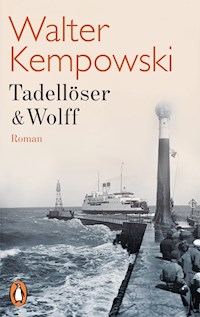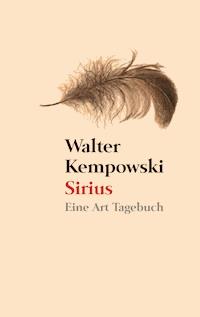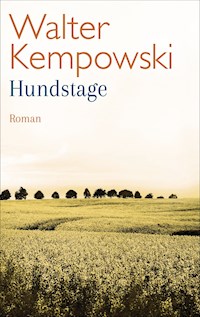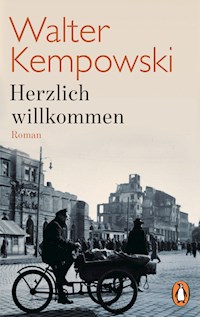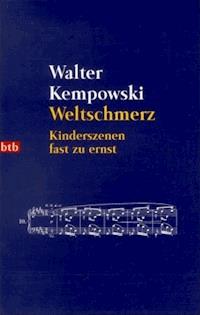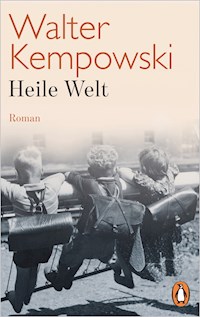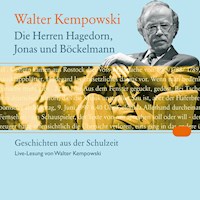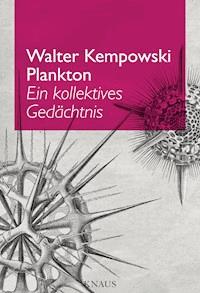2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Aus einer Fülle von Briefen, Tagebüchern, Aufzeichnungen namenloser und prominenter Zeitgenossen, aus Bildern und Dokumenten hat Walter Kempowski in jahrelanger Arbeit sein monumentales „Echolot“ geschaffen. Eine bis dahin noch nie geleistete Rekonstruktion von Alltagsgeschehen und historischen Ereignissen einer besonders dramatischen Epoche der deutschen Geschichte, die bei ihrem Erscheinen für Furore sorgte. Und Kempowski arbeitete weiter an seiner gewaltigen Collage, im Herbst 1999 erschien der zweite Teil des „Echolots“, die „Fuga furiosa“, deren Schlusspunkt die Bombardierung Dresdens bildet.
Wie wohl kaum ein zweites Ereignis der deutschen Geschichte hat sich diese traumatische Erfahrung in das kollektive Gedächtnis der Nation eingegraben. Walter Kempowski nimmt dies zum Anlass, um in dem Band „Der rote Hahn“ die Quellen zum 13. und 14. Februar 1945 um neues Material ergänzt zu präsentieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Walter Kempowski
Der rote HahnDresden im Februar 1945
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.
1. Auflage
Taschenbuchausgabe November 2001
Copyright © 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 978-3- 41-01309-7
www.btb-verlag.de
Vorwort
Es besteht kein Mangel an Büchern über den Untergang des alten Dresden. Weshalb also jetzt noch ein weiteres? In meiner letzten Publikation, dem »Echolot 1945«, der »Fuga furiosa«, habe ich bereits alles erreichbare Material über die schrecklichen Ereignisse vom Februar 1945 ausgebreitet. Ich stellte es in einen größeren Zusammenhang und versuchte damit deutlich zu machen, was mit dem Satz »Wer Wind sät, wird Sturm ernten« gemeint ist. Und nun noch einmal Dresden?
Ich habe das alte Dresden gekannt, 1944 habe ich es vom »Weißen Hirsch« aus liegen sehen, als Norddeutscher etwas verwundert über die höfische Pracht. Ich war noch einmal kurz nach der Februar-Katastrophe dort und später, als man bereits die Reste der alten Stadt abzuräumen begann. Und wieder stand ich drüben am anderen Ufer, und es stellte sich ganz von selbst die Frage: Wie konnte das geschehen? Ein solches Maß an Zerstörung läßt sich doch nicht abtun mit einem Hinweis auf Ursache und Wirkung, oder etwa mit dem Achselzucken so mancher Nachkriegsdeutscher: Selber schuld...
Der Wiederaufbau der Frauenkirche, dieses Unterfangen eines von Liebe durchdrungenen Trotzes der Bürger. Wer Augenzeuge wird der Sorgfalt, mit der er vorgenommen wird, der umsichtigen Organisation, mit der Vernichtetes ersetzt, Aufbewahrtes an die rechte Stelle gerückt wird, ist bewegt von dem heilsamen Aufbruch, durch den das für immer verloren Geglaubte neu entsteht.
Auch die Rekonstruktion von etwas Vernichtetem gehört in den Sinnzusammenhang jenes oben zitierten Wortes: »Wer Wind sät, wird Sturm ernten.« Denn jeder Wiederaufbau ist eine Reaktion auf die Aussaat des Windes. Man könnte es mit dem Wort des jungen Goethe ausdrücken, das Böse betreffend, das eben doch letzten Endes das Gute provoziert.
Noch ein weiteres Buch über die Hölle von Dresden – ja, und es wird nicht das letzte sein, denn von einem Jahrzehnt zum anderen wird sich unser Gedenken in neue Zusammenhänge gesetzt sehen.
Und: Wir hören nicht auf uns zu wundern über die Gewissenlosigkeit einzelner, die auf rote Knöpfe drücken, und über den Mut und die Tatkraft der anderen, die immer wieder alles aufräumen müssen.
Walter Kempowski
Carl Gustav Carus 1789–1869
Dresden 1814
Einer meiner gewöhnlichen Abendspaziergänge war damals der über die dicht vor meiner Wohnung beginnende schöne Brühlsche Terrasse, und wie eigen dort, wo man damals noch meist sehr einsam sich befand, oft die Witterung und Lichteffekte mich innerlich bewegten, davon gibt vielleicht folgende Briefstelle deutlichere Kunde, indem sie zugleich den poetischen Reflex zur vollsten Anschauung bringt, welchen dergleichen größere und mir so neue Szenerien auf mein inneres Leben damals werfen konnten: Ich komme eben von einem Spaziergange im Brühlschen Garten in später Dämmerung. Der Himmel war gleichförmig grau; kleinflockigen Schnee trieb der Nordwind über die glatte Terrasse. Die Elbe verlor sich aufwärts und abwärts im Nebelgrau; die gewaltige Kuppel der Frauenkirche ragte als dunkler Schatten über die niedrigen Häuser, und die Brücke erschien mir wie ein Trauerband über den schönen Strom gelegt, als Zeichen seiner baldigen Erstarrung. Das Eigentümlichste aber war die Vorbereitung zu dieser Erstarrung selbst: es war der Fluß nämlich bedeckt mit tausend und tausend langsam forttreibenden, dünnen Eisschollen, gleichsam weißen Inseln, welche im langsamen Bewegen fortwährend zusammenstießen und seltsam aneinander klirrten. Es war höchst anziehend, zu sehen, wie aus dem Nebel die Massen hervorschwammen, näher kamen, mit dem eigenen monotonen Geräusch vorüberzogen und endlich hinter dem dunklen Bande der Brücke verschwanden. Es war mir, als blickte ich auf den Strom der Zeiten, sähe unzählige Geschlechter aus dunklen Quellen hervortreten, vorüberrauschen und verschwinden. Ich dachte an vieles dabei! Das Ernste des Schauspiels wurde noch gehoben dadurch, daß alle kleinen Schiffchen und Kähnlein dem erstarrenden Strome ausgewichen waren und er so ganz sich selbst überlassen erschien, ein großes einsames Bild periodisch erlöschenden Lebens.
______________________
Dienstag, 13. Februar 1945
FASTNACHT
Berlin/Reichskanzlei Dr. Theodor Morell 1886–1948
13.35 Uhr mittags: Traubenzucker und Betabion forte i.v. – Führer ist etwas eigenartig zu mir, kurz und in verärgerter Stimmung.
BerlinAdolf Hitler 1889–1945
Politisches Testament
Es ist das Verdienst des Nationalsozialismus, daß er zum ersten Mal die jüdische Frage realistisch angepackt hat.
Die Juden haben den Antisemitismus immer selbst ausgelöst. Im Laufe der Jahrhunderte reagierten die nichtjüdischen Völker, von den Ägyptern bis zu uns, auf die gleiche Art. Es kommt ein Augenblick, da sie der Ausbeutung durch den jüdischen Betrüger müde werden. Dann geraten sie in Erregung, wie ein Tier das Ungeziefer abschüttelt. Sie reagieren immer heftiger und zuletzt kommt es zur Empörung. Es ist dies eine Art instinktiver Abwehrreaktion, eine Reaktion der Abneigung gegenüber dem Fremden, der sich nicht anpaßt, sondern der Verschmelzung widersetzt, der sich abschließt und zugleich aufdrängt, der einen ausnützt. Der Jude ist seinem Wesen nach der Fremde, der sich nicht angleichen kann und nicht angleichen will. Darin unterscheidet er sich von den anderen Fremden: er beansprucht Rechte als Glied der staatlichen Gemeinschaft und bleibt doch ein Jude. Er hält es für ein ihm zustehendes Recht, solcherart eine Doppelrolle zu spielen, und steht mit dieser Unverfrorenheit in der Tat einzig da in der Welt.
Die Lage in Ostpreußen ist geradezu fürchterlich geworden. Wir können unsere Trecks kaum noch bewegen; sie liegen fest und es stehen auch nur ungenügend Nahrungsmittel zur Verfügung, um sie zu ernähren. Das Fiasko der ostpreußischen Trecks wird hauptsächlich der Partei in die Schuhe geschoben, und man schimpft auf die Parteiführung in Ostpreußen nach Strich und Faden. Ich glaube auch, daß Teile der ostpreußischen Partei ihrer Aufgabe nicht gewachsen gewesen sind. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, daß der Einbruch in Ostpreußen so plötzlich kam, daß man die Menschen gar nicht mehr wegführen konnte.
Die Truppe ist auch in Ostpreußen stark angeschlagen. Ich entnehme das einem Bericht von Heysing, der gerade aus dem ostpreußischen Raum nach Berlin gekommen ist. Vor allem hat die Truppe außerordentlich schwere Blutverluste erlitten, was natürlich immer sehr deprimierend auf die Moral wirkt.
Dr. Rudolf Semler *1913
Der Luftkrieg wird immer schrecklicher. Hitler hat noch keine einzige der bombardierten Städte besucht; er hat in Berlin vielleicht die Strecke vom Anhalter Bahnhof bis zur Reichskanzlei gesehen – mehr nicht. Die Leute in seiner Umgebung sagen, daß er nie Berichte über die zerstörten Städte liest.
Kürzlich schickte ihm Goebbels ein Album mit Fotografien von zerstörten und beschädigten Denkmälern und berühmten Gebäuden. Bormann sandte das Album zurück mit einer Notiz, die besagte, daß der Führer nicht mit derartig belanglosen Angelegenheiten belästigt werden möchte.
Hitlers irrsinnige Hoffnung, daß die Feinde sich untereinander zerstreiten, ehe sie Deutschland verwüsten, läßt ihn mit voller Überzeugung weitermachen. Der Urheber dieser Theorie ist natürlich Goebbels. Die Spannungen zwischen den Alliierten ermuntern zu diesem weit verbreiteten und sehr beliebten Glauben.
BerlinJoseph Goebbels 1897–1945
Er wirkt geradezu aufreizend, wenn in Moskau erklärt wird, die sowjetische Soldateska habe sich im deutschen Reichsgebiet keinerlei Greueltaten zuschulden kommen lassen, im Gegenteil, ihre Disziplin bürge für ein humanes Auftreten; sie verteidige nicht nur das Vaterland, sondern auch die menschliche Würde. Wort und Papier sind geduldig; aber wie die Sowjets es mißbrauchen, das überschreitet alle bisherigen Vorstellungen. Daß die blutrünstigste Diktatur, die es je in der Geschichte gegeben hat, sich mit einem derartigen liberal-humanitären Phrasement umgeben kann, das steht in der Weltgeschichte einzig da.
Außerdem berichten die sowjetisch[e]n Nachrichten[büros], daß unsere Bevölkerung in den besetzten Ostgebieten sich vorerst einmal an die bolschewistische Soldateska heranzuschmeißen versuche. Sie wende sich in schärfster Form gegen den Nationalsozialismus, und die Ostarbeiter versuchten in den verschiedenen Städten, besonders aber auf dem Lande die Herren über die Deutschen zu spielen. Ich halte diese Meldungen gelinde gesagt für leicht übertrieben. Ich kann mir vorstellen, daß unsere Bevölkerung in den besetzten Ostgebieten vielfach von Angst und Schrecken befallen ist; daß sie dabei aber ihre Würde verliert, das ist für mich unvorstellbar. [...]
Am Abend kommt dann das Kommuniqué über die Dreierkonferenz, die nach einem Vorschlag Stalins die »Konferenz von Jalta« genannt wird. Man annonciert uns in diesem Kommuniqué die stärksten militärischen Schläge, und zwar sowohl im Osten wie im Westen wie im Norden wie im Süden. Die Bedingungen des Friedens, ja des Waffenstillstands, sollen uns erst nach der militärischen Niederlage des Reiches mitgeteilt werden. Die drei Mächte hätten sich darüber geeinigt, in festen Zonen das deutsche Reichsgebiet zu besetzen. Zur Abrüstung des Reich[es un]d zur Vernichtung seiner Kriegsindustrie soll eine zentrale interalliierte Kontrollkommission eingesetzt werden, die ihren Sitz in Berlin hat. Frankreich soll ebenfalls an der Besetzung eines bedeutenden Reichsgebietes beteiligt werden. Deutschland werde seine Streitkräfte entwaffnen und seinen Generalstab auflösen müssen. Das letztere würde ja nicht das Schlimmste sein; das hatten wir ja sowieso vor; wenn das die einzige Bedingung wäre, die die Feindstaaten stellten, dann wäre darauf allein einzugehen. Im übrigen hätten die Feindstaa[ten di]e Absicht, unsere gesamte militärische Ausrüstu[ng z]u zerstören; die deutsche Industrie müßte unter Kontrol[le ge]stellt werden, die Kriegsverbrecher so schnell wie m[ögli]ch zur Aburteilung gelangen und die Nazi-Partei mit a[...] [i]hren Einrichtungen mit Stumpf und Stiel ausgerottet wer[den]. [Au]ßerdem sei Deutschland verpflichtet, die in den fe[indli]chen Kriegsgebieten angerichteten Schäden wiedergutzumachen; und dann solle die Welt Frieden und Sicherheit erhalten. Frieden und Sicherheit sollten gewährleistet werden durch Interimsregierungen, die von den Feindmächten in allen europäischen Staaten eingesetzt werden. Diese sollten dann ihre Bestätigung durch eine freie Wahl erhalten. Wesentlich ist, daß Stalin sich dazu bereitgefunden hat, den Lubliner Sowjet durch, wie es im Kommuniqué heißt, demokratische Elemente zu erweitern. Es soll demnach aus ihm eine Regierung der nationalen Einigkeit gebildet werden. Die Curzon-Linie sei im großen gesehen die westliche Grenze der Sowjetunion. Polen solle dafür durch bedeutende deutsche Ostgebiete entschädigt werden. Kurz und gut, dies Kommuniqué zeigt, daß Stalin in der Tat den Westmächten wenigstens zum Schein so weit entgegengekommen ist, daß sie das Gesicht wahren können. Es ist nach diesem Kommuniqué durch die Krimkonferenz für uns weder etwas gewonnen noch etwas verloren. Selbstverständlich wird in den nächsten Tagen vor allem die Londoner Presse sich triumphierend gebärden und uns feierlich attestieren, daß damit unsere letzten Chancen, den Krieg zu gewinnen, verloren gegangen seien. Aber das ist nicht so ernst zu nehmen. Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten. Es ist an diesem Tage noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Wenn das Kommuniqué auch mehr Substanz enthält, als man zuerst glaubte vermuten zu dürfen, so stellt es doch keine Lösung der zwischen den Feindmächten latent vorhandenen Konfliktstoffe dar. Im übrigen bleibt die Reaktion insbesondere in England abzuwarten. Diese wird nach anfänglicher Begeisterung sicherlich sehr reserviert sein. Denn daß Churchill und Roosevelt im großen und ganzen den Lubliner Sowjet anerkannt haben, wird man zweifellos als eine englisch-amerikanische Niederlage ansehen. Im übrigen ist festzustellen, daß das Kommuniqué nicht von so rüdem und unverschämten Ton ist wie seinerzeit das Kommuniqué von Teheran. Allerdings enthält es mehr politische Entscheidungen, die für uns im Augenblick sehr unangenehm sind. Ich bin froh, daß die Dreierkonferenz nun zu Ende ist. Man weiß jetzt, woran man ist, man kann wieder eine klare Stellung beziehen. Wir müssen versuchen, militärisch wieder den einen oder den anderen Erfolg zu erzielen, und dann werden wir uns weiter sprechen.
BerlinAus der Pressekonferenz der Reichsregierung
.Tagesparole des Reichspressechefs
1. Die unglaubliche Erklärung des alliierten Hauptquartiers, die es fertig bringt, die Terrorabsichten der anglo-amerikanischen Luftwaffe bei ihren Angriffen auf Deutschland zu bestreiten, ist angesichts der gravierenden Tatsachen in massiver Form zu widerlegen.
.Erläuterung zu Punkt 1 Von den Zeitungen wird im Sinne der Tagesparole eine gut fundierte, geharnischte Erwiderung auf die Erklärung des alliierten Hauptquartiers erwartet, wobei besonderer Wert darauf gelegt wird, dass das hier vorliegende Material nicht durch eine flüchtige Beantwortung verzeichnet wird, sondern dass hier mit wirksamen und kräftigen Argumenten eingetreten wird. Insbesondere muss – wie es schon die Tagesparole sagt – auf den Zynismus dieser alliierten Erklärung hingewiesen werden, wobei die zahlreichen Stimmen entgegengehalten werden sollen, die aus englischer und amerikanischer Quelle in den letzten Tagen vorlagen, und die darüber frohlockten, dass die bombardierten Städte voller Flüchtlinge waren, und dass daher die Todesopfer sehr hoch sein würden. Die Zeitungen werden gebeten, in diesem Zusammenhange nicht noch einmal die verwüsteten Kulturgüter anzusprechen, da es nicht am Platze ist, hier in Kulturpessimismus zu machen.
.
KölnDer Pfarrer Robert Grosche 1888–1967
7 Uhr Messe in St. Andreas. Ich feiere die Messe vom vergangenen Sonntag, lese noch einmal die Epistel aus 1 Kor 13, deren Mahnungen wir alle immer wieder brauchen: Caritas patiens est... [Die Liebe ist geduldig ...] Dann das Evangelium, das man einmal von der Mitte aus auslegen müßte: Sie verstanden nichts von all dem. Wir verstehen es ja nie, warum Gott uns in das Leid hineinführt.
HamburgDer Landesbischof Franz Tügel 1888–1946
Lieber Herr Kollege Wittmaack
Für Ihren Gruß aus der Polargegend danke ich Ihnen herzlich. [...] Es ist gut, daß Sie Gedanken über den Römerbrief und die Evangelien aufschreiben, die für eine Religionslehrerin bestimmt sind, und auf diese Weise eine gewisse theologische Arbeit treiben. Wenn Sie meinen, wir müßten wohl auf diese stille Arbeit in der Studierstube, vom Geist des Gebetes getragen, in Zukunft gründlich verzichten, dann möchte ich Ihnen doch widersprechen. Es mag freilich sein, daß die neue Weltlage, die heraufzieht, solche Stille nicht zuläßt, aber dann wird überhaupt alle kirchliche Arbeit von Gewicht und Segen in Gefahr sein. Im Gegenteil dazu glaube ich, daß wir einer Zeit entgegengehen, die bei aller Bescheidenheit und Einschränkung im äußeren Leben uns gestattet, wieder aus den Quellen zu schöpfen, die nur in der Stille der Studierstube und der Gebetskammer fließen. Und zwar einfach darum, weil die Zukunft uns dazu zwingen wird! Wir wollen also bei aller Nüchternheit im Blick auf die Wirklichkeit der Hoffnung sein, daß wir einer Auferstehung des Geistes entgegengehen!
KalabrienCesare Pavese 1908–1950
Die einzigartige Tatsache, an der du dich so begeisterst, darf in Wirklichkeit, um ihren Wert zu haben, nicht geschehen sein. Sie muß Mythos bleiben, im Nebel der Tradition und der Vergangenheit, das heißt der Erinnerung. Spiritistische Ereignisse, Wunder usw. ärgern dich in der Tat nur, weiter nichts. Da diese Dinge geschehen, sind sie nicht mehr einzigartig, sondern normale Begebenheiten, wenn auch außerhalb der Naturgesetze. (Da sie geschehen, sind sie Teil eines Gesetzes, sei es auch eines okkulten.)
LeunaRenate C. *1932
Als ich heute aus der Schule kam, sah ich, daß vor unserem Hause ein Feuer brannte. Die Kinder unseres Nachbarn hatten es angefacht. Das Feuer war ziemlich groß. Mutti hat sie sehr ausgeschimpft. »Wenn jetzt Flieger kommen«, sagte sie, »die sehen doch das Feuer, und sie schmeißen ihre Bomben darauf.« Übrigens habe ich heute eine 5 in der Englischen geschrieben, mit 11 Fehlern.
Der Vormittag
DresdenGerhart Hauptmann 1862–1946
Und eine furchtbarere schlimme Nacht. Dann Karlsbader: erbärmliche Schwächefolgen. Allerdings einigermassen nachholenden Vormittagsbetäubung. Draussen herrlich gleichgiltig, schönes Wetter.
Einige Schritte im Freien.
Wir trafen auf Liegekur: meine lieben Freunde Halbe, Rittner, König ihr wartet auf mich. Ihr habt überwunden. Kommt zu mir alle! ihr seid zuviel um Euch zu kennen. Aber ich fühle[,] fühle euch alle! »Die Natur« hat meinen Vater schwer vor dem Tode gequält, meine Mutter nicht! Ebenso ist sie sanft gewesen mit meiner Schwester.
Gott muss Goethe sehr geliebt haben, denn er gab ihm scheinbar ein seliges Ende.
Trag ein schon des Endes Pein: gebt mir einen Rest von Sein
DresdenGerhart Hauptmann 1862–1946
Entrückt dem Wein, den du, Hafis, mir schenktest, hielt mich ein schwarzer Dämon fest,
und jenen goldnen Nachen, den du lenktest, stieß er hinab ins Meer von Mord nach Pest, Des Lebens ganzer Sinn ward aufgehoben und in qualvollen Widersinn verkehrt,
er war von Fluch statt Segen ganz durchwoben, was Wahrheit, schien in Lüge ganz verkehrt. Nun heut ein holder Knabe reicht durchs Fenster mir eine Zauberblume her,
da schwinden hin die ärgsten der Gespenster, und Gott, der Gute, stellt sich wieder her.
Dresden Ernst Heinrich Prinz von Sachsen 1 896–1971
Ich fuhr am zeitigen Vormittag in die Stadt, und mein Weg führte mich am Neustädter Bahnhof und am Japanischen Palais vorbei zur Friedrich-August-Brücke. Der Verkehr wogte hin und her, ich genoß wie immer den wunderbaren Anblick der Silhouette der Altstadt mit den Wahrzeichen Dresdens, der Kuppel der Frauenkirche, der Brühlschen Terrasse, dem Schloß, der italienischen Hofkirche, der Semper-Galerie und der Oper. Wohl kaum eine andere deutsche Stadt an einem großen Fluß wies ein solches Bild auf. Ich liebte meine Geburtsstadt und die Residenz meiner Väter mit allen Fasern meines Herzens, ich war geradezu verliebt in sie. Sie zu missen war unvorstellbar. Und doch sollte zehn Stunden später die ganze Herrlichkeit in Schutt und Asche liegen!
Ich fuhr zum Palais an der Parkstraße und erledigte dort einige Verwaltungsangelegenheiten. Es war das letzte Mal, daß ich es betrat. Ich nahm meinen Lunch wie immer im »Englischen Garten« im letzten Zimmer unter dem Bild meiner Großtante, der Königin Carola. Acht Stunden später war dort nichts als ein Flammenmeer und ein wüstes Chaos von Balken und Steinen. Dann suchte ich meinen Zahnarzt auf, auch hier war ich das letzte Mal, denn das Haus brannte nieder. Am Spätnachmittag war ich bei Gina und ihrer Schwester zum Tee und einer Plauderstunde eingeladen. Ihre Wohnung lag in einer Villa im Süden der Stadt, im sogenannten Schweizerviertel. Es war friedlich und angenehm, die Zeit verging in anregenden Gesprächen.
DresdenOtto Griebel 1895–1972
Am Fastnachtsdienstag kramten die Kinder allerlei Maskerade aus den Kästen des alten, bunten Bauernschrankes und zogen lärmend in den Straßen herum, was nun einmal das Privileg der Jugend ist, die sich dieses auch in der Kriegszeit nicht nehmen ließ. Ich selbst hatte mir, wie gewöhnlich, mein rundes Tischchen neben den Sammlerschrank ans Fenster gerückt und gab mich unbesorgt musischen Dingen hin.
Nach dem Abendbrot zog ich mir dann meinen Mantel über, setzte den Hut auf und steckte zwei Tabakspfeifen in die Tasche zur wohlgefüllten Tabaksbüchse. Ich fuhr mit der Elektrischen bis zur Neuen Gasse, in der reges Leben herrschte, und trat dann bald in den
Kreis meiner Bekannten und Freunde, die bereits rings um den Stammtisch versammelt saßen.
Nun gab es viel zu erzählen, wobei mir verständlicherweise der Hauptteil zufiel. Die Wirtin traktierte uns nobel mit selbstgebackenen Plinsen und schwarzem Tee, dem ein ordentlicher Schuß langgehüteten Rums zugegossen ward. Tabak spendierte ich, und so wurde es immer gemütlicher im altvertrauten Kreise, wobei wir kaum merkten, wie die Zeit verstrich.
BreslauDer Dramaturg Hugo Hartung 1902–1972
Radio können wir nicht mehr hören, seit der Strom wegbleibt. Aber es sickern auch so alle möglichen beunruhigenden Nachrichten durch: Liegnitz soll in der Hand der Russen sein, und es kann sich nur noch um eine Frage von Tagen handeln, daß der Ring um Breslau geschlossen ist. Der wertvolle Materialtransport, den wir mit so vielen Mühen zusammengestellt haben, ist wieder in den Horst zurückgekommen. Das bedeutet, daß die Bahnstrecke in Richtung Westen unterbrochen ist. Artillerie und Granatwerferfeuer lassen am Abend den kleinen Schuppen am Rollfeld erzittern, in dem jetzt unsere Truppe einsatzbereit liegt. Westlich des Rollfelds geht ein Dorf in Flammen auf. Vielleicht ist es Kriptau.
»Morgen sind wir dran«, heißt es bei unseren Leuten.
(Dresden)Frida Mehnert 1889–1945
An ihre Schwägerin und ihren Bruder in Pirna Liebes Lenel u. Richard!
Nun ist schon Liegnitz besetzt und Görlitz wird geräumt. In Dresden wimmelt es von Flüchtlingen. Das Herz kann einem bluten. Und niemand macht ein Ende. Es wird nicht lange dauern, wird wohl Dresden auch geräumt. Wo soll man dann hin. Daß es einmal so ein Ende nimmt, das hätte niemand gedacht. Am Sonnabend sind 700 Mann Volkssturm fort in der Nacht. Die können einem Leid tun. Warum meldest Du Dich denn nicht mal krank. Ich sehe das schon kommen, die holen jetzt alles. Du wirst schon sehen, dann ist es zu spät. Aber Du hörst doch nicht. Du kannst eben nicht. Beim Karl haben sich auch viele krank gemeldet. Warum Du das nicht einmal tust. Das beunruhigt mich direkt. Also tue es nur. Jetzt ist es noch Zeit. Jetzt mußten die in Breslau geschanzt hatten heim laufen, anders war keine Möglichkeit.
Vor Weißig und auf dem Weißen Hirsch, da schanzen sie schon mächtig. Es ist zum Lachen. Und zum Volksopfer sind so viele schöne S.A.-Mäntel und Uniformen abgegeben worden, ich möchte wissen warum? Wo sie jeder S.A. Mann gebrauchen kann. Also Richard folge mir und melde Dich mal krank.
Da bleibt gesund, seid herzlich gegrüßt
von Eurer Frida und Karl.
BerlinAdolf Hitler 1889–1945
Politisches Testament
Der Nationalsozialismus hat die Judenfrage von Grund auf angepackt und auf den Boden der Tatsachen gestellt: er deckte die jüdischen Absichten auf die Weltherrschaft auf, er befaßte sich eingehend und gründlich mit ihnen, er warf die Juden aus allen Schlüsselstellungen hinaus, deren sie sich bemächtigt hatten, er trieb sie aus mit dem unbeugsamen Willen, den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift zu säubern. Es handelte sich dabei für uns um eine lebensnotwendige und in allerletzter Minute unternommene radikale Entgiftungskur, ohne die wir jämmerlich zugrunde gegangen wären.
Hatte aber dieses Vorgehen in Deutschland Erfolg, so bestand alle Aussicht, daß es Schule machte. Das war sogar zwangsläufig zu erwarten, denn es ist nur natürlich, daß das Gesunde über das Kranke triumphiert. Die Juden wurden sich dieser Gefahr bewußt, und darum entschlossen sie sich, alles aufs Spiel zu setzen und einen Kampf auf Leben und Tod gegen uns auszulösen. Sie mußten den Nationalsozialismus um jeden Preis zerschmettern und sollte die Welt darüber zu Grunde gehen. Noch kein Krieg bisher war ein so ausgesprochen und so ausschließlich jüdischer Krieg wie dieser.
Der Nachmittag
DresdenDer Oberzahlmeister Gerhard Erich Bähr 1894–1975
Ich hatte am 13. Februar mittags Handgranatenausbildung gehabt und ging, weil das schon um 2 Uhr zu Ende war, zur Heereskleiderkasse in der Pragerstraße, um noch einiges Nötige einzukaufen. Auch Hildegard war in der Stadt gewesen und bei ihrer Schwester. Ebenso hatte Ingelore Besorgungen gemacht. Als ich heimkam, spielten kleine Kinder in Faschingsaufzug auf der Straße. Einen Augenblick berührte mich das bitter in dieser Zeit äußerster Sorge. Auch Ingelore war entrüstet darüber. Ich meinte aber doch, ihr sagen zu müssen, daß die Kinder keinen Maßstab für den Ernst der Lage haben können. Und danach haben wir manches Mal daran gedacht, für wie viele dieser Kinder es wohl die letzte Freude gewesen sein mag.
DresdenVictor Klemperer 1881–1960
Dienstag nachmittag bei vollkommenem Frühlingswetter
Odysseus bei Polyphem. – Gestern nachmittag ließ mich Neumark [Dr. Ernst Neumark, Vertrauensmann der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland für den Bezirk Dresden] hinüberrufen; ich müßte heute vormittag beim Austragen von Briefen behilflich sein. Ich nahm das ahnungslos hin. Abends war Berger eine Weile bei mir oben, ich erzählte es ihm, und er sagte geärgert, das werde um Schanzarbeit gehen. Noch immer erfaßte ich nicht die Schwere der Bedrohung. Um acht Uhr war ich dann heute bei Neumark. Frau Jährig kam weinend aus seinem Zimmer. Dann sagte er mir: Evakuation für alle Einsatzfähigen, es nennt sich auswärtiger Arbeitseinsatz, ich selber als Entpflichteter bliebe hier. Ich: Also für mich sicherer das Ende als für die Herausgehenden. Er: Das sei nicht gesagt, im Gegenteil gelte das Hierbleiben als Vergünstigung; es bleibe ein Mann, dem zwei Söhne im ersten Weltkrieg gefallen, ferner er, Neumark, weiter Katz (wohl als EK-I-Träger, nicht als Arzt, denn Simon kommt fort), Waldmann und ein paar Schwerkranke und Entpflichtete. Mein Herz streikte in der ersten Viertelstunde vollkommen, später war ich dann vollkommen stumpf d.h., ich beobachtete für mein Tagebuch. Das auszutragende Rundschreiben besagte, man habe sich am Freitag früh im Arbeitsanzug mit Handgepäck, das eine längere Strecke zu tragen sei, und mit Proviant für zwei bis drei Reisetage in der Zeughausstraße 3 einzufinden. Vermögen, Möbel- etc. Beschlagnahme findet diesmal nicht statt, das ganze ist ausdrücklich nur auswärtiger Arbeitseinsatz – wird aber durchweg als Marsch in den Tod aufgefaßt. Dabei kommen die grausamsten Zerreißungen vor: Frau Eisenmann und Schorschi bleiben hier, Lisl, die elfjährige Sternträgerin, muß mit Vater und Herbert fort. Man nimmt auf Alter weder nach oben noch nach unten, weder auf siebzig noch auf sieben Rücksicht – es ist unbegreiflich, was man unter »arbeitsfähig« versteht. – Ich hatte erst Frau Stühler zu benachrichtigen, sie erschrak wilder als über den Tod des Mannes und raste mit starren Augen fort, Freunde für ihren Bernhard zu alarmieren. Dann fuhr ich, ich durfte fahren [Die Benutzung der Straßenbahn war Juden nur im Ausnahmefall mit Sondergenehmigung erlaubt], mit einer Liste von neun Namen ins Bahnhof- und Strehlener Viertel. Simon, nur erst halb bekleidet, bewahrte gute Fassung, während seine sonst robuste Frau fast zusammenbrach. Frau Gaehde in der Sedanstraße, sehr gealtert, riß die Augen übermäßig auf, öffnete immer wieder den Mund so weit, daß das vorgehaltene Taschentuch fast darin verschwand, und protestierte wild mit krampfhaftem Mienenspiel und leidenschaftlicher Betonung: Sie werde bis zum letzten gegen diese Verordnung kämpfen, sie könne nicht fort von ihrem zehnjährigen Enkel, ihrem siebzigjährigen Mann, ihr Schwiegersohn sei im Ausland gefangen »um der deutschen, der deutschen Sache willen«, sie werde kämpfen usw. Frau Kreisler-Weidlich, vor deren Hysterie ich mich gefürchtet hatte, war nicht zu Hause, ich warf das Blatt erleichtert in den Briefkasten. In derselben Franklinstraße hatte ich noch eine Frau Pürckhauer aufzusuchen. Ich traf sie mit ihrem arischen und tauben Mann. Kleine Leute. Sie waren die ruhigsten von denen meiner Liste. Schlimm war trotz ihrer Beherrschtheit eine Frau Grosse in der Renkstraße, hübsches Villenhaus an der Lukaskirche. Eine Frau mittleren Alters, eher damenhaft; sie wollte ihren Mann anrufen, stand hilflos am Telefon: »Ich habe alles vergessen, er arbeitet in einer Konfitürenfirma... mein armer Mann, er ist krank, mein armer Mann... ich selber bin so herzleidend ... « Ich sprach ihr zu, es würde vielleicht nicht so schlimm, es könne nicht lange dauern, die Russen stünden bei Görlitz, die Brücken hier seien unterminiert, sie solle nicht an Tod denken, nicht von Selbstmord reden... Ich bekam endlich die notwendige Empfangsunterschrift und ging. Kaum hatte ich die Korridortür geschlossen, hörte ich sie laut weinen. Ungleich jämmerlicher noch der Fall Bitterwolf in der Struvestraße. Ebenfalls ein armseliges Haus; ich studierte gerade vergeblich die Namenstafel im Hausflur, als eine junge, blonde, stupsnasige Frau mit einem niedlichen, gutgehaltenen Mädelchen von vielleicht vier Jahren kam. Ob hier eine Frau Bitterwolf wohne? Das sei sie selber. Ich müsse ihr eine böse Mitteilung machen. Sie las das Schreiben, sagte ganz ratlos mehrmals: »Was soll aus dem Kind werden?«, unterschrieb dann still mit einem Bleistift. Inzwischen drängte sich das Kind an mich, reichte mir seinen Teddybär und erklärte strahlend vergnügt: »Mein Teddy, mein Teddy, sieh mal!« Die Frau ging dann mit dem Kind stumm die Treppe hinauf. Gleich darauf hörte ich sie laut weinen. Das Weinen hielt an. – Ein sehr armseliges Haus war auch die Werderstraße 29. Die Frau Tenor dort, sagten Frauen auf der Treppe, sei nicht anwesend, aber ganz oben solle ich ihre Freundin aufsuchen. Eine kränkliche, junge, geradezu fein aussehende Person in sehr kümmerlichem Zimmer unterm Dach. Sie sprach sehr besorgt, ihre Freundin habe das immer gefürchtet, werde Selbstmord verüben. Ich predigte eindringlich Mut, sie möge der Freundin Mut machen. – Im Hause Strehlener Straße 52, wo wir wiederholt bei Reichenbachs und bei Seliksohns gewesen, hatte ich einer Frau Dr. Wiese den Befehl zu überbringen. Mir öffnete an deren Statt eine imposante Matrone in Hosen, eine Frau Schwarzbaum. Sie erzählte, und ich erinnerte mich des Falles, daß ihr eigener Mann im vorigen Jahre, um der Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, zusammen mit Imbach (cf. das Tagebuch vom Lothringer Weg) Selbstmord begangen habe. Zuletzt suchte ich vergeblich das winzige Haus Bürgerwiese 7, winzig, weiß, armselig, alt zwischen stattlichen Nachbarn, nach einer Frau Weiß ab. Die Bürgerwiese darf von Sternjuden nur im Zuge der Lüttichaustraße überquert, sonst nicht begangen werden; ich bin also dort seit Jahren nicht mehr gewesen. – Eben war Frau Jährig mit ihrer jungen Tochter hier, von der sie sich trennen muß. Auftrag von Neumark: Die Frau Weiß wohne bei ihrer Mutter Kästner; ich muß gleich noch einmal hin.
DresdenGiesela Neuhaus *1924
Dresden war militärisch nicht geschützt. Es gab keine Abwehr, keine Bunker, die Stadt würde verteidigungslos in die Hände der Russen fallen.
Während des ganzen Krieges hatte Dresden keinen Bombenangriff erlebt. Es blieb verschont. Bei Luftalarm, was häufiger vorkam, wenn Flugzeugverbände Dresden überflogen, suchte fast niemand seinen Keller auf. »Wir sind ja sicher, Dresden wird nicht angegriffen.«
Warum? Niemand wußte eine genaue Erklärung. Es gab die unterschiedlichsten Meinungen: »Die Tante von Churchill wohnt auf dem Weißen Hirsch.« Andere meinten, »viele Ausländerinnen, besonders Engländerinnen, haben in Dresden die verschiedenen Mädchenpensionate besucht. Sie lieben alle diese Stadt, in der sie ein paar Jahre ihrer Jugend verbracht haben«. Wieder andere: »Dresden ist die schönste Barockstadt Deutschlands, sie wird geschont werden.«
Kein Bunker wurde für die Bevölkerung gebaut, keine Luftabwehr war vorhanden. Nur der Gauleiter Mutschmann besaß einen eigenen Bunker.
Wir, das heißt meine Mutter, mein Vater und ich mit meinem viereinhalbjährigen Sohn, bewohnten eine Villa in einem Vorort von Dresden, dicht bei dem »Großen Garten« gelegen. Von meinem Mann, einem Berufsoffizier, hatte ich seit langer Zeit keine Nachricht. Ich wußte nur, daß er zum Schluß im Stab der Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Model, als General des Transportwesens gedient hatte.
Nach langem Hin und Her beschlossen wir, nach Thüringen in das Haus meiner Großeltern zu fahren. Dies alles wurde am Frühstückstisch besprochen.
Eine andere Überlegung kam hinzu.
Am Abend zuvor hatte ich wie fast immer, den schwedischen Sender eingestellt. Ich hörte »Frauen und Kinder aus Dresden raus«, dann traten Störungen ein. Ausländische Sender abzuhören war verboten, man mußte sehr vorsichtig sein.
Außerdem sagte mein Vater, bevor er zu seiner Zahnarzt-Praxis fuhr, daß Apolda etwa 230 Kilometer westlich von Dresden liege, und sicher die Amerikaner dort in Thüringen einmarschieren würden.
Kurze Zeit später nahm ich die Straßenbahn der Linie 9 vom Wasaplatz, stieg am Horst-Wessel-Platz um und fuhr zum Hauptbahnhof, um dort die Fahrkarten zu kaufen. Aber was war hier passiert?
Nur mühsam konnte ich mir einen Weg durch die dicht gedrängte Menge vor dem Bahnhof bahnen. Im Bahnhof selbst lagen Flüchtlinge Schulter an Schulter auf dem Fußboden. In Decken gehüllt oder mit Mänteln zugedeckt. Säuglinge und Kleinkinder schrien. Die Mütter waren verzweifelt, viele weinten, einige schliefen mit angezogenen Knien auf der Seite liegend. Ein Bild des Elends! Es waren Flüchtlinge aus Schlesien. Viele Familien waren getrennt worden. Einige Mütter riefen laut den Namen ihrer Kinder in der Hoffnung, sie hier in den Menschenmassen auf dem Dresdner Hauptbahnhof wiederzufinden. Sie hatten Schreckliches erlebt.
Mühsam versuchte ich, mir einen Weg zwischen Menschenleibern zu bahnen, um zu den Schaltern zu gelangen. Unmöglich. Ich stolperte und fiel. Lautes Schreien der verängstigten Menschen. Vorsichtig bahnte ich mir einen Weg zurück, dem Ausgang zu.
Mein Vater kam zeitig zurück. Er hatte soviel Geld wie möglich von der Bank abgehoben. Die Stadt ist mit Flüchtlingen vollgestopft, sämtliche Krankenhäuser und Lazarette sind überfüllt; arme, abgerissene Gestalten gehen von Tür zu Tür und bitten um Einlaß. »Ich kann verstehen«, meinte er, »daß es Dir nicht möglich war, Fahrkarten zu bekommen.«
Wir beschlossen, am nächsten Tag mit unserem Wagen aus Dresden rauszufahren, Richtung Thüringen. Der Wagen war jahrelang nicht gefahren worden. Der Tank war aber voll Benzin. Eine Strecke weit würden wir schon kommen. Merkwürdig, wie schwer es war, die Koffer zu packen.
So viele Sachen, die wir mitnehmen wollten, waren unnötig. Hauptsächlich brauchten wir Decken, warme Kleidung zum Wechseln, festes Schuhwerk und viele Lebensmittel. Außerdem packten wir noch einige Wertgegenstände ein und nähten den Schmuck in die Kleidungsstücke, die wir trugen.
Dem kleinen Jürgen schien das alles kolossalen Spaß zu machen. Er schleppte die Koffer ran, suchte unter seinen Spielzeugen aus, was er mitnehmen wollte. Seinen kleinen Hasen gab er nicht aus Hand. Den durfte er auf keinen Fall vergessen.
BernDie Schweizer Radio-Zeitung
Deutschland
Gemeinschaftsprogramm
5.30 Nachrichten
5.40 Frühkonzert, dazwischen 7.00 Nachrichten 7.10 Zwischenspiel
7.15 Eine chemische Betrachtung zum Hören und Behalten 7.45 Musik am Morgen 9.00 Nachrichten
9.05 Unterhaltungsmusik 10.00 Musik am Vormittag 11.00 Bunte Klänge
12.00 Landfunk
12.10 Musik zur Werkpause, dazwischen 12.20 Nachrichten und Lagebericht
14.00 Nachrichten und Wehrmachtsbericht
14. 15 Allerlei von zwei bis drei mit Herbert Jäger 15.00 Nachmittagskonzert des Münchner Rundfunkorchsters
16.00 Unterhaltungsmusik mit Solisten
17.00 Nachrichten
17.15 Kurzweil am Nachmittag
18.30 Wir raten mit Musik
18.45 Zwischenspiel
RAF Bomber Command Headquarter England
Intelligence Narrative of Operations No. 1007. Einsatzbefehl an die britischen Bomberbesatzungen Dresden, die siebtgrößte Stadt Deutschlands – und nicht viel kleiner als Manchester – ist auch die größte bebaute Fläche, die noch nicht bombardiert wurde. Mitten im Winter, mit Flüchtlingsströmen in westlicher Richtung und mit Truppen, die unterzubringen sind, werden Quartiere dringend gebraucht, nicht nur für Arbeiter, Flüchtlinge und Truppen, sondern auch für die aus anderen Landesteilen verlegten Verwaltungsdienststellen. Früher bekannt für sein Porzellan, hat sich Dresden zu einer äußerst wichtigen Industriestadt entwickelt, und wie jede andere Großstadt verfügt es über vielfältige Telefon- und Eisenbahneinrichtungen. Daher ist es besonders geeignet, die Verteidigung jenes Teiles der Front zu steuern, der von einem Durchbruch Marschall Konjews bedroht ist.
Mit dem Angriff ist beabsichtigt, den Feind dort zu treffen, wo er es am meisten spüren wird, hinter einer teilweise schon zusammengebrochenen Front gilt es, die Stadt im Zuge weiteren Vormarsches unbenutzbar zu machen und nebenbei den Russen, wenn sie einmarschieren, zu zeigen, was das Bomberkommando tun kann.
DresdenDer Domkirchenprobst Wilhelm Beier †1945
Gebet während einer öffentlichen Andacht
am Nachmittag
Du im heilgen Sakrament verborgener Gott,
schau auf uns in Deiner Barmherzigkeit
und auf all die Not unseres Vaterlandes
und aller Völker,
auf den Kummer und das Elend der Familien,
der Jugend und der Kinder.
Gib Frieden unseren Tagen und erhöre unser Flehen.
Wir weihen uns Dir ganz und bieten uns Deiner göttlichen Barmherzigkeit als Sühne an. Nimm mich, und alle, die hier versammelt sind,
die ganze Gemeinde, und wende das Unglück der Tage.
Verzeih allen, uns und den anderen,
die die Not der Zeit heraufbeschworen haben.
Verzeih auch denen, die Dich hassen und verfolgen.
Rechne ihnen das in Deiner Barmherzigkeit nicht an.
Laß sie alle das Elend und ihre Schuld erkennen
und für die Ewigkeit nicht verloren gehen.
Darum bitten wir Dich, Herr.
Gib Frieden unseren Tagen,
allen Völkern und jedem einzelnen von uns.
Darum bitten wir Dich, o Herr!
Und laß uns darum nicht vergeblich flehen.
Amen
BerlinAdolf Hitler 1889–1945
Politisches Testament
Ich jedenfalls habe das Weltjudentum gezwungen, die Maske fallen zu lassen, und selbst wenn unsere Anstrengungen fehlschlagen, so wird es sich nur um einen vorübergehenden Fehlschlag handeln, denn ich habe der Welt die Augen geöffnet über die jüdische Gefahr.
Unser Vorgehen hat den Juden gezwungen, aggressiv zu werden. In dieser Form ist der Jude weniger gefährlich als im Gewande des heimtückischen Duckmäusers. Hundertmal lieber ist mir der Jude, der sich zu seiner Rasse bekennt, als einer, der sich für jemanden ausgibt, den nur die Konfession von uns unterscheidet. Wenn ich diesen Krieg gewinne, dann setze ich der jüdischen Weltmacht ein Ende, ich versetze ihr den Todesstreich. Verliere ich diesen Krieg, dann ist der jüdische Triumph noch lange nicht berechtigt, denn die Juden würden darüber außer sich geraten und den Verstand verlieren. Sie würden ihre Anmaßung derart auf die Spitze treiben, daß sie selber damit wieder die Nägel zu ihrem Sarge schlagen. Natürlich würden sie weiter ihr Doppelspiel treiben, indem sie in allen Ländern die vollen Staatsbürgerrechte beanspruchen, ohne auf ihren Dünkel als Angehörige des auserwählten Volkes zu verzichten. Doch der jüdische Leisetreter hätte ausgelebt, an seine Stelle träte der siegesbewußte Jude – ebenso dreckig und stinkig wie der andere, wenn nicht noch mehr. Damit wäre dafür gesorgt, daß der Antisemitismus nicht ausstirbt: die Juden selbst nähren und schüren ihn unaufhörlich. Die Ursache müßte erst verschwinden, damit die Abwehr aufhörte. Darin wenigstens kann man sich auf die Juden verlassen: der Antisemitismus wird erst mit ihnen aus der Welt geschafft werden.
Der Abend
StettinDer Matrosen-Hauptgefreite Klaus Lohmann *1910
Vormittags kommt es zu einem höchst interessanten Gespräch, das ich mit dem zur Zeit dienstältesten Offizier an Bord, einem Kptleutnant Borchers aus Bremen, habe. Vom Persönlichen kommen wir bald zum »Sachlichen«, d. h. in diesem Falle zu dem Thema »Christus Herr«. Vor allem geht es um die Frage... [unleserlich] Staat und Kirche u.s.w. Ich kann in diesem Zusammenhange klar von Christus zeugen... [unleserlich]
Immerhin ist es für mich schon eine Freude, mich einmal mit einem gebildeten ernstzunehmenden Menschen über die Wahrheitsfrage aussprechen zu können. Über 11/2 Stunden sind wir zusammen – meinen Nerven tut solch ein Gespräch nicht gut, wohl aber dem Herzen.
Abends lasse ich mich von Willi überreden, in den Film »Gasparone«, nach der Operette von Millöcker, zu gehen. Aber ich bin, wie jedesmal, danach wie geschlagen. Bisher sah ich noch keinen Film, der mich irgendwie befriedigte, von künstlerischen Qualitäten gar nicht zu reden. Alles Effekt, übertrieben – und sittlich völlig minderwertig.
JugoslawienDer Leutnant Eberhard Isemann 192 3–1945
Mein liebstes Schwesterlein,
dunkel ist die Welt und traurig; und dunkel ist eben der Himmel draußen – aber hell leuchtet der Orion und hell leuchtet uns, die wir noch darum wissen, das Licht der Liebe Gottes.
Dies ist mein Gruß für Dich heute und er soll Dir Mut und Freude bringen, daß Du trotz aller Not und Traurigkeit stark und fröhlich bliebest. Denn jetzt müssen wir tapfer bleiben und den Verzagenden Trost und Hilfe sein. Jetzt müssen wir treu bleiben im Glauben und im Hoffen, denn sonst vergeht auch noch der heilige Rest.
Ich weiß, mein Schwesterlein, daß Du alle das Geschehen jetzt schwer trägst. Wem sollte es nicht bitter weh tun, wenn alle Not und alles Herzeleid so bitter und schwer wird wie nie zuvor? Und deshalb denke ich sehr an Dich und bete für Dich wie für alle, die mir lieb sind. Wir müssen ja für viel Bewahrung täglich dankbar sein.
Feine Post bekam ich von Reni, die am 1. Jan. einem Wolfgang das Leben schenkte. Wie freue ich mich mit ihr über dies gesunde Kindlein und über Gottes gnädige Bewahrung. Nun darf sie ein eigenes Menschenkind ins Leben geleiten nach den vielen fremden.
Gottes Liebe befehle ich Dich wie auch alle Lieben und bleibe Dein Hardy
FuldaDer Luftwaffenhelfer Bruno Hoenig *1928
Ja nun ist der Urlaub zu Ende. Sitze jetzt im Bahnhof Fulda und warte auf den Anschlußzug. Es ist so ein eigenartiges Gefühl jetzt wieder Soldat zu sein. Am 1 1. sollte ich schon bei der Batterie eintreffen. Wer weiß was das geben wird. Ich habe mich jetzt entschlossen dem Stolz ein Ende zu setzen. Den Ring habe ich abgelegt. Will mich jetzt mal zusammenreißen, daß ich endlich das Übel loswerde. Am Sonntag waren wir in Blankenese in der Kirche. Zur Beichte konnte ich nicht gehen aber die hl. Kommunion habe ich empfangen. Auch in der Kirche will ich sehen, daß ich die übertriebene Frömmelei ablege. Wenn ich nur wieder richtig beten könnte! In der Batterie steht mir sicher wieder ein Kampf bevor, daß ich jeden Sonntag zur hl. Messe kann. Aber gerade das macht mich glücklich. Ich bin eben ein Idealist und muß ein Ideal haben. Der Nationalsozialismus ist sicher nicht das Rechte aber auch er hat ein Ideal. Hoffentlich komme ich nicht auf ungerade Wege dadurch.
BerlinGertrud Bayer *1909
Bei strömendem Regen und grundlosem Schneematsch zum Friseur, wo der Strom versagte, gerade ehe gewaschen wurde. Alle Lokale zu! Nachdem Herta und ich aus dem Rucksack frische Schuhe und Strümpfe angezogen hatten, landeten wir im Kino. »Meine Frau Teresa«, reizend. Dann Schulungsvortrag bei der Arbeitsfront, unerhört, einen für sowas zu bestellen! In L. fiel ich abends die ganze Treppe kopfüber herunter. Glück gehabt!
DresdenLiesbeth Flade
Wir saßen nach dem Abendbrot noch gemütlich erzählend um den Tisch, ich hatte irgend eine Flickerei in der Hand und probierte meine erste nagelneue Brille aus. Die Abende vorher waren wir ziemlich unruhig gewesen; wahrscheinlich weil fast jede Nacht Alarm war und weil man erst jetzt durch die schlesischen Flüchtlinge anfing an das Flüchtlingselend zu glauben, zogen wir die Möglichkeit in Erwägung, daß es auch uns einmal so gehen könnte. Deshalb hatte ich für Maria und mich Taschen aus Nessel an einen Gurt genäht, die wir uns, gefüllt mit unseren Wertsachen (Sparkassenbücher, Geld, Schmuck) unter die Kleider binden konnten. Auch hatten wir alles Wichtigste (Verzeichnis über unser verstreutes Eigentum, die Nummern unserer Sparkassenbücher und Konten und Versicherungen und Adressen für den Fall der Zerstreuung unserer Familie) aufgeschrieben. Jedes Familienmitglied hatte einen Durchschlag im wichtigsten Luftschutzgepäck. Auch hatte ich mich – vielleicht in schlimmer Vorahnung – noch am Tag zuvor aufgerafft, unsere Rucksäck ordentlich gepackt, außen mit Bändern versehen, sodaß wir unsere Daunendecken, in die Regenmäntel gerollt, darum herumschnallen konnten. Jeden Abend brachte ich auch die Koffer mit den Kleidern in den Keller.
DresdenDer Oberzahlmeister Gerhard Erich Bähr 1 894–1975
Wir saßen nach dem Abendbrot in unserem schönen Speisezimmer und hörten im Radio ein Mozart-Konzert. Dann zog sich Hildegard um, weil sie noch aufwaschen mußte. Dazu zieht man sein ältestes Zeug an. Das war dann auch das einzige, was gerettet wurde.
DresdenVictor Klemperer 1881–1960
Gegen neunzehn Uhr. Die Frau Kästner wohnte im Keller des Hofseitenflügels, man sieht hinter dem Hof eine merkwürdige kleine, alte Kirche. Ein sehr junges dunkles Mädchen öffnete mir, sie las das Schreiben ganz resigniert. Ja, ihr sei schon alles gleichgiltig, nur unterschreiben wollte sie nicht, ehe die Muttel das gelesen hätte. Ob ich nicht wiederkommen wollte. Ich sagte, das sei mir unmöglich, ich mußte sie dann eine ganze Weile zur Quittungsleistung drängen.
Bei Neumark war das ganze Büro mit Deportanden besetzt, ich reichte Paul Lang, Rieger, Lewinsky die Hand – »Sie kommen auch mit? Nein?«, da war schon eine Kluft zwischen uns. Ich ging einen Augenblick zu Eisenmanns hinauf, die ganze Familie versammelte sich – schwerst verstört. Ich ging zu Waldmann, der hierbleibt. Er entwickelte mit sehr großer Bestimmtheit die düsterste Annahme. Weswegen nimmt man die jüdischen Kinder mit? Lisl Eisenmann ist doch kein Arbeitseinsatz. Weswegen muß Ulla Jacobi allein mit – ihr Vater gilt als Friedhofsverwalter noch für unabkömmlich. Da stecken Mordabsichten dahinter. Und wir Zurückbleibenden, »wir haben nichts als eine Galgenfrist von etwa acht Tagen. Dann holt man uns früh um sechs aus den Betten. Und es geht uns genauso wie den andern«.
Ich warf ein: Warum man einen so kleinen Rest hierlasse? Und das jetzt, wo man zeitbedrängt sei?
Er: »Sie werden sehen, ich behalte recht.«
DresdenDer Kfz-Schlosser Rolf Becker *1929
Am zeitigen Abend des Fastnachtdienstages 1945 kam ich von Arbeit. Mit meinem Schäferhund Lux drehte ich noch die allabendliche Runde durch die Lindenaustraße zum Bismarckplatz und dann durch die Strehlener Straße wieder nach Hause. Von Fastnacht war nicht viel zu spüren, nur ein paar Kinder tollten noch durch die Finsternis. Nach dem Abendessen ging ich beizeiten zu Bett, denn die langen Arbeitszeiten durch den »totalen Krieg« zehrten ganz kräftig an meinen jugendlichen Reserven.
BreslauDer Postbeamte Wilhelm Bodenstedt 1894–1961
Habe heute reichlich gekocht und gebraten, 1 Pfd. Schweinebraten, 1/2 Pfd. grüner Speck und Knochen, da mache ich morgen, wenn ich noch in der Wohnung sein sollte, Nudeln. Das ganze Haus zittert und bebt, denn an der Schenkendorffstraße stehen nun Langrohrgeschütze und die bullern immerzu. Die Gärten sind voll von ziehendem Pulverdampf. Die Nacht wird man wohl nicht schlafen können von der Kracherei. Es ist jetzt 19 Uhr. Gute Nacht mein Herzensweiberle, Du wirst dort noch Ruhe haben zum Schlafen. Ich küsse Dich heiß und innig.
BreslauDer Schüler Horst G.W. Gleiss
Am Rest des Vormittags hackte ich, wie fast jeden Vormittag in letzter Zeit, Holz und zersägte lange Stämme die beim Barrikadenbau abfielen, um die kärglichen Reste unserer Kohlenvorräte zu strecken. Mittags holte ich Mutti von der Straßenbahn ab, denn sie brachte zwei große Wäschekörbe mit Gebrauchsgegenständen des Haushalts und Wäsche. Als Wehrmachtsangestellte erhielt sie bei der Verteilung der Wehrmachtslager Breslaus vor ihrer Vernichtung noch eine ansehnliche Menge bisheriger Mangelware, wie z.B. unter anderem: Brotmaschine, Thermosflasche, Plätteisen, Kartoffelreibemaschine, Filz- und Turnschuhe, Bestecks, Unterhemden und -hosen und manches Andere.
Grottkau/SchlesienDer Soldat Klaus-Andreas Moering 1915–1945
An seine Frau Elle
Mein lieber Engel!
Heute auf einem scheußlichen Schloß – der Besitzer ist weg, nur eine Baronin Holtei ist noch da. Wir wollten ein Bad nehmen in einem der 20 Badezimmer, aber wieder Stellungswechsel – zu allem Überfluß rummelt Iwan wieder ganz gehörig, etwas weiter nordwestl. von uns. Ich bin recht gefaßt und beinahe heiter geworden. Auch Goethes Gedichte trugen dazu bei. Es gehört freilich ein Lebensgefühl dazu, in dem jetzigen Geschehen ein Wirksames zu sehen. »Es gehen Menschen auf – und nieder« heißt die große Stelle bei Hölderlin, wie Saat, wie Wogen. Ich habe mir die Toten recht genau angesehen, wie sie rücklings mit dem Gesicht in die Erde, daliegen, nicht wie liegende Menschen, sondern wie umgefallene Puppen, ohne Schwerkraft, klein und wächsern, abgemäht. – Gestern träumte ich wieder von Dir; ich war gekommen – seltsam, Du warst noch in Muskau; es war spät Nacht, und um 1/28 mußte ich wieder zurück sein. Ich zog mich aus, Du nahmst mich ins Bett; ungewaschen, dachte ich, und die Läuse, doch ich sagte nichts, um nicht zu stören. Erst nach glücklichem Frieden fiel mir ganz spät ein, weshalb ich eigentlich gekommen war und wie brenzlig die Lage. Ob Du meine Briefe alle bekommen habest, doch da sah ich schon meine blaugrünen Umschläge stehen. Ja, sagtest Du. Ich wollte vom Wegziehen reden, aber ich weiß nur noch zersplitterte Bilder, mein Vater, der plötzlich auch da war; er schlief in einem Bett neben unserem, in seinem grauen Straßenanzug; man müsse ihn wenigstens zudecken – dann war es aus mit dem Traum – aber noch im Wachen war das Glück, bei Dir gewesen zu sein, mächtig, beruhigend.
Wir sind noch bei Grottkau. Das eine Auge des Gutsbesitzers war geschlossen, ein schmaler blutunterlaufener Streifen, die ganze Wange rot – das andere Auge stand offen, und, obwohl es mich sehr klein dünkte, hatte es durch sein helles, stumpfes Blau, in dessen Mitte ein schwarzer Kern saß, etwas sehr Weites. Das Haar war graublond auf der weißen Stirn, alles wie künstlich. »Denn alles muß in Nichts zerfallen – wenn es im Sein beharren will« steht in einem Gedicht bei Goethe.
Ich hatte in der Nacht Wache auf dem Turm. Die Sterne tauchten auf in den losen Maschen des verhängten Himmels, der Wind war stark – groß ist so ein Wesen, das über die Erde zieht, gleichgültig, was sich da unten abspielt.
Elle, jede Faser hängt an Dir. Küß die Kinder, und dränge Dich durch in dieser Zeit mit allen Deinen Kräften, Du Liebe, Große, Starke. Ich vertraue Dir. Mein! Dein Kl.
im WestenDer Soldat Hans-Henning Teich 1923–1945
An seine Freundin Anna
Mein Liebes!
Nun fährt das gute Hänschen von der Vermittlung morgen nach R. Da muß ich ihn doch schnell als »postillon d’amour« engagieren!
Ich hoffe, Du wirst meinen Brief auch ohne Benny-Stempel als echt erkennen. Ich nahm ihn wohl mit, habe aber hier kein rotes Stempelkissen. Hast Du irgendwie gehört, ob man mir dies verübelt hat? Schreib’ es mir ruhig.
Ich habe mich hier schnell und froh eingelebt, zumal ich mehrere alte Kameraden traf. Ich möchte jetzt nicht mehr tauschen mit meinem alten Posten. Es geht nichts über die frische, freie Luft hier, über die Gedankenfreiheit! Hätte ich sonst die Kätzchen gefunden, könnte ich sonst Abend für Abend die wunderschönen Sonnenuntergänge beobachten? Hier weht ein rauherer, aber herzlicherer Wind!
Heut’ Abend habe ich nun wirklich Deine Weidenkätzchen gezeichnet. Allerliebst schaut es aus! Wann ich es Dir wohl zeigen kann?
Von Zuhause hörte ich lange, lange nichts, weiß auch noch nicht, ob sich meine Mutter schon für Dich verwenden konnte. Hab’ Geduld, Annele!
Ein ganzer Stoß Bücher liegt neben mir. Bis tief in die Nacht werde ich lesen und auch ein wenig Kunstgeschichte lernen. Die meisten Gedanken sind bei meinem Beruf!
Verzeihst Du es?
Du weißt doch, wie ich zu Dir stehe!
Dein Henning.
Das Rundfunkprogramm
Reichsprogramm:
20.15-21.00: Balladen und Lieder von Loewe
21.00-22.00: Konzert, Werke von Mozart, Franck, Spohr
Deutschlandsender:
20.15-21.00: »Der Prinz von Homburg« von Kleist
21.00-22.00: Musik für Dich
BernDie Schweizer Radio-Zeitung
England I
19.00 Konzert des B.B.C. Northern Orchstra: Brahms, Tragische Ouvertüre, Sibelius, Sinfonie No. 3
19.30 Plauderei von Sir Harold Spencer Jones, dem königl. Astronomen
19.45 »Make a Date«
20.15 »The Brain’s-Trust« (Der Gehirn-Trust) Fragen und Antworten
20.40 Orgelmusik
21.00 Westminsterschlag, Nachrichten (englisch) 21.25 »Tonight’s Talk«
21.30 Dienstags-Serenade
22.15 Religiöser Vortrag
22.40 Joseph Jongens: Streichquartett op. 23
23.40 Klaviervorträge
24.00 Zeitzeichen. Nachrichten (englisch)
0.20 Nachrichten in norwegischer Sprache
0.30 Ende
BerlinJoseph Goebbels 1897–1945
Hin und wieder sind Stimmen aus England vernehmbar, die doch eine langsam dämmernde Erkenntnis über die bolschewistischen Fernziele bemerkbar machen. So hat sich beispielsweise jetzt der Herzog von Bedford wieder in sehr scharfer Form gegen die englische Kriegspolitik gewandt und eine Erklärung abgegeben, die fast im »Völkischen Beobachter« als eigene Meinung niedergelegt sein könnte. Allerdings ist der Herzog von Bedford ohne jeden Einfluß; immerhin aber darf nicht vergessen werden, daß er ein Mitglied des Königshauses ist. Ich nehme an, daß das englische Königshaus nicht viel besser ist als die anderen europäischen; und Könige pflegen im allgemeinen wankelmütig zu werden, wenn sie bemerken, daß ihre Throne in Gefahr geraten. Und diese Gefahr ist sicherlich heute auch für den englischen Thron gegeben.
*
DresdenKatharina Tietze
Der 13. Februar war grad Fastnachtsdienstag. Am Spätnachmittag war Frl. Weßner mal ein Stündchen